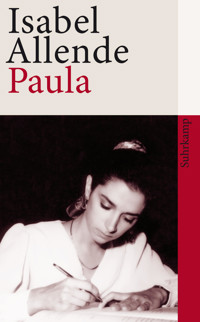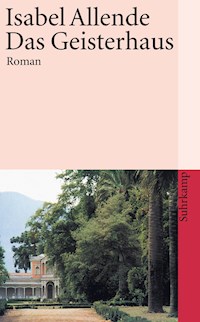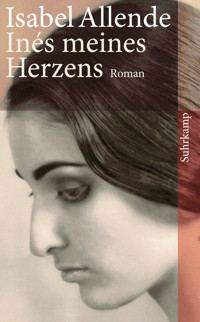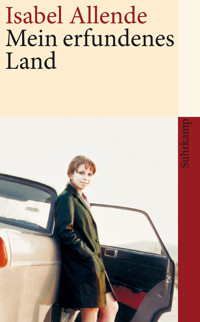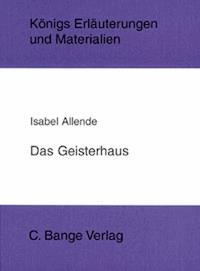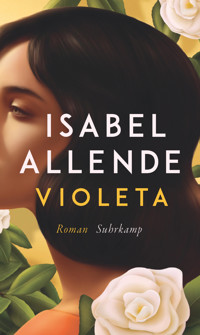11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie weit ist der Weg, den wir gehen müssen, um im Leben anzukommen? Isabel Allende erzählt von Flucht und Neuanfang und den zärtlichen Verheißungen einer eigentlich unmöglichen Liebe.
Gerade beginnt der junge Katalane Víctor Dalmau seine vielversprechende Karriere als Arzt, da bricht der Bürgerkrieg aus. Seine Familie beschließt, das belagerte Barcelona zu verlassen, und macht sich auf den beschwerlichen Weg über die Pyrenäen. Unterwegs erfährt Víctor vom Tod seines geliebten Bruders an der Front, aber er bringt es nicht über sich, seiner hochschwangeren Schwägerin Roser davon zu erzählen. Als auch in Frankreich kein Bleiben ist, organisiert er in letzter Minute für Roser und sich eine Überfahrt nach Südamerika. Im chilenischen Exil kommen sich die beiden näher. Ist es Liebe? Für sie und Víctor scheint ein spätes gemeinsames Glück greifbar nahe – bis plötzlich eine weitere politische Katastrophe ihre Pläne zu vereiteln droht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cover
Titel
Isabel Allende
Dieser weite Weg
Roman
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Largo pétalo de mar bei Penguin Random House, BarcelonaDie Zitate Pablo Nerudas stammen aus den folgenden Werken: Pablo Neruda. Das lyrische Werk. Aus dem Spanischen von Erich Arendt, Monika López und Fritz Vogelgsang. Pablo Neruda. Um geboren zu werden. Aus dem Spanischen von Anneliese Botond. Pablo Neruda. Ich bekenne, ich habe gelebt. Aus dem Spanischen von Curt Meyer-Clason. © Pablo Neruda y Fundación Pablo Neruda Alle Rechte an den Übersetzungen von Erich Arendt, Monika López, Fritz Vogelgsang, Anneliese Botond und Curt Meyer-Clason liegen beim Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2019
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2019.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: (c) Mark Owen/Trevillion Images
eISBN 978-3-518-73444-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meinen Bruder Juan Allende, für Víctor Pey Casado und andere Seefahrer der Hoffnung.
Motto
Das, ihr Fremden, ist mein Heimatland, hier bin ich geboren, hier siedeln meine Träume.
Pablo Neruda, »Rückkehr« Seefahrt und Rückkehr
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Erster Teil Krieg und Exodus
I
1938
II
1938
III
1939
IV
1939
Zweiter Teil Exil, Liebschaften und Versäumnisse
V
1939
VI
1939-1940
VII
1940-1941
VIII
1941-1942
Dritter Teil Rückkehr und Wurzeln
IX
1948-1970
X
1970-1973
XI
1974-1983
XII
1983-1991
XIII
Hier endet mein Erzählen 1994
Danksagung
Informationen zum Buch
Dieser weite Weg
Erster TeilKrieg und Exodus
I1938
Macht euch fit Jungs, trainiert
zum neuen Töten, neuen Sterben,
bald streut man wieder Blumen aufs Blut.
Pablo Neruda, »Blutig war …«Das Meer und die Glocken
Der kleine Soldat gehörte zur Schnullerkohorte, der Truppe von Kindern, die man rekrutiert hatte, als keine jungen und keine alten Männer mehr übrig waren für den Krieg. Víctor Dalmau nahm ihn zusammen mit anderen Verwundeten in Empfang, die wegen der Eile wenig behutsam aus den Güterwaggons geschafft und wie Baumstämme auf die Strohmatten am Bahnsteig im Nordbahnhof abgeladen wurden, um dort auf weitere Transporte zu warten, mit denen sie auf die Lazarette der Ostarmee verteilt werden konnten. Reglos lag der Junge da, mit dem ruhigen Ausdruck von einem, der die Engel gesehen hat und sich vor nichts mehr fürchtet. Wer weiß, wie viele Tage er schon durchgeschüttelt von einer Trage auf die nächste, von einem Militärposten zum nächsten, von einer Ambulanz in die nächste verladen worden war, bis er schließlich mit diesem Zug Katalonien und den kalten Boden aus Stein und Beton erreichte. Im Bahnhof kümmerten sich mehrere Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern um die Verwundeten, schickten die schwersten Fälle sofort weiter, sortierten die anderen nach der Art ihrer Verwundung – Gruppe A: Armverletzung, Gruppe B: Beinverletzung, Gruppe C: Kopfverletzung und so fort – und verteilten sie mit einem Pappschild um den Hals auf die Krankenhäuser. Die Verwundeten kamen zu Hunderten hier an, für Diagnose und Entscheidung blieben nur wenige Minuten, doch die Aufregung und das Durcheinander hier waren nur vordergründig. Niemand blieb unversorgt, niemand ging verloren. Wer operiert werden musste, wurde nach Manresa ins alte Hospital Sant Andreu gebracht, wer eine andere Behandlung benötigte, in eins der umliegenden Lazarette geschickt, und einige blieben besser, wo sie waren, weil man nichts mehr für sie tun konnte. Freiwillige Helferinnen benetzten ihnen die Lippen, redeten leise mit ihnen und wiegten sie wie ihre eigenen Kinder, weil sie wussten, dass irgendwo anders eine andere Frau dasselbe für ihren Sohn oder Bruder tun würde. Später brachten die Bahrenträger sie in die Leichenhalle. Der kleine Soldat hatte ein Loch in der Brust, und der Arzt, der ihm rasch den Puls fühlte und nichts fand, entschied, dass hier auch Morphium und Trost nicht mehr halfen. An der Front hatte man seine Wunde mit einem Lappen abgedeckt, sie mit einem umgedrehten Blechteller geschützt und dann den Oberkörper verbunden, aber wie viele Stunden, Tage, Züge das her war, ließ sich unmöglich sagen.
Víctor Dalmau war dort, um den Ärzten zur Hand zu gehen. Er hätte die Anweisung befolgen, den Jungen liegen lassen und sich um den Nächsten kümmern sollen, aber er dachte, wenn der Kleine durch den Treffer, den Blutverlust und den Transport nicht gestorben war, dann musste er einen zähen Lebenswillen besitzen und es wäre ein Jammer, müsste er sich jetzt hier auf dem Bahnsteig dem Tod doch noch ergeben. Vorsichtig nahm Víctor den Verband ab und sah staunend, dass die Wunde offen lag und so sauber war, als hätte sie jemand auf diese Kinderbrust gemalt. Er konnte sich nicht erklären, wie das Geschoss die Rippen und Teile des Brustbeins hatte zerschlagen können, ohne dabei das Herz zu zerfetzen. Víctor hatte sich eingebildet, er hätte in den drei Jahren, die er seit Ausbruch des Bürgerkriegs zunächst an der Front in Madrid und Teruel, später im Lazarett von Manresa Dienst getan hatte, bereits alles gesehen und wäre abgehärtet gegenüber dem Leid seiner Mitmenschen, aber ein lebendes Herz war ein neuer Anblick für ihn. Er starrte auf die letzten Schläge, wie sie langsamer wurden, die Pausen länger, bis sie ganz ausblieben und der kleine Soldat ohne ein Seufzen verstarb. Einen kurzen Augenblick sah Víctor wie gelähmt in den roten Krater, in dem jetzt nichts mehr pulste. Von allen Erinnerungen an den Krieg sollte das seine klarste und hartnäckigste bleiben: dieses fünfzehn, vielleicht sechzehn Jahre alte Kind, noch bartlos, verdreckt von der Schlacht, schmutzig von geronnenem Blut, vor ihm auf einer Strohmatte, mit seinem Herz im Freien. Er konnte sich nie erklären, warum er drei Finger der rechten Hand in die grausige Wunde steckte, das Herz umfasste und rhythmisch, völlig ruhig und selbstverständlich einige Male zudrückte, ob dreißig Sekunden oder eine Ewigkeit, er wusste es nicht. Doch dann spürte er, wie das Herz zwischen seinen Fingern zum Leben erwachte, erst kaum merklich bebte und gleich darauf entschlossen und gleichmäßig schlug.
»Junger Mann, hätte ich das nicht mit eigenen Augen gesehen, ich würde es nicht glauben«, sagte in feierlichem Tonfall einer der Ärzte, der unbemerkt zu Víctor getreten war.
Energisch rief er zweimal nach den Trägern und wies sie an, den Verwundeten unverzüglich mitzunehmen, es handele sich um einen besonderen Fall.
»Wo haben Sie das gelernt?«, wandte er sich wieder an Víctor, als die Träger den kleinen Soldaten aufhoben, der weiter aschfahl war, aber atmete.
Víctor Dalmau, der nie viel Worte machte, erklärte in zwei Sätzen, dass er drei Jahre in Barcelona Medizin studiert hatte, ehe er als Sanitäter an die Front gegangen war.
»Und gelernt haben Sie das wo?«, wiederholte der Arzt.
»Nirgends, ich dachte, es gibt nichts zu verlieren, da …«
»Sie hinken.«
»Linker Oberschenkel. Teruel. Heilt ab.«
»Gut. Von jetzt an arbeiten Sie mit mir, hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Wie heißen Sie?«
»Víctor Dalmau, Genosse.«
»Lassen Sie das. Für Sie: Herr Doktor, und unterstehen Sie sich nicht, mich zu duzen. Haben wir uns verstanden?«
»Verstanden, Herr Doktor. Aber auf Gegenseitigkeit, bitte. Sie dürfen mich Herr Dalmau nennen, auch wenn das die anderen Genossen treffen wird wie eine Ohrfeige.«
Der Arzt lächelte gequält. Am Tag darauf begann Víctor Dalmau das zu lernen, was seinen Lebensweg prägen sollte.
Wie alle Beschäftigten im Hospital Sant Andreu und den anderen Lazaretten erfuhr auch Víctor Dalmau, dass die Chirurgen sechzehn Stunden lang einen Toten auferweckt und er den OP als Lebender verlassen hatte. Ein Wunder, sagten viele. Fortschritt der Wissenschaft und der Kleine außerdem zäh wie ein Ackergaul, erwiderten andere, für die Gott und die Heiligen abgedankt hatten. Víctor nahm sich vor, den Jungen zu besuchen, wohin man ihn auch verlegt haben mochte, aber gehetzt von den Wirren der Zeit gelang es ihm nicht, den Überblick zu behalten über Begegnungen und Abschiede, Anwesende und Verschwundene, Lebende und Tote. Für eine Weile schien es, als hätte er dieses Herz vergessen, das in seiner Hand gelegen hatte, weil sein Leben so schwierig wurde und anderes vordringlich war, aber Jahre später, am anderen Ende der Welt, sah er den Jungen in seinen Albträumen wieder, und von da an besuchte der Kleine ihn ab und zu, bleich und traurig, mit seinem leblosen Herzen auf einem Tablett. Víctor erinnerte sich nicht mehr an seinen Namen oder hatte ihn vielleicht nie gewusst und nannte ihn aus naheliegenden Gründen Lazarus, der kleine Soldat indes vergaß den Namen seines Retters nie. Kaum dass er sich aufsetzen und ohne Hilfe einen Schluck Wasser trinken konnte, erfuhr er von der Heldentat des Sanitäters im Nordbahnhof, eines gewissen Víctor Dalmau, der ihn aus dem Reich der Toten zurückgeholt hatte. Man bestürmte ihn mit Fragen, wollte wissen, ob es Himmel und Hölle wirklich gab oder ob die Bischöfe sie erfunden hatten, um allen Angst einzujagen. Der Junge war vor Kriegsende wieder gesund und ließ sich zwei Jahre später in Marseille den Namen Víctor Dalmau auf die Brust tätowieren, unterhalb der Narbe.
Eine junge Milizionärin, das Barett schräg auf dem Kopf, um die hässliche Uniform aufzupeppen, erwartete Víctor an der Tür zum OP, und als er mit Dreitagebart und fleckigem Kittel schließlich herauskam, gab sie ihm einen gefalteten Zettel mit einer Nachricht der Telefonistinnen. Víctor war seit vielen Stunden auf den Beinen, sein Oberschenkel schmerzte, und das Rumoren in seinem Bauch erinnerte ihn daran, dass er zum letzten Mal bei Tagesanbruch etwas gegessen hatte. Die Arbeit war eine Plackerei, aber er war dankbar, dass er im erhabenen Umfeld der besten Chirurgen Spaniens lernen durfte. Unter anderen Umständen wäre ein Student wie er nie auch nur in deren Nähe gekommen, aber jetzt im Krieg zählten Ausbildung und Titel weniger als Erfahrung, und davon besaß Víctor mehr als genug, befand der Leiter des Hospitals, als er ihm gestattete, in der Chirurgie zu assistieren. Inzwischen konnte Víctor vierzig Stunden ohne Schlaf durcharbeiten, hielt sich mit Zigaretten und Muckefuck wach und ignorierte die Schmerzen in seinem Bein. Dank dem Bein war er vom Frontdienst befreit und durfte den Krieg in der Etappe führen. Wie fast alle jungen Männer seines Jahrgangs war er 1936 in die Republikanische Armee eingetreten und mit seinem Regiment ausgezogen, um Madrid zu verteidigen, das in Teilen besetzt war von den Nationalen, wie sich die Heeresverbände, die gegen die Regierung geputscht hatten, selbst nannten. Er hatte sich um die Verwundeten gekümmert, weil er mit seinen Medizinkenntnissen nützlicher sein konnte als mit einem Gewehr in der Stellung. Danach hatte man ihn an andere Frontabschnitte geschickt.
Im Dezember 1937 leistete Víctor Dalmau während der Schlacht von Teruel bei klirrender Kälte in einem Ambulanzwagen Erste Hilfe, während der Fahrer, Aitor Ibarra, ein nicht totzukriegender Baske, der pausenlos sang und lauthals lachte, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, ihr Gefährt heldenhaft über die zerbombten Wege lenkte. Víctor vertraute darauf, dass das Glück des Basken, der bereits tausend Gefahren unbeschadet überstanden hatte, für sie beide ausreichen würde. Um den Bombardements zu entgehen, fuhren sie häufig bei Dunkelheit. Schien kein Mond, stapfte jemand mit einer Laterne voraus, um Aitor den Weg zu zeigen, sofern es einen gab, während Víctor im Schein einer zweiten Laterne im Innern des Wagens mit dem wenigen, was zur Verfügung stand, die Verwundeten versorgte. Sie trotzten dem mit Hindernissen gespickten Gelände und der Eiseskälte, krochen im Schneckentempo über den gefrorenen Boden, blieben im Schnee stecken, schoben den Wagen Böschungen hinauf, zerrten ihn aus Gräben und Bombentrichtern, umkurvten Metallgerippe und steifgefrorene Maultierkadaver und entkamen den Maschinengewehrsalven der Nationalen und den Luftangriffen der Legion Condor, die über sie hinwegjagte. Nichts konnte Víctor Dalmau ablenken, so vertieft war er in die Aufgabe, die Männer in seiner Obhut, die vor seinen Augen zu verbluten drohten, am Leben zu halten, und so angesteckt auch vom wahnsinnigen Stoizismus von Aitor Ibarra, der unbeirrt fuhr und jedes Vorkommnis mit einem Scherz parierte.
Vom Krankentransport wechselte Víctor dann in das Feldlazarett, das man in den Höhlen von Teruel eingerichtet hatte, um es vor den Bomben zu schützen. Hier arbeitete man im Schein von Kerzen, von Fackeln aus in Motoröl getränkten Lumpen und Petroleumlampen. Gegen die Kälte standen Kohlebecken unter den Operationstischen, aber die verhinderten nicht, dass einem das Operationsbesteck an den Fingern festfror. Die Ärzte flickten die, denen zu helfen war, notdürftig für den Transport ins Krankenhaus zusammen, wohl wissend, dass viele die Reise dorthin nicht überstehen würden. Den anderen, die nicht mehr zu retten waren, gab man Morphium, sofern welches vorrätig war, allerdings streng rationiert. Auch Äther war Mangelware. Wenn er nichts anderes fand, um den Verwundeten zu helfen, die vor Schmerzen schrien, dann gab Víctor ihnen Aspirin und behauptete, es sei ein Wundermittel aus den Staaten. Die Verbände wurden in geschmolzenem Eis und Schnee ausgewaschen und dann wiederverwendet. Die scheußlichste Aufgabe war es, die abgeschnittenen Beine und Arme zu Scheiterhaufen zu schichten. An den Geruch von verbranntem Fleisch konnte Víctor sich bis zum Schluss nicht gewöhnen.
Dort in Teruel sah er auch Elisabeth Eidenbenz wieder, die er von der Front in Madrid her kannte, wo sie Freiwilligendienst für die Arbeitsgemeinschaft für Spanienkinder geleistet hatte, eine Schweizerin mit dem Gesicht einer Renaissancemadonna und dem Mut eines hartgesottenen Kämpfers. In Madrid war er ansatzweise in sie verliebt gewesen und wäre ihr restlos verfallen, hätte sie das geringste Entgegenkommen gezeigt, aber nichts konnte sie von ihrer Mission ablenken, das Leid der Kinder in diesen brutalen Zeiten zu lindern. In den Monaten, seit sie sich zuletzt gesehen hatten, war von der Blauäugigkeit, mit der die Schweizerin nach Spanien gekommen war, nichts geblieben. Ihr Kampf gegen die Militärbürokratie und die Dummheit der Menschen hatte sie hart gemacht. Mitgefühl und Sanftmut sparte sie sich für die Frauen und Kinder in ihrer Obhut auf. Víctor traf sie zufällig in einer Feuerpause vor einem Lieferwagen mit Proviant wieder. »Hallo, Kleiner, kennst du mich noch?«, begrüßte sie ihn in ihrem deutschschweizerisch gesungenen Spanisch. Wie hätte er sie nicht mehr kennen sollen? Er brachte nur bei ihrem Anblick keinen Ton heraus. Sie kam ihm erwachsener vor und schöner denn je. Sie setzten sich auf einen Haufen Betonschutt, er zum Rauchen, sie auf einen Schluck Tee aus ihrer Feldflasche.
»Wie geht's deinem Freund Aitor?«, erkundigte sie sich.
»Wie immer: unter Dauerbeschuss, aber ohne einen Kratzer.«
»Der hat vor nichts Angst. Grüß ihn von mir.«
»Was hast du vor, wenn der Krieg vorbei ist?«
»In den nächsten ziehen. Irgendwo ist immer Krieg. Und du?«
»Wir könnten ja heiraten, was meinst du?«, brachte Víctor schüchtern heraus.
Sie lachte und wurde für einen Augenblick wieder das Renaissancefräulein von früher.
»Nicht im Traum, Kleiner, ich heirate dich so wenig wie irgendwen sonst. Für die Liebe fehlt mir die Zeit.«
»Vielleicht überlegst du es dir noch mal anders. Glaubst du, wir sehen uns wieder?«
»Bestimmt, sollten wir das hier überleben. Verlass dich auf mich, Víctor. Wenn ich was für dich tun kann …«
»Ebenso. Darf ich dich küssen?«
»Nein.«
In den Höhlen von Teruel erwarb Víctor endgültig Nervenstärke und medizinische Kenntnisse, die keine Universität der Welt ihm hätte vermitteln können. Er lernte, dass man sich an nahezu alles gewöhnen kann, an das Blut – so viel Blut! –, an das Operieren ohne Betäubung, an den Gestank des Wundbrands, den Schmutz, den nicht abreißenden Strom verwundeter Soldaten, bisweilen Frauen dazwischen und auch Kinder, an die jahrhunderteschwere Müdigkeit, die einem den Willen zerfraß, und schlimmer noch, an den schleichenden Verdacht, all die Entbehrungen könnten vergeblich sein. Und dort, als er nach einem Bombardement Tote und Verletzte aus den Ruinen barg, kam es zu dem verspäteten Einsturz, der ihm das linke Bein zertrümmerte. Ein englischer Arzt von den Internationalen Brigaden behandelte ihn. Ein anderer hätte sich womöglich für eine rasche Amputation entschieden, aber der Engländer hatte seinen Dienst gerade erst begonnen und zuvor ein paar Stunden geschlafen. Er kauderwelschte der Krankenschwester eine Anweisung zu und ging daran, die kaputten Knochen zu richten. »Du hast Glück, mein Junge, gestern ist die Lieferung vom Roten Kreuz gekommen, wir legen dich schlafen«, sagte die Krankenschwester und streifte ihm die Äthermaske über.
Víctor schrieb den Unfall dem Umstand zu, dass Aitor Ibarra nicht bei ihm gewesen war, um mit seinem guten Stern über ihn zu wachen. Aber der Baske fuhr ihn zum Zug, der ihn zusammen mit Dutzenden Verwundeten nach Valencia brachte. Sein Bein war mit Latten geschient und mit Stoffstreifen umwickelt, weil man es wegen der Fleischwunden nicht hatte eingipsen können, er bibberte unter seiner Wolldecke vor Kälte und Fieber, wurde gemartert vom Ruckeln des Zugs und war doch dankbar, weil es ihm weit besser ging als den meisten anderen, mit denen er dort auf dem Boden des Waggons lag. Aitor hatte ihm seine letzten Zigaretten gegeben und außerdem eine Ampulle mit Morphium, das er nur im äußersten Notfall einsetzen sollte, weil er keine zweite bekommen würde.
In Valencia beglückwünschte man ihn zu der guten Arbeit des englischen Kollegen. Sofern keine Komplikationen aufträten, werde sein Bein wieder wie neu, wenn auch etwas kürzer als das andere, sagten sie ihm. Als die Wunden zu vernarben begannen und er sich an Krücken halten konnte, schickte man ihn mit einem Gipsverband nach Barcelona. Daheim bei seinen Eltern spielte er endlose Partien Schach mit seinem Vater, bis er wieder ohne Hilfe gehen konnte, und meldete sich dann zurück zur Arbeit in einem Krankenhaus der Stadt, das Zivilisten behandelte. Dort kam er sich vor wie im Urlaub, verglichen mit der Front war hier alles paradiesisch sauber und wohlorganisiert. Bis zum Frühjahr blieb er dort, dann wurde er nach Manresa ins Hospital Sant Andreu abkommandiert. Er verabschiedete sich von seinen Eltern und von Roser Bruguera, einer Musikstudentin, die seine Eltern bei sich aufgenommen hatten und die in den Wochen seiner Genesung wie eine Schwester für ihn gewesen war. Die zurückhaltende, freundliche junge Frau, die viele Stunden mit ihren Etüden am Klavier verbrachte, war die Gesellschaft, deren Marcel Lluís und Carme bedurften, seit ihre Söhne aus dem Haus waren.
Víctor faltete den Zettel auseinander, den die Milizionärin ihm übergeben hatte, und las die Nachricht von seiner Mutter. Er hatte sie seit sieben Wochen nicht gesehen, obwohl es vom Krankenhaus nach Barcelona nur fünfundsechzig Kilometer waren, aber er hatte nicht einen Tag frei gehabt, um den Bus zu nehmen. Einmal in der Woche, stets sonntags um dieselbe Zeit, rief sie ihn an, und am selben Tag kam auch ein Päckchen von ihr mit einer Tafel Schokolade von den Internationalen Brigaden, einer Wurst oder einem Stück Seife vom Schwarzmarkt oder manchmal auch mit Zigaretten, was für sie ein großes Opfer bedeutete, weil sie ohne Nikotin nicht leben konnte. Er fragte sich, wo sie die herbekam. Die feindlichen Flugzeuge warfen manchmal Zigaretten und Brot ab, um sich über den Hunger auf der republikanischen Seite lustig zu machen und mit dem Überfluss zu protzen, der bei den Nationalen herrschte.
Eine Nachricht von seiner Mutter an einem Donnerstag konnte nichts Gutes bedeuten: »Bin im Telegrafenamt, ruf an.« Víctor überlegte, dass sie schon annährend zwei Stunden auf seinen Anruf wartete, so lange war er im OP gewesen. Er ging hinunter zu den Büros im Kellergeschoss und bat eine der Telefonistinnen um eine Verbindung zum Telegrafenamt in Barcelona.
Carme Dalmau nahm den Anruf entgegen und sagte ihrem ältesten Sohn, unterbrochen von Hustenanfällen, er solle nach Hause kommen, sein Vater liege im Sterben.
»Was ist passiert? Er war doch ganz gesund!«
»Sein Herz kann nicht mehr. Versuch deinen Bruder zu erreichen, er soll auch kommen und sich verabschieden, es kann jeden Moment vorbei sein.«
Um Guillem an der Front in Madrid zu erreichen, brauchte er dreißig Stunden. Als Víctor ihn endlich am Funkgerät hatte, erklärte ihm Guillem in einem Gewirr aus statischem Rauschen und sphärischem Knacken, er werde unmöglich die Erlaubnis bekommen, nach Barcelona zu reisen. Er klang so weit entfernt und müde, dass Víctor ihn nicht wiedererkannte.
»Wer auch immer ein Gewehr führen kann, wird hier gebraucht, Víctor, das weißt du ja. Die Faschisten sind uns zahlenmäßig überlegen und besser ausgerüstet, aber sie kommen nicht durch«, sagte Guillem und wiederholte damit die Parole von Dolores Ibárruri, zu Recht bekannt als La Pasionaria, weil sie die Leidenschaft unter den Republikanern zu befeuern verstand.
Die aufständischen Militärs hatten den größten Teil Spaniens besetzt, aber Madrid bislang nicht einnehmen können, das mit seinem Kampf Straße um Straße, Haus um Haus zu einem Symbol in diesem Krieg geworden war. Auf Seiten der Nationalen kämpften Kolonialtruppen aus Marokko, die gefürchteten Moros, und sie bekamen massive Unterstützung von Mussolini und Hitler, aber der republikanische Widerstand hatte sie vor der Hauptstadt zum Stehen gebracht. Zu Beginn des Kriegs hatte Guillem Dalmau in der Kolonne Durruti gekämpft. Damals tobte die Schlacht im Universitätsviertel, die beiden Lager waren manchmal nur eine Straßenbreite voneinander entfernt. Sie konnten einander ins Gesicht sehen und sich beschimpfen, ohne die Stimme übermäßig zu heben. Guillem, der in einem der Gebäude verschanzt gewesen war, hatte später berichtet, die Mörsergranaten hätten die Wände der Philosophischen und Medizinischen Fakultät und der Casa de Velázquez durchsiebt, dagegen habe es kein Mittel gegeben, aber gegen Gewehrkugeln hätten drei Bände Philosophie sich bewährt. Guillem war nicht weit entfernt, als Buenaventura Durruti starb. Der legendäre Anarchist war mit Teilen seiner Kolonne nach Madrid gekommen, um sich dem Kampf dort anzuschließen, nachdem er die Revolution erfolgreich in Aragón verbreitet und gefestigt hatte. Er starb durch einen Schuss aus nächster Nähe in die Brust, unter nicht geklärten Umständen. Seine Kolonne wurde aufgerieben, über tausend Milizionäre ließen ihr Leben, und unter den Überlebenden blieb Guillem als einer von wenigen unverletzt. Zwei Jahre später war er, nachdem er an anderen Frontabschnitten gekämpft hatte, zurückbeordert worden nach Madrid.
»Vater versteht es sicher, dass du jetzt nicht kommen kannst, Guillem. Aber zu Hause warten wir auf dich. Komm, sobald es möglich ist. Selbst wenn du Vater nicht mehr lebend siehst, für Mutter wäre es ein großer Trost, dich hier zu haben.«
»Roser ist bei ihnen, nehme ich an.«
»Ja.«
»Grüß sie bitte von mir. Sag ihr, dass ihre Briefe mich begleiten, und sie soll nicht böse sein, wenn ich nicht immer gleich antworte.«
»Wir warten auf dich, Guillem. Pass auf dich auf.«
Sie verabschiedeten sich mit einem knappen Lebewohl, und Víctor flehte bei sich, dass sein Vater noch etwas länger lebte, sein Bruder unversehrt nach Hause käme, der Krieg endlich vorbei wäre und die Republik gerettet.
Der Vater von Víctor und Guillem, Professor Marcel Lluís Dalmau, hatte fünfzig Jahre seines Lebens damit zugebracht, Musik zu unterrichten, hatte im Alleingang das Jugendsinfonieorchester von Barcelona aufgebaut und es leidenschaftlich dirigiert, ein Dutzend Konzerte für Klavier geschrieben, die seit dem Ausbruch des Krieges niemand mehr spielte, und daneben verschiedene Lieder, die in derselben Zeit unter den Milizionären beliebt wurden. Carme hatte er kennengelernt, als sie noch ein fünfzehnjähriges Schulmädchen in der strengen Uniform ihrer Schule war und er ein junger Musiklehrer, zwölf Jahre älter als sie. Carme war die Tochter eines Stauers vom Hafen, durfte aus Barmherzigkeit bei den Nonnen zur Schule gehen, wo man sie schon als Kind auf den Eintritt ins Kloster vorbereitete und ihr nie verzieh, dass sie der Kirche den Rücken kehrte, um in Sünde mit einem arbeitsscheuen Atheisten, Anarchisten und vermeintlichen Freimaurer zu leben, der für den heiligen Bund der Ehe nichts als Spott übrig hatte. Marcel Lluís und Carme lebten mehrere Jahre in Sünde, heirateten kurz vor der Geburt von Víctor, ihrem ersten Nachkommen, aber doch, um dem Kind das Stigma der Unehelichkeit zu ersparen, das damals noch eine Bürde fürs Leben darstellte. »Hätten wir unsere Kinder heutzutage bekommen, wir hätten nicht geheiratet, die Republik kennt keine Bastarde«, erklärte Marcel Lluís in einem Moment des Überschwangs zu Beginn des Bürgerkriegs. »Dann hätte ich als alte Frau schwanger werden müssen und unsere Söhne lägen noch in den Windeln«, bemerkte Carme.
Víctor und Guillem besuchten eine laizistische Schule und wuchsen in einer kleinen Wohnung im Raval auf, als Söhne eines bescheidenen katalanischen Mittelklassehaushalts, in dem die Musik des Vaters und die Bücher der Mutter an die Stelle der Religion getreten waren. Die Dalmaus gehörten keiner Partei an, standen aber aufgrund ihres Argwohns gegenüber jeder Bevormundung und Herrschaft dem Anarchismus nah. Neben ihrem Interesse an allerlei Arten von Musik weckte Marcel Lluís bei seinen Söhnen auch die Neugier auf Naturwissenschaften und den Sinn für soziale Gerechtigkeit. Über die Wissenschaft kam Víctor dazu, Medizin zu studieren, und die soziale Gerechtigkeit wurde Guillems Steckenpferd, denn schon als Kind war er zornig gewesen auf die Welt und hatte mit mehr Eifer als Argumenten gegen Grundbesitzer, Kaufleute, Industrielle, Aristokraten und Priester gewettert, vor allem gegen Priester. Er war fröhlich, laut, massig und unerschrocken, umschwärmt von den Mädchen, deren Verführungsversuche ins Leere liefen, weil ihm seine Wirkung auf sie herzlich egal war und er vollständig von Sport, Barbesuchen und Freunden in Anspruch genommen war. Gegen den Willen seiner Eltern schloss er sich mit neunzehn den ersten Arbeitermilizen an, die sich organisierten, um die republikanische Regierung gegen den Putsch der Faschisten zu verteidigen. Er war zum Soldaten gemacht, dazu geboren, eine Waffe zu führen und andere zu befehligen, die weniger entschlossen waren als er. Sein Bruder Víctor hingegen sah mit seinen langen Knochen, den wirren Haaren und dem sorgenvollen Gesicht eher aus wie ein Dichter, hielt ständig ein Buch in der Hand und schwieg zumeist. In der Schule hatte er die Hänseleien seiner Mitschüler über sich ergehen lassen, »werd halt Pfaffe, du Schwuchtel«, bis sein drei Jahre jüngerer Bruder Guillem sich einmischte, der kräftiger war und immer bereit, sich für eine gerechte Sache zu prügeln. Guillem warf sich der Revolution in die Arme wie einer Braut: in ihr fand er etwas, das es wert war, sein Leben dafür zu geben.
Die Konservativen und die katholische Kirche, die mit Geld, Propagandamethoden und apokalyptischen Predigten von der Kanzel herab ihren Wahlkampf geführt hatten, unterlagen 1936 bei den Parlamentswahlen der Volksfront, einem Bündnis aus verschiedenen linksgerichteten Parteien. Spanien, das seit dem Sieg der Republik fünf Jahre zuvor unter Spannung stand, wurde wie durch einen Axthieb gespalten. Weil angeblich die Ordnung wiederhergestellt werden musste in dieser Situation, die sie als chaotisch bezeichnete, obwohl sie es keineswegs war, verschwor sich die Rechte umgehend mit dem Militär gegen die gewählte Regierung aus Liberalen, Sozialisten, Kommunisten und Gewerkschaftern, die getragen wurde von enthusiastischen Arbeitern, Kleinbauern, Tagelöhnern und den meisten Studenten und Intellektuellen im Land. Guillem hatte die Oberschule mit Mühe geschafft und besaß laut seinem Vater, der den bildhaften Vergleich liebte, die Physis eines Athleten, die Verwegenheit eines Stierkämpfers und das Hirn eines achtjährigen Rotzbengels. Die politischen Rahmenbedingungen waren wie gemacht für ihn, weil er gern bei jeder Gelegenheit mit den Fäusten auf seine Gegner losging, seine Überzeugungen jedoch nur schwer in Worte zu fassen vermochte, was sich erst änderte, als er der Miliz beitrat, wo man die ideologische Schulung genauso wichtig nahm wie die an der Waffe. Die Stadt war geteilt, die beiden Lager trafen sich nur, um übereinander herzufallen. Es gab linke Bars, Tanzvergnügen, Sportveranstaltungen und Feste, und es gab rechte. Schon bevor er Milizionär wurde, suchte Guillem ständig Streit. Nach manchen Handgreiflichkeiten mit frechen Herrensöhnchen kam er zerschlagen nach Hause, aber glücklich. Seine Eltern wussten nicht, dass er nachts loszog, um auf den Gütern der Großgrundbesitzer Ernten zu verbrennen oder Tiere zu stehlen, sich zu prügeln, Brände zu legen und Verwüstungen anzurichten, bis er eines Tages einen silbernen Kerzenleuchter nach Hause brachte. Seine Mutter riss ihm den Leuchter aus der Hand und schlug damit nach ihm. Wäre sie größer gewesen, sie hätte ihm den Schädel gespalten, doch so traf sie ihn nur am Rücken. Sie zwang ihn zu gestehen, was andere längst wussten, wovor sie aber bisher die Augen verschlossen hatte: dass ihr Sohn, neben anderen Schandtaten, Kirchen entweihte, Priester und Nonnen überfiel, kurzum, genau das tat, was die Propaganda der Nationalen behauptete. »Undank, nichts als Undank ist der Welten Lohn! Was für eine Schande! Du bringst mich noch ins Grab, Guillem! Du trägst das sofort dahin zurück, wo du es herhast, hast du mich verstanden?« Kleinlaut machte sich Guillem mit dem in Zeitungspapier gewickelten Leuchter davon.
Im Juli 1936 erhob sich das Militär gegen die demokratische Regierung. Umgehend setzte sich General Francisco Franco an die Spitze der Rebellion, dessen Allerweltsgesicht ein kaltes, rachsüchtiges und brutales Wesen verbarg. In seinen Großmannsträumen wollte er Spanien zu altem Glanz und Gloria führen und sein nächstes Etappenziel bestand darin, das Chaos der Demokratie ein für alle Mal zu beenden und das Land mit Unterstützung der Streitkräfte und der katholischen Kirche mit harter Hand zu regieren. Die Rebellen dachten, sie könnten Spanien binnen einer Woche unter ihre Kontrolle bringen, trafen aber unerwartet auf den Widerstand der Arbeitermilizen, die entschlossen waren, ihre in der Republik erlangten Rechte zu verteidigen. Damit begann eine Zeit voller entfesseltem Hass, Rache und Terror, der in Spanien eine Million Menschen zum Opfer fielen. Zur Strategie der Männer unter Francos Kommando gehörte es, möglichst viel Blut zu vergießen und Angst zu säen, weil sich nur so jeder Widerstand unter der besiegten Bevölkerung im Keim ersticken ließ. Unterdessen war Guillem Dalmau so weit, in den Krieg zu ziehen. Es ging nicht mehr darum, Leuchter zu stehlen, es hieß, zu den Waffen zu greifen.
Hatte Guillem früher Vorwände gesucht, um Ärger zu machen, so erübrigte sich das im Krieg. Er beging keine Gräueltaten, das verboten ihm die Grundsätze, die er von zu Hause mitbrachte, aber er verhinderte auch nichts von dem, was seine Genossen ihren häufig unschuldigen Opfern antaten. Tausende wurden ermordet, vor allem Priester und Nonnen, viele Anhänger der Rechten mussten in Frankreich Schutz suchen vor den Roten Horden, wie manche Zeitungen sie nannten. Bald erging von den politischen Parteien der Republik der Befehl, die Gewalttaten zu unterlassen, die den Idealen der Revolution zuwiderliefen, sie hörten jedoch nicht auf. Francos Soldaten bekamen allerdings die gegenteilige Order: unterwerfen und strafen mit Feuer und Blut.
Mit dreiundzwanzig Jahren wurde Víctor zur republikanischen Armee einberufen, davor lebte er zu Hause bei seinen Eltern und war vollständig von seinem Studium in Anspruch genommen. Er stand bei Tagesanbruch auf und bereitete, ehe er zur Universität ging, seinen Eltern das Frühstück, das war alles, was er im Haushalt tat. Spätabends kam er heim, aß, was ihm seine Mutter in der Küche hingestellt hatte – Brot, Sardinen, Tomaten –, trank einen Kaffee dazu und vertiefte sich wieder in seine Bücher. Von der politischen Leidenschaft seiner Eltern und dem Fanatismus seines Bruders hielt er sich fern. »Wir schreiben Geschichte. Wir fegen den Feudalismus fort, der in Spanien über Jahrhunderte geherrscht hat, wir sind ein Vorbild für Europa, die Antwort auf den Faschismus von Hitler und Mussolini«, predigte Marcel Lluís seinen Söhnen und seinen Trinkgefährten im Rocinante, einer im Aussehen zwielichtigen, im Geiste höchsten moralischen Ansprüchen genügenden Spelunke, in der sich täglich dieselben Gäste trafen, Domino spielten und kratzigen Wein tranken. »Schluss mit den Privilegien von Oligarchie, Kirche, Grundbesitzern und sonstigen Ausbeutern des Volkes. Wir müssen die Demokratie verteidigen, Freunde, aber denkt daran, Politik ist nicht alles. Ohne Wissenschaft, Industrie und Technik gibt es keinen Fortschritt und ohne Musik und Kunst keine Seele.« Auch wenn Víctor die Ansichten seines Vaters im Grunde teilte, floh er doch vor dessen Ansprachen, die sich wenig abwechslungsreich wiederholten. Mit seiner Mutter sprach er ebenfalls nicht über Politik, brachte aber zusammen mit ihr im Keller einer Brauerei Milizionären das Lesen und Schreiben bei. Als Lehrerin hatte Carme viele Jahre ihre Schüler auf ein Studium vorbereitet, Bildung war in ihren Augen so wichtig wie Brot und jeder, der lesen und schreiben konnte, dazu verpflichtet, sein Wissen weiterzugeben. Die Milizionäre zu unterrichten war für sie Routine, für Víctor dagegen oft eine Qual. »Was für Esel!«, stöhnte er, wenn er zwei Stunden mit dem Buchstaben A zugebracht hatte. »Von wegen Esel. Die Jungs haben noch nie eine Fibel gesehen. Wie würdest du dich wohl hinter einem Pflug anstellen«, wies seine Mutter ihn zurecht.
Weil sie fürchtete, er werde zum Einsiedler, predigte sie ihm von der Notwendigkeit, mit dem Rest der Menschheit zusammenzuleben, und hielt ihn früh dazu an, einige beliebte Lieder auf der Gitarre zu lernen. Víctor besaß einen samtweichen Tenor, unerwartet bei seiner schlaksigen Erscheinung und seiner mürrischen Miene. Verschanzt hinter seiner Gitarre konnte er seine Schüchternheit kaschieren, dem belanglosen Gespräch entgehen, das ihm zuwider war, und es sah trotzdem nicht aus, als sonderte er sich ab. Die Mädchen achteten nicht auf ihn, bis er zu singen begann, dann kamen sie näher und stimmten irgendwann ein. Hinterher tuschelten sie, so schlecht sehe der Ältere von den Dalmaus gar nicht aus, wenn auch, natürlich, kein Vergleich zu seinem Bruder Guillem.
Die bei weitem beste Pianistin unter Professor Dalmaus Musikschülern war Roser Bruguera, eine junge Frau aus dem Dorf Santa Fe, die ohne die großzügige Einmischung von Santiago Guzmán ihr Leben als Ziegenhirtin zugebracht hätte. Guzmán entstammte einer vornehmen Familie, deren Vermögen und Landbesitz allerdings von mehreren Generationen nichtsnutziger Sprösslinge weitgehend verschleudert worden war. Seine letzten Jahre verbrachte Don Santiago zurückgezogen in seinem Landhaus, das in einer steinigen Einöde lag und angefüllt war mit sentimentalen Erinnerungen. Trotz seines hohen Alters – er hatte bereits zu Zeiten von König Alfons XII. einen Lehrstuhl für Geschichte an der Universidad Complutense in Madrid bekleidet – war er weiterhin rüstig. Mit seinem Pilgerstab, dem abgewetzten Lederhut und seinem Jagdhund verließ er täglich das Haus für stundenlange Wanderungen, ob nun die unbarmherzige Augustsonne brannte oder die eisigen Januarwinde bliesen. Seine Frau war in den Labyrinthen der Demenz gefangen und verbrachte den Tag unter Beobachtung im Haus, wo sie mit Papier und Pinsel schauerliche Kunstwerke schuf. Im Dorf kannte man sie als die Sanfte Närrin, und das war sie auch. Sie machte keine Schwierigkeiten, verlief sich nur manchmal, weil sie schnurstracks dem Horizont entgegenging, und bemalte die Wände des Hauses mit ihrem eigenen Kot. Roser war ungefähr sieben, genau hätte das niemand zu sagen gewusst, als Don Santiago ihr und ihren dürren Ziegen auf einer seiner Wanderungen begegnete, und schon nach den ersten Sätzen, die sie miteinander wechselten, wusste er, dass er es mit einem hellwachen und wissbegierigen Geist zu tun hatte. Zwischen dem Professor und der kleinen Ziegenhirtin wuchs eine außergewöhnliche Freundschaft, genährt von den Kenntnissen, die er ihr zu vermitteln versuchte, und dem Lerneifer der Kleinen.
An einem Tag im Winter fand Don Santiago sie mit ihren drei Ziegen durchnässt vom Regen, fiebrig gerötet und bibbernd in einem Graben, er band die Ziegen fest und legte sich das Mädchen wie einen Sack über die Schulter, dankbar, dass sie so klein war und kaum etwas wog. Dennoch war die Anstrengung zu viel für sein Herz, und er gab sein Vorhaben nach wenigen Schritten auf. Er ließ die Kleine, wo sie war, und ging einen seiner Knechte holen, der sie zum Haus trug. Die Köchin wies er an, ihr etwas zu essen zu machen, das Dienstmädchen, ihr ein Bad einzulassen und ein Bett für sie zu richten, und den Stallburschen schickte er nach Santa Fe den Doktor holen und danach auf die Suche nach den Ziegen, damit sie nicht gestohlen wurden.
Der Arzt stellte fest, dass die Kleine Grippe hatte und stark unterernährt war, außerdem hatte sie die Krätze und Kopfläuse. Da niemand auf Guzmáns Landsitz vorstellig wurde und nach ihr fragte, hielt man sie dort für eine Waise, bis jemand auf die Idee kam, sie zu fragen, und sie erklärte, ihre Familie lebe auf der anderen Seite des Hügels. Die Kleine erwies sich als zäher als gedacht und kam trotz ihrer rebhuhndünnen Erscheinung rasch wieder auf die Beine. Sie ließ sich den Kopf scheren gegen die Läuse, ertrug klaglos die Schwefelbehandlung gegen die Krätze, aß gierig und bewies ein für ihre traurigen Lebensumstände ungerechtfertigt sonniges Gemüt. In den Wochen, die sie im Gutshaus verbrachte, schlossen alle sie ins Herz, von der verwirrten Hausherrin bis zum niedersten Knecht. Nie hatte man in dem düsteren Steinhaus, durch das halbwilde Katzen und Gespenster aus vergangenen Epochen streunten, ein Kind zu Besuch gehabt. Am meisten war der alte Professor von ihr bezaubert, der sich lebhaft an das Glück erinnerte, einem wachen Geist etwas beibringen zu dürfen. Jedoch konnte der Aufenthalt des Mädchens nicht unbegrenzt verlängert werden. Don Santiago wartete, bis sie vollständig genesen war und etwas Fleisch auf den Rippen hatte, und brach dann auf, um ihren nachlässigen Eltern auf der anderen Seite des Hügels die Leviten zu lesen. Er überhörte die Klagen seiner Frau, setzte die Kleine dick eingemummelt in seine Kutsche und fuhr mit ihr davon.
Sie erreichten eine niedrige Lehmhütte außerhalb des Dorfs, eine ärmliche Behausung wie viele in der Gegend. Die Landarbeiter schufteten für einen Hungerlohn auf den Feldern der Grundbesitzer und der Kirche. Don Santiago machte sich durch Rufen bemerkbar, und eine Schar verschüchterter Kinder zeigte sich in der Tür, gefolgt von einer schwarz gekleideten Hexe, die nicht, wie er vermutete, die Urgroßmutter, sondern die Mutter von Roser war. Hier war noch nie Besuch in einer Berline mit zwei schimmernden Pferden vorgefahren, und alle sperrten die Augen auf, als Roser mit diesem feinen Herrn aus dem Gefährt stieg. »Ich muss mit Ihnen über dieses Kind reden«, begann Don Santiago in dem gebieterischen Ton, vor dem seine Studenten an der Universität einst gezittert hatten, aber noch ehe er fortfahren konnte, hatte die Frau Roser im Nacken gepackt, langte ihr eine und schrie sie an, wo sie die Ziegen gelassen hätte. Da begriff er, dass es sinnlos sein würde, dieser abgekämpften Frau irgendwelche Vorhaltungen zu machen, und fasste im selben Augenblick einen Plan, der das Los des Mädchens für immer wenden sollte.
Roser verbrachte den Rest ihrer Kindheit auf dem Gut der Guzmáns, offiziell als Schützling und persönliches Dienstmädchen der Herrin, aber daneben als Schülerin des Gutsherrn. Dafür, dass sie den Bediensteten zur Hand ging und das Dasein der Sanften Närrin aufheiterte, bekam sie Herberge und Ausbildung. Der alte Professor stellte ihr einen großen Teil seiner Bibliothek zur Verfügung, brachte ihr mehr bei, als sie auf jeder Schule gelernt hätte, und ließ sie den Flügel seiner Frau spielen, die sich schon nicht mehr erinnerte, wofür um alles in der Welt das schwarze Ungetüm gut sein sollte. Wie sich herausstellte besaß Roser, die in den ersten sieben Jahren ihres Lebens außer dem Akkordeonspiel der Betrunkenen in der Johannisnacht nie Musik gehört hatte, ein außergewöhnlich gutes Ohr. Im Haus gab es einen Phonographen, aber nachdem Don Santiago klar geworden war, dass dieses Kind eine Melodie schon nach einmaligem Hören nachspielen konnte, ließ er aus Madrid ein modernes Grammophon und eine Sammlung von Schallplatten kommen. Roser reichte mit den Füßen noch nicht an die Pedale, konnte aber die Stücke von den Schallplatten im Handumdrehen mit geschlossenen Augen nachspielen. Hocherfreut trieb Don Santiago in Santa Fe eine Klavierlehrerin auf, schickte Roser dreimal in der Woche zum Unterricht und wachte persönlich darüber, dass sie wie aufgetragen übte. Weil sie alles aus dem Kopf spielen konnte, sah Roser nicht recht ein, wozu sie Noten lesen und über Stunden dieselben Läufe üben sollte, aber sie tat es aus Achtung vor ihrem Förderer.
Mit vierzehn übertraf Roser ihre Klavierlehrerin bei weitem, und als sie fünfzehn wurde, brachte Don Santiago sie in einem katholischen Mädchenpensionat in Barcelona unter, damit sie Musik studieren konnte. Er hätte sie gerne bei sich behalten, aber sein Pflichtbewusstsein als Erzieher siegte über seine väterlichen Gefühle. Für ihn stand außer Frage, dass dieses Mädchen von Gott eine besondere Gabe erhalten hatte und seine Rolle auf Erden darin bestand, diesem Talent zur Entfaltung zu verhelfen. Damals begann die Sanfte Närrin langsam zu erlöschen, bis sie schließlich ohne Aufruhr starb. Allein in seinem Gutshaus wurden Don Santiago die Jahre nun doch zu einer Bürde, er musste auf seine Wanderungen mit dem Pilgerstab verzichten und verbrachte die Zeit lesend am Kamin. Auch sein Jagdhund starb, und er wollte ihn nicht ersetzen, um nicht vor seinem Vierbeiner abzutreten und ihn ohne Herrchen zurückzulassen.
Mit der Zweiten Republik im Jahr 1931 wurde dem alten Mann das Leben endgültig sauer. Nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses, das zugunsten der Linken ausfiel, ging König Alfons XIII. unverzüglich ins Exil nach Frankreich, und für Don Santiago, der Monarchist war, erzkonservativ und katholisch, brach eine Welt zusammen. Er würde die Roten niemals dulden und schon gar nicht würde er sich in ihre Niederungen herablassen, diese Gottlosen waren nichts als Lakaien der Sowjetunion, steckten Kirchen in Brand und schossen Geistliche nieder. Die angebliche Gleichheit der Menschen war in der Theorie nur Gewäsch und führte in der Praxis auf Abwege. Vor Gott waren die Menschen nicht gleich, schließlich hatte der Höchste selbst soziale Klassen und andere Unterschiede geschaffen. Durch die Landreform verlor Don Santiago seinen Grund und Boden, der wenig wert war, aber von jeher der Familie gehört hatte. Von einem Tag auf den anderen nahmen die Bauern ihre Mützen nicht mehr ab, wenn sie mit ihm sprachen, und sie schlugen die Augen nicht nieder. Die Anmaßung seiner Untergebenen traf ihn härter als der Verlust der Ländereien, sie war ein Affront gegen seine Ehre und die Stellung, die er zeitlebens in der Welt innegehabt hatte. Er entließ seine Bediensteten, die seit Jahrzehnten unter seinem Dach gelebt hatten, gab Anweisung, seine Bibliothek, seine Kunstwerke und Erinnerungsstücke einzupacken, und verrammelte das Gutshaus. Sein Gepäck füllte drei Lastwagen, aber die sperrigsten Möbel und den Flügel musste er zurücklassen, weil dafür in seiner Wohnung in Madrid kein Platz war. Monate später beschlagnahmte der republikanische Bürgermeister von Santa Fe das Gutsgebäude, um darin ein Waisenhaus einzurichten.
Zu dem schweren Verdruss und dem vielen, was Don Santiagos Zorn in diesen Jahren schürte, gehörte auch die Wandlung seines Schützlings Roser Bruguera. Unter dem schlechten Einfluss der Aufrührer an der Universität, namentlich eines gewissen Professor Marcel Lluís Damau, der Kommunist war, Sozialist oder Anarchist, was auch immer, jedenfalls ein perverser Bolschewist, war seine Roser zu einer Roten geworden. Sie hatte das Pensionat für anständige junge Frauen verlassen und lebte mit irgendwelchen Flittchen zusammen, die sich wie Soldaten kleideten und über freie Liebe schwadronierten, wie Ehebruch und Sittenlosigkeit neuerdings genannt wurden. Zwar musste er zugeben, dass Roser ihm gegenüber nie den Respekt hatte vermissen lassen, aber da sie es sich herausnahm, seine Ratschläge zu überhören, sah er sich, natürlich, gezwungen, ihr seine Unterstützung zu entziehen. In einem Brief bedankte sie sich von Herzen für alles, was er für sie getan hatte, versprach, sie werde sich bemühen, stets auf dem rechten Pfad zu bleiben, den er ihr gewiesen hatte, und ließ ihn wissen, dass sie nachts in einer Bäckerei arbeitete und tagsüber weiterhin Musik studierte.
In seiner luxuriösen Wohnung in Madrid, in der man sich zwischen den vielen Möbeln und Kunstgegenständen kaum bewegen konnte, lebte Don Santiago Guzmán hinter schweren, stierblutroten Samtvorhängen, abgeschirmt vom Lärm und dem Unflat der Straße, getrennt von der Gesellschaft durch seine Schwerhörigkeit und seinen überzogenen Stolz und bekam nicht mit, wie der Groll in seinem Land hochkochte, ein Groll, der über Jahrhunderte geschürt worden war vom Elend der einen und der Überheblichkeit der anderen. Don Santiago starb allein und unversöhnt in seiner Wohnung im Salamanca-Viertel, vier Monate bevor Francos Truppen sich erhoben. Bis zum letzten Moment war er klar im Kopf und so einverstanden mit seinem Hinscheiden, dass er eigenhändig seine Todesanzeige verfasste, damit nicht irgendein Nichtswisser Unwahrheiten über ihn verbreitete. Er sagte niemandem Lebewohl, vielleicht weil ihm niemand Nahestehendes geblieben war in dieser Welt, doch erinnerte er sich an Roser Bruguera und vermachte ihr in einer noblen Geste der Versöhnung den Flügel, der noch eingemottet in einem Raum des neuen Waisenhauses von Santa Fe stand.
Professor Marcel Lluís Dalmau war auf seine Studentin Roser Bruguera sehr schnell aufmerksam geworden. In seinem Bemühen, in seinen Lehrveranstaltungen alles zu vermitteln, was er über Musik und über das Leben wusste, entschlüpften ihm politische und philosophische Bemerkungen, die seine Zuhörerschaft vermutlich stärker beeinflussten, als er selbst ahnte. Damit hatte Santiago Guzmán richtig gelegen. Aus Erfahrung misstraute Dalmau Schülern, denen die Musikalität in die Wiege gelegt schien, denn, wie er nicht müde wurde zu betonen, ein Mozart war ihm noch nicht untergekommen. Er hatte schon Fälle wie Roser erlebt, junge Leute, die mit einem glänzenden Gehör jedes Instrument spielen lernten, die dann aber faul wurden, weil sie glaubten, das reiche aus für einen Musiker und aufs Üben und auf Disziplin könne verzichtet werden. Mehr als einer landete in einer Tanzkapelle, verdiente sein Geld auf Volksfesten, in Hotels oder Restaurants, wurde zu einem Hochzeitsklimperer, wie Dalmau das nannte. Um Roser Bruguera vor diesem Unheil zu bewahren, nahm er sie unter seine Fittiche. Als er hörte, dass sie allein in Barcelona war, öffnete er ihr sein Zuhause, und als er später erfuhr, dass sie einen Flügel geerbt hatte, ihn aber nirgends hinstellen konnte, räumte er für das Instrument sein Wohnzimmer frei und beschwerte sich nicht ein einziges Mal über die endlosen Fingerübungen der jungen Frau, die täglich nach dem Unterricht vorbeikam. Irgendwann richtete Carme für Roser das Bett von Guillem her, der im Krieg war, damit sie ein paar Stunden schlafen konnte, ehe sie um drei in der Früh in die Bäckerei ging und das Brot für den Morgen backte, und auf diese Weise, weil sie so oft auf seinem Kopfkissen schlief und die Spuren seines Duftes nach jungem Mann atmete, verliebte sie sich in den jüngeren Sohn der Dalmaus, ohne dass die räumliche Trennung, die Zeit oder der Krieg sie davon abgebracht hätten.
Roser wurde so unbemerkt Teil der Familie, als gehörte sie von Geburt an dazu, sie war die Tochter, die sich die Dalmaus immer gewünscht hatten. Das Haus, in dem sie wohnten, war bescheiden, etwas düster und nach vielen Jahren ohne Renovierung ziemlich verwohnt, aber geräumig. Als auch Víctor in den Krieg zog, bot Marcel Lluís Roser an, ganz zu ihnen zu ziehen. So hätte sie weniger Ausgaben, müsste nicht so viele Stunden arbeiten, könnte Klavier üben, wann immer sie wollte, und außerdem seiner Frau ein wenig mit dem Haushalt helfen. Obwohl Carme erheblich jünger war als ihr Mann, sah sie älter aus als er, bekam schlecht Luft und schnaufte, während er vor Vitalität strotzte. »Meine Kräfte reichen gerade noch, um den Milizionären Lesen und Schreiben beizubringen, und wenn das mal nicht mehr nötig ist, kann ich bloß noch sterben«, seufzte sie. In seinem ersten Jahr als Medizinstudent lautete Víctors Diagnose, ihre Lunge sehe aus wie ein Blumenkohl. »Verdammt, Carme, die Qualmerei bringt dich noch mal ins Grab«, schimpfte ihr Mann, wenn er sie husten hörte, ohne einen Gedanken daran, dass er ja selbst rauchte und womöglich vor ihr sterben könnte.
In enger Verbundenheit zur Familie Dalmau blieb Roser in den Tagen nach dem Infarkt bei ihrem Professor. Sie ging nicht zum Unterricht, arbeitete aber weiter in der Bäckerei und übernahm abwechselnd mit Carme die Pflege des Kranken. War gerade nichts zu tun, spielte sie Klavierkonzerte für ihn, flutete das Haus mit Musik und beruhigte den Sterbenden damit. Sie saß dabei, als Marcel Lluís seinem ältesten Sohn seine letzten Bitten mit auf den Weg gab.
»Wenn ich nicht mehr bin, dann hast du die Verantwortung für deine Mutter und für Roser, Víctor, weil Guillem in diesem Krieg sterben wird. Der Kampf ist verloren, mein Sohn«, sagte er, unterbrochen von langen Pausen, in denen er um Atem rang.
»Das darfst du nicht sagen, Vater.«
»Mir ist das seit März klar, seit den Bomben auf Barcelona. Das waren Flugzeuge aus Italien und Deutschland. Das Recht ist auf unserer Seite, aber wir verlieren trotzdem. Wir sind allein, Víctor.«
»Alles kann sich ändern, wenn England, Frankreich und die USA eingreifen.«
»Vergiss die USA, die helfen uns nicht. Angeblich hat Eleanor Roosevelt ihren Mann beschworen, es zu tun, aber der Präsident hat die öffentliche Meinung gegen sich.«
»Die kann so eindeutig nicht sein, Vater, du weißt doch, wie viele sich dem Lincoln-Bataillon angeschlossen haben und bereit sind, mit uns zu sterben.«
»Das sind Idealisten, Víctor. Und von denen gibt es sehr wenige auf der Welt. Viele von den Bomben, die im März hier gefallen sind, stammten aus den USA.«
»Aber Hitler und Mussolini machen sich mit ihrem Faschismus in ganz Europa breit, wenn wir sie hier nicht stoppen. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren, sonst wird dem Volk alles genommen, was es sich erkämpft hat, wir fallen ins Mittelalter zurück, in den Feudalismus.«
»Niemand hilft uns. Denk an meine Worte, Víctor, selbst die Sowjetunion hat uns im Stich gelassen. Stalin interessiert sich nicht mehr für Spanien. Wenn die Republik fällt, wird die Unterdrückung bestialisch. Franco hat sein Großreinemachen angekündigt, das heißt Terror, Hass, die blutigste Vergeltung, er verhandelt und verzeiht nicht. Seine Truppen begehen Gräueltaten, die sind unbeschreiblich …«
»Unsere auch«, sagte Víctor, der vieles gesehen hatte.
»Wie kannst du das vergleichen! In Katalonien wird es ein Blutbad geben. Ich muss das nicht mehr erleben, aber ich möchte beruhigt sterben. Du musst mir versprechen, dass du deine Mutter und Roser über die Grenze bringst. Die Faschisten werden Carme bestrafen, weil sie Soldaten alphabetisiert, die erschießen Menschen schon für weniger. Dich bringen sie um, weil du in einem Militärhospital arbeitest, und Roser ist eine junge Frau. Du weißt doch, was sie denen antun. Sie geben sie den Söldnern. Ich habe alles vorbereitet. Ihr geht nach Frankreich, bis die Lage sich beruhigt hat und ihr wieder zurückkönnt. In meinem Schreibtisch findest du eine Karte und etwas Erspartes. Versprich mir, dass du das tust.«
»Ich verspreche es dir, Vater«, sagte Víctor, ohne es wirklich zu meinen.
»Versteh doch, das ist keine Feigheit, es geht ums Überleben.«
Marcel Lluís Dalmau war nicht der Einzige, der am Fortbestand der Republik zweifelte, aber niemand wagte, das offen auszusprechen, weil es ein schwerer Verrat gewesen wäre, Hoffnungslosigkeit und Angst unter den Bewohnern der Stadt zu verbreiten, die schon zu viel gelitten hatten und mit ihren Kräften am Ende waren.
Am Tag darauf trugen sie Professor Marcel Lluís Dalmau zu Grabe. Die Familie hätte es gern in aller Stille getan, weil die Zeiten nicht dafür gemacht waren, die eigene Trauer auszustellen, aber es sprach sich herum, und auf dem Friedhof von Montjuïc versammelten sich seine Freunde aus dem Rocinante, Kollegen von der Universität und auch ein paar seiner schon betagteren ehemaligen Studenten, denn die jüngeren waren an der Front oder unter der Erde. Trotz der Junihitze ganz in Schwarz, vom Schleier bis zu den Strümpfen, folgte Carme Dalmau, auf Víctor und Roser gestützt, dem Sarg, in dem der Mann ihres Lebens ruhte. Es gab weder Gebete noch Reden, noch Tränen. Seine Studenten verabschiedeten ihn mit dem zweiten Satz des Streichquintetts von Schubert, dessen Schwermut zum Anlass passte, und danach sangen sie eins der Lieder, die der Professor für die Miliz komponiert hatte.
II1938
Nichts, nicht einmal der Siegwird die schreckliche Leere des Blutes füllen …
Pablo Neruda, »Beleidigtes Land«
Spanien im Herzen
Roser Bruguera erlebte die erste Liebe ihres Lebens im Haus von Professor Dalmau, in das er sie unter dem Vorwand eingeladen hatte, ihr Studium zu unterstützen, wenngleich die mildtätigen Motive die didaktischen überwogen, wie beide wussten. Der Professor ahnte, dass seine Lieblingsschülerin zu wenig aß und eine Familie gebrauchen konnte, vor allem jemanden wie Carme, deren Bemutterungsversuche bei Víctor wenig und bei Guillem gar keinen Anklang fanden. In diesem Jahr war Roser dem Kasernenhofton ihres Mädchenpensionats endgültig entflohen und in die Barceloneta gezogen, wo sie sich mit drei jungen Frauen von der Volksmiliz ein Zimmer teilte, das für sie gerade noch erschwinglich war. Sie war neunzehn und ihre Mitbewohnerinnen dort im Hafenviertel zwischen vier und fünf Jahre älter, allerdings etwa zwanzig Jahre reifer an Erfahrung. Die Milizionärinnen lebten in einer anderen Welt als Roser, gaben ihr den Spitznamen »Novizin« und ließen sie die meiste Zeit vollständig links liegen. In ihrem Zimmer teilten sie sich zwei Stockbetten – Roser schlief oben –, zwei Stühle, Waschschüssel, Krug und Nachttopf, einen Petroleumofen und ein paar Nägel an der Wand, um ihre Kleider aufzuhängen, außerdem das Gemeinschaftsbad, das von allen etwa dreißig Bewohnern des Stockwerks benutzt wurde. Die Frauen waren fröhlich und kühn und genossen in vollen Zügen die Freiheiten, die diese bewegte Zeit ihnen bot. Sie trugen vorschriftsmäßig Uniform, die schweren Schuhe und das Barett, malten sich aber die Lippen rot und brannten sich Locken mit einem Eisenstab, den sie über einem Kohlebecken erhitzten. Sie trainierten mit Stöcken oder geliehenen Gewehren und wollten eigentlich an die Front und dem Feind Auge in Auge gegenüberstehen, anstatt sich um Transport, Nachschub, Verpflegung und Sanitätsdienst zu kümmern, wozu sie eingeteilt wurden, weil die sowjetischen und mexikanischen Waffen kaum für die Männer ausreichten und in den Händen einer Frau angeblich verschwendet wären. Als Francos Truppen einige Monate später zwei Drittel des Landes besetzt hatten und weiter vorrückten, erfüllte sich der Wunsch der drei, in vorderster Front zu kämpfen. Zwei von ihnen wurden bei einem Angriff marokkanischer Truppen vergewaltigt und enthauptet. Die Dritte überlebte die drei Jahre Bürgerkrieg und die sechs Jahre des Zweiten Weltkriegs, schlug sich unerkannt von einem Ende Europas zum anderen durch, bis sie 1950 schließlich in die Vereinigten Staaten auswandern konnte. In New York heiratete sie einen jüdischen Intellektuellen, der im Lincoln-Bataillon gekämpft hatte, aber das ist eine andere Geschichte.
Guillem Dalmau war ein Jahr älter als Roser. Während sie mit ihren altbackenen Kleidern und ihrer Ernsthaftigkeit dem Novizinnen-Spitznamen alle Ehre machte, war er ein Angeber und Draufgänger, dem die Welt gehörte. Sie musste allerdings nur zweimal allein mit ihm sein, um hinter seiner Großspurigkeit den kindlich verwirrten Romantiker zu erkennen. Mit jedem seiner Besuche in Barcelona wirkte Guillem verschlossener, von dem Jungen mit den Flausen im Kopf, der Kerzenleuchter geklaut hatte, war nichts geblieben, er war ein erwachsener Mann geworden, zog die Brauen zusammen und rang mit der angestauten Gewalt in seinem Innern, die beim geringsten Anlass auszubrechen drohte. Er wohnte in der Kaserne, sorgte aber dafür, dass er ab und zu bei seinen Eltern übernachten konnte, vor allem um Roser zu sehen. Er war froh, sein Herz an niemanden gebunden zu haben und nicht wie seine Kameraden an der Front gequält zu werden von Gedanken an eine Braut oder eine Familie. Der Krieg brauchte ihn ganz, und er erlaubte sich keine Ablenkung, aber diese Musikschülerin seines Vaters stellte keine Gefahr für seine Unabhängigkeit dar, sie war nur ein harmloser Zeitvertreib. Je nach Blickwinkel und Beleuchtung konnte Roser anziehend aussehen, aber sie tat nichts dafür, und ihre Einfachheit brachte eine verborgene Saite in Guillems Seele zum Klingen. Er war an seine Wirkung auf Frauen gewöhnt, und dass er die auch auf Roser hatte, entging ihm nicht, obwohl sie unfähig war zu jeder Art von Koketterie. ›Die Kleine ist verliebt in mich, ist ja klar, ihr Leben besteht ja bloß aus Klavierspielen und Brotbacken, aber das legt sich schon wieder‹, dachte er. »Sieh dich vor, Guillem, Finger weg von ihr, wenn ich dich bei der kleinsten Respektlosigkeit erwische …«, hatte sein Vater ihn gewarnt. »Wo denkst du hin, Vater! Roser ist wie eine Schwester für mich.« Aber das war sie nicht, zum Glück. So wie seine Eltern auf sie aufpassten, musste Roser noch Jungfrau sein, eine der letzten im republikanischen Spanien. Zu weit gehen würde er nicht, auf gar keinen Fall, aber ein paar kleine Zärtlichkeiten konnte niemand ihm vorwerfen, eine Berührung der Knie unter dem Tisch, eine Einladung ins Kino, um sie dort im Dunklen zu berühren, während sie über den Film weinte und bebte vor Schüchternheit und Verlangen. Für kühnere Vorhaben hatte er seine Genossinnen von der Miliz, die frei waren, selten abgeneigt und erfahren.
Nach jedem kurzen Fronturlaub in Barcelona kehrte Guillem in die Schlacht zurück in der Absicht, sich ganz aufs Überleben und auf den Sieg zu konzentrieren, aber es fiel ihm schwer, Rosers erwartungsvolles Gesicht und ihren unverstellten Blick zu vergessen. Er wollte sich partout nicht eingestehen, wie sehr er ihre Briefe brauchte und ihre Päckchen mit Süßigkeiten und Socken und Schals, die sie für ihn strickte. Er besaß ein Foto von ihr, das er als Einziges in der Brieftasche bei sich trug. Roser stand neben einem Flügel, wahrscheinlich während eines Konzerts, in einem dunklen, schlichten Kleid, der Rock länger als gewöhnlich, die Ärmel kurz, der Kragen aus Spitze, ein absurd altjüngferlicher Aufzug, der ihre Figur verbarg. Auf diesem schwarzweißen Fotokarton wirkte Roser weit weg und verschwommen, anmutlos, alterslos, ausdruckslos. Den Kontrast zwischen ihren bernsteinfarbenen Augen und dem schwarzen Haar musste man sich dazudenken, die gerade, statuenhafte Nase, die ausdrucksvollen Brauen, die Segelohren, die schlanken Finger, den Geruch nach Seife, Kleinigkeiten, die Guillem nachgingen, ihn unvermittelt anfielen, ihn im Schlaf in Besitz nahmen. Diese Kleinigkeiten waren die Ablenkung, die ihn das Leben kosten konnte.
Neun Tage nach der Beisetzung seines Vaters kam Guillem an einem Sonntagnachmittag unangemeldet in einem klapprigen Militärfahrzeug nach Hause. Sich die Hände an einem Küchentuch trocknend trat Roser an die Haustür, und im ersten Moment erkannte sie den schmalen, abgezehrten Mann nicht, der da von zwei Milizionärinnen unter den Armen gestützt wurde. Vier Monate hatte sie ihn nicht gesehen, vier Monate ihre Hoffnungen genährt mit den kargen Sätzen, die er ihr sporadisch schrieb über das, was in Madrid geschah, ohne ein liebevolles Wort, als würde er Meldung machen in seiner Schülerschrift, auf den ausgerissenen Seiten eines Notizhefts. Hier alles wie immer, du hast bestimmt gehört, wie wir die Stadt verteidigen, die Mauern sind von den Mörsergranaten durchsiebt, Ruinen überall, die Faschisten bekommen Munition von Italienern und Deutschen, sie sind sehr nah, manchmal können wir den Tabak riechen, den sie rauchen, diese Schweine. Wir hören sie sprechen, sie rufen Beleidigungen zu uns rüber, um uns zu reizen, dabei haben sie die Hosen voll, bloß die Moros nicht, die sind wie Hyänen, die haben vor nichts Angst, denen sind ihre Schlachtermesser lieber als Gewehre, der Kampf Mann gegen Mann, der Geschmack von Blut. Täglich kriegen die Verstärkung, aber sie machen keinen Meter Boden gut. Uns fehlt es hier an Wasser und Strom, das Essen ist knapp, aber wir kommen klar. Mir geht es gut. Die Hälfte der Gebäude sind zertrümmert, die kommen kaum damit nach, die Toten zu bergen, oft bleiben sie liegen, bis der Leichentransport sie am nächsten Tag einsammelt, es konnten nicht alle Kinder evakuiert werden, du kannst dir nicht vorstellen, wie stur manche Mütter sind, sie wollen nicht hören, nicht weg von hier, sich nicht von ihren Kindern trennen, es ist unfassbar. Was macht das Klavier? Wie geht es meinen Eltern? Sag Mutter, sie soll sich keine Sorgen um mich machen.
»Der Himmel steh uns bei! Was ist mit dir, Guillem, o mein Gott!«, entfuhr es Roser, bei der jäh die katholische Kinderstube durchbrach.
Guillem reagierte nicht, sein Kopf baumelte vor der Brust, seine Beine trugen ihn nicht. In dem Moment kam auch Carme aus der Küche, ihr gellender Schrei blieb ihr in der Kehle stecken, und sie krümmte sich in einem Hustenanfall.
»Immer mit der Ruhe, Genossinnen. Er ist nicht verwundet. Er ist krank«, sagte eine der Milizionärinnen fest.
»Bitte, hier hinein.« Roser führte sie mit ihrer Last in das Zimmer, das früher Guillem gehört hatte und jetzt von ihr bewohnt wurde. Die beiden Frauen legten den Kranken auf dem Bett ab und verschwanden dann, um kurz darauf mit seinem Rucksack, der Militärdecke und seinem Gewehr zurückzukommen. Sie verabschiedeten sich mit einem knappen Gruß und wünschten viel Glück. Während Carme weiter hustend nach Atmen rang, zog Roser dem Kranken die löchrigen Stiefel und die schmutzigen Strümpfe aus und kämpfte gegen die Übelkeit, die sein Gestank ihr verursachte. Ihn ins Krankenhaus zu bringen war ausgeschlossen, dort grassierten die Infektionen, und einen Arzt konnte man auch nicht rufen, die waren alle mit den verwundeten Soldaten beschäftigt.