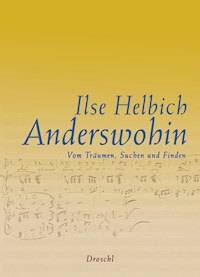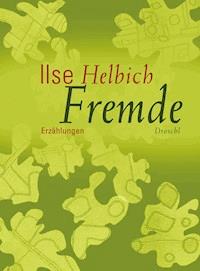19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Von der ersten Zeile an faszinieren diese Geschichten durch die so unnachahmliche Schärfe von Beobachtung und Benennung. Hand in Hand geht damit immer eine große, nur sehr vorsichtig benannte Liebe zum mit den Sinnen erfahrbaren Leben einher. Bevor Ilse Helbich 2003 mit "Schwalbenschrift" ihren ersten (autobiografischen) Roman vorlegte, verfasste sie Erzählungen, Rundfunkarbeiten und die für ihr späteres Schreiben so typischen Betrachtungen zu Leben und Alltag. Diesseits vereint gesammelte Erzählungen der Autorin – darunter auch bisher unveröffentlichte Texte sowie jene des lange vergriffenen "Iststand". Der Band umspannt einen Zeitraum von nahezu 40 Jahren. Dass Ilse Helbich von Anfang an sehr aufmerksam auf die Lebensbedingungen von Frauen eingegangen ist wie auf die Gegensätze von Arm und Reich, belegt dieses Buch eindrucksvoll. Was vielleicht überraschen mag: Schon bei den ältesten erhaltenen Geschichten finden sich solche, die sich des Erzählmodells der Märchen bedienen – und auch die bisher jüngste ist wieder ein Märchen, aber selbstverständlich eines, das den Leser*innen den Kopf geraderückt und die Augen für das Diesseitige, das Nicht-Wunderbare und doch so Rätselhafte öffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Ähnliche
Ilse Helbich
Diesseits
Gesammelte Erzählungen
Mit einem Nachwort von Franz Schuh
Literaturverlag Droschl
Gebrauchsanweisung: Manche Geschichten sind wie Steine, die man aus dem Fluss fischt.
Im Spiegel
Biographische Notiz: Sie war Schriftstellerin. Sie schrieb viel und regelmäßig. Jeden Vormittag arbeitete sie einige Stunden mit voller Konzentration. Wenn sie erschöpft war von der ihr alle Kräfte abverlangenden Arbeit, erholte sie sich beim Schreiben von Aufsätzen und Buchbesprechungen.
Die Genauigkeit des Ausdrucks war ihr Ziel. Jeden Tag schreiben, Tagebuch schreiben, hieß: die Feder üben, sie noch beweglicher machen. Man kann alles sagen, was man genau sagen kann.
Beim Schreiben hatte sie Geduld: siebenmal schrieb sie ihren ersten Roman um, bevor sie ihn dem Verleger zeigte. Später musste sie sich zügeln, wenn die Lust des Abenteurers, in neue Gebiete einzudringen, ihren Genauigkeitsdrang überwältigen wollte.
Das Schreiben regiert ihre Lebensumstände. Aus dem Umgang mit Freunden, von Festen und Einladungen, vom Theaterbesuch zieht sie sich immer wieder in das dem Schreiben gemäßere Alleinsein zurück.
Sie hat einen Mann, der über sie wacht, der ihr am Vormittag die Milch ans Schreibpult bringt, dessen Person die Ordnung ihres Lebens garantiert. Als sie einmal allein nach Paris reisen möchte, entdeckt sie im letzten Augenblick, dass ihr dieses Unternehmen ohne ihn sinnlos ist.
Die beiden haben keine Kinder. Dies bleibt, scheint es, ein unterirdisch nagender Schmerz, der sich von Zeit zu Zeit ins Bewusste durchbeißt. Aber es gibt keine Masern und keine Keuchhustenwochen, keine Vorladung zum Lehrer, keine auf Kinder abgestimmten Tagesläufe. Sie ist ganz der Aufgabe des Schreibens ausgeliefert.
Ihre Liebesgeschichten, verwehend. Männer, ihre Beziehungen zu anderen Frauen. Es ist dann, als sei sie bezaubert, eingefangen im Netz einer Neigung. Aber das Muschelhaus ihrer Virginität bleibt unverletzt.
Einige Reisen. Ihre Eindrücke bleiben in der Sphäre des Welligen, Oberflächenbewegten. Die Stoffe ihrer Bücher kommen aus tieferen Schichten als der Topographie der mediterranen Küsten, und von dem Bild der Akropolis wird ihre schreibende Existenz nur geritzt. Sie versucht die Ablichtung von Erscheinungen, die nicht ortsbezogen, die allgegenwärtig sind. Am einzelnen Fall beschreibt sie eine Psychologie des Daseins, die in eins fällt mit seiner Physik.
Jeden Nachmittag macht sie lange Spaziergänge; allein zieht sie querfeldein. Ihre Schritte passen sich dem Motor der Gedanken an, sie werden schneller, wenn der Faden ihrer Geschichte sich behänder in ihrem Gehirn abspult. Dann Blackout. Erschöpfung. Heimzu, sich ausruhen im Anhaften an die wieder sichtbar gewordene Umgebung. Die Grünnuancen der Wiesen, die Verschleierungen des Himmels, die fast unmerkbaren. Das alles muss sie sehen, sich merken. Alles, was ihr geschieht, wird sie in irgendeinem Text verwenden.
Sehr oft fällt sie in Erschöpfungszustände. Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Herzrasen. Wenn sie ein Buch beendet hat, ist sie wochenlang nicht fähig, das Bett zu verlassen; sie ist zu schwach, um zu gehen.
Die Kopfwehtage, die Wochen im Bett werden als Rohstoff für das zu Beschreibende eingebracht. Die Tage, in denen sie nicht bei sich ist, bewirken, dass ihre Beschreibung der baumstarken Madame de Sévigné die Kraft aus ihrer eigenen Erfahrung schöpft, dass ganz bei sich zu Hause zu sein ein freudegebärendes Wunder ist. Die Feste, die sie beschreibt, borgen ihren Glanz von der tödlichen Mattigkeit der eigenen Gefangenentage. Die Perioden ihres offen auftretenden Wahnsinns sind im Nachhinein neu dazueroberte Erfahrungsgebiete, die sie in der Beschreibung wiederbetritt – unter Lebensgefahr.
Selbstreflexion. Das Führen eines Tagebuchs. Sich selbst ausbeuten als das einzig unmittelbar zu erfahrende Objekt. Darum größte Konzentration auf die eigenen Eindrücke, auf die Erfahrung mit sich selbst, bei gleichzeitigem Equilibrium in der tiefen Bewusstseinsschicht; ein Equilibrium, das, peinlich in der Waage gehalten, die Selbstbeobachtung erst ermöglicht. Leben, um zu schreiben.
Kopfwehtage, Herzschmerzen. Keine Tränen. Kein Händeringen. Wenn es Schmerz gibt, wird er in den Höhlungen der Keller gehalten, tritt nicht auf in den bewohnten Räumen. Streitszenen, gelegentliche Zornausbrüche gehören einer so reflexhaften Schicht an wie das Niesen.
Wenn sie krank ist, hat die Angst ihren Platz nur als Symptom ihrer Krankheit. Sie ergibt sich den Ohnmachten und den Kopfschmerzen, die sie auslöschen, sie ergibt sich den Stimmen aus dem Off. Wenn sie noch einmal die Kraft dazu hat, wird sie herauskriechen aus den immer erneuerten Angriffen ihrer Krankheit, um weiterzuschreiben.
Vor der Kritik an ihren Büchern hat sie panische Angst. Wenn ihre Romane verdammt, oder, böser noch, verlacht würden, verlöre ihr Leben allen Sinn. Die Anerkennung ihrer Bücher ist die Anerkennung ihrer eigenen gelungenen Existenz. Im gegenteiligen Falle ist der Name Virginia Woolf nichts als eine leere Chiffre für Krankheit, Versagen, für Lächerlichkeit.
Es gibt viele angenehme Stunden und Tage. Die Sicherheit im Zusammenleben mit ihrem Mann, mit ihrer Schwester. Behagliche Teestunden, Lachen mit Freunden und lange Gespräche; Verkleidungen, Maskenfeste. Stete Beziehungen und Nähe unter dem oberflächlichen Wechsel von Ärger und kleinlichem Streit und neuer Zuwendung. Und trotz Kopfschmerzen und Schwindelanfällen kann sie die handnahen Aufgaben in der Druckerei erfüllen, kann Bücher verpacken oder am Setzkasten die Lettern ordnen. Dazwischen hält ihr Tagebuch in wechselnden Abständen fest, dass sie wieder die Finne des großen Fisches hat durchs glatte Wasser gleiten sehen. Immer die geheime Anwesenheit des riesigen, des niemals erblickten Fisches unter der glatten Oberfläche. Kopfschmerzen.
Als sie fünfzig ist, beginnen ihr die Freunde wegzusterben. Bei einem dieser Begräbnisse legt sie einem Übriggebliebenen die Hand auf die Schulter, sie tut es zum ersten Mal, schreibt sie in ihrem Tagebuch; sie bittet ihn, »stirb du mir noch nicht.«
Der Wachtraum, am Rande der Krankheit: aufgeschlagen ist der Deckel des hölzernen Fisch-Kalters. Ich beuge mich über die Truhe, nahe, ich schaue hinein.
Ich sehe: die schleimige Schachtel ist angefüllt bis zum Rande mit feuchten schwarzen Schlangenleibern. Die Windungen schieben sich hin und her, eine ganz langsame Bewegung.
Ich muss jetzt ganz starr stehen. Tief niedergebeugt, warte ich mit angehaltenem Atem. Ich warte, bis zwischen den armdicken Strängen irgendwo das Auge des Reptils ans Licht kommt und mich ansieht.
Wenn das geschieht, muss ich sterben.
Die Geschichte vom reichen Mann und der armen Frau
In einer Landgegend, von der die Besucher sagen, es sei dort alles geblieben wie vor hundert Jahren, und damit meinen sie, dass über den Feldern und zwischen den Menschen viel Friede sei – in einer solchen Gegend lebte ein reicher Mann. Die Einwohner des unbedeutenden Dorfes nannten ihn reich, denn gleich, als er vor wenigen Jahren zu ihnen gekommen war, hatte er sich ein schönes und behagliches Haus bauen lassen, und dort wohnte er nun. An den hellen Abenden sah man ihn in seinem ausgebreiteten Garten umhergehen, dort, wo er zwischen den alten Bäumen, wie sie hier überall herumstanden, Beete mit so seltenen Blumen hatte anlegen lassen, dass sie die anderen Dorfbewohner nicht einmal von den Bildern in den dicken Bestellkatalogen her kannten, die ihnen der Briefträger jedes Jahr ins Haus brachte. Dieser Briefträger hatte auch erzählt, dass der zugereiste Mann an jedem Vormittag vor einem Schreibtisch sitze, mit zornigem Gesicht oft, und manchmal mit einem traurigen. Der Briefträger hatte auch jeden Tag viele Briefe ins neue Haus zu tragen, manche kamen von weit her, wie man an den bunten Marken sah; und so einigten sich die Dörfler in ihrer sonntäglichen Wirtshausrunde bald darauf, dass ihr neuer Mitbewohner erstens ein reicher Mann sei und von Beruf, zweitens, etwas Rares, was ohne viel Schweiß Geld und Anerkennung einzubringen schien. Und als der Lehrer einmal die Vermutung äußerte, der Fremde könne so eine Art Schreiber sein, der für Zeitungen verschiedene wichtige Dinge festhielte, vielleicht gar auch fürs Radio – da erschien das den Männern um den Wirtshaustisch als ganz gewiss. Und von da an gingen dem Mann alle Eingesessenen leise aus dem Wege und die Kinder, die auf der Schwelle spielten, huschten ins Haus zurück, denn keiner hatte Lust, sich am nächsten Tag in der Zeitung wiederzubegegnen oder gar im Radio.
Übrigens fiel dem Mann diese anhaltende Scheu der Bewohner gar nicht auf. Er machte es seinen Heimatgefährten nämlich gar nicht schwer, eine solche Entfernung einzuhalten. Er ließ sich nicht in der Kirche sehen und schon gar nicht in den beiden Gasthäusern des Ortes.
Er hatte zwar, als das Haus stand, beim Arzt und beim Pfarrer und beim Lehrer – in dieser Reihenfolge – Besuch gemacht, er war an drei Sonntagnachmittagen in je einer Stube gesessen, aber er hatte mehr gefragt, als dass er sich hätte ausfragen lassen. Selbst die Lehrersgattin, die die Frauen des Ortes als bestallte Leiterin der Frauenschar anführte bei allen kirchlichen Feiern, und die die zu einem solchen Amt nötigen Tugenden der Beharrlichkeit und des Durchdringungsvermögens in hohen Graden an sich ausgebildet hatte, auch sie versuchte nicht, mit listig verkleideten Wohers und Wozus den Zaun des Nichteinmalgehörthabens beim Besucher zu durchschlüpfen – und wenn sogar die Lehrersfrau nichts ausrichtete in der Erlangung diskreter Lebensdaten, gaben die schwerfälligeren Dörfler von vornherein jeden Versuch dazu auf.
So lebte der Mann ruhig in seinem Haus. Es kamen vom Dorf Leute, die ihm die Handarbeiten besorgten: die alte Rosa, die lange Pfarrersköchin in der kleinen Stadt am Fluss gewesen war, besorgte die Speisen, und ihre Großnichte, die Mitzi, hielt die Räume sauber; und wenn der zweite Sohn des Karrerbauern nicht gar zu dringend auf den väterlichen Feldern gebraucht wurde, sah man ihn im Garten des Zugezogenen werkeln, und der Mann stand daneben und gab kurze Anweisungen, wie mit den fremdländischen Pflanzen verfahren werden sollte; am späten Nachmittag zogen diese drei Leute ins Dorf zurück, und der Mann ging daheim in seinem Garten auf und ab.
Dieser Anton vom Karrer holte so alle vierzehn Tage das Auto des Mannes aus der gemauerten Garage und führte den Fremden in die Hauptstadt. Er ließ ihn dort vor einem großen Haus aussteigen, einem herrschaftlichen, das der Anton aber nicht gut instand gehalten befand, fuhr wieder ins Dorf heim, und nach zwei Tagen oder nach dreien machte Anton die Fahrt ein zweites Mal und kehrte mit dem Herrn zurück. Und mit der Zeit empfanden die Dörfler, wenn sie am Abend vor ihren Häusern in der letzten Sonne saßen und im schönen Garten eine Gestalt sahen, eine friedliche Genugtuung, dass nun ihr Fremder wieder zurückgekehrt war.
So gingen ein, zwei Jahre hin. Der Mann blieb im Ort, er ging nicht Schifahren im Winter und hielt auch die Sommermonate in seinem Wohnsitz aus, wo freilich unter den mächtigen Kugeln der beiden Linden immer ein von einem Lufthauch durchwehter Schatten lag.
Im dritten Sommer nahm der Herr eine neue Bedienstete ins Haus. Es war die Maria vom Unterkarrer. Von ihr war nicht viel zu sagen: Als Jüngste hatte sie still bei den Eltern, und nach deren Tod beim ältesten Bruder gelebt, Hand angelegt, wo es sein musste, auf dem Hof, und auf die beiden Kinder des Bruders gesehen. Wenn man genau zurückdachte, hatte es einmal einen Burschen gegeben, der an den Abenden vor der Bank gestanden war, auf der die Maria saß, und vor langen Jahren war auch der Nachbarssohn auf seinem Moped oft am Unterkarrer-Hof vorbeigefahren, öfter, als es hätte sein müssen. Aber das war auch schon wieder eine Zeit her, und im Dorf hatten sich alle daran gewöhnt, dass die Maria eine Stille war und es auf ihre Weise haben wollte.
Diese Maria nahm der Mann also auf. Man wusste nicht, wo er die Frau bemerkt hatte auf seinen wenigen Gängen. Sie war nun im Haus und im Garten, und weil die Arbeiten, die täglich anfielen, schon alle ihre Hand trugen, blieb für Maria nichts, was jeden Tag auf sie gewartet hätte. Sie nähte einmal Vorhänge, sie staubte ein anderes Mal die vielen Bücher ab, wobei sie ein jedes in die Hand nahm und am offenen Fenster sorgfältig gegen die andere Handfläche schlug, und nachher hörte man den Herrn laut schelten, dass einige Bände dabei auf den falschen Platz gerutscht seien. Maria stand auch dabei, wenn Anton zu den Gärtnerarbeiten angeleitet wurde; und wie der Herr früher mit seinem Stock auf eine Pflanze gedeutet hatte, und Anton hatte sich gebückt, hatte das bisschen Grün zwischen zwei braune Finger genommen und in das vorbereitete Loch gesteckt, so bückte sich nun Maria, wenn der Herr deutete, und reichte Anton das Pflänzchen hin.
Maria trug auch das Essen auf; eines Tages saß sie am unteren Tischende, weit weg vom Hausherrn, und richtete ihm den gebratenen Fisch zurecht, wie er es ihr ansagte, und langsam, langsam kam es, dass sie dem Mann den Kaffee einschenkte, das Essen auf die Teller vorlegte, und dann, dass sie mit ihm aß und ein wenig später auch seine Kammer teilte. Das ging so allmählich und leise dahin, dass die Leute im Dorf es übersahen und gar nichts darüber zu reden wussten, so sehr sie auch in der Eintönigkeit ihres Lebens auf jedes neue Ereignis lauerten.
Nun war aber der Mann mit seiner Mitbewohnerin gar nicht zufrieden. Bei den Mahlzeiten musste er, kaum war sie geräuschlos auf ihren Platz dem seinen gegenüber geglitten, vom ersten Löffel an sehr vieles aussetzen. Sie streckte zum Beispiel die Ellbogen weit weg und sie beugte, so oft er ihrs auch gesagt hatte, den Kopf bis fast in den Teller hinein. Wenn Leute kamen, Handwerker etwa oder der Briefträger, so war es wie verhext: einmal schmetterte sie ihnen ihren Gruß entgegen, als hätte sie keinen Anstand im Leibe, und das nächste Mal wisperte dieselbe Maria so leise, als wäre sie noch das kleine Volksschulmädel, das gleich vor Verlegenheit den Daumen oder gar das Zopfende in den Mund steckt. Und die Nächte! Es gab geradezu Kämpfe um die eine große Decke, die der Herr zum Andenken an seine Auslandsjahre in seinem breiten Bett zu verwenden pflegte, und wie oft erwachte er nicht davon, dass seine Bettgefährtin vor sich hin schnarchte – wenn ihr nicht noch menschlichere Laute entkamen –, dann musste sie der Mann natürlich wachrütteln, und während sie ihn noch um Verzeihung bat, drehte sie sich auf die andere Seite und war schon wieder eingeschlafen, während der Herr, hellwach jetzt, vor sich hinsah ins erste Dämmern und seine Decke vor dem nächsten Angriff bewachen musste.
Es war natürlich, dass dieser Ärger auch auf die Vormittagsarbeit abfärbte. Als es noch keine Maria gegeben hatte, war es dem Mann, als seien die Sätze doch viel leichter und runder aus seiner Feder gerollt. Und Besserungen konnte man beim besten Willen an dieser Frau nicht feststellen. Es schien zwar, als ob die Hausgenossin sich zusammennehme, um das Rechte richtig zu tun, aber je krampfhafter sie sich zu zwingen versuchte, umso mehr ging ihr daneben und umso eher Anlass zum Schimpfen fand der Mann.
Und dann war Maria weg. Sie war verschwunden. Als der Mann sich an einem sonnigen Junimorgen – war wirklich ein volles Jahr vergangen seit dem Einzug des Mädchens? – zum Frühstück setzte, blieb der Platz ihm gegenüber leer. Sie konnte nicht weit sein, eben hatte er sie ja noch im Badezimmer laut plätschern und leise singen hören, er hatte an die Tür geklopft und sie ermahnt, leiser zu sein, da seine Vormittagsarbeit in eineinhalb Stunden beginne und er seine schon zusammengefassten Gedanken sich nicht mehr zerstreuen lassen könne.
Nun – Maria war fort. Es fehlte nichts von ihren Dingen, und als der Herr am Nachmittag ganz gelassen zum Hause ihres Bruders hinüberging, sah ihn der zwar sonderbar an, schüttelte aber nur den Kopf und sagte, die Schwester sei nicht hier. Und das war alles.
Das Leben im Hause des Mannes ging weiter. Die alte Rosa buk und kochte aus Leibeskräften und mit aller Freude ihres alten Herzens, der Anton goss die Blumen, und das junge Ding putzte die Fenster und bediente den Staubsauger. Und der Herr saß vor seinem Schreibtisch und hielt die Feder in der Hand. Nach zwei Tagen warf er die Feder weg, stand rasch von seinem Schreibtisch auf, der Sessel fuhr nur so zurück, und ging geradenwegs zur Lehrerin. Aber die zuckte die Achseln und hatte nicht gehört, wo Maria geblieben war. Und nachher ging der Herr zum Krämer, der gerade einen neuen Selbstbedienungsladen gebaut hatte. Auf diese Idee war der Herr sehr stolz gewesen. Jetzt kaufte er zwei Kerzen, wenn vielleicht die Elektrizität zusammenbräche, wenn jetzt die schweren Gewitter kämen, und dann sah er sich um und kaufte geistesabwesend fünf Schnüre Kaugummikugeln, die bei der Kassa baumelten, und während er das Kleingeld in der Börse zusammensuchte, fragte er nach den auswärtigen Arbeitern, es führen doch so viele in die Fabrik hinüber, und er wollte gerade fragen, ob sie dort auch Frauen beschäftigten, aber da hob er die Augen und sah in die lachenden des alten Krämers, da ging er. Aber als er schon die Tür aufstieß, rief ihm der Alte nach, seine Enkelin habe neulich die Maria in der neuen Seepension gesehen, am See sei ja jetzt schon Saison, da brauchten die jemand zum Geschirrwaschen, die Maschinen kämen da gar nicht nach. Der Mann ärgerte sich, denn die Sätze hatten mitleidig geklungen.
Aber am nächsten Tag ließ er Anton doch mit dem Auto vorfahren, und er machte eine Spazierfahrt zum blitzenden See, auf dem die Ruderboote durch die Sonne glitten. Er hieß Anton sich ein Bier kaufen und setzte sich selber unter die funkelnagelneuen Sonnenschirme auf der Seeterrasse, er trank seinen Kaffee aus und ging nach hinten, und als er an der Küche vorüberkam, stieß er die Tür auf, da hob sich hinten ein Kopf, der über der Abwasch hing, und grinsend sah ihn eine alte Frau an, als sei er der heilige Nikolaus.
Der Mann setzte sich ins Auto, aber dann stieg er noch einmal aus und ging zurück ins Haus, er traf auch gleich den Wirt und fragte rasch nach Maria. Der Wirt war sehr unwirsch und sagte, in der Hauptsaison wegzurennen, das sei keine Art, die Damen müssten halt früher nachdenken, ob sie sich für gewisse Arbeiten nicht zu gut seien, und er glaube gern, dass man drüben beim Fleischhauer jeden Tag Schnitzel am Teller habe – das sei ja etwas, und sonst gäbe es drüben noch allerhand als Draufgabe, haha. Aber da war der Mann schon bei der Tür draußen, ging über die Straße und läutete bei der schmiedeeisenberankten Tür, die Eintritt zur Fleischhauerwohnung gab. Es kam auch ein nasebohrender Bub, und während der die Mutter holen ging, stieg in dem Mann ein heftiger Zorn auf gegen seine frühere Hausgenossin. Sie war schuld, dass er hier zwischen schmiedeeisernen Wandleuchten und einer grünblauen Muttergottes stand und wartete. Die Fleischhauerin war mager und bissig: Man habe die Frau natürlich nicht behalten können. Sie sei abends um acht Uhr aus der Küche gegangen und habe nur gesagt, morgen werde sie den Boden aufreiben. Der Mann stand und sah vor sich nieder, so war es erträglich, und hörte, dass da noch etwas gewesen sei, worüber man nicht sprechen wolle, aber das würde er ja auch wissen, wenn keine Ruhe sei zwischen einem Dienstmädchen und dem Mann, dann habe immer das Mädchen die Schuld. Die Männer seien anlassig, dass sich die Männer aufgeilen lassen, weiß ja ein jedes. Der Mann stieg ins Auto und ließ sich heimfahren.
Es verging ein Tag nach dem anderen. Der Mann setzte sich gar nicht zum Schreibtisch. Er ging in seinem Garten herum und immer öfter auch durch die Felder, bis hin zum Forst, und wenn einer ihn grüßte, dankte er höflich und immer im gleichen Tonfall, ob der Grüßende nun ein Mann war oder ein kleines Kind.
Es war schon später September, als der Mann wieder wegfuhr. Er holte das Auto selber aus der Garage, und die Dörfler sahen ihn langsam die Straße hinunterfahren. Er hielt sich viel mehr gegen die Straßenmitte als sein Fahrer, der Anton. Der Mann fuhr in die Industriestadt. Vor der Textilfabrik, ein Stück weit vom eisernen Tor, parkte er das Auto. Dann stellte er sich unter einen staubigen Kastanienbaum, in den tiefsten Schatten, obwohl die Sonne jetzt schon recht schwach schien. Von dort beobachtete er fortwährend das Fabriktor. Erst geschah nicht viel, einige Lastautos fuhren hinein, zwei Autos kamen flink heraus, dann nichts, und dann ergossen sich Ströme von Menschen auf die Straße. Zuerst kamen einige eilige Frauen, dann Grüppchen von ganz jungen Mädchen. Sie schlenkerten mit den Beinen und riefen übermütig hin und her. Der Mann sah ihnen nach, und für einige Augenblicke hatte er vergessen, warum er hier stand. Es kamen weniger Menschen, einige ernste Männer, vielleicht die Buchhalter, und dann war Maria da.
Sie kam auf ihn zu, der unter dem Baum stand; sie war vielleicht ein bisschen blasser, als sie daheim gewesen war, und sie hatte zu ihrem grauen Rock eine braune Jacke an, die er unbeschreiblich hässlich fand. Sie sah nicht traurig aus und nicht froh, auch nicht müde. Dann erblickte sie ihn. Sie blieb stehen und wartete. Der Mann machte die zwei Schritte, die nötig waren, er sagte: »Komm mit. Das Auto steht an der Ecke.« Maria stand und sah ihn an. Ihm war das fremd: sie hatte noch nie so geradewegs in seine Augen geschaut. Dann senkte sie den Blick und ging mit ihm. Wie es sich gegeben hatte, wenn sie miteinander gingen, blieb Maria auch jetzt einen winzigen Schritt zurück. Es war aber etwas anders. Er hätte das andere nicht zu benennen gewusst; wenn er aber darauf geachtet hätte, hätte er vielleicht bemerkt, dass Maria nicht wie sonst mit ihren raschen kleinen Schritten hinter ihm her eilte: sie war in seinen Schritt gefallen.
Er holte den Autoschlüssel aus der Tasche und sperrte auf, warf sich auf den Fahrersitz und stieß die Tür auf Marias Seite auf. Die Frau glitt hinein. Der Mann drehte den Startschlüssel, der Motor sprang an, und während er vom ersten Gang in den zweiten schaltete und sich ärgerte, weil es dabei krachte, während es bei Anton immer geräuschlos ging, dachte er dort hinten, wo man keine Sätze braucht, dass nun also alles so weitergehen werde: die schlürfende Frau mit der Kaffeeschale ihm gegenüber, Nacht für Nacht der Kampf um die Decke. Die Zeit der Liebe, seiner Traumgefährtin, war für immer vorbei.
Voll Ärger sagte er: »Du hättest mich auch erinnern können, dass wir dein Zeug jetzt gleich mitnehmen – so muss der Bursche morgen deswegen nochmals fahren.« Sie sagte: »Ja, Rudolf.« Er sah sie groß an. Denn es war das erste Mal gewesen, dass die Frau ihn bei seinem Namen genannt hatte.
Ich komm, weiß nicht, woher
»Ich komm, weiß nicht, woher,
Ich leb, weiß nicht, wie lang,
Ich geh, weiß nicht, wohin –
Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.«
Diesen Spruch las das junge Kindermädchen des Dr. Praxmarer, Arzt in Kirchbach, während sie den Kinderwagen auf- und abwippen ließ, damit das Baby nicht vorzeitig aufwachte. Fast täglich war sie bei ihren Vormittagsausfahrten an dem kleinen Haus am Waldrand vorbeigekommen, heute aber hatte sie zum ersten Mal die Schrift unter seinem Giebel bemerkt. Sie las den Spruch noch einmal und dann langsamer noch einmal seinen letzten Satz. Es schien ihr, dass sie die Sätze nicht verstand. Sie schob den Kinderwagen weiter, in dem das Baby, mit erhobenen Fäusten schlafend, lag, bis zu der Kurve, wo sich der Waldschatten über die Straße legte, und dort kehrte sie um, wie an jedem Tag.
Das Kindermädchen Ella stammte nicht aus Tirol; sie war erst neulich hierhergekommen. Ihre Kindheit hatte sie in Wien verlebt, auf eine gewöhnliche Weise. Ihre Erinnerung war angefüllt mit viel Dämmrigem: die dunkle Ecke des Schlafzimmers, wo ihr Schemel stand, und auf dem braunen Linoleumboden lagen ihre abgefingerten Spielsachen, schattendunkle Hernalser Straßen, durch die dunklere rasche Schatten glitten, der Vater, die Mutter, wie sie stumm am Küchentisch einander gegenüber saßen, jedes müde von seiner Arbeit, und wenn sie weitergegangen war durch die Gassen, immer weiter in den Tunnel, auf einmal aufgerissen die Leere eines Runds, gellend klingelten die brandroten Straßenbahnen, wenn sie vorbeisausten, von oben manchmal eine dröhnende Stimme vor dem Meer unverständlicher Laute. Die Menschenströme stürzten vorüber, und es hätte sie fast von der Hand der Mutter gerissen.
Aber dann gab es einmal eine lustige Buntheit, das war im Prater. Musik kam von überallher, erst schoss der Vater der Mutter eine Rose und lachte, dann drückte er das Gewehr an ihre Wange, sie hatte Angst, aber da hatte schon etwas in ihr abgedrückt, und dann reichte ihr schon der Bursch mit den Gewehren augenzwinkernd den Preis: ein Zelluloidpüppchen, das sie sehr lange immer bei sich trug. Dann beim Ringelspielfahren saß sie nicht auf dem Pferd, sie saß geborgen in der hellgrünen Kutsche, goldene Zügel in der Hand, vor ihr lief ein weißer Eisbär im Kreis und die Musik spielte im Takt zu seinem Trab. Es macht nichts, dass die Musik jetzt aufhört und sie aussteigen muss, denn der Vater nimmt sie fest an der Hand, und drüben hat sich die Mutter eingehängt, damit sie nicht einer dem andern verloren gehen unter den anderen Lustigen, und sie gehen zu den fliegenden Töpfen, sie fährt allein und hat keine Angst, wirklich nicht, sie fliegt und fliegt höher, und ihre Schuhspitzen stoßen Löcher in den blauen Himmel, und unten stehn die beiden, der Vater, die Mutter, sie schauen zu ihr herauf, sie lacht und schreit und möchte winken, aber sie muss sich anhalten, und wie sie wieder landet, ziehen sie weiter, und sie sind alle müde, da essen sie Bratäpfel und Zuckeräpfel. Bei der Luftballonfrau wird sie wieder ganz munter: Wird ihr der Vater den großen kaufen? Er kauft nicht den großen, aber doch einen roten, der hängt in der nächsten Frühe noch über ihrem Bett, aber als sie am Abend vom Hort heimkommt, liegt er schrumplig am Boden.
Im nächsten Frühling sollen sie wieder in den Prater gehen, aber sie war beim Mittagessen ungeduldig und ausgelassen gewesen, sie hatte das Bierglas des Vaters umgestoßen, und als sie es noch erwischen wollte, stieß sie so heftig an die Suppenschüssel an, dass die Grießnockerl nur so über den Tisch sprangen. Da hatte der Vater gezischt, dass es nichts mit dem Prater sei, und hatte sich zu seinem Mittagsschlaf aufs Sofa zurückgezogen wie an jedem Sonntag; und sie hatte der Mutter die Teller abgetrocknet wie an jedem Sonntagmittag.
Später war sie gern in die Schule gegangen. Dort gab es viel Abwechslung. Am liebsten hatte sie die Religionsstunden. Eine Klosterschwester kam und erzählte ihnen. Am schönsten waren die Geschichten vom Himmel. In der Kirche schloss sie die Augen und spürte, wie das Jesuskind in ihr Herz kam. Oft saß sie daheim, ohne sich zu regen, und sah auf die Bildchen, die ihr die Schwester fürs Bravsein geschenkt hatte; besonders liebte sie das mit der blonden Heiligen, die blauen Augen schlug sie zum Himmel auf und breitete ihre schönen Gewänder, und vom Himmel fielen Rosen auf sie herab. Dann versank das alles; und sie konnte geläufig die sieben Gaben des Heiligen Geistes aufzählen oder die Kirchengebote.
In ihre Klasse ging zwei, drei Jahre lang ein ausländisches Mädchen, vielleicht war es eine Italienerin. Die sprach recht gut Deutsch, aber trotzdem war sie anders, denn sie war viel behänder als die anderen Kinder, und Weinen und Lachen kamen ihr leichter. Einmal hatte sie diese Kameradin gesehen, als sie durch den Park musste, um die Milch zu holen. Da war die Fremde unter den kleinen Mädchen, die sich die Striche fürs Tempelhüpfen weiß auf den Asphalt gezeichnet hatten, und die Fremde sprang geschickt und mit flinken Drehungen alle Figuren durch, die sie selbst vom Zuschauen schon lange kannte, und lachte ihr völliges Lachen, und ihre kleinen Brüste unter dem Leiberl sprangen noch öfter als sie. »Du, lass mich auch einmal probieren«, sagte sie da und stellte die Milchkanne hin. Sie sprang und sie drehte sich. Sie machte es ganz richtig, sie war auf keinen Kreidestrich getreten, aber nach einigen Sprüngen blieb sie schon stehen, irgendetwas stimmte nicht, sie sollte doch jetzt hochfliegen wie ein Ball. Sie versuchte noch, laut zu lachen, so wie die andere, mit offenem Mund und den Kopf zurückgeworfen, aber gleich verstummte sie, als hätte sie einen Schlag bekommen. Sie nahm ihre Milchkanne wieder auf und ging mit gesenktem Kopf leise davon. Hinter ihr waren keine Rufe und kein Gelächter, das wunderte sie.
Dann ging eben alles weiter. Sie kam aus der Schule und sie wurde Verkaufslehrling in einem Schuhgeschäft. Sie tat ihre Arbeit. An Montagen und Dienstagen kamen wenig Kunden, dann standen die Verkäuferinnen herum, und sie hörte zu, was sie vom Kino erzählten oder vom Schwimmengehn, und sie kämmte sich vor dem Klosettspiegel dreimal am Nachmittag die Haare anders. Gegen das Wochenende war dann viel zu tun. An den Samstagnachmittagen ging sie selber ins Kino und an den Sonntagnachmittagen auch, obwohl die Eltern dann schimpften, oder sie ging mit einer Freundin spazieren, die Hernalser Hauptstraße auf und ab in der neuen grünen Hose, und dann noch auf ein Eis. Um sieben Uhr abends musste sie wieder zu Hause sein, die Mutter sagte, wenn sie erst achtzehn sei, werde man weitersehen. Dann würde sie in die Diskothek gehen dürfen, aber es würde dann auch nicht viel anders sein mit den Wochentagen und mit ihren Wochenenden, das wusste sie genau. Jetzt schon durfte sie an manchen Nachmittagen mit einer Gruppe von Burschen und Mädchen in den Prater gehen. Sie fuhr dann in der Hochschaubahn und mit den Go-Karts, solang das Taschengeld eben reichte, das ihr die Eltern ließen; sie kreischte mit den andern um die Wette, wenn die Wägelchen sich ins Tal stürzten, und sie schrie, wenn sie im Topf des alten Karussels höher und höher flog; aber was wurde davon anders? Diese Freude, die sie damals als Kind geschmeckt hatte, war es nicht mehr. Es ging ja doch alles weiter in seinem Geleise.
Der Durchbruch zu dieser Freude, deren äußere Bezirke sie als Kind manchmal betreten hatte, auf die sie immer wartete, ohne es zu wissen, gelang erst später. Aber nein, so war es ja nicht: nicht sie hatte tun müssen, es war die Freude selbst, die zu ihr durchstieß.
Es hatte ganz alltäglich angefangen, ununterschieden von den anderen Gelegenheiten, war diese Einladung zu einer Geburtstagsfeier gekommen, die dieses Mal die eben achtzehnjährige Anneliese gab. Sie war hingegangen, und die Eltern hatten sie ohne viele Worte ziehen lassen, in der gewohnten Mischung von Ängstlichkeit und halbhoffender heimlicher Erwartung, die beide auf den gleichen Punkt gerichtet waren, vor dem auch sie in ihren Träumen und Gedanken eine unübersteigbare Mauer aufgerichtet hatte.
Bei der Feier war alles ein klein wenig anders gelaufen als sonst: Die Eltern der Anneliese hatten den Jungen das kleine Siedlungshaus nicht nur für die Dauer eines Kinobesuchs überlassen, sie hatten rasch nach Graz zu einer sterbenden Tante reisen müssen. Und unter den Burschen gab es einige fremde Gesichter, solche, auf denen Erfahrungen geschrieben standen, die hier noch keine kannte. Es waren neue Tänze getanzt worden, und die fremden drei Burschen hatten Whisky mitgebracht und Gin, den sie den Mädchen in die Orangeade gossen, und die Mädchen wurden dazu ermuntert, das fremde Getränk in den Wasserbechern auf einen Schluck hinunterzugießen.
Die Spiele hatten mit dem Polsterltanz begonnen, da war sie noch, ängstlich kichernd, in einem Winkel gesessen und hatte sich auch immer wieder in ihre Ecke zurückgezogen, wenn sie wirklich einmal von einem der alten Schulkollegen zum Tanzen und Küssen geholt worden war. Im Halbdunkel hatte man eine Weile engumschlungen getanzt, so, wie es die Neuen taten. Dann hatte ein wildes Versteckenspielen begonnen, einer hatte die Zuschauende am Handgelenk gepackt, da halfen die Finger nicht, die sich an die Sessellehne klammerten, heraus aus der Stube, durch die Küche ins kleine Bad, und der Schlüssel wurde umgedreht, dann war das Licht auf einmal ausgegangen, überall kreischte es im Dunklen, und leise leise wieder hinaus aus dem Bad, die Hand zog, und über die Stiegen hinauf, die zu den beiden Schlafzimmern im engen Dachgeschoß führten. Das war lustig, das Lachen löste sich von irgendwo, wo es eingesperrt gewartet hatte. Der fremde Bursch kam ganz nah und legte ihr die heiße Hand auf den offenen Mund. »Uns zwei kriegen sie nicht«, zischte es ihr ins Ohr. Sie lachte und schwankte, sie musste betrunken sein, sie lachte und duldete es, dass er sie um die Hüfte nahm. Die Hand zog sie weiter. Danach geschah alles in rasender Schnelligkeit. In der Finsternis polterten zwei von unten die Stiege herauf. Oben horchten sie, eng aneinandergedrückt in einer Nische, auf das Trampeln und Stolpern, das näher kam. Der Körper neben dem ihren wand sich nach allen Seiten, auf einmal gab eine Tür nach, die abgestandene Luft eines engen Raumes schlug ihnen entgegen. Sie wurde mehr hineingehoben als gestoßen, ganz leise drehte sich ein Schlüssel, die heiße Hand war wieder auf ihrem Gesicht, ein Mund an ihrem Ohr, ein heißes Lispeln, das sie nicht verstand. Er zog sie hinunter, sie knieten nebeneinander vorm Schlüsselloch, und Wange an Wange versuchten sie hinauszuspähen, mit angehaltenem Atem, wo doch nichts war als Finsternis und die tappenden Schritte. Draußen kratzte es an den Wänden, eine Klinke wurde irgendwo niedergedrückt, zwei beklommene Stimmen ganz nah, und dann polterte es wieder die Stiegen hinunter. Jetzt hörte man nichts als von weit weg den Beat. Vielleicht hätte sie jetzt die Angst gepackt, als sie da auf dem Boden lag, in irgendetwas Fetzigem, es roch muffig, und seine Hände waren überall, aber dann war das alles versunken, und sie ritten dahin, im Takt des Liedes, dessen Versprechen sie hundertmal gehört hatte an den Spätnachmittagen daheim in der trüben Küche, und schon nicht mehr geglaubt hatte sie ihm, aber jetzt ritten sie beide dahin zu dieser Musik und lachten dabei, bis ihr das Lachen verging und gleich drauf auch ihm, und nichts war da als ein furchtbarer Schmerz, aber dann war es doch die glühendste Freude. Sie war dort, wo sie immer hatte sein wollen. Sie lag neben ihm, der noch immer manchmal lachte, in leisen Stößen, und sie dachte: Ich habe ja gewusst, dass es das gibt. Er hatte sich von ihr weggedreht, ein wenig nur, aber er wendete sich jetzt schon wieder zu ihr und gab ihr, leise lachend, viele Küsse, die sie ebenso lachend erwiderte. Dann lagen sie nebeneinander, eins im Arm des andern, und das war wohl das Schönste, so ruhig zu liegen, während die Freude, diese glühende Sonne, allmählich auseinanderfloss und alles mit lichter Wärme erfüllte. Es war gut so.
Sie gingen später getrennt in die wieder erleuchtete Stube hinunter, wo das wilde Fest müde geworden war, die anderen saßen mit trüben Gesichtern und starrten vor sich nieder, während sich noch immer die gleiche Platte auf dem Plattenteller drehte, und nur manchmal trank einer von den Burschen mit Anstrengung noch einen Schluck. Vielleicht hatten die nichts bemerkt?
Sie ging dann nach Hause, auf der Straße sang sie leise ihr Lied, sie schlich in die Wohnung, schliefen die Eltern fest?, sie wusch sich ganz leise, und dann lag sie lange wach und sah vor sich hin, in einen hellen Himmel, obwohl ihre Kammer dunkel war und sich nur manchmal auf Sekunden erhellte, wenn noch ein Auto durch die kleine Gasse fuhr.
Am nächsten Morgen schimpften die beiden Alten, dass es so spät geworden war gestern, sie sagte nichts und rührte im Kaffee und gab sich gar keine Mühe, zu sein wie an jedem trübseligen Morgen, es war ja jetzt alles anders. Wenn die Eltern sich besser miteinander verstanden hätten, hätten die beiden jetzt miteinander einen Blick getauscht.
Sie aber wartete. Sie sagte sich gar nicht vor, worauf sie wartete. Die Tür stand ja jetzt offen. Sie ging ins Geschäft, wo sie seit zweieinhalb Jahren Schuhe verkaufte. Der Tag war langsam, es kamen nur wenige Kunden; so konnte sie weiter warten. Sie war so eingehüllt in die eine Stunde, in der alles beschlossen war, was jetzt kommen konnte, dass sie gar nicht bedachte, was ihr geschehen war. Sie war ja verwandelt, endlich zurückverwandelt, und das genügte. Als sie am Abend aus dem Geschäft trat, sah sie sich um, aber es stand keiner da. Jetzt begann sie mühsam zu denken. Wie hätte er auch da stehen können, der doch nur ihren Taufnahmen wusste – es sei denn, er hätte noch nach ihren Umständen bei den andren gefragt. Sie war aber jetzt zu müde, um über solche Möglichkeiten zu grübeln. Sie ging nach Hause. Auch da war nichts. Der Vater würde in einer Stunde kommen und gleich darauf die Mutter. In der gewohnten Umgebung fiel das Warten von ihr ab. Die Mutter fand keinen Grund mehr, sich zu verwundern an diesem Abend.
Auch in den nächsten Tagen geschah nichts und auch nichts in den folgenden Wochen. Am zweiten Sonntag danach war sie mit Anneliese im Kino gewesen, als sie nachher heimgingen, hatte sie die Freundin beiläufig nach den drei fremden Burschen gefragt, die auf der Party so wild getan hätten. Anneliese hatte sie von der Seite angeschaut und gesagt, die drei gehörten zu einem Kabellegertrupp, die seien heute da und morgen dort, und natürlich wüsste sie gar nichts weiter von ihnen.
Aber viel später erst war der Hoffnungsfunke erloschen. Auch damals dachte sie nicht, weder vor noch zurück, es war aber eben so, dass jeder Tag und jede Stunde eine neue Decke auf die kleine Sonne tief in ihr legte. Es war wieder so, wie es jetzt immer sein würde, dreißig Jahre oder vierzig oder fünfzig. Sie sah den Vater an und die Mutter und wusste es. Sie stand jeden Morgen auf, sie aß die Semmel und trank den Kaffee, den ihr die Mutter hinstellte, und ging ins Geschäft. Sie kam abends heim, sie saß vorm Fernseher oder ging mit ihren Bekannten ins Kino. Die Mutter sah sie immer öfter von der Seite an, später auch der Vater. Es war ihr gleichgültig. Der Vater ging jetzt regelmäßiger in seinen Verein und nahm sie immer mit. Die Mutter, die sonst nörgelte bei solchen Anlässen, weil sie zu müde war für alle Unterhaltungen, zog sich jetzt schweigend um und ging mit. Wenn im Verein getanzt wurde und einer sie holte, tanzte die Tochter, wie sie auch früher getanzt hatte, sie ließ sich zum Tisch zurückführen und ging gehorsam mit, wenn ein anderer Tänzer kam. Einladungen von fremden Burschen zum Kegeln oder ins Kino beachtete sie nicht.
Die Tage gingen. Die Eltern sahen, dass sie abmagerte. In den Nächten konnten sie hören, dass sich die Tochter schlaflos im Bett herumwarf. Sie schickten sie zum Arzt. Am Tag darauf ging die Mutter zu ihm und hörte sich seine Ratschläge an. Dann hatten die Eltern begonnen, von einem langen Urlaub zu sprechen, sie hatte sich alles angehört und keine Wünsche nach dem Wie und dem Wohin zu äußern gewusst, als die Eltern sie drängten. Es hatte sich aber dann eine bessere Gelegenheit gefunden: Es hatte der Mutter eine Arbeitskollegin von dem Tiroler Arzt erzählt, der ein verlässliches Kindermädchen suchte. Die Mutter erinnerte sie, wie sie früher ihre Freundinnen um die kleinen Geschwister beneidet hatte. Aber ja, sie wollte es also versuchen. In der Auslage eines Reisebüros ließ sie sich ein buntes Plakat zeigen: Berggipfel hinten und tanzende Trachtenpaare vorne und dazwischen einige lachende Sommerfrischler.
Das Bild säte Erwartungen, nebelleichte, die sich zu einer kleinen Neugier verdichteten, als sie endlich im Zug saß, und der Zug glitt vorbei an raschen Flüssen und winkenden Kirchtürmen, und einmal grüßten auch Kinder aus einem Auto herüber. Als sie dann in Kirchbach ankam, hatte sie bald das Gefühl, dass die Eltern etwas verwechselt haben mussten.
Niemand trug bunte Trachten, nicht einmal an den Sonntagen. Im Herbst jetzt lag der Ort von den Sommerfrischlern verlassen als Mumie zwischen den leeren Feldern, vor den struppigen Waldhügeln. Übrigens stand das Haus des Doktors ein bisschen abseits, in einer Industriesiedlung, sein neues Haus im mauerumschlossenen Garten zwischen den anderen zaunumschränkten Siedlungshäusern, deren Bewohner sie manchmal in den Beeten graben sah. Sie grüßte und wurde gegrüßt und kannte keinen.
Ihre Arbeit tat sie gewissenhaft, die Doktorin war mit ihr zufrieden. Das neue Kindermädchen hielt die Dreijährige sauber und ließ das lebhafte Kind bei seinen Spielen nicht aus den Augen. Vielleicht wäre es besser für die Kleine gewesen, wenn die Neue mit ihr ein wenig herumgetobt hätte, aber man konnte nicht alles haben, dafür lernte das Kind von der Neuen keine verrückten Schlager. Nach zwei Wochen konnte die Doktorsfrau auch das Baby unbesorgt in die Obhut von Ella geben. Und bei den Mahlzeiten konnte die Herrschaft sich ruhig über Patienten und Sonntagspläne unterhalten, man konnte sicher sein, dass das Mädchen nicht vorlaut dazwischenredete wie seine Vorgängerin, es saß stumm und schob der Kleinen Löffel um Löffel in den Mund, und aß dazwischen vom eigenen Teller.
An den freien Nachmittagen ging Ella auch hier ins Kino; sie ging meist allein, und manchmal auch mit dem alten Dienstmädchen. Bevor der Film anfing, stand sie vorm Kinoeingang und sah hinüber zu den Gruppen der schwatzenden Jugend, deren Dialekt sie nicht verstand, und der eine oder andere sah neugierig zu ihr herüber. Manchmal versuchte auch die Doktorsfrau das Mädchen in ein Gespräch zu ziehen, über den letzten Film oder über sein Zuhause; da sie aber immer einsilbige Antworten auf diese Bemühung zurückbekam, ließ sie’s bald sein. – Das Mädchen zog jeden Tag die beiden Kinder an, es fütterte sie und badete sie und fuhr mit dem Kinderwagen auf der Straße dem Wald zu und wieder zurück; es ging manchmal ins Kino und saß jeden Abend vor dem Fernsehapparat, bevor es in sein Zimmer ging. Die Fernsehspiele und die Kinofilme sah sie sich an, damit die Stunden vergingen; es waren Nachrichten aus einer bunten und bewegten Welt, die nicht ihre war.
Am kommenden Wochenende war Kirtag im Marktflecken. Die Doktorsfrau sagte dem Mädchen, dass es mitfahren könne; es würde dort Standel geben mit billigen Pullovern und mit Schuhen, und allerlei Krimskrams, und natürlich auch solche mit Lebzeltherzen und Türkischem Honig, und eine Schießbude. In den beiden Wirtshäusern würden die »Inntaler Buben« und die Feuerwehrkapelle aufspielen, und sie könne ja bei ihnen am Tisch sitzen, Tänzer würden sich dann schon finden. Das Mädchen nahm an, gleichgültig dankend, wie sie auch dankte, wenn ihr die Frau einen Teller mit Birnen in ihr Zimmer stellte; aber beim Mittagessen, der Doktor war noch bei einer Entbindung, fragte sie die Frau dann doch, wie es die Mädchen hier bei solchen Anlässen mit dem Anziehen hielten, und ob sie das Augen-Make-up nehmen solle, das sie von Wien fürs Ausgehen gewohnt war. Die Doktorin freute sich, dass sie die Ella ein Stück aus ihrer Höhle herausgelockt hatte; sogar die Wangen des Mädchens hatten heute ein bisschen Farbe.
Als sie am anderen Tag zu dritt ins Auto stiegen, sah Ella sehr hübsch aus, fand das Doktorpaar, die Aufregung stand ihrem ein wenig ausdruckslosen Gesicht gut. Die Feuerwehrkapelle spielte einen Tusch, als der Doktor mit seiner Frau den vollgestopften Saal des Wirtshauses betrat, man zog sie alle drei an den Honoratiorentisch, man goss ihnen Wein ein und schob ihnen riesige Backhendlportionen hin und grellrote Punschtorten und eine weißüberzogene Nusstorte, während die Musikkapelle daneben ihnen eine Polka ins Ohr schmetterte. Wenn man dem Nachbarn antworten wollte, musste man sich zu ihm beugen und schreien. Kaum hatte Ella den letzten Tortenbissen in den Mund geschoben, holte sie schon ein Tänzer; der Doktor hatte heimlich den Fleischhauersohn herangewunken. Sie tanzten in der Enge der hin- und herschiebenden Paare, es machte ihr nichts, dass viele ihr zusahen. Sie ließ sich an den Tisch zurückführen, aber da stand schon der nächste Tänzer vor ihr, und von dem holte sie ein anderer weg und dann wieder ein anderer zum Walzer. Sie tanzte in einem fort. Sie tanzte Walzer und noch einen Walzer und dann einen Beat und dann eine Polka. Sie tanzte und lachte, wie die anderen Mädchen lachten, wenn ihr Tänzer einen wilden Jodler ausstieß. Sie drehte sich, sie ließ sich hin- und herschwenken. So leicht ging das. Ihren Füßen fielen alle Figuren wieder ein. Es war ihr, als wäre das kleine Mädchen, das sie einmal war, plötzlich herangewachsen. Wenn sie wollte, konnte sie jetzt fliegen. Die Burschen rissen sich um die Fremde, sie tanzte leichter als die Dorfmädchen und doch mit bestimmten Bewegungen. Wenn ihr Partner beim Beat einige Drehfiguren mit ihr versuchte, verstand sie ihn gleich, und sie bewegte Kopf und Arme in schönen freien Linien. Selbst der junge Lehrer holte sie zum Tango, und die anderen sahen zu, wie er die Fremde weit hintenüber bog, und sie ließ sich wiegen. Erst als die Musik aufhörte, ging sie zum Doktortisch zurück, es war, als ob sie noch immer tanze. Sie trank den Wein aus, den man ihr schon wieder hingestellt hatte, und lachte mit roten Wangen, obwohl sie der alte Pfarrer nur gefragt hatte, wo sie in Wien denn daheim sei. Sie gab ausführlich Antwort und erzählte ihm aus freien Stücken, wie gern sie Porzellanmalerin geworden wäre, sie habe sich’s als Kind so schön vorgestellt, den ganzen Tag in einem ruhigen Saal zu sitzen und schöne Blumen zu malen, wie es ihre Tante tat.
Die gestärkten Musiker begannen wieder zu spielen, es war ein Marsch, und sie sah erwartungsvoll zu den anderen Tischen hinüber, wo die Burschen anfingen ihre Tänzerinnen auf den Tanzboden zu ziehen. Aber es kam keiner zu ihr, auch nicht beim nächsten Fox, und auch dann bei den Walzern nicht. Sie saß und sah mit blinden Augen in das Schieben und Drehen und hörte im Gelärme nicht mehr auf den Pfarrer, der sie gern weiterunterhalten hätte. Der Doktor sagte nachher, es hätten eben die Konservativen über die dörfliche Fortschrittspartei gesiegt; Unsinn, sagte seine Frau, es sei die überständige Tochter des Altbürgermeisters gewesen, die hätte in der Pause die Parole ausgegeben, das fremde Mädchen nicht zu beachten. Aber das ging Ella nichts mehr an. Sie saß schon wieder hinter sieben Bergen; und als der alte Schmied, der, der alle Traktoren reparieren konnte, sie aus Mitleid mit der plötzlich Isolierten zu einem langsamen Landler holte, war es, als hätte die Fremde das Tanzen auf einmal verlernt. Es ließ sich von dem schweren Mann herumschleppen und trat ihm einige Male empfindlich auf die Füße, und beide waren froh, als die Musik mit einem anderen Tanz begann und sie zum Tisch zurückkehren konnten. Dort saß dann das Mädchen, es saß zehn Minuten und dann eine ewige halbe Stunde.
Die Doktorfrau hatte zwischen Gesprächen mit dem Strumpffabrikanten und dem Schuldirektor dem allen zugesehen. Das Mädchen tat ihr leid, wie es so dasaß mit leerem Blick, seine Wangen hatten ihre Farbe verloren, und so schickte sie es nach Hause, damit es nun wieder die Aufsicht über die beiden schlafenden Kinder übernehmen solle. Das Mädchen wurde also vom Fabrikanten mitgenommen, es saß hinten in seinem großen Auto, während sich vorn der Mann und seine Frau, bald spottend, bald scheltend, lachend über den Abend unterhielten.
Sie sagte Gute Nacht und Danke und trat ins Doktorhaus; es war Licht in der Küche, da fand sie die alte Liesl überm Küchentisch eingenickt. Als die das Kindermädchen erkannte, zog sie sich schwerfällig auf und hinkte brummend in ihre Kammer. Das Mädchen sah nach den beiden Kindern, die Kleine schlief fest, aber das Baby lag mit offenen Augen und begann zu wimmern, als sie die Nachttischlampe aufdrehte. Sie wickelte es und gab ihm ein wenig warmen Kamillentee, beim zweiten Schluck war es schon wieder eingeschlafen. Im Wohnzimmer unten hörte sie die Standuhr ticken. Sie ging in ihr Zimmer hinüber.