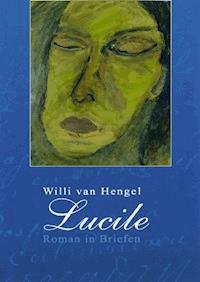3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sprache – anders. Willi van Hengel hat einen Entdeckungsroman verfasst, in dem das Ich nur anhand einer neuen Sprache zu sich findet. Nennen wir diese Sprache »neo-romantisch«. Sein Werk ist zeitlos – die Handlung könnte heute, vor zweihundert Jahren oder in zweihundert Jahren spielen. Gleichwohl ist das Thema des Romans hochaktuell, geht es doch um das, was seit Ewigkeiten die Menschen berührt: das Erleben tiefer Gefühle sowie das Leiden an einer unausgesprochenen und von daher gequälten Seele. Der Protagonist Alban erkennt auf seiner Reise ins eigene Ich den Grund seiner Bindungsängste. Er war das Schlachtfeld, auf dem die Kämpfe seiner Eltern ausgetragen wurden. Seine Eltern sind tot. Sie zur Rede stellen kann er nicht mehr. Dafür seinen besten Freund, der ihm ein abscheuliches Frauenbild eingeimpft hat – und der noch lebt. Also, was tun? Ihn, den besten Freund, töten? Dieser innere Kampf bringt Alban so weit, zu denken, dass er und sein Leben, wie er es lebt, »bloß ein Vorurteil« sei. Er wird sich seiner Vergangenheit und den damit verbundenen Erinnerungen stellen, um ein Stück von sich selbst zu Grabe (oder zu Stein, denn Alban ist Bildhauer) zu tragen. Um zu werden, was er sein könnte: ein Mensch, der aus lauter Zweifeln besteht, der nun aber beginnt, sich selbst anzunehmen – und vielleicht sogar zu lieben. Der »Wortzauberer« Willi van Hengel hat mit seiner Sprachmagie nicht nur ein einzigartiges Kunstwerk erschaffen. Sondern auch eine (Er)Findung, die in einem Finale aus Tränen endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Willi van Hengel
Dieudedet
oder
Sowas wie eine Schneeflocke
Willi van Hengel
DIEUDEDET
oder
Sowas wie eine Schneeflocke
Zwischen den Stühlen 3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juni 2022
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: Skulptur FUMANS von Simone Zewnik, 2018, Privatbesitz
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 293 5
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 906 4
Für Marizz und für Mia
»Langsam ist das Erleben aller tiefen Brunnen:
lange müssen sie warten, bis sie wissen,
was in ihre Tiefe fiel.«
Zarathustra, Von den Fliegen des Marktes
»Die glücklichen Sklaven
sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.«
Marie von Ebner-Eschenbach
1.
In einer abgedunkelten terracottafarbenen Mansarde lag Alban, unruhig träumend, auf seinem alten ausgelegenen Diwan, während der Klang der Mittagsglocken durch das geöffnete Fenster drang. Selbst die knarrenden Holzstufen der alten Eichentreppe, die einen Besuch ankündigten, ließen ihn seine Position auf der Couch, auf der er nun schon seit einigen Monaten unter derselben Decke lag, nicht verändern.
Es wird Madeleine sein, dachte er, und beruhigte sich mit dem Gedanken, dass nur sie ihn immer beim Nachnamen nennt. Aus einer Laune heraus sagte er damals in der Schule seinem Banknachbarn, dass er sich seines normalen Namens entledigen wolle, schon lange fühle er sich nicht mehr angesprochen, wenn man ihn Bernhard nenne, erst recht nicht Bernhard Abergrund. Er schäme sich dessen, auch wenn er nicht so recht wisse, warum. Es sei halt so. Und kaum dass er den Satz ausgesprochen, und damit eines seiner längsten Geheimnisse ihm entwichen war, begehrte Heinrich, sein Banknachbar, der es mittlerweile zu einem angesehenen Posten bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse gebracht hatte, mit schriller Stimme auf, indem er den Namen Alban laut in den Klassenraum schrie, Bernie heißt ab jetzt Alban, endlich heißt er Alban, und alle anderen wurden aufmerksam und warfen ihre Blicke auf den Tisch von Heinrich und … Alban, dachte Bernhard in diesem Augenblick selbst. Dabei kam er sich gar nicht einmal so verraten vor. Dennoch war er überrascht, mit welcher Entschlossenheit Heinrich auf diesen Namen kam.
Es war Madeleine. Alban erkannte sie stets an ihren Schritten, so wie er eigentlich jeden an seinem Schritt erkannte. Nachdem sie die alte Holztür leise hinter sich zugemacht hatte, hielt sie ihm … oh, er schläft … den Brief hin. Der hat, sagte sie in ihrer sanften Stimme, unten auf der Treppe gelegen. – Auf der dritten Stufe, dachte Alban. – Auf der dritten Stufe, sagte sie, so wie immer. Albans Hauswirtin Mia hatte sich mit der Zeit angewöhnt, all das, was für ihn bestimmt war, auf die dritte Stufe zu legen. Aber nicht nur postalisch, sondern auch zum Überleben. Denn oft stand für ihn dort auch etwas zu essen auf einem Teller eingepackt in silbernes Lackpapier, das so herrlich rasselt, wenn man es berührt. Und er berührte so oft wie möglich das Papier, wenn er mit dem Essen die Treppe wieder hinaufging. Er liebte dieses Geräusch. Wie er auch Madeleines Stimme liebte; sie hatte auf ihn eine ungeheuer beruhigende Wirkung. So weich. Und liebevoll. Ganz langsam in ihn hineinsickernd. Wo sollte seine nomadische Mansardenexistenz nur enden?
2.
Weil Alban nicht reagierte, nachdem Madeleine eingetreten war und ihm den Brief vor die Nase hielt und ihm gesagt hatte, dass nichts anderes auf der Treppe gelegen habe, erschrak sie. In dem Gedanken, dass ihm vielleicht etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte, rief sie lauthals nach Mia; sie wusste sich nicht anders zu helfen. Sogleich öffnete sich unten eine Tür. Mia schrie hinauf, was denn los sei – und schon hörte man ein Knacken auf den Stufen. Mia, trotz ihres Alters gesegnet mit einem glatten, feinen Gesicht – nur nicht näher hinsehn, sagte sie immer, wenn man sie darauf ansprach, kam wegen ihrer körperlichen Fülle jedoch nur sehr schwer und langsam, sich am Geländer wie ein Sack Kartoffeln an unsichtbarer Leine hinaufziehend, die Treppe hinauf. Schritte in einem anderen Tempo übertönten plötzlich ihren schweren Atem. Polternd wurde sie von ihrem Mann in der Mitte der Treppe überholt, nein, eigentlich eher überrannt. Er wollte unbedingt vor ihr oben sein. Seitdem er pensioniert war und dem Staat in seiner Funktion als Stempelbewacher (so Mias Bezeichnung für seine lebenslange Tagtäglichkeit) im Einwohnermeldeamt nicht mehr dienen konnte, hatte er sich mehr und mehr dem Herumhängen zugewandt. Wäre Mia also durch seine überdrehte Aktivität zu Fall und demzufolge in ein Hinabtaumeln und somit möglicherweise zu Tode gekommen, was ja zum Glück nicht so war, weil sie sich geistesgegenwärtig mit beiden Händen am Geländer festgehalten hat, so wäre ihr Alfred wegen zu viel Alkohol im Blut freigesprochen worden. Glücklicherweise ist es, wie erwähnt, dazu aber nicht gekommen. Mia blieb am Leben. Und Alfred, klein an Gestalt sowie groß an Klappe und mit vollem grauem Haar bis zur Schulter, landete nicht hinter Gittern. Das merkte man ganz besonders, als die beiden in Albans Wohnung, nachdem Mia auch oben angekommen war, heftig in Streit gerieten. Hochroten Kopfes begann sie ganz sachte sich zuerst nach seinem Befinden zu erkundigen, ob er sie überhaupt unterwegs gesehen und warum nicht gleich die Treppe hinuntergeschubst hätte, dann hätte sie sich den Weg bis hier oben ersparen können, jetzt müsse sie sich das auch noch antun, ihn hier oben zu ertragen, wo sie ihn doch schon den ganzen lieben langen Tag unten ertragen müsse, und nicht nur den ganzen Tag, sondern die ganze Woche und übers Wochenende hinaus den ganzen Monat lang, wie angenehm da ein Februar sei, oder für den Rest des Jahres die Monate mit nur dreißig Tagen, dieser eine Tag mehr bei Monaten mit den Knochenballen, die man im Gegensatz zu den gerundeten Dellen dazwischen zu den einunddreißigtägigen zählt, die Dellen dagegen zu den dreißigtägigen Monaten, und sie sich oft dabei ertappe, wie sich ihr beim Berühren des herausstehenden Handknochens alle Lust am Leben verzagt, der eine Tag mehr würde ihr eines Tages das Genick brechen, das habe sie immer schon gewusst, und heute wäre es beinahe so weit gewesen. Die wirklichen Verletzungen tragen wir unter der Haut.
Mia breitete vor ihm und Madeleine ihre unglückliche Seele aus. Im Leben findet man ja nie das erträumte Glück, das habe sie mittlerweile kapiert, aber wenn man sich dann auch noch gegenseitig bekämpft und die Seele und das Herz zerstört … aber eigentlich sei das Wort Seele eine Perle vor die Säue, ebenso wie Herz. Mia hob dabei ermahnend ihren Zeigefinger, um ihrem Alfred zu bedeuten, dass er nicht einfach nur zuhören, sondern es endlich verstehen müsse. Sie senkte aber sehr schnell ihre Stimme, vielleicht in der Hoffnung, dass irgendwann einmal ein einziger Buchstabe in das Ohr von Alfred dränge und hielt kurz Ausschau nach den beiden beharrlich Zuhörenden, Alban und Madeleine. Sie fand aber keinen Anklang, war sich dennoch ihrer sicher und warf ihrem Alfred vor, dass er eine Frau nur in Form ihrer Brüste und ihres Hinterns wahrnehme. Mia sprach auch diese beiden Wörter so kalt und gelassen aus, dass man vermuten mochte, dass sie ihm das nicht einmal mehr vorwerfen wolle. Aber wieso hatte sie solch eine Sprache gewählt, wieso diese feinen Unterschiede gemacht, nicht nur in den Wörtern selbst, sondern in ihrer Betonung. Und nur darin. Niemand spricht etwas einfach nur aus. Außer die vom Leben Verlassenen. Die Glücklichen. Die das Leben nie berühren und die vom Leben nie berührt werden.
Alfred sah Mia entsetzt an. Sein Unterkiefer wollte herabhängen. Er empfand, neben all der Leere seines ganzen Lebens, dass er zumindest dem Willen seines Unterkiefers entgegentreten musste. Menschen mit herabhängendem Unterkiefer hatte er noch nie leiden können, schon auf dem Amt nicht, sie hatten keinen Charakter.
Als Mia die Wörter Brüste und Hintern von sich gab, widerte sie ihre Gefühle aus, indem sie lasziv ihre Hände an die Brüste und zwischen die Beine führte; ihr Gesicht riss dabei in Fransen eines Aufbegehrens, das Alfred bis dahin sicherlich als Hingabe verstanden hatte, nein, mehr noch als Demut. Er war einer von denen, die es erregte, wenn sie einen anderen Menschen demütigten. Und sie ließ es, dem äußeren Gesichtsausdruck nach, über sich ergehen. Verunstaltet kann auch ein Gesicht sein, das nicht zu seinen Gefühlen steht. Verunstaltet, weil es seine Wahrheit begräbt, obwohl es noch gar nicht alt ist.
Ein tiefes Ausatmen durchströmte die enge Mansarde.
Niemand atmete richtig durch, alles stockte und verlor sich.
Jeder fühlte sich anders, als er sich gab. Fühlte sich beinahe verraten.
3.
Mia war außer sich. Doch man hatte das Gefühl, sie übe sich gekonnt im Selbstvergessen, auch jetzt. Ihr angewiderter Augenaufschlag hatte etwas Ironisches. Verdammt war das Leben genug. Eines musste sie dennoch loswerden – und das schrie sie ihrem flüchtenden Alfred hinterher –, nämlich dass Anke, ihre gemeinsame Tochter, nur wegen seiner verkorksten und stumpfsinnigen Lebenseinstellung zur Hure geworden sei; wieso er immer so getan habe, dass er glaube, sie studiere, bleibe sein Geheimnis. Wahrscheinlich aber habe er gewusst, dass sie niemals irgendwo studierte und auch nie studieren wollte, sondern immer nur ihre Grenzen austesten, und das sei bei einer so gearteten Frau aus diesem Elternhaus nicht verwunderlich, dass ihre Grenzen nämlich in fremden geilen Männern zu überschreiten sei.
Mia wurde immer lauter, je leiser Alfreds Schritte von Stufe zu Stufe wurden. Abwärts. Er sollte ihre Stimme nie wieder vergessen. Eine Tochter komme immer auf ihren Vater, schrie sie ihm hinterher, und das könne nie was Gutes bedeuten. Mia meinte es wirklich ernst. Töchter, die ihren Vater in ihrem Leben niemals loswerden wollen, werden von den Männern immer nur enttäuscht. Sie ist es. Aber die können es nicht erkennen. Ahnen es bloß. Ihre Möse ist lebenslang besetzt. Von einem Phantom, das lebt und die eigene Mutter schon lange nicht mehr liebt, die aber dennoch Reibekuchen brät und ihm die Socken wäscht, nur weil damals der eine Fluss nicht in den anderen mündete … Wieso mussten wir über die Brücke mit dem Mofa ohne Helm, wieso!?
Wieso vergewaltigt eigentlich jeder Vater seine Tochter? Wieso will jeder Daddy sein Vögelchen unvögelbar machen?
Es geht nicht ums Geschlechtliche. Es geht um Liebe. Und Liebe ist viel schlimmer!
Mias Wut hatte sie bis zur Kante der obersten Stufe getrieben. Sie stemmte sich, ihren Oberkörper vornüber haltend, zwischen dem Holzbalken und der weiß gestrichenen Wand, die an dieser Stelle von der regelmäßigen Berührung menschlicher Handballen oder Finger schwarz gefärbt war, und fluchte einige Male die verlogene Beziehung, die wir führen, die verlogene Beziehung, die wir führen … Sie genoss nicht nur die Wörter selbst, sondern auch den Schall durchs Treppenhaus. Sie genoss ihre Stimme, die trällernd die Stufen hinabtropfte wie ein Ball, der nicht zu tropfen aufhören will. Da müsse man ja auf dem Strich landen … Oder zum Mörder werden.
Die letzten beiden Worte blieben fast in ihrer Kehle stecken. Ihre Stimme wurde heiser. Ihr Leben, das mehr den Zwecken des Tages diente als sonst was, drang wie etwas zu viel Luft zwischen die Zunge, die Buchstaben und den Kehlkopf. Schließlich hast du mich auch nur so behandelt. Nur so! Nur so! Dann brach sie in einen Weinkrampf aus. Madeleine stürzte geistesgegenwärtig auf sie zu und hielt sie fest. Als Madeleine sich Alban zuwandte, mit einem überaus gelassenen Ausdruck im Gesicht, da war klar, dass Mia sich nicht mehr die Treppe hinunterstürzen würde. Sie war ins Gleichgewicht gekommen. Vielleicht mehr denn je. Auch wenn ihr massiver Körper auf dem ersten Blick etwas anderes suggerieren wollte. Deshalb erschrak Madeleine auch so sehr. Und Alban dann ebenso. Mia hatte sich schon längst fallen gelassen. Endlich. Aber nur das, was ihr schon lange nichts mehr bedeutete, hatte sie abfallen lassen. Ihre Tränen waren nur das letzte Zucken eines hartnäckigen Nervs, der ihr mit der Zeit immer mehr die Kehle zudrückte.
… wenn aus Wut erlöster Atem wird.
Alban legte seine Hand sanft in Mias Nacken. Seine Wärme ließ sie durchatmen. Sie beugte sich hoch und drehte ihren Kopf. Mit einem zusammengeknäulten Stofftaschentuch tupfte sie ihre Tränen ab. Ihr Blick sagte ihm, dass es ihr leidtue und sie sich so gar nicht kenne, so unbeherrscht sei sie noch nie gewesen. Mit den Augen eines Kindes sah sie Alban an. Sie lachten leicht auf im See einer Genugtuung, auf dem sie etwas Ruhe fand. Mia atmete tief durch, erleichtert. Das Weiße ihrer Augen war leicht gerötet, ebenso ihr Teint. Indem sie wegsah, ohne sich mit ihrem Gesicht davonzustehlen, glaubte sie wohl, dass man ebenso wegsah, um ihre leichte Schamesröte nicht zu erkennen. Vielleicht aber schämte sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben gerne. Denn sie versuchte nicht, zu fliehen.
Die beiden merkten, dass sie sich in ihrer Gegenwart wohlfühlte. Irgendetwas verband sie alle miteinander. Vielleicht der Geschmack eines halbwegs ehrlichen Lebens. Oder eines Lebens, das endlich in die Spur kam. Es gibt Phasen, da verliert man die Orientierung. Als wenn man verliebt ist. Und schnell glaubt, wirklich zu lieben. Für das ganze Leben. Mit diesem Menschen will ich alt werden. Ich liebe dich. Es gibt dann kaum noch einen Moment, an dem man etwas anderes denkt. Die Momente selbst beginnen sich dann zu verstecken, oder zu schämen, was man aber nicht wahrhaben will.
Vielleicht sind allein gelassene Menschen niemals so einsam wie die, die immer nur Menschen um sich haben müssen. Kein Gefühl für sich, kein Gefühl für den anderen, keinen Abgrund, keinen Höhepunkt, die Haut pickelt nicht, selbst eine Mücke interessiert sich nicht wirklich für das Blut, das gelangweilt hin und her schwappt in den vorgefassten Adern. Hinter wie viel Geschäftigkeit verbirgt sich der nutzlose Tag? Wie rettet uns der Schlaf über die Nacht? Mia sagte Danke. Dankte den beiden für ihr Mitgefühl. Aber wahrscheinlich dankte sie dem lieben Gott für diesen Ausbruch an diesem Ort in dieser Sekunde. Aus ihrer Haut heraus. Und genau in solch einer Sekunde sind Menschen da, die dir ganz nah sind. So nah, wie man sich selbst nie nah gewesen ist.
Seufzend löste Mia sich liebevoll aus Albans Umarmung. Sie wollte die Treppe nun allein hinuntergehen, körperlich schwer, aber innerlich unheimlich erleichtert, die erste Stufe hinab, dann die zweite, im Kleinkinderschritt, tapsend in eine Tiefe, die man sich nie zugetraut hat, ängstlich in aller Vorsicht, um nicht zu stolpern. Mia hatte eine Spur hinterlassen. Wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben. Und Madeleine spürte es. Ebenso wie Alban.
4.
Er ging zurück in seinen abgedunkelten Schlafraum und riss die Vorhänge auf. Zum ersten Licht seit ungefähr drei Monaten. Oh Licht?, versuchte Madeleine ironisch zu sein. Sie fand in Albans Gesicht aber nichts Erhellendes, nicht mal ein Lächeln. Madeleine wollte über Mia reden, jetzt, wo sie die ausgedrückten Kammern der Kopfschmerztabletten auf dem Tisch sah. Er blickte versteinert in die plötzliche Helle des Raums. Sein Auge wanderte zwischen dem ausgelegenen Diwan und dem kleinen eckigen Tisch mit der rosaroten Decke, die ihm Mia damals, als er eingezogen war, geschenkt hatte. Sicherlich würde er einige Schwierigkeiten mit dem normalen Leben haben. So dachte sie damals über ihn. Das hatte er sofort gespürt.
Madeleine gingen unheimlich viele Dinge durch den Kopf. Das war immer so, wenn sie auf Alban traf. Allein der Gedanke schon, sich für ihn zurechtzumachen, ließ die Farbe ihrer Lippen vor oder nach dem Auftun des Lippenstiftes anders erscheinen als beabsichtigt. Irgendwie kam sie sich lächerlich vor. Sowohl, wenn sie ihre Lippen für Alban färbte – er mochte doch diesen lila Stich – als auch wenn sie sich für einen anderen schminkte, Alban aber in Gedanken hinter ihr im Spiegel erschien. Es gibt Menschen, die einem das Leben nahebringen, so nahe, dass man es manchmal in ihrer Nähe nicht mehr aushält. Sie sind halt einfach anders als die meisten. Und lieben tut man doch immer das Andere.
So wie Alban damit beschäftigt war, sich an das Tageslicht in seiner Mansarde zu gewöhnen, obwohl er allein durch seinen Job als Steinmetz immer früh aufstehen und den ganzen Tag über Licht ertragen musste, war Madeleine wohl zeitlebens damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie sie Albans Liebe zurückgewinnen könne. Für ihn war sie seine beste Freundin, was ja für sie eine unendliche Qual bedeuten musste, schließlich wurde sie für ihre Gefühle bestraft; ihr Begehren wollte ja nur seine Haut und seine Umarmungen – und nichts anderes. Vor allem nicht die Nähe, die er ihr bot. Dennoch kam es ihr wie eine Lebensaufgabe vor. Albans einhellige Beschäftigung mit dem Licht ließ sie vorsichtig in die Frage münden, ob er überhaupt den Brief, den sie ihm vorhin gegeben habe, wahrgenommen hätte, schließlich schien es ein Familienmitglied zu sein, allein der Anschrift nach, Mein Alban, was ja sehr vertraulich klinge. Madeleine mochte es, wenn sie ihm nahe sein durfte. Ohne Telefon, Mail oder SMS. Stimmen, Blicke, Gerüche – so etwas wie seine eigene Handschrift oder Berührung im Stillen.
Madeleine mochte es nicht, in diesem kleinen Zimmer so fern von ihm zu sein. Obwohl nicht mal zwei Schritte zwischen ihnen waren.
Alban mochte die Handschrift auf dem Briefumschlag, sie ähnelte der seiner Mutter. Doch sie war es nicht, sie konnte es nicht sein. Es war die Handschrift eines anderen, nämlich die seines Großcousins aus Rotterdam. Albans Mutter hatte ihm einmal gesagt, dass es einen in der Familie gebe, der so ähnlich schriebe wie sie, und das sei der versoffene Gilbert, der weit weg lebte.
Madeleine hielt ihm noch einmal den Brief vors Gesicht. Deine Mutter? Alban drehte seinen Kopf auf die andere Seite, berührte dann leicht den Umschlag und stieß ihn von sich. Er versuchte noch näher ans Fenster zu treten, obgleich er fast ganz davorstand, und fragte mit belegter Stimme in den Raum hinein, als läge eine Scheibe Käse auf seiner Zunge, was das Leben eigentlich von ihm wolle. Er fasste sich an die Stirn; dann schloss er seine Augen und fuhr mit Daumen und Zeigefinger kräftig darüber hinweg.
Er lachte hämisch auf. Es war die Häme, die sich über seinen Kopf ausschüttete. Wie eine Flasche Fusel, die er über sich ergoss. In dieses verzweifelte Lachen hinein sagte er, dass er zwar immer geliebt werden wollte, gleichzeitig aber unendliche Angst davor hatte, tödlich verletzt zu werden, weil Liebe letzten Endes ja nur selbstzerstörerisch sei. Madeleine sah ihn nur an.
Alban murmelte weiterhin einige undeutliche Worte vor sich her; dabei berührte er mit seinen Fingerspitzen sein schulterlanges Haar. Er drehte es um seinen Zeigefinger, ließ es dann wieder los und begann von Neuem, eine Haarspitze zu berühren. Dann blieb er still. Für einen kleinen Moment. Wartete. Erwartete. Fragte leise nach der Farbe seines Haares als Kind. Er wollte immer schon lange Haare haben. Sein Vater hatte es ihm aber verboten. Auf der Kirmes, mit elf oder zwölf, stand Alban mit seinem neuen Fahrrad, das rechte Bein auf der Stange, die Ellenbogen auf dem Lenker, vor einem Imbisswagen, in dessen Spiegel auf Höhe der Ablage er sein wachsendes Haar bestaunte. Das erste Gefühl von Freiheit. Endlich vom Vater vergessen. Doch kaum zu Hause angekommen, befahl der ihm, am anderen Tag zum Friseur zu gehen, es werde Zeit, er habe erwartet, dass er, Alban, nun von alleine darauf komme, ansonsten müssen wieder andere Seiten aufgelegt werden, er könne es sich aussuchen.
Alban mochte das Leben. Gleichwohl hasste er es auch. Erst gaukelt es einem was vor. Dann schießt es einen ab. Mitten in einer Hoffnung. Von da an war er auf der Suche. Auf der Suche nach sich und demjenigen, der zu ihm passte. Also nach seinem Spiegelbild. Ab da genoss er es nicht mehr. Er wollte nie wieder nach Hause kommen, obwohl er es mehr als alles andere brauchte. Seine eigenen vier Wände. Hinter sich die Tür schließen und alle Vorhänge zuziehen. Und irgendwann am Nachmittag das Geräusch, dass seine Liebste die Haustür öffnet und den Mantel in der Diele auf den Haken hängt, ohne gleich nach ihm zu rufen – und sie beide sich dann im Geruch des bereits gekochten Kaffees begegneten. Was in sich schon ein Lächeln war.
Vielleicht hat das Leben eine ganz eigene Farbe? Die kann man nicht sehen, nur fühlen.
Madeleine überlegte, ob sie ihren Arm um Alban legen sollte.1 Allein, dass sie es nicht einfach tat, zeugte von einem Respekt, den sie nicht mochte. Sein Misstrauen hatte sich schon so weit in sie hineingefressen, dass sie nicht mehr sie selbst war. Er hemmte. Obwohl er genau das Gegenteil einforderte. Warum konnte er nicht das geben, was er einforderte? Eine Umarmung. Ein feines Wort, nur um anzudeuten, es ist schön, dass du da bist? Warum gab er einem immer das Gefühl, unbedeutend zu sein. Aber was kann ein Mensch, der ständig auf der Suche nach den Fragen ist, für die andere sich kaum interessieren, geben? Er ist ja immerzu nur mit sich selbst beschäftigt. Was denkt und fühlt er, wenn man ihm die Post mit hinaufbringt, hinauf in ein dunkles Zimmer, in dem, wie er meint, ein verkommenes Genie verkümmert. Ein solcher Mensch verlangt einem wohl doch alles ab, dachte Madeleine.
Madeleine war in diesem Augenblick klar, warum sie hinter ihm stand. Sie sah ihm zu, wie er sein Haar zwischen seinen Fingern drehte. Liebebedürftig. Und dennoch hatte sie das Gefühl, dass er ein ganzer Mensch sei. Er weiß es nur nicht. Deshalb geht alles an ihm vorbei. Streift ihn und wendet sich von ihm ab. Seine Worte, seine Haut, seine Blicke und sein Herz haben noch nicht die richtige Sprache gefunden, also die Sprache, die er mit sich selbst spricht. Er hätte nicht nach Hause fahren dürfen, nachdem er sich auf der Kirmes im Spiegel des Imbisswagens über sein langes Haar so gefreut hat. Er will nie mehr verwechselt werden mit einem Kind, das nach Hause kommt, um dem Vater zu gehorchen, mit einer verlorenen Seele, die nicht alleine sein kann, mit Wörtern, die von vielen gesprochen werden, ohne dazugehörige Stimme, von einer Umarmung, die von Zeit zu Zeit zwar ein Bekenntnis der Liebe in sich schließt, oft aber auch nur die eigene Verlorenheit.
Alban drehte sich um. Sein Haar strich leicht über seine Schulter. Mit starrem Blick, in unerklärbaren Erinnerungen gefangen, sah er Madeleine an. Er bemühte sich um ein Lächeln. Es gelang ihm nicht. Madeleine kam sich vor wie ein Fenster in der Abenddämmerung. Alban sah durch sie hindurch. Sie spürte, dass er irgendwo anders war, weit weg, vielleicht über die Liebe hinaus. Oder nur die eine suchend. Komisch war seine Haltung, sein Blick durchdringend, als stellte sich ein Wille quer, der von nichts mehr abzuhalten war. Nichts mehr suchend … vielleicht.
Alban wandte sich dem Schreibtisch zu, sagte, dass er nicht wisse, warum er dort allein obdachlos sein wolle, und es so genieße, dort zu sitzen, um die Welt zu vergessen, zumindest das, was sie von einem erwartet, manchmal liebe er sogar die Aussichtslosigkeit, jemals als bedeutender Künstler anerkannt zu werden, weil das, was er da mache, ohne Zweck sei, rein aus Liebe zu dem, was der Augenblick hergebe, so wie Liebe sein soll, ohne Berechnung, ohne Hintergedanke und Ziel und Sinn für die Wirklichkeit.
Alban war ein eigenartiger Mensch. Nur durch seine mit der Zeit eingeübte Freundlichkeit vereinsamte er nicht. Er sprach Dinge an, die andere nur dachten, vielleicht dem einen oder anderen sogar den Schlaf raubten, verkürzte so Gespräche und Abende und ließ sie in einer Art Langeweile und Wankelmütigkeit verebben. Er wehrte sich heftig gegen seine Lügen, und man merkte ihm an, dass er hoffte, mit dem Leben eines Tages doch noch versöhnt zu werden, vielleicht bei einem Glas Champagner. Doch woher seine Menschenflucht stammte, das wusste er nicht. Ebenso wenig wie er noch wusste, wann genau sie anfing.
Zugleich hielt er sich jedoch durch seine mit der Zeit eingeübte Freundlichkeit auch die meisten Menschen vom Leib. Er würde nie allein bleiben. Dazu stach seine bloße Anwesenheit zu tief. Zu tief in die Mutlosigkeit, so sein zu wollen, wie man es wirklich will.
Je mehr man sich belügt, umso unbedeutender wird man. Zum Schluss erreicht man niemanden mehr.
Madeleine wusste, dass Alban die Menschen nicht mied, weil er sie hasste, sondern weil er sich in ihrer Gegenwart nicht aufgehoben fühlte. Er wollte verstanden werden, ohne ihre Sprache zu sprechen. Er wollte in den Arm genommen werden, obwohl er ihnen die Wahrheit sagte. Er wollte frei sein. Mit erhobenen Armen zu demonstrieren, dass man es sei, schien ihm zu infantil …
Madeleine spürte (vielleicht immer schon), dass Alban sich befreien musste. Er tänzelte wie ein gezündeltes Streichholz auf einem Pulverfass. Warum konnte er sich nicht mit sich zufriedengeben? Warum war alles, was er tat, mit den Farben und den Sehnsüchten einer anderen Welt bemalt? Warum wollte er unbedingt die Nuancen dieser Welt in sich aufsaugen?
Seine Insel war sein Kopf. Ohne einen einzigen Steg.
Die Wut, die Erinnerung, die willenlose Hingabe ans Leben, die Überwindung des Ich – ja, das war er! Ein Ich hängt am Tropf der Wirklichkeit und wird damit nicht fertig. Guter Titel für die Hälfte eines Lebens.
Madeleine wusste um die vergebliche Mühe Albans. Denn solange er (angeblich) scheiterte, kam er weiter. Sie wusste, dass er gar nicht in der Lage war, zu hassen, leider war er auch noch nicht so weit, zu lieben.
Alban räusperte sich. Sie erwartete, dass er etwas sagte, denn zu reden war sein Liebstes, um so manchmal zu zerreden, was er eigentlich dachte. Doch er sagte nichts. Es gibt Momente, in denen das Schweigen tötet. Weil es alles sagt. Und man alles verstehen würde, wenn man die Arme ausgebreitet hätte, nicht, um den Schnee einzufangen, sondern nur, um von ihm berührt zu werden.
Madeleine ahnte zwar nur, dass in Alban etwas ihn tief Bewegendes vorging, doch der Gedanke, dass er schlagartig das Fenster öffnen und sich kopfüber hinauswerfen könnte, war zu absurd; er würde sich nie in Gegenwart eines anderen umbringen. Dennoch! Das alte Leben musste weggeschmissen werden, ausgemerzt, ein Loch im T-Shirt, Strumpf, Hemd, in der Hose, dem Welt- und Frauenbild war ihm plötzlich unangenehm.
Vielleicht ist seine wahre Seele längst aus seiner Haut gekrochen und davongeflogen, durch den Spiegel und die Scheibe und andere Ungereimtheiten hindurch (er hat ja nie gewollt, dass ich ihm die Fenster putze) – und seine körperliche Anwesenheit spricht seine eigene Abschiedsrede:
flieg, meine seele, flieg in mein erleuchtetes herz, flieg aus dem mauseloch, ungerührt vor lichtwut, bald wird nichts mehr unberührt bleiben von dir, die zukunft wird nach deinem atemzug verlangen, sie will dein blut haben, um die sonnenuntergänge zu bemalen, in denen du deine zelte aufschlagen wirst … die wüste ruft dich, wie gott damals die wüste rief, dort findet man nicht viele ausgetrocknete gräser …
Madeleine fühlte in Albans Gegenwart hin und wieder selbst Flügel. Besonders, wenn sie seinen Atem spürte. Er war einer der wenigen Menschen, die das Leben herausforderten. Eigentlich der einzige.
Sie nahm Albans Hand und drückte sie gegen die Glasscheibe. Er spreizte seine Finger. Beide betrachteten den Abdruck in einem dunkel umarmten, aber dennoch hellblauen Abendhimmel, die vielen kleinen Ameisengänge in einem Labyrinth aus Haut.
Du weißt, Madeleine, sagte er sich, dass ich seit Langem im Bett liege und nicht mehr schlafen kann. Ich möchte nicht mehr vor mir davonlaufen. Voller Gedanken, Ängste, wie gelähmt am ganzen Körper bis zum Hals. Der Kopf ist irgendwo, nur nicht hier. Vielleicht bin ich ein Mensch aus einer anderen Zeit? Ich suche keine Möse, ich suche Liebe. Warum wird das immer wieder verwechselt? Ich verstehe es nicht.
Madeleine spürte ganz tief, dass Alban begann, in ein neues Leben zu wandern. Dennoch sträubte sie sich, es zuzulassen. Sie fragte ihn, ob er Drogen genommen habe oder sonst was. Er antwortete nicht. Seine Falten unter den Augen lächelten. Madeleine lächelte zurück. Sie fühlte sich selten so wohl wie in diesem Augenblick. Sie kroch einfach in seine Falten hinein.
Wie viele Frauen müssen dich noch verlassen, bis du verstehst? Und wenn du verstanden hast, wirst du verstehen, dass dich noch keine Frau wirklich verlassen hat. Eher umgekehrt. Du hast sie verlassen, lange bevor sie mit dir Schluss gemacht haben. Du bist kein Mann für einen Tag, du gehörst, wenn überhaupt jemandem, dann nur der Nacht, nur dir allein. Du gehorchst nicht. Denn wer gehorcht, kann nicht so getrieben sein!
Alban drückte nun die andere Hand gegen die Scheibe, gleich neben dem Abdruck von vorhin. Es war, als hätten sich beide Hände in den Himmel um einen bestimmten Hals gelegt – und als wollten sie zudrücken. Die ständigen Verwirrungen, das unendliche Alleinsein mit seinen Gefühlen und Gedanken, nie sich selbst zu genügen, und die vielen unbeabsichtigten Demütigungen der anderen, nur weil sie unter Liebe etwas anderes verstanden – und niemand erklären konnte, warum.
Jeder Mensch redet ständig mit sich selbst. Der Rest ist die Enthäutung des Ichs, damit man sich zerstreuen kann. Man kann sich nicht ständig selbst befruchten. Das können nur die, die ihr Leben der Fantasie widmen, widmen müssen. Deren Schädeldecke wie ihr Herz schlägt. Und die ihre Träume nicht im Mund vertrocknen lassen.
»Ich hatte mal eine Freundin, die sah mich entsetzt an, als ich ihr sagte, dass Liebe selbstzerstörerisch sei«, und ich glaube, sie hörte gar nicht mehr zu, als ich es erklären wollte.
5.
»Ins Ich – für kurze Zeit«
Straf mich nicht mit deinem Blick, sagte Alban plötzlich in einem anderen Ton. Ich habe keine Lust mehr, dich anzulügen. Nein, ich habe keine Lust mehr, dir ständig etwas zu verschweigen. Ich falle dir in den Rücken, weil ich genau das von dir verlange. Jeden habe ich damit gemeuchelt, vor allem diejenigen, die mich liebten und vielleicht immer noch lieben. In den Stunden der Liebe lauert immer der Tod. Ich möchte mich für dich zerfleischen. Ich gebe mich hin, damit du mich erdolchen kannst. Nur hätte ich damit nie gerechnet. Es blutet immer sehr lange. Gerinnt nur langsam. Ich bin kein Meister des Vergessens. Hänge an meiner selbst verschuldeten Freiheit wie eine Schweinehälfte in einer kalten Welt am Haken; man hat vergessen, ihr das Clownskostüm abzunehmen.
Es gibt Augenblicke im Leben, die wollen unberührt bleiben von bloßen Wörtern.
Und dann gibt es Augenblicke, die zu einer schlimmen Tat oder zu einer schönen Liebe führen.
Madeleine sah erschrocken auf, nachdem er aufgehört hatte zu reden. Ihre Stirn legte sich in Falten. Sie ahnte Schreckliches. Doch warum sprach Alban so gelassen davon. Sein schweres Herz erdrückte sie. Am liebsten wäre sie zu ihm hin und hätte ihn heftig geschüttelt, bis alles aus ihm herausgebrochen wäre. Seine leidenschaftslose Sprache machte sie verrückt. Es musste etwas sehr Schlimmes mit ihm geschehen sein. Sie kannte ihn lange genug.
Ein geheimnisvoller Schatten schwirrte wie heiße Luft, die verbrennt, um seine Stimme. Madeleine fror. Doch in Albans Herzen war es warm. Das fühlte sie.
»Ein Freigeist wird immer auch seine Freiheit finden. Und weißt du, wo das möglich ist?« Er sah in der Scheibe, dass Madeleine mit dem Kopf hinter ihm nickte. »Ich wusste«, sagte er weiter, »dass du mich verstehst, wenn auch nur spiegelverkehrt.« Selbst das schien sie zu verstehen, denn sie nickte abermals und lächelte dabei ins Spiegelbild der Scheibe. »Wem anderes als dir sollte das gelingen, oder soll ich besser sagen: Wem anderes sollte daran gelegen sein!?«
»War das eine Liebeserklärung«, sagte sie schelmisch und tat einen Schritt auf ihn zu. Absichtlich trat sie dabei auf eine bestimmte Bohle des Holzbodens. Es sollte leise knarren, damit Alban nicht erschreckte, wenn sie plötzlich ihre Arme um ihn legte. Beide blickten in den Abendhimmel. Dann drückte sie ihre Wange gegen seinen Arm und fragte ihn, ob er das Gleiche sehe wie sie?
»Natürlich«, erwiderte er, »meinen Untergang. Das meinst du doch!«
»Du bist und bleibst ein Idiot. Warum musst du immer alle Stimmungen …« Sie stockte.
»Sag ruhig: zerstören.«
»Du lebst halt in einer anderen Welt, und wenn man das nicht begreift, begreift man nichts von dir. Merkst du eigentlich, dass ich regelmäßig an deiner Tür klopfe, manchmal leicht daran kratze wie eine Katze. Ich mag, wie du, die Wolken; sie sind mir sympathisch.«
Alban runzelte die Stirn.
»Das hast du natürlich auch nicht verstanden. Willst von allen verstanden werden und verstehst selbst kaum etwas von den anderen um dich herum. Und du bist auch noch beleidigt, wenn man dich manchmal nur grinsend ansieht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.«
Madeleines Stimme klang ironisch. Sie war in eine Höhe geklettert, aus der man nichts anderes heraushört. Eines Tages wirst du mir öffnen. Und wenn es nur die Klappe zu deiner Zelle ist. Das ist es nämlich, worin du lebst. Du bist nämlich gar nicht frei, in Wirklichkeit bist du nur ein Gefangener deines Verlangens danach, mehr nicht!
Alban verstummte. Weder verkrampft noch überrascht zeigte er seine innere Regung, indem er nichts erwiderte.
»Alle deine Frauen, mich inbegriffen, haben dich angeblich immer verlassen, weil sie sich nicht geliebt fühlten. Aber hast du dich geliebt gefühlt? Hast du ihnen nicht immer vorgeworfen, nur ihre Vorstellungen durchbringen zu wollen? Doch genau das hast du doch getan. Hast du ihre Bedürfnisse überhaupt wahrgenommen? War dein Liebeskummer nicht eher ein Trennungsschmerz wie von seiner eigenen Mutter verlassen? Oder besser noch: der Verlust eines schönen Körpers. Hast du eine Frau schon einmal anders denn als eine hautliche Form betrachtet? Hast du schon mal gefragt, warum all deine Trennungen auf die gleiche Weise vonstattengegangen sind, fast zumindest. Und meinst du allen Ernstes, dass das nur an den Frauen liegt?«
Alban legte seinen Kopf auf den ihren, irgendwie scheu und angestrengt, als wolle er ihr nicht zu nahe treten.2 Zwischen der Berührung ihrer beider Haare lag eine Armada von wehrlosen Zugeständnissen. Wie recht sie doch hat. Doch warum hat er das nie erkannt. Warum ist er immer nur am Leben vorbeigerannt? Wieso hat ihn noch nie eine Frau wirklich interessiert? Als Mensch, und nicht nur als Mutter oder Möse. Da unterbrach Madeleine ihn mit der Frage, ob er wisse, wovor er zeit seines Lebens davongelaufen sei, wer ihm das Liebenkönnen genommen hat, obwohl er das Herz dazu hat. Was ist schiefgelaufen? Welche Angst jagt ihn immerzu davon? Vor was und wem? Wieso fühlt er sich schon verlassen, obwohl die Beziehung noch gar nicht richtig angefangen hat?
Madeleine hatte das Gefühl, nicht aufhören zu dürfen, auch wenn sie es gerne wollte, aber der Gedanke, dass solch eine Situation sich nie mehr wiederholen würde, ließ sie ihren eigenen Schmerz vergessen, den sie auch sich zufügte mit all ihren Fragen und Behauptungen. Doch Schmerzen hatte sie bislang auch immer aushalten müssen; da mache dieser eine auch nichts mehr aus. Vielleicht, so versuchte sie sich zu beruhigen, wird der eine tiefe Schmerz all seine bisherigen und damit die möglichen noch kommenden im Keim ersticken, weil er endlich einmal in sich hineinführt. »Eine Leiche muss her«, sagte sie lachend. »Entweder deine Zukunft oder deine Vergangenheit. Gestern noch habe ich in einer Zeitung den Spruch gelesen, dass ein Geist nur durch die Stimme des Herzens wirken und zu einer Persönlichkeit werden kann.Hast du dich schon einmal gefragt, warum dich alle deine Freunde großer Meister nennen?«
Sie löste sich von ihm. Mit einem langen Blick forderte sie ihn auf, sich ihr zuzuwenden.
Nicht nur, dachte sie, weil sie in dir eine große wahnhafte Kraft sehen und dich irgendwie bewundern, sondern weil sie dich zugleich auch auslachen; du bist ein Narr für sie, ein Dummkopf vom Herzen her, verstehst du?