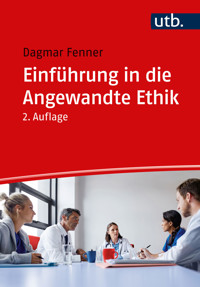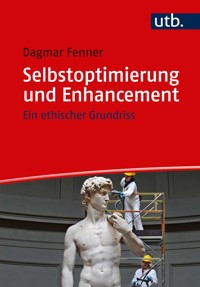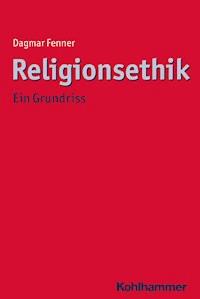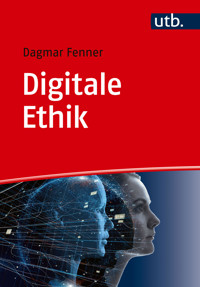
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die rasch voranschreitende Digitalisierung und der damit verbundene tiefgreifende Kulturwandel erfordern dringend ethische Reflexionen und mehr gesellschaftliche Gestaltung. In dieser Einführung werden wichtige Grundbegriffe und normative Leitideen geklärt. Im ersten Teil Digitale Medienethik geht es um Probleme wie Fake News, Emotionalisierung und Hassrede in Online-Medien. Dies führt zur Frage, ob das Internet die Demokratie eher fördert oder gefährdet. Der zweite Teil KI-Ethik reflektiert die Gefahren von Datafizierung und Big-Data-Analysen, z. B. Diskriminierung oder Verlust von Freiheit. Zudem wird beleuchtet, wie der vermehrte Einsatz von Robotern unser Leben und unser Menschenbild verändert. Gegeben wird ein kritisch abwägender Überblick über das hochkomplexe aktuelle Themenfeld mit klarer Struktur und vielen Übersichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dagmar Fenner
Digitale Ethik
Eine Einführung
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Prof. Dr. Dagmar Fenner ist Titularprofessorin für Philosophie an der Universität Basel und Lehrbeauftragte für Ethik an der Universität Tübingen und anderen deutschen Universitäten und Hochschulen. Sie ist Autorin zahlreicher philosophischer Bücher, die sich auch an ein größeres Publikum richten. Als utb erschienen sind von ihr bereits „Selbstoptimierung und Enhancement. Ein ethischer Grundriss“ (2019), „Ethik. Wie soll ich handeln?“ (Zweitauflage 2020) und „Einführung in die Angewandte Ethik“ (Zweitauflage 2022).
Umschlagabbildung: Geisteswelt des menschlichen Konzepts, [email protected]
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838562810
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6281
ISBN 978-3-8252-6281-5 (Print)
ISBN 978-3-8463-6281-5 (ePub)
Inhalt
Im Andenken an meine 2024 verstorbene Doktormutter
Prof. em. Annemarie Pieper
Vorwort und Danksagung
Das vorliegende Buch ist das Resultat einer intensiven vierjährigen Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation und ihren Auswirkungen auf die individuelle Lebenswirklichkeit, auf gesellschaftliche und demokratische Strukturen. Die Digitalisierung und insbesondere die Künstliche-Intelligenz-Forschung nahm in dieser Zeit ungeahnt an Fahrt auf und elektrisierte 2022 mit der allgemeinen Verfügbarkeit von ChatGPT die Weltöffentlichkeit. Große Faszination üben die seither Schlag auf Schlag folgenden technologischen Errungenschaften und die dadurch neu eröffneten Handlungsmöglichkeiten aus. Die damit einhergehenden Veränderungen in sämtlichen menschlichen Lebensbereichen werfen zahlreiche spannende philosophische und ethische Fragen auf, wecken aber auch viele Ängste und Sorgen über die Zukunft des Menschen. Die Technologieentwicklung scheint auch in diesem Zusammenhang häufig schneller zu sein als die menschliche Fähigkeit zu ihrer gründlichen Reflexion, argumentativen Bewertung und wirksamen Regulierung. Gerade ein Buch mit langer Entstehungs- und Herstellungszeit wie dieses kämpft mit der Schwierigkeit, dass fortwährend neue Anwendungen, Themenfelder, Studien und Erkenntnisse hinzukommen. Die rasch anwachsende Fülle an Literatur zu digitalen Medien und KI unter Einbezug auch ethischer Aspekte ist für einen Menschen nicht mehr zu bewältigen, sodass eine Auswahl zu treffen ist und Überblicksarbeiten und Handbücher gute Dienste leisten. Es können nicht laufend Ergänzungen zu Neuerscheinungen, Richtlinien oder Gesetzen vorgenommen werden, weil die Buchabgabe sich sonst ständig verzögerte und dann wieder andere inzwischen „antiquierte“ Textteile überarbeitet werden müssten usw. Der große Teil der Arbeit bestand in Recherchen, Lektüre und dem Erstellen von Exzerpten und Konzeptblättern, um am Ende ein hochverdichtetes Textkondensat zu erstellen.
Zentrales Ziel war von Anfang an, eine durchgängige Systematik für das enorm vielschichtige und weite Feld verschiedenster praktischer Anwendungen, ethischer Problemstellungen, Pro- und Kontra-Argumente und teils noch schwer abschätzbarer soziokultureller Folgen zu entwickeln. Eine solche Strukturierung scheint mir hilfreich zu sein, um die Dinge klarer zu sehen und zugleich den Blick für das Ganze nicht zu verlieren. Eine zweite Herausforderung bestand darin, für die vielfach heterogen verwendeten Begriffe wie etwa „Digitalisierung“, „Big Data“ oder „Roboter“ klare, einfache Definitionen zu erarbeiten. Es liegt in den häufig noch jungen Forschungsfeldern meist kein Konsens vor, sodass es sich dabei um Vorschläge zu einer wünschenswerten Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten handelt. Die so entstandene philosophische Einführung bietet einen systematischen Überblick über ein hochkomplexes aktuelles Themenfeld der Angewandten Ethik, der trotz der erforderlichen hohen Komprimiertheit bei wichtigen Fragen in die Tiefe zu gehen versucht, in der Debatte vernachlässigte Differenzierungen vornimmt und einen eigenen ethischen Standpunkt zum digitalen Wandel zum Ausdruck bringt. Aufgrund der didaktischen Aufbereitung, einer starken Praxisorientierung und großen Anschaulichkeit mit vielen zusammenfassenden Tabellen und Graphiken eignet er sich als Lehrbuch an Universitäten, Hochschulen und anderen weiterführenden Schulen. Es werden weder ein Philosophiestudium noch Spezialkenntnisse in Informatik oder Angewandter Mathematik vorausgesetzt. Er richtet sich nicht nur an Studierende und Dozierende der Philosophie, Medien- und Kommunikationswissenschaft oder Informatik, sondern auch an diejenigen aller anderen Fachrichtungen, sowie an alle am Thema Interessierte und Entscheidungsträger in Politik und (Zivil-)Gesellschaft.
Ohne meine kompetenten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen hätte das Buch in dieser Form nicht entstehen können. Zu größtem Dank verpflichtet bin ich den beiden Ethikdozenten Andreas KleinKlein, Andreas (PD Universität Wien) und Wolfgang Kornberger (M. A. Universität Tübingen), die das ganze Manuskript in einer ersten Fassung gelesen und mit ihren kritisch Kommentaren zahlreiche Differenzierungen und Klärungsprozesse angeregt haben. Mit Wolfgang, der an der Hochschule Konstanz und am Referat für Technik- und Wissenschaftsethik (rtwe) im Bereich Ethik, Digitalisierung und Risikotechnologien lehrt, traf ich mich regelmäßig, um in ausgiebigen Diskussionen gemeinsam an den Texten zu feilen. Andreas, der an verschiedenen Ausbildungsstätten Ethik etwa bezüglich neuer Technologien im Gesundheitswesen unterrichtet und Mitherausgeber des utb-Bands Health Care und Künstliche IntelligenzKünstliche IntelligenzKI (Künstliche Intelligenz) (2024) ist, hat in zahlreichen E-Mails und Gesprächen sein Fachwissen eingebracht und Kapitel 3.1.2 zum maschinellen Lernen verfasst. Jessica HeesenHeesen, Jessica, Professorin für Philosophie an der Universität Tübingen und Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik, Technikphilosophie und KI, hat mir als ausgewiesene Expertin immer wieder geduldig alle meine Fragen beantwortet und damit viel zur Systematisierung des Gegenstandbereichs und meiner eigenen Positionierung beigetragen. Catrin MisselhornMisselhorn, Catrin, Professorin für Philosophie an der Universität Göttingen und Vordenkerin im Bereich der Maschinen- und Roboterethik, hat mich in Fragen der Maschinenethik, Andreas Urs SommerSommer, Andreas, Professor für Kulturphilosophie an der Universität Freiburg, bezüglich Demokratie und Digitalisierung beraten. Christoph Horn, Professor für Philosophie an der Universität Bonn, hat viele Kapitel durchgesehen und auf wesentliche philosophische Kategorien und Konzepte aufmerksam gemacht. Die informatisch-technischen Passagen hat der Data Scientist und KI-Forscher Marco Tilli (FH Joanneum Graz) sorgfältig geprüft, berichtigt und ergänzt. Meinem Lektor Tilmann Bub danke ich für die große Unterstützung und das Vertrauen in das Buchprojekt, auch als es immer länger wurde und am Ende den doppelten Umfang als geplant erreichte. Erwähnt sei aber auch mein Partner Horst Hermas, der mit großem Gleichmut alle meine Schaffenskrisen durchstand und nicht nur mich, sondern immer wieder auch meine Diskussionspartner kulinarisch verwöhnte.
Aufbauen konnte ich bei dieser Einführung auf meine Vorarbeiten in den früheren utb-Bänden Ethik (2. Aufl. 2020), Einführung in die Angewandte Ethik (2. Aufl. 2022) und Selbstoptimierung und Enhancement (2019), bei denen bereits die Fähigkeit zur Komplexitätsreduktion gefragt war. Als Titularprofessorin für Philosophie am Departement Künste, Medien und Philosophie der Universität Basel unterrichte ich daselbst und in verschiedenen transdisziplinären Studiengängen Ethik an deutschen Universitäten und Hochschulen. Digitale Medienethik steht etwa in meinem regelmäßig an der Universität Tübingen angebotenen Seminar „Medien und Verantwortung“ im Zentrum, und auch im Kurs „Ethisches Argumentieren in der Praxis“ für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (rtwe) konnte ich von den lebhaften Diskussionen mit Digital NativesDigital Natives viel lernen. Da ich zudem noch Musik (Kontrabass) studierte, wählte ich bei der Frage nach der Ersetzbarkeit des Menschen das Phänomen der KI-Kunst als Anwendungsbeispiel aus (Kap. 3.3.4).
Obwohl ich als Ethikerin eine gendergerechte Sprache grundsätzlich befürworte, konnte ich mich nicht für eine der umständlichen gebräuchlichen Formen des „Genderns“ mit Sonderzeichen oder Beidnennungen entscheiden. Meine Präferenz wäre das einfache „Entgendern“, d.h. die Neutralisierung der verschiedenen Geschlechter auf ein Neutrum (z.B. einheitliche Endung „y“). Da diese Variante jedoch zu befremdlich klingt, verwende ich weiterhin das „generische Maskulinum“, bei dem stets alle möglichen Geschlechtsidentitäten mitgemeint sind.
1Einleitung und ethischer Grundriss
Die Digitalisierung und der digitale Wandel sind hochaktuelle, möglicherweise die drängendsten und wichtigsten Themen unserer Zeit, welche in wissenschaftlichen, medialen und gesellschaftlichen Diskursen immer mehr Raum einnehmen. Die Rede ist vom „Megatrend des 21. Jahrhunderts“, einem tiefgreifenden „Kulturwandel“ oder gar einem „Paradigmenwechsel“ und einer dritten oder vierten „Revolution“ (PiallatPiallat, Chris, 20; Adlmaier-Herbst u.a., 1212f.; HengstschlägerHengstschläger, Markus, 9; Corsten u.a., 4). Ihre technischen Voraussetzungen sind digitale Technologien, insbesondere Informations- und KommunikationstechnologienInformations- und Kommunikationstechnologien (IKT) (IKT), d.h. computergestützte Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung von Information und zur Unterstützung von Kommunikation, bei denen immer mehr auch sogenannte Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt (s. Kap. 1.1.2). Die Digitalisierung erfasst immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche und entwickelt sich in rasend schnellem Tempo. Fast täglich wird von den Medien über neue technologische Errungenschaften, Durchbrüche und Entwicklungstrends in der Forschung berichtet. Menschen verbringen einen immer größeren Teil ihrer Lebenszeit online in sozialen Netzwerken und virtuellen Welten und informieren sich hauptsächlich über Internetdienste. Infolgedessen prägen die digitalen Mediendigitale Medien in hohem Maß die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, miteinander kommunizieren und umgehen. Der Ruf nach schnelleren und flächendeckenden Internetverbindungen und nach digitaler „Aufrüstung“ von Schulen und öffentlicher Verwaltung ist allgegenwärtig. Alles im Leben scheint eine digitale Komponente bekommen zu müssen, um mithilfe des Sammelns und Auswertens von Daten das Lernen, Arbeiten, Einkaufen oder die Freizeitgestaltung zu optimieren (vgl. Otto u.a., 6). So verändert der digitale Wandel die Denk- und Handlungsweisen der Menschen, die gesellschaftlichen Organisationsformen und sozialen Systeme, und damit auch das menschliche Welt- und Selbstverständnis.
Zu einer völligen Neuorganisation von Arbeitsprozessen kam es nicht zuletzt auch in der Wirtschaft, wo der Begriff Industrie 4.0 für die vierte industrielle RevolutionRevolution (4./digitale) steht. Gemeint ist damit die Computerisierung und Automatisierung der gesamten Wertschöpfungskette, wodurch diese auf eine ganz neue Stufe der Organisation und Steuerung gestellt wird (vgl. Corsten u.a., 7): Dank der DigitalisierungDigitalisierung stehen riesige Daten z.B. über Kundenwünsche, Auftragslage, Verbrauch von Ressourcen bis hin zur Fertigung und Auslieferung zur Verfügung. Diese können je nach Zwecksetzung beliebig miteinander verknüpft werden, wodurch sich die Produktivität und Effizienz von Unternehmen und unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerken erheblich steigern lassen. Automaten und Roboter mit Künstlicher Intelligenz ersetzen zunehmend menschliche Arbeitskräfte, sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor und im Gesundheitssystem. Immer häufiger sind es Algorithmen, die anstelle von Menschen schneller und vermeintlich objektiver Entscheidungen über die Auswahl von kundengerechten Produkten oder die Vergabe von Anträgen, Stellen oder Krediten treffen. Im Zuge der Digitalisierung fallen auch bei der privaten Nutzung mobiler Geräte z.B. für Kommunikation oder digitale Selbstvermessung, beim Einkaufen und Surfen im Internet, Zahlen mit Kreditkarte etc. riesige Datenmengen an. Diese Massendaten („Big DataBig Data“) erlauben es selbstlernenden Computerprogrammen, Muster und Korrelationen zu erkennen und beispielsweise medizinische Diagnosen zu stellen oder das individuelle Verhalten, Einbrüche, Klima oder andere zukünftige Entwicklungen vorauszusagen.
Einen enormen Aufschwung und Fortschritt erlebte die Digitalisierung mit dem Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie, als dieses Buchprojekt seinen Anfang nahm. Zu Beginn des Jahres 2020 reagierten viele Länder mit einem vollständigen Lockdown, sodass schnell digitale Alternativen wie Homeoffice, Online-Lehre und digitale Meetings und Veranstaltungen entwickelt werden mussten. Diese waren willkommene Maßnahmen gegen die soziale Isolation und den Stillstand zentraler gesellschaftlicher Bereiche wie Arbeit oder Bildung über einen langen Zeitraum hinweg – auch wenn der digitale Ersatz von der Mehrheit der Bevölkerung als unzulänglich erlebt wurde. Darüber hinaus konnten die riesigen Datenmengen zu Impfungen, Testergebnissen oder Aufenthaltsorten der Infizierten kaum noch anders als digital erfasst werden. Diese Daten erlaubten es dann ihrerseits, Verbreitung, Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Ansteckungsrisiko des Coronavirus zu berechnen. Dieses positive Anschauungsbeispiel aus einer gesellschaftlichen und internationalen Krisenzeit kann die kaum zu bestreitenden Vorteile der Digitalisierung gut vor Augen führen. Angesichts solcher hilfreichen Nutzanwendungen setzen viele Menschen große Hoffnungen in den digitalen Wandel, der zahlreiche drängende soziale und ökologische Probleme lösen und die Chancen der Menschen auf ein gutes Leben erhöhen könnte.
Für Skeptiker und Kritiker dieser Veränderungsdynamik ist jedoch die omnipräsente Rede von „Digitalisierung“ regelrecht zum Reizwort geworden (vgl. BaubergerBauberger, Stefan, 1). Je stärker sich die DigitalisierungDigitalisierung und ihre Auswirkungen im täglichen Leben bemerkbar machen, desto mehr breiten sich ernstzunehmende Bedenken sowie diffuse Bedrohungsgefühle in der Bevölkerung aus: etwa die Furcht vor dem Verlust von Arbeitsplatz und Privatsphäre infolgePrivatsphärePrivatheit permanenter ÜberwachungÜberwachung, oder diejenige vor ManipulationenManipulation der eigenen Entscheidungen durch algorithmenbasierte Suchmaschinen oder individualisierte Werbung. Insbesondere in der westlichen Science-Fiction-Kultur hat das Ausmalen von Katastrophenszenarien wie der Versklavung oder Auslöschung der Menschen durch überlegene und grausame Roboter bereits eine lange Tradition. Apokalyptische Ängste werden häufig verstärkt durch den weit verbreiteten Eindruck, dass wir in immer schnellerem Tempo von informationstechnologischen Innovationen überrollt werden und den Umwälzungen ohnmächtig ausgeliefert sind. Sie scheinen eine so starke Eigendynamik zu entwickeln, dass die Menschen kaum mehr nachkommen und die KontrolleKontrollproblem/-verlust verlieren. Demgegenüber scheint bei vielen Entwicklern, Forschern und technikaffinen Menschen die Faszination von den enormen technologischen Fortschritten eine Euphorie auszulösen, die zur Realisierung alles technisch Machbaren drängt. Angesichts immer intelligenterer und autonomerer Roboter und leistungsfähigerer Anwendungen Künstlicher Intelligenz werden die Fragen virulent, ob die Maschinen nicht die „besseren Menschen“ sind und der „unterlegene Mensch“ nicht technologisch aufgerüstet oder gar ganz durch intelligente Computer ersetzt werden soll (s. Kap. 3.4). In dieser Einführung wird versucht, reflexive Distanz und philosophische Gelassenheit zu wahren und einen Mittelweg zwischen dystopischen Zukunftsängsten und utopischer Technikbegeisterung zu gehen.
PrivatsphäreRechtDa die Digitalisierung weitreichende informationelle GrundversorgungRechtAuswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche wie z.B. Arbeit, Bildung, Politik, Justiz oder Gesundheit hat, WürdeRechthandelt es sich um eine GrundrechteRecht„Querschnittserscheinung“ (NassehiNassehi, Armin 2022, 1160). Dieses Querschnittsthema erfordert daher einen interdisziplinären Zugang und eine Zusammenarbeit von Ingenieur- und Informatikwissenschaften einerseits und Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften andererseits (vgl. RothRoth, Stefan u.a., V; HengstschlägerHengstschläger, Markus, 11). Im vorliegenden Buch wird eine philosophisch-geisteswissenschaftliche ethische Perspektive auf die Umwälzungsprozesse der Digitalisierung eingenommen, bei der ethische Fragen nach einem verantwortungsvollen Umgang mit den neuen technologischen Möglichkeiten im Zentrum stehen. Auf der Grundlage der ausführlich dargestellten normativen Leitideen soll Orientierung in einer sich rasch wandelnden und immer komplexer werdenden Welt ermöglicht werden, um die negativen Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ganz zu vermeiden oder abzumildern. Zur Anwendung kommen dabei philosophische Methoden wie Begriffsanalyse, kritische Prüfung der Stichhaltigkeit von Argumenten, das Aufzeigen von Widersprüchlichkeiten in Standpunkten und ihren Voraussetzungen sowie die systematische Auswertung von Lebenserfahrung und wissenschaftlicher Forschung. Vorschnelle Übergeneralisierungen und Spekulationen, simple Totschlagargumente und unfruchtbare Polarisierungen werden durch begriffliche Präzisierungen und das Heranziehen differenzierender Konzepte aus der Wissenschaft in ihre Grenzen verwiesen. Ziel ist es, das kritische Bewusstsein der Leser zu fördern und zur Versachlichung und Rationalisierung der Debatte beizutragen. Die Leser sollen ethische Argumentations- und Reflexionskompetenzen erwerben und dazu ermutigt werden, sich mit eigenen begründeten Stellungnahmen an der gesellschaftlichen Diskussion über die normative Gestaltung der zukünftigen digitalen Entwicklung zu beteiligen. Damit verbunden ist die Hoffnung, demokratische Prozesse zu fördern und weitere wissenschaftliche Forschung zur Durchdringung der komplexen Thematik anzuregen.
Wenn man sich eine eigene qualifizierte Meinung zu den Technologien und Möglichkeiten ihrer Gestaltung bilden will, ist ein grundlegendes Verständnis der behandelten Gegenstände und Entwicklungen unabdingbar. Für alle Leser ohne technisches Basiswissen werden daher die zur Diskussion stehenden technischen Anwendungen jeweils zu Beginn möglichst knapp und einfach erläutert. Die empirische Verfasstheit der in der praxisorientierten „Angewandten Ethik“ verhandelten Probleme erfordert grundsätzlich auch deskriptive Analysen. In dieser Einführung werden die wichtigsten, in der ÖffentlichkeitÖffentlichkeitfragmentarisierteFragmentierung am meisten diskutierten Konfliktfelder erörtert, indem die verschiedenen Positionen und Argumentationen möglichst ausgewogen und sachlich dargestellt und gegeneinander abgewogen werden. Die Verantwortungsträger auf den verschiedenen Verantwortungsebenen werden klar benannt und Empfehlungen geeigneter moralischer (und rechtlicher) Regulierungsmaßnahmen formuliert. Das Buch erschöpft sich aber nicht in einer Zusammenstellung von ethischen Prinzipien, Ethikrichtlinien und konkreten Sollensforderungen in der Art eines Praxishandbuchs. Denn ethische Reflexionen und Bewertungen einzelner Technologien in ihren jeweiligen konkreten Anwendungskontexten greifen in der Digitalisierungsdebatte eindeutig zu kurz, weil sie immer in größere ökonomische und soziokulturelle Zusammenhänge gestellt werden müssen (vgl. BaubergerBauberger, Stefan, IX). Um die ethischen und gesellschaftspolitischen Chancen und Risiken der neuen oder sich in der Planungs- und Forschungsphase befindlichen Technologisierungsprozesse einschätzen zu können, sind auch ihre tieferliegenden Auswirkungen auf das individuelle und gesellschaftliche Leben bestmöglich zu erfassen. Dafür werden neben philosophischen und technikethischen auch psychologische, sozial- und kulturwissenschaftliche Studien herangezogen. Außerdem führen technologische Entwicklungen immer wieder zu grundlegenden hermeneutischen, erkenntnistheoretischen oder anthropologischen Fragestellungen, die auf der Grundlage der normativen Ethik reflektiert werden müssen.
Neben der Klärung der in der Digitalisierungsdebatte vielfach sehr unterschiedlich verwendeten Begriffe und Konzepte ist es ein großes Anliegen dieser Einführung, das hochkomplexe Themenfeld zu strukturieren. Die systematische, kleinteilige Gliederung soll helfen, den Überblick bei all den neuen Herausforderungen nicht zu verlieren. Diesem Zweck dient eine einfache grobe Einteilung in vier Kapitel: Der Hauptteil zwischen Einleitungskapitel (Kap. 1) und dem Schlusskapitel (Kap. 4) ist untergliedert in die beiden großen Anwendungsfelder oder Hauptdisziplinen der Digitalen Ethik: die Digitale Medienethik (Kap. 2) und die KI-Ethik (Kap. 3). In Kapitel 1 werden die begrifflichen und normativen Grundlagen einer Digitalen Ethik entfaltet und in einen historischen und kulturellen Kontext gestellt. So geht es in Kapitel 1.1 etwa um ein tieferes Verständnis davon, was mit dem Modewort „digital“ eigentlich gemeint ist, welche Bedeutungsebenen die „Digitalisierung“ umfasst oder wann und wie das „Internet“ entstand. In Kapitel 1.2 werden unter anderem die Unterschiede zwischen Moral, Recht, Ethik, Angewandter Ethik und Digitaler Ethik erläutert sowie verschiedene Grundtypen der Ethik skizziert. Konzeptuell schwieriger zu fassen sind die wichtigsten allgemeinen ethischen Leitideen Freiheit, Glück/gutes Leben, Gerechtigkeit/Nichtdiskriminierung, Privatsphäre und Nachhaltigkeit, die in Kapitel 1.3 als normatives Fundament der weiteren Ausführungen etwas breiter erörtert werden. Spezifischere ethische Prinzipien, die vornehmlich in einer der beiden Teildisziplinen Thema sind, werden jeweils zu Beginn der entsprechenden Kapitel vorgestellt: etwa Wahrheit, Unparteilichkeit und Relevanz in der Medienethik und Transparenz, menschliche Aufsicht und Sicherheit in der KI-Ethik.
Kapitel 2: Bei der Digitalen MedienethikEthikMedien-Digitale Medienethik steht die menschliche Kommunikation, genauer der Austausch von Informationen zwischen Menschen im Vordergrund. Die Digitalisierung brachte neben neuen Kommunikationstechnologien auch neue Verbreitungswege über privatwirtschaftlichMedienökonomisch-privatwirtschaftliche organisierte Internet-Plattformen sowie einen erstarkenden Bürger- oder Laienjournalismus LaienjournalismusBürger-/(Graswurzel-)journalismusim Netz, die zu stark veränderten Kommunikationsbedingungen und einem neuen StrukturwandelStrukturwandelÖffentlichkeit der ÖffentlichkeitÖffentlichkeitStrukturwandel (der Öffentlichkeit) führten: Worin bestehen die grundlegenden Charakteristika der digitalen oder Online-Kommunikation im Kontrast zur analogen, und wie verändern sich dadurch die Interaktionsformen, Denk- und Lebensweisen der Menschen? Fördert oder gefährdet das Internet mit seiner egalitären und partizipatorischen Struktur die Demokratie, und wie ist mit den Gefahren der Desinformation, Emotionalisierung und sinkender Hemmschwellen umzugehen?
Kapitel 3: In der KI-EthikEthikKI- geht es nicht um die Interaktionen zwischen Menschen, sondern um den Einsatz von KI-Systemen als Werkzeugen und die Interaktionen zwischen Menschen und Robotern bzw. virtuellen Akteuren: Wie verändert die umfassende Datafizierung und die Suche nach Mustern und Trends in den entstehenden Massendaten das individuelle und gesellschaftliche Leben? Wie lassen sich bedrohte Grundrechte auf Freiheit, Privatheit oder Nichtdiskriminierung schützen? Wollen wir den eingeschlagenen Weg zu einer Robotergesellschaft gehen und was hat es für Auswirkungen auf das Leben, das Selbstverständnis und die MenschenbilderMenschenbilder, wenn Menschen mit immer intelligenteren und autonomeren Maschinen verglichen und zunehmend durch diese ersetzt werden?
Kapitel 4: Im kurzen Schlusskapitel werden auf Basis der vorangegangenen Erörterungen die Kernanliegen der Digitalen Ethik herausgestellt und einige Zukunftsszenarien kritisch beleuchtet.
1.1Begriffsklärungen und kultureller Hintergrund
1.1.1Bedeutungsebenen der Digitalisierung
„DigitalisierungDigitalisierung“ ist ein schillernder Begriff, zu dem es zahllose verschiedene Definitionsvorschläge beispielsweise mit einer technologischen oder ökonomischen Akzentuierung gibt. Er hat genauso wie das Adjektiv „digital“ eine inflationäre Entwicklung erfahren, sodass alles Mögliche in den Medien und im Alltag als „digital“ bezeichnet wird, das irgendwie mit Informations- und KommunikationstechnologienInformations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zusammenhängt (vgl. Corsten u.a., 10). Solche moderne Technologien werden allerdings schon viele Jahrzehnte lang genutzt, sodass sie noch kein hinreichendes Spezifikationsmerkmal darstellen können (vgl. ebd., 12). Nimmt man für das Verständnis dieses Sammelbegriffs die Etymologie zu Hilfe, geht der Terminus „digital“ auf das englische Wort „digit“ für „Ziffer, Zahl, Stelle“ zurück bzw. noch weiter auf das lateinische „digitus“: „Finger“. Die Verbindung zwischen Zahl und Finger könnte darin bestehen, dass Menschen in früheren Zeiten wie heute noch kleine Kinder mithilfe der Finger bis zehn zählten. Im englischen Sprachraum kamen die Ausdrücke „digitize“ und „digitization“ in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf, und seit den 1980er Jahren wird die deutsche Übersetzung „Digitalisierung“ verwendet. Während die deutsche Sprache aber nur den ungenauen Ausdruck „Digitalisierung“ kennt, differenziert die englische Sprache zwischen einem technischen Begriff einer „Digitization“ und einer über diesen technischen Kern hinausgehenden „Digitalization“. Auch wenn es trotz der Flut an Publikationen zum Phänomen der Digitalisierung keine einheitliche begriffliche Grundlage gibt, lassen sich doch drei verschiedene Bedeutungsebenen unterscheiden. Zusätzlich zur Unterscheidung im Englischen bezieht sich der Begriff der dritten Ebene auf die in der allgemeinen Einleitung geschilderten tieferliegenden strukturellen Umwälzungen.
1) Technischer Begriff: Digitization
2) Datenverarbeitung und Vernetzung: Digitalization
3) Struktureller Wandel: Digitale Transformation
Digitalisierung (1) als „DigitizationDigitalisierungDigitization“ auf einer ersten, elementaren Bedeutungsebene meint den rein technischen Vorgang der Umwandlung von analogen Daten oder Vorgängen in digitale Formate (vgl. KroppKropp, Cordula u.a., 10; Winter u.a., 1237; Schoder u.a., 1329). Ziel dieser ersten Stufe der Digitalisierung ist die Darstellung in einem Zahlensystem, genauer einem binären Code aus den beiden Ziffern 0 und 1. Die Zahl 0 steht dabei für den Zustand „Strom aus“, 1 für „Strom ein“. Diese kleinsten Informationseinheiten der komplexen digitalen Welt werden auch „Bits“ als Kürzel für „Binary Digit“: „Binärzahl“ genannt. Jeweils acht Bits werden zur nächsthöheren Einheit „Byte“ zusammengefasst, und Präfixe wie „Mega“-, „Giga“- oder „Petabytes“ bezeichnen ein Vielfaches von Byte (vgl. SpechtSpecht, Philip, 22). So benötigt beispielsweise der Buchstabe A in der Binärcode-Darstellung 8 Bits bzw. 1 Byte. Im Unterschied zu analogen Signalen liegen digitale Signale also nicht in einem Kontinuum vor, sondern in einem klar abgrenzbaren Zahlenformat. Während etwa bei einem am Himmel erscheinenden Regenbogen die einzelnen Farben ineinander überzugehen scheinen, wird bei seiner Digitalisierung jede einzelne Abstufung durch exakte Ziffern definiert. Daher wird „analog“ mit stufenlos, kontinuierlich und annähernd assoziiert, wohingegen „digital“ in einem allgemeinen Sinn für ganzzahlig, abzählbar, quantifiziert und gestuft steht. Auf diese Weise wird die analoge Welt für die digitale Konservierung und Informationsverarbeitung auf digitalen Geräten wie Computern oder Handys präpariert. Technisch möglich ist die „Digitization“ seit der Computerisierung in den 1940er Jahren. Zunächst waren Computer reine Rechner, bis es in den 1970er Jahren die ersten Computer mit einer graphische Benutzeroberfläche und mit dem Apple 1 den erste „Personal Computer“ (PC) gab. Damit war der Grundstein für den Zugang der breiten Bevölkerung zu Computern gelegt, die dann in immer mehr Lebens- und Arbeitsbereichen eingesetzt wurden. Seit den 1990er Jahren mit der Entwicklung des World Wide WebsWorld Wide Web (WWW) prägen sie den Alltag der meisten Menschen.
Informationen müssen in der digitalen Welt nicht mehr wie in der analogen in einer physischen und oft sehr unhandlichen und zerstörungsanfälligen Form wie beispielsweise auf Papier oder einer Schallplatte vorliegen. Sobald die Daten auf digitalen Geräten gespeichert sind und außerdem in ein Netzwerk gelangen, stehen sie örtlich ungebunden und innerhalb des Netzwerkes uneingeschränkt zur Verfügung, und ihr Verlust ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Digitale Kopier- und Suchfunktionen erleichtern zudem das Speichern und Wiederfinden von Dateien oder Dateiinhalten. Ein Zettel kann hingegen in einer Schublade verschwinden, oder ein Buch muss komplett gelesen werden, um eine Passage zu finden. Zu den einfachsten und frühsten Beispielen für eine „Digitization“ gehört das Digitalisieren von Papierdokumenten in digitale Textformate, das in den 1950er Jahren begann. Das 1971 gegründet „Projekt Gutenberg“ gilt als das erste groß angelegte Digitalisierungsvorhaben für Bücher und Schriften und ist die älteste digitale Bibliothek der Welt. Bereits ab den 1990er Jahren können auch Bilder, Audios und Videos digital codiert werden. Verschiedenste analoge MedienMedienanaloge vs. digitale wurden in digitale transformiert wie z.B. Schallplatten in CDs oder Kassetten in MP3-Dateien. Außerdem lassen sich analoge Abläufe in digitale Prozesse umwandeln, indem z.B. eine Dokumentanlage mit Ordnern in ein digitales Dokumentenmanagement überführt wird. Schließlich können auch physische Dinge oder Zustände, körperliche Vorgänge und Verhaltensweisen von Personen digital repräsentiert werden und bekommen so ein digitales Abbild. Aufgrund der Omnipräsenz von Computern, Smartphones und Sensoren z.B. am eigenen Körper, in der Natur, am Arbeitsplatz oder in der industriellen Produktion erfolgt heute die Erstellung und Speicherung von Daten zum großen Teil direkt in digitalen MedienMedienanaloge vs. digitale (vgl. KroppKropp, Cordula u.a., 8). Viele am Computer geschriebene Bücher erscheinen nur noch online, und Fotos einer Handykamera werden als Vielzahl von Pixeln, d.h. binären Zahlenreihen dargestellt. Diese erste und fundamentalste technische Form der DigitalisierungDigitalisierungDigitization als solche erscheint zwar ethisch weitgehend unproblematisch, weil die digitalisierten Phänomene nicht verändert, sondern nur anders repräsentiert werden. Die „Digitization“ ebnet aber z.B. den Weg für eine Kontrolle und Überwachung der Datenproduktion.
Während sich die technische Digitalisierung auf der ersten Bedeutungsebene noch relativ klar und eindeutig definieren lässt, sind die Begriffsbestimmungen auf den beiden folgenden Stufen nicht mehr trennscharf voneinander abgrenzbar. Eine Hierarchie verschiedener Stufen des digitalen Wandels liegt insofern vor, als für das Erreichen der jeweils höheren Ebenen die darunterliegenden Transformationen erforderlich sind (vgl. Schoder, 1328): Bei der zweiten Stufe der Digitalisierung (2) oder „DigitalizationDigitalisierungDigitalization“ geht es im Wesentlichen um die Datenverarbeitung und die Vernetzung von digitalen Endgeräten über Daten (vgl. Winter u.a., 1237; PiallatPiallat, Chris, 21f.). Die technischen Vorgänge der digitalen Aufzeichnung und die Transformation in die digitale Universalsprache im Sinne der „Digitization“ schaffen die Voraussetzungen für die Vernetzung von Menschen, Maschinen oder Institutionen in der realen Welt mit ihren virtuellen Repräsentanten in der digitalen Welt. Der interaktive Charakter der Digitalisierung (2) kommt erst zum Vorschein, wenn mit digitalen Geräten wie Computern oder Smartphones z.B. über Telefon- oder Glasfaserkabel und drahtlose Kommunikationsformen wie WLAN oder Mobilfunk miteinander kommuniziert werden kann. Bei dieser digitalen Informationsübertragung über binäre Codes werden die Signale nicht wie bei der analogen exakt proportional in eine besser übertragbare Signalform umgewandelt (vgl. SpechtSpecht, Philip, 24). So werden z.B. beim Aufnehmen einer Schallplatte die Schallwellen in Druck umgewandelt, um mit seiner Hilfe proportional zu seiner Stärke die Rillen in die Platte zu prägen. Mit fortschreitender Digitalisierung können durch elektronische Impulsübertragung über Internetknoten im weltweiten Netz in enormer Geschwindigkeit Daten ausgetauscht und vielseitige, übergreifende Interaktionen und Operationen zustande kommen. Die zunehmende Anschlussfähigkeit führt zu einer sprichwörtlich grenzenlosen Verknüpfbarkeit des Digitalisierten im virtuellen Raum (vgl. KroppKropp, Cordula u.a., 14f.). Ein anschauliches Beispiel für diese integrative Vernetzung ist das sogenannte Internet der DingeInternetof Things (IoT), das z.B. reale Dinge wie Kühlschränke, Heizungen, Fernsehen und Smartphone in einem Smart Home miteinander oder etwa auch verschiedene Industriemaschinen mit Computern in Unternehmen verknüpft (vgl. Corsten u.a., 11).
„DigitalisierungDigitalisierungDigitalization“ im Sinne der „Digitalization“ (2) wird jedoch in vielen Definitionen auf den ökonomischen Bereich verengt. Das Schlagwort steht dann für eine strategisch auf Effizienz und Effektivität ausgerichtete Veränderung der Steuerung von Produktions- und Geschäftsprozessen oder für völlig neue Geschäftsmodelle unter Nutzung digitaler Technologien wie Internet oder Algorithmen (vgl. Schoder u.a., 1329; Corsten u.a., 13). An einem simplen Beispiel erklärt müssen Arbeitskräfte ihre Arbeitszeiten nicht mehr in Papierformulare eintragen, sondern erledigen dies über einen vorinstallierten Screen oder ein iPad oder mittels Chip-Card beim Ein- und Auschecken. Die Digitalisierung eines Geschäftsmodells am Beispiel des digitalen Unternehmens „Netflix“ könnte allerdings auch als Beispiel für die „digitale Transformation“ auf der nächsthöheren Stufe herangezogen werden: Der Filmverleih findet nicht mehr analog statt, indem die Kunden in einem Kaufhaus oder einer Bibliothek DVDs kaufen oder leihen, sondern die digitalisierten Filme werden „gestreamt“ oder „downgeloadet“. Im Unterschied zur bloßen Umwandlung von analogen in digitale Formate auf der ersten Stufe der Digitalisierung (1) sind mit der Verarbeitung und Vernetzung von Daten teilweise erhebliche ethische Probleme verbunden, die in diesem Buch in verschiedenen Anwendungskontexten zur Diskussion stehen werden (s. Kap. 3.2). Als beispielsweise Google 2004 in einem ersten großen privaten Digitalisierungsprojekt rund 20 Millionen Bücher aus Beständen großer Bibliotheken digitalisierte und zur Volltextsuche bereitstellte, löste dieses Vorgehen einen heftigen Streit über das UrheberrechtUrheberrecht und das private Monopol über das digitale Erbe der Buchkultur aus (vgl. StalderStalder, Felix, 105f.). 2008 wurde daraufhin die virtuelle Bibliothek „Europeana“ ins Leben gerufen, um einen gemeinsamen Zugang zu Online-Archiven europäischer Kulturinstitutionen zu schaffen.
Für die dritte und weitreichendste Stufe der DigitalisierungDigitalisierungdigitale Transformation werden unterschiedliche Umschreibungen wie etwa „digitale Wende“, „digitale Transformation“ oder „digitale RevolutionRevolution (4./digitale)“ verwendet. Auf dieser Ebene der Digitalisierung (3) geht es nicht mehr um einzelne konkrete Anwendungen oder neue technische Möglichkeiten der Digitalisierung, sondern um einen tiefgreifenden und umfassenden strukturellen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft (vgl. Schoder u.a., 1331). Das Adjektiv „strukturell“ meint wie bei anderen Wortkombinationen z.B. in „struktureller Gewalt“ oder „struktureller Diskriminierung“, dass ein Phänomen grundlegend in der ganzen Organisation des gesellschaftlichen Miteinanders oder dem System der Gesamtgesellschaft verankert ist. Im Bereich von Unternehmen steht das Schlagwort „digitale Transformation“ allerdings meist für radikale Veränderungsprozesse durch den Einsatz von innovativen (oder disruptiven) Informationstechnologien zur beträchtlichen Steigerung der wirtschaftlichen Leistung, sodass eine Abgrenzung gegenüber der „Digitalization“ (2) schwierig ist (vgl. Schoder u.a., 1329; Adlmaier-Herbst u.a., 1217). Es ließe sich auf Unterscheidungskriterien wie innovative versus disruptive Technologien oder eine Abfolge verschiedener industrieller Revolutionen zurückgreifen: Disruptive Technologiendisruptive Technologien sind solche, die bestehende Technologien praktisch vollständig verdrängen wie z.B. die CD die Schallplatte. Von einer digitalen Disruption wird bei einem plötzlichen radikalen Wandel in bestimmten Wirtschaftsbranchen als Effekt des exponentiellen Fortschritts in der Digitalisierung gesprochen (vgl. SpechtSpecht, Philip, 67). Dazu lassen sich die Substitution des oben erwähnten CD-Verkaufs durch Online-Streamingdienste in der Musikindustrie oder die Ablösung der Festnetztelefonie durch Mobilfunk und Internettelefonie in der jungen Generation zählen. Die größten Disruptionen sind jedoch von der Entwicklung Künstlicher Intelligenz etwa in der Banken-, Versicherungs- und Bauindustrie zu erwarten. Bei der nicht immer genau gleich vorgenommenen Einordnung in verschiedene „industrielle RevolutionenRevolution (4./digitale)“ geraten demgegenüber größere strukturelle Veränderungen im Wirtschaftssektor in den Blick:
Die in England Ende des 18. Jahrhunderts einsetzende und vielerorts erst im 19. Jahrhundert durchgreifende erste industrielle Revolution markiert den Übergang vom Manufakturwesen mit Heim- und Handarbeit zur mechanisierten Produktion, bei der große mechanische Produktionsanlagen z.B. mit Maschinenwebstühlen von Dampf- und Wasserkraft angetrieben werden konnten (vgl. SpechtSpecht, Philip, 298f.; KroppKropp, Cordula u.a., 15f.; Holfelder u.a., 2f.).
Ende des 19. Jahrhunderts brachte die zweite industrielle Revolution die Elektrifizierung der Produktionsanlagen und ermöglichte damit standardisierte Wertschöpfungsketten mit Fließbandarbeit und Massenproduktion.
Die unter der Bezeichnung digitale Revolution firmierende dritte industrielle Revolution wurde in den 1970er Jahren durch den Einsatz von Elektronik und Informationstechnologie ausgelöst und führte zu einer Computerisierung und Automatisierung der Produktion.
Die sich ab Mitte der 1990er Jahre vollziehende vierte industrielle Revolution wird gleichfalls häufig als digitale oder aber als cyberphysische Revolution bezeichnet und meint die elektronische Vernetzung und Einbindung der ganzen Wertschöpfungskette mit Maschinen, Steuerungsgeräten, Prozessen, Produkten etc. in der digitalen Welt intelligenter Systeme (vgl. KroppKropp, Cordula u.a., 16; SpechtSpecht, Philip, 299f.). Damit wäre die Industrie 4.0 mit einem tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Arbeit erreicht, benannt nach den bei Softwareprogrammen üblichen, ständig aktualisierten Versionsbezeichnungen.
In diesem Buch soll die digitale Transformation aber keineswegs auf disruptive Revolutionen im ökonomischen Bereich verengt werden, weil die digitalen Technologien noch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Verwaltung, Bildung, Wissenschaft, Medien, Recht etc. zu Umbrüchen führen. Vor allem aber kommt es durch die Weiterentwicklung und Ausbreitung neuer Technologien auf verschiedenen Ebenen zu vielen Wechselwirkungen und neuen systemischen Möglichkeiten, die nicht auf einzelne Vorgänge der Digitalisierung zurückgeführt werden können (vgl. Schoder u.a., 1331; NassehiNassehi, Armin 2022, 1160f.). Solche Tiefenströmungen eines kulturellen Wandels werden auch als Megatrends oder Metaprozesse bezeichnet (vgl. Adlmaier-Herbst u.a., 1212; ZöllnerZöllner, Oliver 2020b, 223; PiallatPiallat, Chris, 201). Das „Meta“ (griech. „nach, hinter“) in der letzteren Begriffsfügung wird vorangestellt, weil eine solche fundamentale Transformation vielen anderen Veränderungsprozessen gleichsam „übergestülpt“ wird und die Gesellschaft und ihre Institutionen prägt (vgl. Zöllner 2020a, 223). „Megatrends“ oder „Metaprozesse“ sind Treiber eines umfassenden Kulturwandels, der die Einstellungen, das Selbst- und Weltverständnis und die Lebens- und Handlungsweisen der Menschen prägt. Aus einer kultur- und geisteswissenschaftlichen Perspektive stehen weniger einzelne technische und ökonomische Veränderungen im Fokus des Interesses als vielmehr solche fundamentale Auswirkungen auf die gesamte Lebenswelt. Philosophen und Soziologen haben versucht, die „Digitalisierung als eine gesellschaftliche Kulturerscheinung“ zu verstehen und zu beschreiben (Nassehi 2019, 26), und das Verbindende des „einzigen makroskopischen Trends“ zu fassen, das hinter all den verschiedenen Phänomenen und Bedeutungsebenen der Digitalisierung steckt (FloridiFloridi, Luciano, 7). Felix StalderStalder, Felix charakterisiert die Kultur der DigitalitätDigitalität mit den Merkmalen (1) „Referentialität“ aufgrund des digital codierten, leicht reproduzierbaren und bearbeitbaren kulturellen Materials; (2) „Gemeinschaftlichkeit“ als kollektivem Referenzrahmen dank eines offenen Austauschs in neuen Medien mit kollaborativen Plattformen; und (3) „Algorithmizität“ infolge zunehmend automatisierter Entscheidungsverfahren bei der Formung und Reduktion der Informationsflüsse (vgl. Stalder, 13). Von Armin Nassehi werden neben der digitalen Vernetzung insbesondere die durch Algorithmen geleistete Strukturierung, Typisierung und Musterbildung herausgearbeitet (vgl. 2019, 53). Die von Steffen MauMau, Steffen soziologisch analysierte Kultur der QuantifizierungQuantifizierung (d. Sozialen) wurde durch die neuen digitalen Möglichkeiten des Vergleichens, Messens und Rankings enorm begünstigt (vgl. Mau, 11; s. Kap. 3.2.1).
Bedeutungsebenen der Digitalisierung
1)
DigitizationDigitalisierungDigitization: technische Umwandlung von analogen Daten oder Vorgängen in digitale Formate durch Darstellung in einem binären Zahlensystem
2)
DigitalizationDigitalisierungDigitalization: Datenverarbeitung und Verknüpfung von digitalen Endgeräten bzw. digital repräsentierten Dingen, Personen, Prozessen etc.
3)
Digitale TransformationDigitalisierungdigitale Transformation: umfassender, tiefgreifender struktureller Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft, der das Welt- und Selbstverständnis der Menschen prägt
1.1.2Algorithmen, Internet und Künstliche Intelligenz
Im Zusammenhang mit der DigitalisierungDigitalisierung fallen in öffentlichen Debatten viele Schlagwörter wie „Internet“, „Künstliche Intelligenz“, „Algorithmen“ und „Big Data“, die selten explizit definiert und häufig synonym zu „Digitalisierung“ verwendet werden. Die Grundbausteine der Digitalisierung und digitaler Technologien bilden Algorithmen, die digitale Geräte wie Computer oder Smartphones erst zum Laufen bringen. Algorithmen sind ganz generell Anweisungen, die dazu anleiten, Schritt für Schritt ein bestimmtes Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen (vgl. BendelBendel, Oliver 2022, 6; LenzenLenzen, Manuela 2020, 29; Schneider, 59). Analoge Algorithmen sind in einer natürlichen Sprache verfasst und sind solange harmlos, als sie zu einem guten Ziel dienen, z.B. der Zubereitung einer Mahlzeit dank der schrittweisen Ausführung eines Kochrezepts. Im Zusammenhang mit Digitalisierung geht es aber ausschließlich um digitale AlgorithmenAlgorithmen in einer formalen Sprache bzw. Programmiersprache, d.h. um digital-formalisierte Handlungsanweisungen (vgl. WadephulWadephul, Christian, 58). Während ein frühes Beispiel eines analogen mathematischen Algorithmus der Euklidische Algorithmus wäre, kam es erst im 18. und 19. Jahrhundert zu Meilensteinen auf dem Weg zur Entwicklung von digitaler Technologie: Der britische Mathematiker Charles Babbage präsentierte 1822 die erste funktionierende Rechenmaschine (vgl. Heinrichs u.a., 3f.). Alan TuringTuring, Alan, ebenfalls britischer Mathematiker sowie Informatiker, entwickelte 1936 ein mathematisches Modell, die sogenannte Turing-Maschine, die das schrittweise Vorgehen eines Algorithmus mathematisch darstellbar machte (vgl. ebd., 4f.; MisselhornMisselhorn, Catrin 2019, 19). Ihre physikalische Umsetzung in einem frei programmierbaren Digitalrechner gelang aber erst 1941 dem deutschen Bauingenieur und Erfinder Konrad ZuseZuse, Konrad, und auch der ungarisch-amerikanischen Mathematiker John von NeumannNeumann, John von leistete einen entscheidenden Beitrag zur modernen Computertechnik (vgl. Heinrichs u.a., 6; Misselhorn 2019, 20).
Immer ausgefeiltere und komplexere Algorithmen führten schließlich zur Künstlichen Intelligenz, die im übernächsten Abschnitt erläutert wird: KI wird stets in Computerprogrammen realisiert, sodass es sich von dieser technischen Seite aus betrachtet um nichts anderes als den computergestützten Einsatz von Algorithmen handelt (vgl. LenzenLenzen, Manuela 2020, 25; CoeckelberghCoeckelbergh, Mark, 70; Hammele u.a., 154). Mit fortschreitender Schwierigkeit der zu lösenden Problemstellungen werden diese Algorithmen und ihr Zusammenspiel immer komplexer und damit schwerer durchschaubar. Dies führt zum Problem mangelnder Transparenz und erhöht die Anfälligkeit für Widersprüche, Fehler und ethisch problematische Resultate, auf das in der KI-Ethik zurückzukommen ist (vgl. Lenzen 2020, 30; Kap. 3.1.2; 3.1.3.1). Da die zur Verfügung stehenden Daten im Zuge der Digitalisierung enorm angewachsen sind („Big Data“), werden Befürchtungen vor einer totalitären „Macht der Algorithmen“ oder einer „algorithmic governance“ lauter. Verwiesen wird auf die chinesische Kontrollgesellschaft mit einem „Social ScoringSocial Scoring“-System (s. Kap. 3.2.4). In vielen Bestsellern werden AlgorithmenAlgorithmen als „Ausgeburt“ von allem Schlechten und als größte Gefahr für die Menschheit und die Demokratie dargestellt (vgl. dazu Schneider, 59; WadephulWadephul, Christian, 57). So lautet etwa der Originaltitel von Kathy O’Neil Weapons of Math Destruction, in der deutschen Ausgabe Angriff der Algorithmen. Wie sie Wahlen manipulieren, Berufschancen zerstören und unsere Gesundheit gefährden (2017). Der eher weniger gebräuchliche Terminus AlgorithmenethikEthikAlgorithmen- wird teilweise synonym zu einer Digitalen Ethik verwendet oder als Teilbereich der KI- oder Maschinenethik (vgl. Bendel 2022, 6Bendel, Oliver; BaubergerBauberger, Stefan u.a., 910). Er spielt darauf an, dass Algorithmen erhebliche Auswirkungen auf das Wohl der Menschen haben oder dass man ihnen eine Art Moral beibringen sollte.
Vom „Internet“, wörtlich übersetzt „Zwischennetz“, war im vorangegangenen Kapitel schon häufig die Rede. Es gilt zu Recht als stärkster Motor oder Katalysator der Digitalisierung und als wichtigste Innovation, die der Digitalisierung zum Durchbruch verhalf (vgl. SpechtSpecht, Philip, 49). Das InternetInternet ist ein weltweites physisches Computernetzwerk aus vielen technischen Geräten (wie z.B. Switches oder Routern), das über ein einheitliches Kommunikationsprotokoll (TCP/IP) die Kommunikation zwischen allen Computern und Handys mit Internetanschluss regelt (vgl. Bendel 2022, 139). Die Anfänge vom „Netz der Netzwerke“ reichen in das Jahr 1969 zurück, als die erste Netzwerkverbindung ARPANET im Rahmen des vom US-Verteidigungsministerium initiierten Projekts zur Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen entstand. Der Geburtstermin kann aber auch zu späteren Zeitpunkten festgemacht werden, beispielsweise als das WWWWorld Wide Web (WWW) durch den am Schweizer CERN tätigen britischen Physiker und Informatiker Tim Berner Lee 1989 öffentlich zugänglich gemacht wurde (vgl. PiallatPiallat, Chris, 24; Specht, 49f.). Ab 1970 ermöglichte eine steigende Zahl an digitalen Plattformen wie Diskussionsformen oder Chat-Diensten die Kommunikation und den Austausch von Dateien zwischen Menschen aus aller Welt (s. Kap. 2.1). Schlagartig populär wurde das Internet aber erst mit dem Aufkommen des WWW und seinen inzwischen auf über eine Milliarde angewachsenen Websites. Im Unterschied zum InternetInternet als physischem Netzwerk ist das World Wide WebWorld Wide Web (WWW) (kurz WWW) eine nichtphysische Applikation, die auf der Infrastruktur des Internet aufbaut und den Internetnutzern den Zugriff auf die Text- und Bilddokumente der verschiedenen miteinander verlinkten Websites erlaubt (vgl. Specht, 56). Kurz nach der Jahrtausendwende erlebten soziale Netzwerkesoziale Netzwerke einen enormen Aufschwung, sodass sie heute von vielen Nutzern mit dem Internet gleichgesetzt werden (vgl. Bendel 2022, 140Bendel, Oliver).
Zu Beginn seiner weltweiten Verbreitung in den 1990er Jahren wurde das InternetInternet als eine Sphäre betrachtet, die als „CyberspaceCyberspace“ oder „Virtual RealityVirtual Reality (VR)“ von der „realen“ oder „echten“ Welt abgetrennt existiert (vgl. Schmidt, 284). Befördert wurde diese Sichtweise durch die lange Zeit sehr populären Online-Rollenspiele wie „World of Warcraft“ oder „Second Life“, wo man sich völlig frei eine zweite virtuelle Welt erschaffen und gestalten kann. Diese Trennung in unterschiedliche Sphären oder Handlungsbereiche suggerierte, dass in diesen jeweils ganz unterschiedliche Regeln, moralische Normen und Gesetze gelten. Obwohl diese Vorstellungen bis heute Spuren hinterlassen, sind die Online- und Offline-Welten mittlerweile vielfältig miteinander verflochten und durchdringen einander zusehends (vgl. ebd., 285). Auch beim Konzept des „Metaverse“ sollen physische, virtuelle und erweiterte Realität („Augmented RealityAugmented Reality“) miteinander verschmelzen: Menschen bewegen sich zwar als AvatareAvatare in einer virtuellen Welt, die aber die gleichen Funktionen erfüllt wie die reale und Auswirkungen auf diese hat, z.B. beim Bestellen einer Pizza oder dem Gang zum Ordnungsamt (s. Kap. 4). Das InternetInternet ist auch keineswegs ein rechtsfreier Raum, wie immer noch von vielen Internetnutzern angenommen wird, sondern es gelten online grundsätzlich die gleichen moralischen und rechtlichen Regeln wie offline (s. Kap. 2, insbesondere Kap. 2.2.4). Als Synonym zu der in Kapitel 2 behandelten „Digitalen MedienethikDigitale Medienethik“ wird bisweilen von einer InternetethikEthikInternet-, „Netzethik“ oder „Ethik des Internets“ gesprochen, die sich mit den ethischen Problemen beim Umgang mit digitalen Massenmedien befasst (vgl. Fenner 2022, 378; Hausmanninger u.a.; Schmidt 2016). Viele darin behandelten Probleme wie z.B. Cybermobbing, Desinformation und Hassrede sind besonders virulent in sozialen Medien, sodass die Frage ihrer Regulation und Kontrolle immer dringender wird.
Der Begriff „Künstliche IntelligenzKI (Künstliche Intelligenz)“ ist mindestens so populär wie „Digitalisierung“, wird als „Speerspitze der Digitalisierung“ bezeichnet und dient häufig als „Platzhalter“ für sämtliche digitalen Themen (vgl. BaubergerBauberger, Stefan, 1; Bauberger u.a., 908). Angesichts der großen und anhaltenden öffentlichen Aufmerksamkeit für diese neue Technologie hat sich die Charakterisierung von technischen Artefakten als „künstlich intelligent“ oder „smart“ zu einem inflationären Marketinginstrument entwickelt: Zahnbürsten, Armreifen, Handys, Kameras, Fernseher, Kühlschränke oder Autos erhalten oft unberechtigterweise das Etikett „smart“ oder werden mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht, um sie interessanter zu machen und besser zu verkaufen. Zwar fehlt bis heute eine allgemein anerkannte Definition von Künstlicher Intelligenz (KI), und auf die begrifflichen Schwierigkeiten wird erst in Kapitel 3 zur KI-Ethik näher eingegangen. Es handelt sich aber grob gesprochen um ein Forschungsfeld der Informatik, das bei Menschen als „intelligent“ bezeichnete Denk- oder Handlungsweisen auf Computern nachzubilden versucht (vgl. Bendel 2022, 156; Hoeren u.a., 2) Bendel, Oliver. Gleichzeitig wird KI auch für die entsprechenden von Informatikern entwickelten Technologien verwendet, die entweder das Verständnis menschlicher Kognition verbessern oder praktische Zwecke erreichen sollen (vgl. CoeckelberghCoeckelbergh, Mark, 67; LenzenLenzen, Manuela 2018, 31; Heinrichs u.a., 17). Die rasant fortschreitende Entwicklung in diesem Forschungsbereich führt dazu, dass beinahe täglich von den Medien neue technologische Errungenschaften gemeldet werden. Diese sorgen nicht nur unter Spezialisten, sondern in einer breiten Öffentlichkeit für großes Aufsehen und Diskussionen. Zu denken ist an den erwähnten, 2022 allgemein zugänglich gemachten Chatbot ChatGPT, der zur „generativen KI“ zählt und neue Inhalte erstellen kann (s. Kap. 3.3.4). Unter anderem wurde er daher von Studierenden zum Verfassen von Hausarbeiten begeistert aufgenommen, was seitens der Bildungseinrichtungen eine hektischen Suche nach geeigneten Regulierungsmaßnahmen auslöste. Die vielfältigen Herausforderungen der KI-Ethik werden in Kapitel 3 zur Sprache kommen.
Als Geburtsstunde der KI-Forschung gilt die vom IT-Pionier John MacCarthy im SommerSommer, Andreas 1956 organisierte Dartmouth-Konferenz in den USA, bei dessen Antrag auf Fördermittel zum ersten Mal der Begriff „Artificial Intelligence“ verwendet wurde (vgl. SpechtSpecht, Philip, 223; CoeckelberghCoeckelbergh, Mark, 66; RamgeRamge, Thomas 2018, 32f.). Nach ersten kleineren Erfolgen dieser neuen akademischen Disziplin in den 1960er Jahren z.B. mit Strategiespielen wie Schach, Chatbot-Prototypen oder halbautonomen Robotern folgte ein sogenannter KI-Winter, d.h. eine Zeitspanne ohne nennenswerte Fortschritte und mit zurückgehendem wirtschaftlichem und öffentlichem Interesse (vgl. Ramge 2018, 35f.; Müller, 18; Specht, 223). Erst ab den 1990er Jahren gab es wieder merkliche Fortschritte und es kam zu weltweiten Schlagzeilen wie dem Sieg des Schachcomputers „Deep Blue“ über den damaligen Weltmeister Garry Kasparow 1996 oder dem ersten autonomen Fahrzeug, das 2005 eine vorgegebene Strecke von 213 km bewältigte. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erlebte die KI aufgrund des Aufkommens großer Datenmengen und leistungsfähiger Computer einen großen Aufschwung. Erste Anwendungen im Bereich von Sprachassistenten und personalisierten Empfehlungen wurden dadurch ermöglicht. Bis heute wurde der Terminus „Künstliche IntelligenzKI (Künstliche Intelligenz)“ dergestalt erweitert, dass bisweilen die ganze Computerwissenschaft und High-Technologie darunter gefasst wird (vgl. Müller, 18). Dieser enormen Popularität ist es wohl geschuldet, dass die meisten Menschen bei „Digitalisierung“ an KI denken. DigitalisierungDigitalisierung ist aber keineswegs gleichbedeutend mit KI, sondern schafft im Sinne der oben definierten ersten Stufe der technischen „Digitization“ (1) erst einmal die Voraussetzung für jede Form informationsverarbeitender Systeme und damit auch für KI (vgl. LenzenLenzen, Manuela 2020, 15). Gemäß den beiden anderen Bedeutungsebenen (2) und (3) handelt es sich jedoch bei der Digitalisierung um einen tiefgreifenden und umfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel, der über einzelne technologische Neuerungen mit KI hinausgeht (s. Kap. 1.2).
Begriffliche Abgrenzungen
AlgorithmenAlgorithmen: Computerprogramme, die Schritt für Schritt zur Lösung von Problemen anleiten
Grundbausteine digitaler Technologie (Digitalisierung 1)
InternetInternet: weltweites physisches Netzwerk, das die Kommunikation zwischen Computern ermöglicht
Voraussetzung und Motor der Digitalisierung (1, 2 und 3)
Künstliche IntelligenzKI (Künstliche Intelligenz): Nachbildung intelligenter Vorgehensweisen in Computerprogrammen
basiert auf Digitalisierung (1) und komplexen Algorithmen
1.1.3Polarisierung in der Digitalisierungsdebatte
Bezüglich der Beurteilung der in den vorangegangenen Kapiteln geschilderten Digitalisierungsprozesse ist in westlichen Kulturen ein oppositionelles Lagerdenken zu erkennen. Antagonistische Positionen sind durchaus typisch für gesellschaftliche Systemdebatten, die nichts weniger als die Zukunft der Gesellschaft oder der Menschheit insgesamt betreffen (vgl. Armin GrunwaldGrunwald, Armin: „Gretchenfrage 4.0“, SZ 26.12.2019): Zu einem „Entweder-Oder“ mit einer klaren bis aggressiven Abgrenzung von der Gegenseite kam es nicht nur bei Themen wie „Demokratie von unten“ versus „Monarchie von oben“, Plan- oder Marktwirtschaft, sondern in jüngerer Zeit v. a. bei den großen Technikdebatten über Kernenergie, Gentechnik oder Künstliche Intelligenz. Auf der einen Seite wird die Digitalisierung als große Chance begrüßt, individuelle und gesellschaftliche Freiheit, wirtschaftliche Produktivität, Komfort und Lebensqualität zu steigern und durch die Auswertung von Daten viele globale Probleme wie z.B. Klimawandel und Epidemien lösen zu können. Auf der anderen Seite wird es als ebenso große Bedrohung zentraler westlicher Werte und Rechte wie Freiheit oder Demokratie erlebt, wenn Menschen zunehmend durch immer autonomere Maschinen ersetzt werden, ÜberwachungsÜberwachung- und ManipulationsvorgängeManipulation kaum mehr durchschaubar sind und sich Monopole mächtiger Digitalunternehmen herausbilden. Es handelt sich nach Petra GrimmGrimm, Petra um konkurrierende „Meta-Narrative“ oder „zeitdiagnostische Digitalnarrative“ (vgl. Grimm 2021, 67; PiallatPiallat, Chris, 27f.). Narrative in ihrer engen, nichtinflationären Bedeutung weisen eine dreiteilige Erzählstruktur auf mit einer Ausgangssituation, einer bedeutungsvollen Transformation und einer Endsituation. Die übergeordneten „Meta“-Erzählungen der DigitalisierungDigitalisierung werden von Grimm metaphorisch als „Heiliger Gral“ und „Büchse der Pandora“ bezeichnet (vgl. ebd., 68f.). Sie waren in verschiedenen Entwicklungsphasen des Internets bzw. der Digitalisierung vorherrschend, sind aber natürlich auch gleichzeitig und antagonistisch präsent.
Die erste optimistische Erzählweise wird häufig als „Kalifornische Ideologie“ oder „Silicon Valley-IdeologieSilicon Valley-Ideologie“ bezeichnet (vgl. ebd., 67; Nida-RümelinNida-Rümelin u.a. 2020, 20). Sie dominierte in der ersten Phase der Digitalisierung mit dem Aufkommen des Internets in den 1970er Jahren. Für die Entwicklung des InternetsInternet war eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern und technischen Pionieren verantwortlich, die sich jenseits staatlicher Steuerung die Regeln, Ziel- und Wertvorstellungen dieser neuen und faszinierenden digitalen Welt selbst gaben (vgl. PiallatPiallat, Chris, 24; SpechtSpecht, Philip, 49f.; Kap. 1.1.4). Es herrschte in der frühen Netzkultur und -bewegung ein starker Glaube an die emanzipatorische, dezentrale Kraft des Internets, die überkommene Grenzen überwindet und Menschen verbindet. Prägend für die Silicon-Valley-IdeologieSilicon Valley-Ideologie sind Sozialutopien alternativer Gesellschaftsordnungen und Gemeinschaftsformen, aber auch uramerikanische puritanische Erlösungshoffnungen auf eine bessere und gerechtere Welt, die dank harter Arbeit auserwählter kreativer Softwareentwickler im Silicon Valley endlich erreichbar scheint (vgl. GrimmGrimm, Petra u.a. 2020b, 12; Nida-Rümelin u.a. 2020, 20; Kap. 2.3). Diese alten Hippie-Ideale sollen ab den 1970er Jahren nahtlos in lukrative Geschäftsmodelle umgemünzt worden sein und sich in den neoliberal geprägten gesellschaftlichen Trend zur Optimierung und zur Quantifizierung sämtlicher Lebensbereiche eingegliedert haben (vgl. Grimm u.a., ebd.; Kap. 3.2.1). Auch als die Garagen-Startups inzwischen zu Großkonzernen angewachsen waren, wurde der euphorische, ja predigerhafte Tonfall der Pioniere beibehalten. Zu denken ist etwa an das Verkünden technischer Neuerungen oder Visionen von Apple-Gründer und Ex-Hippie Steve Jobs oder später Facebook- bzw. Meta-Chef Mark Zuckerberg anlässlich ihrer PR-Auftritte. Die Mission lautet bis heute, die Welt offener und vernetzter zu machen und die globalen Probleme der Welt zu lösen: „Die Welt steht vor wirklich großen Herausforderungen, und unser Unternehmen liefert die Infrastruktur dafür, diese Herausforderungen zu meistern.“ (Mark Zuckerberg im Interview 2008, zitiert nach MorozovMorozov, Evgeny 2013, 10)
Grob vereinfachend ist die DigitalisierungDigitalisierung in den letzten zwei Jahrzehnten in eine neue Phase eingetreten, in der sich kritische gesellschaftliche und politische Diskurse etablierten und sich bei vielen Ernüchterung einstellte (vgl. PiallatPiallat, Chris, 24f.; WeyerWeyer, Johannes u.a., 82). Carissa VélizVéliz, Carissa registriert einen drastischen Wandel „from tech hype to techlash“ in der letzten Dekade (xiii). Bisweilen ist sogar die Rede von einem „Realitätsschock“ als Massenphänomen oder einer sich in der digitalen Welt ausbreitenden „moralischen Panik“ (vgl. ebd., 20; EssEss, Charles, 4; LoboLobo, Sacha). Die Heilsversprechen und der grenzenlose Fortschrittsoptimismus der Pioniere in der wilden Phase des frühen InternetsInternet werden aus Distanz als naiv bewertet: Das neu Erfundene ist nicht automatisch besser, und das Internet scheint trotz erleichterter Partizipationsmöglichkeiten nicht mehr Demokratie oder gar eine weltumspannende Kommunikationsgemeinschaft gebracht zu haben, sondern viele Polarisierungen und Teil-Öffentlichkeiten (vgl. SpiekermannSpiekermann, Sarah 2019, 16f.; GrimmGrimm, Petra u.a. 2020a, 13; Kap. 2.3). Seit der Jahrhundertwende wurde die unter den Pionieren völlig außer Acht gelassene Problematik der VerantwortungVerantwortungAbschieben von zur öffentlichen Verhandlungssache, und es wurden regelrechte Kulturkämpfe über die Zuständigkeiten für unliebsame Vorgänge im Netz geführt (vgl. Piallat, 25). Missbilligt wird insbesondere, dass wenige immer mächtigere Technologieunternehmen für ihre Leitprinzipien wie Effizienz, Kundenorientiertheit und durchgängige Quantifizierung universelle Gültigkeit beanspruchen. Gewarnt wird vor der Verblendung durch die Tech-Konzerne, die mit dem Lieblingsslogan des Silicon ValleySilicon Valley-Ideologie: „Innovation über alles“ in erster Linie bestrebt sind, auf dem Innovationsstrom mitzuschwimmen und nicht unterzugehen (vgl. MorozovMorozov, Evgeny 2013, 10; Spiekermann 2019, 17). Nach langer Vernachlässigung des Themas trat auch die „Digitalpolitik“ seit den 2010er Jahren endlich neben Umwelt- und Klimapolitik auf die politische AgendaAgenda-Setting (vgl. Piallat, 25). Wie bei vielen gesellschaftlichen Trends fehlen allerdings empirische Erhebungen darüber, wie weit verbreitet Skepsis und Ablehnung in der Bevölkerung tatsächlich sind. Im Feuilleton, in populärwissenschaftlichen Bestsellern und akademischen Schriften melden sich zwar vornehmlich kritische Stimmen zu den neuen technologischen Entwicklungen zu Wort. Eine radikale Form der Abweisung und Verweigerung könnte sich aber auf einen kleinen KreisKreis, Jeanne von Intellektuellen beschränken.
Diese beiden Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit entsprechen dem vom Marktforschungsunternehmen „Gartner“ entwickelten Zyklus aufstrebender Technologien (vgl. www.Gartner.com): Gemäß dem Hype-Zyklus rufen die meisten neuen Technologien nach ihrem Durchbruch zunächst eine Phase hoher Erwartung und Überschätzung hervor („Hype“), auf die eine Phase der Ernüchterung als „Tal der Enttäuschungen“ folgt. Meist erst wenn die Berichterstattung nachlässt oder die Einschätzungen nüchterner werden, stellen sich sowohl ihre Vorteile als auch Grenzen heraus. Beim Big-Data-Hype beispielsweise stiegen die Erwartungen seit 2011 steil an und erreichten ca. 2013 ihren Höhepunkt. Ab 2014 wurde Big Data nicht mehr als aufstrebende Technologie beschrieben, ist aber inzwischen längst auf einem mittleren Niveau mit Mainstream-Anwendungen angelangt. Noch schneller scheint der Zyklus bei generativer KI wie dem 2022 einen Hype erlebenden ChatGPT abzulaufen, der nach Gartners „Hype Cycle for Emerging Technologies“ seinen Gipfel bereits 2023 erreicht hat. Durch all die vielen Begeisterungsschübe, Enttäuschungen und Überwältigungsängste hindurch scheint sich der Mainstream heute zwischen verhaltenem Optimismus und diffuser Skepsis gegenüber dem digitalen Wandel einzupendeln – auch wenn viele TechnikeuphorikerTechnik-Euphoriker und ApokalyptikerTechnik-Apokalyptiker an den entgegengesetzten Polen verharren (vgl. PiallatPiallat, Chris, 27ff.). Diagnostiziert wird teilweise ein postdigitales Zeitalterpostdigital, das nach der erfolgreichen Digitalisierung aller Lebensbereiche angebrochen sei (vgl. EssEss, Charles, 11). Gemeint ist damit keine auflehnend-kritische „anti-digitale“ Haltung, sondern eher eine gleichgültige oder unaufgeregt-kritische Einstellung zur Digitalisierung jenseits von Heilserwartungen und Furcht vor einem zivilisatorischen Untergang. Diese sei für die postdigitalepostdigital Generation der nach 1980 Geborenen typisch, die als Digital NativesDigital Natives mit den technologischen Errungenschaften groß geworden sind und ihre Dienste schätzen, aber durchaus auch mal bewusst digitale Abstinenz pflegen (vgl. Köhler). Ethisch problematisch wäre jedoch eine lethargisch-unkritische Haltung, weil die Digitalisierung noch im vollen Gang ist und die Weichen für ihre Entwicklung gestellt werden müssen.
Eine der wenigen bundesweiten Umfragen mit dem bezeichnenden Titel Künstliche Intelligenz im Alltag. Wie groß ist die Akzeptanz in Deutschland? Ein Volk zwischen Hoffnung, Angst und Zuversicht (2019) deutet tatsächlich auf eine durchschnittlich ambivalente Haltung gegenüber der Digitalisierung hin, die immer noch weiter fortschreitet und große Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung mit sich bringt (vgl. Dorn, 38): Es erwartet zwar über die Hälfte der deutschen Bevölkerung eine Erleichterung des Lebens und eine Einsparung von Ressourcen durch die neuen Technologien. Aber auch unter jungen Menschen hat die Hälfte Sorgen vor einer Fremdbestimmung durch KI und dem KontrollverlustKontrollproblem/-verlust über die eigenen Daten. In den letzten Jahren wurden unzählige deutschsprachige Diskussionsveranstaltungen unter der Überschrift: „Chancen und Risiken der Digitalisierung“ durchgeführt (vgl. PiallatPiallat, Chris, 28). Verschiedene Akteure wie etwa die Gruppe der Eltern kämpfen bisweilen an verschiedenen Fronten, z.B. „gegen die digitale Sucht ihrer Kinder, für eine Digitalisierung der Schule und mit den Anforderungen digitaler Systeme in Freizeit und Arbeitswelt“ (KroppKropp, Cordula u.a., 8). Unabhängig von empirischen Erhebungen über das tatsächliche Meinungsspektrum in der Bevölkerung sind programmatische Pauschalisierungen und Polarisierungen in der Digitalisierungsdebatte äußerst hinderlich. Anstelle einer unfruchtbaren Opposition zwischen apokalyptischen Untergangsszenarien und Verlustängsten einerseits und verheißungsvollen UtopienUtopien und Paradieserzählungen andererseits muss ein mittlerer Weg eingeschlagen werden (vgl. GrimmGrimm, Petra 2021, 70f.; Nida-RümelinNida-Rümelin u.a. 2020, 11). Erforderlich sind sachliche und kleinteilige Anwendungsdebatten über einzelne konkrete technische Möglichkeiten oder Anwendungsbereiche, jenseits dramatischer Zuspitzungen und einer undifferenzierten Beurteilung der Digitalisierung als Ganzer.
Polarisierungen in der Digitalisierungsdebatte
UtopienUtopien: Silicon Valley-IdeologieSilicon Valley-Ideologie
Dystopien:Dystopien moralische Panik
Fortschrittsoptimismus, euphorische Verheißungen
Pessimismus, apokalyptische Untergangsszenarien
Hoffnung auf freie, vernetzte Welt und Lösung der Weltprobleme
Ängste vor Verlusten und Verletzungen zentraler Werte und Rechte
ethische Forderungen:
keine dramatischen Zuspitzungen und Polarisierungen
sachliches Abwägen aller Chancen und Risiken
kleinteilige Debatten über einzelne digitale Anwendungsmöglichkeiten
1.1.4Kritik am digitalen Technikdeterminismus
Wie in Kapitel 1.1.3 skizziert wurde, folgte auf die erste sozialutopische Phase der technischen Pioniere eine Ernüchterung mit intensiven gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. Es wurden die Fragen laut, wer für die Technikentwicklung eigentlich verantwortlich ist und ob sich der Prozess der Digitalisierung überhaupt steuern lässt. Hinter apokalyptischen Bedrohungsszenarien wie hinter optimistischen Technikutopien steht häufig eine deterministische Einstellung zur Technikentwicklung. Der TechnikdeterminismusTechnik-determinismusDeterminismus, digitaler (Technik-) geht davon aus, dass der technische Fortschritt einer kaum oder gar nicht steuerbaren Eigendynamik folgt und die Zukunft von Mensch und Gesellschaft vollständig bestimmt bzw. „determiniert“ (vgl. GrunwaldGrunwald, Armin 2022a, 50): Die Menschen können die technische Entwicklung nicht aufhalten oder nach gesellschaftlichen Vorstellungen und ethischen Standards gezielt gestalten, sondern müssen ihr gezwungenermaßen nachlaufen. Entsprechend besagt der „digitale Technikdeterminismus“ oder kurz digitale DeterminismusDeterminismus, digitaler (Technik-), dass die Gesellschaft den Prozess der Digitalisierung nicht zu steuern vermag, sondern sich genauso wie bei schicksalshaften Naturereignissen wie z.B. einem Erdbeben oder Tsunami an die unvermeidbaren Vorgänge und ihre unerwünschten Folgen anpassen muss (vgl. Grunwald 2024, 871). Der in Wirtschaft und Politik omnipräsente Appell, die Gesellschaft müsse sich „fit machen“ für die rasant voranschreitende Digitalisierung und dürfe „den Anschluss nicht verpassen“, geht in diese Richtung (vgl. Grunwald 2022a, 50). Wichtig wäre es dann, wie im Bereich natürlicher Vorfälle zukünftige Entwicklungen möglichst gut vorauszusehen. Dann könnte zumindest versucht werden, mit geeigneten gesellschaftspolitischen Maßnahmen die Härten für gesellschaftliche Verlierer der Digitalisierung kompensatorisch abzufedern. Häufig verleitet der Technikdeterminismus zur fatalistischen Haltung, Ingenieure und Informatiker würden ohnehin tun, was technisch machbar sei. Sie kann sich aber auch mit der optimistischen liberalen Annahme einer invisible hand (Adam Smith) verbinden, die dafür sorgt, dass sich stets die besten technischen Innovationen durchsetzen.
Auch wenn dieser TechnikdeterminismusTechnik-determinismus noch in vielen öffentlichen Stellungnahmen der Gegenwart zum Ausdruck kommt, gilt er heute sowohl theoretisch als auch empirisch als widerlegt (vgl. GrunwaldGrunwald, Armin 2024, 872). In Anbetracht der großen digitalen Veränderungsdynamik scheint aber genauso auch die entgegengesetzte sozialkonstruktivistische Betonung einer wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch bestimmten Technikentwicklung allzu radikal zu sein (vgl. dazu Kropp u.a., 9). Es handelt sich um ein Denken in zu einfachen Dualismen, wenn entweder „der Mensch“ bzw. „die Gesellschaft“ die Technik beherrschen soll oder umgekehrt. Wer oder was Subjekt und Objekt oder Ursache und Wirkung im schwer durchschaubaren Prozess der Technikentwicklung ist, lässt sich nicht immer genau angeben. Sicherlich ist der technologische Fortschritt kein isoliertes Phänomen, sondern eingebettet in politische, soziale und kulturelle Kontexte und Rahmenbedingungen, von denen er gefördert oder gehemmt wird (vgl. Boehme-NeßlerBoehme-Neßler, Volker, 59). Deswegen entwickeln sich innovative Technologien in bestimmten Umgebungen wie z.B. im Silicon Valley besser als in Europa mit seinen vielen Restriktionen. Umgekehrt prägen aber auch technologische Standards die kulturelle, politische und ökonomische Ausgestaltung einer Gesellschaft. Auszugehen ist also von hochkomplexen Wechselwirkungen und Verflechtungen zwischen Kultur und Technik, wobei neue Techniken zusätzlich noch einer eigenen, gesellschaftlich wenig beeinflussbaren Entwicklungslogik folgen (vgl. ebd., 60). Veränderungen in der digitalen Gesellschaft gehen aus vielschichtigen Interaktionen von sozialen, wirtschaftlichen und technischen Treibern hervor, die in den verschiedenen Bereichen wie Quantifizierung des Sozialen oder Mensch-Roboter-Interaktionen jeweils unterschiedlich großen Einfluss ausüben können (vgl. Kropp u.a., 10).
Der TechnikdeterminismusTechnik-determinismusDeterminismus, digitaler (Technik-) ist insbesondere deswegen als irreführend zurückzuweisen, weil neue Technologien nicht im strengen und direkten Sinn soziale Strukturen determinieren. Sie stellen nach soziologischen Erkenntnissen vielmehr materielle Angebotsstrukturen dar, die den Menschen oder der Gesellschaft einen Spielraum an Verwendungsweisen zur Verfügung stellen und kulturell verschieden angeeignet werden können (vgl. ReckwitzReckwitz, Andreas, 225). Technologien können nur in bestimmten Kontexten erfolgreich sein, in denen sie auf einen bereits vorhandenen gesellschaftlichen oder kulturellen Bedarf stoßen. Obgleich die meisten innovativen Technologien bei vielen Zeitgenossen zunächst auf heftige Kritik und Widerstände stießen, setzten sich nach einer gewissen Übergangsphase diejenigen durch, die von der Mehrheit als positiv bewertet wurden. So hat z.B. PlatonPlaton die Einführung der Schrift scharf verurteilt, weil sie nur zu einem Scheinwissen statt zu wahrer Weisheit verhelfe (vgl. Platon, 274e–275b). Die Befreiung des Wortes von seinen zeitlichen und räumlichen Grenzen erwies sich aber als großer Vorteil. Ähnlich scheint die digitale Transformation mit ihren Möglichkeiten des Vernetzens, Quantifizierens, Erkennens von Regelmäßigkeit und Ordnung ein willkommenes Lösungsangebot bereitzustellen für das Leben in hochkomplexen modernen Gesellschaften (vgl. NassehiNassehi, Armin 2019, 35f.): Würde die Digitalisierung nicht zu dieser Gesellschaft passen, wäre sie in Armin Nassehis Worten „nie entstanden oder längst wieder verschwunden“ (ebd., 8). Ethisch verwerflich sind jedoch manipulative Marketingstrategien von mächtigen IT-Unternehmen und ihrer Lobby, die eine angebliche Notwendigkeit immer neuer digitaler Geräte oder Softwarelösungen suggerieren (s. z.B. Kap. 2.1.1; 3.2.2). Eine Digitale Ethik muss das Bewusstsein wachhalten, dass „no technology is inevitable“ (VélizVéliz, Carissa, xvi). Niemand kann sich mit dem Argument aus der VerantwortungVerantwortungAbschieben von stehlen, dass die digitale Transformation ein Naturereignis oder eine spontane (disruptive) RevolutionRevolution (4./digitale) darstellt. Digitale Technik entsteht in Ketten von EntscheidungsprozessenTechnik-gestaltung verschiedenster Akteure in Technikwissenschaften, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und ist an vielen Stellen in Forschung und Entwicklung beeinflussbar und steuerbar (vgl. GrunwaldGrunwald, Armin 2024, 872; MainzerMainzer, Klaus 2019, 232).
Digitaler TechnikdeterminismusTechnik-determinismus: Determinismus, digitaler (Technik-)Der Prozess der Digitalisierung folgt einer Eigendynamik, sodass er sich kaum oder gar nicht steuern lässt.
fatalistische Haltung: Was technisch machbar ist, wird auch getan.
optimistische Haltung: Die besten Techniken setzen sich durch.
angemessene relationale Betrachtung der Technikentwicklung: hochkomplexe Wechselwirkungen zwischen neuen technischen Angeboten, kulturellem Bedarf, gesellschaftlichen Zielen, wirtschaftlichen Interessen u.a. Treibern
→
digitale Transformation ≠ Naturereignis, sondern von Menschen gemacht und beeinflussbar und steuerbar
1.1.5Einfluss der Science-FictionScience-Fiction
Seit jeher sind Menschen fasziniert von der Idee, aus lebloser Materie künstliche menschenähnliche Wesen zu erschaffen. Auch weit über die jüdische Mystik und Literatur hinaus bekannt ist der Mythos vom Golem, der auf eine Legende zurückgeht: Ein Rabbi soll aus Lehm mithilfe von Zahlen- oder Buchstabenmystik ein Wesen geschaffen haben, das zwar stumm und nicht vernunftbegabt ist, aber viel Kraft besitzt und als willkommener Helfer verschiedenste Aufträge zu erfüllen vermag. In vielen Geschichten und Darstellungen gerät die Lage jedoch außer Kontrolle, sodass ein wutentbrannter Golem am Ende große Verwüstungen anrichtet. 1818 erschien Mary Shelleys Schauerroman Frankenstein oder der moderne Prometheus