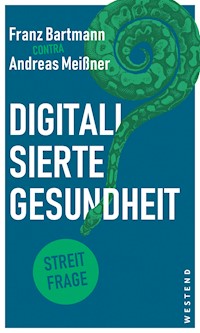
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Streitfragen
- Sprache: Deutsch
Alle Behandlungsdaten an einem Platz, kein Schleppen von Akten mehr von Arzt zu Arzt - die neu eingeführte elektronische Patientenakte soll vieles verbessern und vereinfachen. Allergien, Medikation und andere wichtige Informationen wären im Notfall sofort einsehbar. Aber sind sensible Gesundheitsdaten auf Servern sicher gespeichert? Verbessern sich damit Forschung und die Versorgung der Patienten? Oder bestehen andere Interessen am Datenfluß? Eine solche zentrale Speicherung könnte Leben retten - zugleich aber entscheidenden Einfluss auf die zukünftigen Chancen auf einen Arbeitsplatz oder eine Versicherung nehmen. Und ändert sich unser Blick auf Patienten und Patientinnen nicht durch solche Behandlungen zunehmend, verliert das Gespräch nicht immer mehr an Bedeutung, wird der Behandelte nicht mehr und mehr zur Datensammlung, in der er vollkommen aufgeht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ebook Edition
Franz BartmannAndreas Meißner
Digitalisierte Gesundheit?
Herausgegeben von Lea Mara Eßer
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-868-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Motiv: Westend Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Umschlag: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Vorbemerkungen
Franz Bartmann: Digitalisierung als ethische Verpflichtung
Einleitung
Es geht also doch – Fernbehandlung und Videosprechstunde
»… denn sie wissen nicht, was sie tun« – Elektronische Patientenakten
Wer schreibt, der (und das) bleibt – das elektronische Rezept
Andere Länder, andere Sitten – Erfolgsmodelle sind keine Blaupause
»Wo laufen sie denn?«– Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte
Radiologische Netzwerke
Schlaganfallversorgung
Das Virtuelle Krankenhaus
Telenotarzt – Eine Entwicklung in den Startlöchern
Medizininformatikinitiative (MII)
gesund.bund.de – Ein lohnenswerter Versuch
Telemonitoring
Der Wind ist da – Zeit, Mühlen zu bauen!
Schlussakkord
Andreas Meißner: Digitalisierung als Weg zum gläsernen Patienten
Einleitung
Todbringende Cholesterinsenker
Doppeluntersuchungen und Wechselwirkungen: irrelevant
Patientensouveränität mit Tücken
Die Entmenschlichung der Arzt-Patient-Beziehung
Vertrauensverlust bei Patienten, Mehrarbeit bei Ärzten
Hohe Kosten für TI und ePA – anderes wäre dringender
Der Patient als Datensatz?27
Vielfältige Interessen und Verflechtungen
Auf dem Weg in eine Callcenter-Medizin
Opt-In oder Opt-Out? Zwangstendenzen der Digitalisierung
»Wir alle landen in Datenlecks«
Was wir eigentlich brauchen
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. […] Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, in einem – schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen – Vertrauen auf das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man es nicht.
Hannah Arendt
Vorbemerkungen
Dies ist der Versuch, Sie in die Frage zu verführen. Das Bild der Schlange, das Sie auf dem Titel sehen, ist keineswegs Zufall: In der Genesis ist sie es, die die Frage in die Welt bringt, die dazu verführt, das Selbstverständliche zu prüfen, dazu, sich ein ganz eigenes Urteil zu bilden. Auf diesem Weg bringt sie zugleich die Gefahr dieses Fragens in die Welt, denn zu fragen heißt immer, dem allzu Selbstverständlichen seine vermeintliche Alternativlosigkeit – und somit die darin liegende trügerische Sicherheit – zu nehmen.
Die Reihe Streitfragen stellt umstrittene Themen und Debatten zur Diskussion. Sie möchte Lust am Selberdenken und dem Entwerfen einer eigenen Position wecken wie auch das offene Gespräch verteidigen. Es ist ein großes Gut und Zeichen von Freiheit, dass es andere Standpunkte gibt, die den eigenen in Frage stellen. Nur so können Gedanken sich formen und umformen, nur so kann Neues entstehen, kann Gesellschaft wachsen und sich entwickeln.
Woran es unserer Zeit nicht mangelt, sind Formate des Streits, die in Lager einteilen und Kontrahenten in die Arena treten lassen. Diese Art der Debatte befördert eine Vertiefung und Verfestigung nicht mehr übertretbarer Frontlinien, sie zieht diese sogar oftmals erst. Auf diese Weise wird zur Linie verkürzt, was Gesellschaft und Öffentlichkeit einzig ermöglicht, nämlich der gemeinsame Raum des Gesprächs. Eine vielstimmige Gesellschaft ist aber weder selbstverständlich noch natürlich, sie bildet sich einzig im Dialog und endet, sobald ein solcher nicht mehr möglich ist, sobald es nur noch darum geht, den anderen mit allen Mitteln zu übertrumpfen, sobald Debatte zum Wettkampfspektakel verkommt.
Diese Reihe möchte dem entgegenwirken. Bei dem hier ausgetragenen Streit soll es nicht um Angriff und Verteidigung gehen, sondern darum, beiden Standpunkten ausreichend Platz zur Entfaltung zu lassen. Aus diesem Grund werden beide Beiträge ohne Kenntnis des jeweils anderen verfasst, und damit ohne dem (unterschwelligen) Zwang zu unterliegen, sich für seine eigene Position rechtfertigen zu müssen.
Nach der Lektüre sollen sich beide Standpunkte erheben wie die Teile eines Vorhangs und so den Platz eröffnen, der Ihren Gedanken, Ihrer Meinung zukommt. Der so entstehende Zwischenraum für eine eigeneSichtweise ist es, der eine lebendige Gesellschaft hervorbringt: die Leerstelle, die offene Frage, die auffordert zu Austausch, Diskussion und Überprüfung der eigenen Überzeugungen.
Lea Mara Eßer, Frankfurt am Main 2022
Franz Bartmann: Digitalisierung als ethische Verpflichtung
Einleitung
Wenn der Wind der Veränderung weht,bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen.
Altchinesische Weisheit
»Alles gut«.Bloß zwei Worte, aber mit ihnen gelingt das Kunststück, einen Inhalt zu transportieren, der so ziemlich im Gegensatz zur eigentlichen verbalen Äußerung steht. Als Antwort auf die Frage nach der eigenen Befindlichkeit steht hinter dieser Aussage das Signal, dass durchaus nicht alles gut ist, man darüber aber nicht reden möchte. Wenn Politiker1 heute das deutsche Gesundheitssystem gern und häufig als »eines der besten der Welt« bezeichnen, ist ihnen sicher nicht bewusst, dass es sich mit dieser Aussage ähnlich verhält. Die zarten Abstriche am Superlativ scheinen hinnehmbar und kommen wie ein vornehmes Understatement daher. In Wahrheit ist die Aussage aber nicht mehr als eine Floskel, die sich spätestens dann als solche entlarvt, wenn man sieht, dass die politisch Verantwortlichen in anderen Ländern sie in fast identischer Weise nutzen. So gilt das deutsche Gesundheitswesen aus Sicht der skandinavischen Länder im Vergleich zu den ihrigen als hoffnungslos antiquiert und ineffizient. Aus deutscher Perspektive wiederum bestehen dort erhebliche Defizite beim Zugang für Patienten zur direkten Arztkonsultation, durch ein beschränktes Leistungsspektrum und lange Wartezeiten auf elektive, also planbare Untersuchungs- und Behandlungsverfahren. Und geradezu fassungslos muss man angesichts der negativen Darstellung in der hiesigen Fachpresse registrieren, dass der britische National Health Service das gleiche Attribut für sich in Anspruch nehmen kann, ohne dass dies in der dortigen Gesellschaft kollektiven Widerspruch provoziert.2
Das lässt vermuten, dass die jeweils grundlegenden Zielkriterien von Mehrheiten in der betreffenden Bevölkerung mitgetragen werden. Dabei ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese Mehrheiten in allen hochentwickelten Gemeinwesen getragen werden von Individuen, die zwar bei akuten Gesundheits- oder Befindlichkeitsstörungen gelegentlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, im Übrigen aber völlig gesund sind. Chronisch Kranke oder von Krankheit existenziell bedrohte Patientinnen und Patienten werden bei solchen Entscheidungen wenig Einfluss nehmen können, obwohl sie in besonderem Maße von dem jeweiligen Gesundheitssystem abhängig sind.
Die Frage der Gesundheit ist eine der zentralsten einer Gesellschaft – denn sie betrifft unser aller Leben und Überleben. Am Gesundheitssystem zeigt sich, wie fortschrittlich und wie gerecht eine Gemeinschaft ist. Heute stehen uns zahlreiche technische Möglichkeiten zur Verfügung, um die Gesundheitsvorsorge zu verbessern, um Leben zu verlängern und vorzeitige Todesfälle wie schwere Komplikationen zu verhindern. Doch selbst in einem so modernen und wohlhabenden Land wie Deutschland werden diese Möglichkeiten nicht genutzt, sondern werden durch bürokratische Vorgaben oder durch Widerstand der etablierten Akteure eher sogar behindert. Dieses Verhalten gegenüber Innovationen und Abweichungen von gewohnten Abläufen ist keineswegs neu. Angst vor Veränderung ist sozusagen eine genetische Determinante menschlicher Existenz. Nur dass dieser Urzeitinstinkt heute nicht mehr überlebensnotwendig ist, sondern – fast im Gegenteil – auch dringend notwendige Veränderungen aufhält oder sogar verhindert.3 Zu Beginn eines Veränderungsprozesses überwiegen regelhaft die Ängste vor den Risiken die Erwartungen in offensichtliche Vorteile und Chancen. Die zeitgenössischen Warnungen vor der Nutzung der Dampfeisenbahn legen dafür ein beredtes Zeugnis ab. Auch als das Automobil längst seinen Siegeszug in der individuellen Mobilität angetreten hatte, soll der damalige Kaiser Wilhelm II. geäußert haben, er halte das für eine modische Zeiterscheinung. Die Zukunft gehöre eindeutig dem Pferd. Fuhrunternehmer, die diesen Glauben teilten und anstatt in Lastwagen und Garagen in moderne Pferdeställe investierten, dürften rasch erkannt haben, dass dieses Pferd das falsche war, auf das sie gesetzt hatten.
Diesen offensichtlichen Fehler sollten wir bei der kontroversen Diskussion über die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht wiederholen, zumal es dabei keineswegs um eine komplette Verdrängung des Alten und Gewohnten durch etwas völlig Neues geht. Im übertragenen Sinne: Die Reise geht weiter, aber deutlich rascher, sicherer und komfortabler. Deshalb sollten wir uns in Bezug auf unsere Gesundheit nicht von der Angst vor Neuem leiten lassen, sondern mutigen Schrittes alle Möglichkeiten vorantreiben, die unser Leben verbessern, verlängern, erhalten können.
Wie das konkret aussehen könnte oder bereits aussieht, soll in den folgenden Kapiteln erörtert werden.
Es geht also doch – Fernbehandlung und Videosprechstunde
In Deutschland ist der Grund für eine Arztkonsultation häufig die vom Gesetzgeber im Entgeltfortzahlungsgesetz offengehaltene Option, dass ein ärztliches Attest über Arbeitsunfähigkeit bereits ab dem ersten Ausfalltag beizubringen ist. Gedacht war diese Möglichkeit ursprünglich als Sanktionsmöglichkeit bei offensichtlichem oder vermutetem Missbrauch der Karenzregel durch einen Arbeitnehmer. Grundsätzlich muss ein ärztliches Attest aufgrund einer ärztlichen Untersuchung nämlich erst ab dem vierten Krankheitstag beigebracht werden.4
Schleichend hat sich die ursprüngliche Ausnahmeregel zum Regelfall gemausert. Gedient ist damit aber weniger dem Schutz des betroffenen Arbeitnehmers als vielmehr der Vermeidung von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass ein betroffener Arbeitnehmer sich trotz verminderter Leistungsfähigkeit eher zur Arbeit schleppt, als sich dem morgendlichen Virenaustausch in überfüllten Wartezimmern auszusetzen. Dabei nimmt er nicht nur unbewusst eine mögliche Verlängerung des eigenen Krankheitsverlaufes in Kauf, sondern riskiert auch die Ansteckung weiterer Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Aus gesundheitspolitischer Sicht ist diese arbeitgebernahe Interpretation eines geltenden Gesetzes ein eindeutiger Flop.
Die Coronapandemie hat, wie so vieles andere auch, diesen Missstand fokussiert. Der medizinisch unnötige, aber erzwungene Arztbesuch stand plötzlich im Konflikt zu Aufrufen zu Kontaktbeschränkungen und Vermeidung nicht zwingend notwendiger Wege. Infolgedessen konnte nun bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege mit einem Mal, zeitlich befristet und mehrfach verlängert, eine Arbeitsunfähigkeit auch ohne körperliche Untersuchung bis zu einer Dauer von sieben Tagen bescheinigt werden, es bestand sogar die Option einer Verlängerung über weitere sieben Tage nach erneutem telefonischem Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde.5 In allen übrigen Fällen konnte – und kann – auf diesem Wege eine Krankschreibung bei nicht persönlich bekannten Patienten für maximal drei Tage, also die ohnehin ursprünglich vom Gesetzgeber zugestandene Karenzzeit, erfolgen.
Dass eine ärztliche Diagnose und Therapieempfehlung ohne einen vorherigen physischen Kontakt und eine entsprechende Untersuchung überhaupt berufs- und sozialrechtlich zulässig ist, ist unmittelbare Folge der Änderung des ärztlichen Berufsrechtes auf dem 121. Deutschen Ärztetag in Erfurt im Mai 2018.6 Auf diesem wurde das bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückreichende sogenannte Fernbehandlungsverbot so modifiziert, dass unter bestimmten Voraussetzungen die abschließende Behandlung eines akuten Krankheitszustandes ohne vorhergehenden unmittelbaren Arztkontakt erfolgen kann. Die telemedizinische Betreuung von Bestandspatienten war zuvor bereits seit 2017 im Sozialrecht verankert. Allerdings waren die dazu geforderten Voraussetzungen so restriktiv geregelt, dass sich die tatsächliche Inanspruchnahme statistisch eher im Rahmen einer erweiterten Kasuistik, also der Betrachtung einer Anzahl von Einzelfällen, bewegte. Entscheidende Kernaussage des geänderten Paragrafen7 des ärztlichen Berufsrechtes ist, dass das Stellen einer Diagnose in Abwesenheit des Patienten nur dann erfolgen darf, wenn hierfür eindeutig keine ärztliche Untersuchung erforderlich ist und der Patient seine ausdrückliche Einwilligung erteilt hat.
Vielfach dürfte es sich dabei um akute Gesundheitsstörungen handeln, die bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts ohnehin keine ärztliche Aufgabe darstellten, sondern in die Domäne der vorwiegend weiblichen Haushaltsvorstände fielen. Trotzdem kann natürlich dieses Spektrum durch ärztliche Kompetenz wesentlich erweitert werden. Medizinstudenten lernen bereits zu Beginn des klinischen Studiums, dass im Mittelpunkt jeglicher Diagnostik die sorgfältige Anamnese steht. Weitergehende Untersuchungen dienen dann im Wesentlichen der Verifizierung (oder Falsifizierung) der Verdachtsdiagnose.
Nach Aussage eines großen Telemedizinanbieters aus der Schweiz, der seit fast zwei Jahrzehnten im Rahmen der dortigen Regelversorgung tätig ist, kann etwa die Hälfte aller eingehenden medizinischen Anfragen abschließend auf diese Weise behandelt werden.8 Die übrigen Patienten werden entsprechend der Schwere und Akuität des vermuteten Krankheitsbildes an geeignete Behandlungseinrichtungen in räumlicher Nähe ihres Wohnortes verwiesen, oder es werden in erkennbaren Notfallsituationen sofortige Maßnahmen zur Notfallrettung eingeleitet. Durch diese Form der gezielten Patientensteuerung wären vermutlich auch in Deutschland erhebliche Rationalisierungseffekte im Hinblick auf drohende, beziehungsweise teilweise bereits manifeste Versorgungsengpässe zu erzielen.
Die Videosprechstunde in der heutigen Form, als gedeckeltes Zusatzangebot eines Vertragsarztes neben seiner regulären Sprechstunde, wird dazu allerdings kaum wesentlich beitragen können. Denn die Videokonsultation ist mitnichten weniger zeitaufwendig als eine vergleichbare Behandlung in der Präsenzmedizin. Vermutlich trifft eher das Gegenteil zu. Dies dürfte auch der Grund für ihre nur zögerliche Inanspruchnahme vor der ersten Welle der Coronapandemie sein. Bei vollen bis überquellenden Wartezimmern muss die Behandlung zusätzlicher Patienten in einem technisch und organisatorisch aufwendigen und darüber hinaus nicht kostendeckend dotierten Behandlungssetting zurückstehen.
Corona hat auch dies während der ersten Welle im Frühjahr 2020 dramatisch verändert. Patienten blieben aus Angst vor Infektionen den Wartezimmern fern, Ärzte hatten plötzlich freie Kapazitäten mit der drohenden Gefahr wirtschaftlicher Einbußen für die betroffenen Quartale. Als mögliche Lösung, die beiden Seiten entgegenkam, lag das Angebot der Videosprechstunde nahe. Erleichtert wurde die Entscheidung zusätzlich durch die befristete Lockerung des restriktiven Zugangs- und Abrechnungsverfahrens durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).
Nach Angaben des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung sind während der ersten Coronawelle zwischen März und Dezember 2020 insgesamt 2,5 Millionen Videosprechstunden abgerechnet worden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur wenige Tausend gewesen. Auch die Zahl der telefonischen Beratungen hat sich in den gleichen Vergleichszeiträumen von 2,7 auf 6,3 Millionen mehr als verdoppelt, die Zahl der bei der KBV akkreditierten Videodienstanbieter gar verdreifacht.9
Euphorischen Hoffnungen, dies sei der Durchbruch für die Digitalisierung und E-Health im deutschen Gesundheitswesen, muss man allerdings mit großen Vorbehalten begegnen. Denn letztendlich bedeutet die Videosprechstunde nicht viel mehr als eine Verlagerung des Arztgespräches aus dem realen in den virtuellen Raum. Ein Arzt kommuniziert mit einem Patienten. Der Zeitaufwand im Vergleich zur Präsenzmedizin ist gleich groß oder – wie gesagt – vermutlich sogar größer. Außerdem muss sich erst erweisen, ob der Andrang nach dem Ende der Pandemiezeit weiter anhält, zumal die enormen Zuwächse überproportional dem psychotherapeutischen Behandlungsspektrum zuzuordnen sind. In der Einzelpraxis wird sich ein relevantes Zusatzangebot im telemedizinischen Bereich mit dem Ziel einer Erweiterung des Patientenstamms bei einem Normalbetrieb wie vor der Pandemie kaum realisieren lassen. Für die Betreuung von Bestandspatienten außerhalb der Sprechstunde ist in der Regel das deutlich weniger aufwendige Telefongespräch ausreichend. Attraktiv könnte ein derartiges Angebot aber für Gemeinschaftspraxen, Berufsausübungsgemeinschaften, also Kooperation von Ärztinnen und Ärzten über einen gemeinsamen Praxissitz hinaus, oder Medizinische Versorgungszentren sein, in denen schwerpunktmäßig ein oder mehrere Mitarbeiter ausschließlich telemedizinische Kapazitäten vorhalten.





























