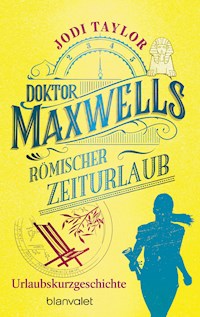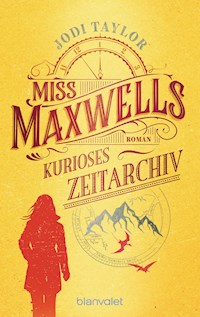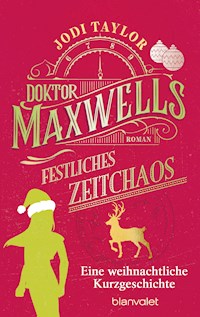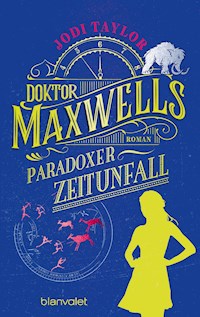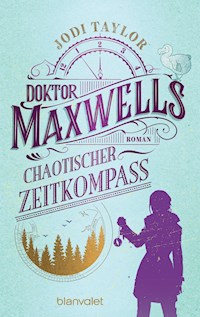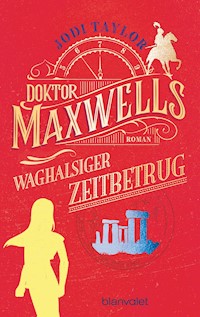
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von St. Mary’s
- Sprache: Deutsch
Von Vorgesetzten und anderen Störenfrieden. Der siebte Teil der urkomischen Erfolgsserie über die Zeitreisende Doktor Madeleine Maxwell
Die Zeitreisenden von St. Mary’s bekommen einen neuen Vorgesetzten. Klar, dass er nicht die ganze Wahrheit verträgt. Warum also ihn damit behelligen? Schließlich muss er ja nicht wissen, dass Madeleine »Max« Maxwell Excalibur entdeckt, für St. Mary’s gerettet und schließlich doch wieder zurück in die Vergangenheit gebracht hat. Leider findet er es heraus. Und dann nimmt das Chaos für Dr. Maxwell mal wieder seinen Lauf, bis hin zu dem möglicherweise etwas peinlichen Zwischenfall mit der Zeitpolizei …
Die waghalsigen und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
* Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
* Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
* Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall
7. Doktor Maxwells waghalsiger Zeitbetrug
Weitere Bände in Vorbereitung
(bei den mit * versehenen Titeln handelt es sich um E-Only-Kurzgeschichten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Die Zeitreisenden von St. Mary’s bekommen einen neuen Vorgesetzten. Klar, dass er nicht die ganze Wahrheit verträgt. Warum also ihn damit behelligen? Schließlich muss er ja nicht wissen, dass Madeleine »Max« Maxwell Excalibur entdeckt, für St. Mary’s gerettet und schließlich doch wieder zurück in die Vergangenheit gebracht hat. Leider findet er es heraus. Und dann nimmt das Chaos für Dr. Maxwell mal wieder seinen Lauf, bis hin zu dem möglicherweise etwas peinlichen Zwischenfall mit der Zeitpolizei …
Autorin
Jodi Taylor war die Verwaltungschefin der Bibliotheken von North Yorkshire County und so für eine explosive Mischung aus Gebäuden, Fahrzeugen und Mitarbeitern verantwortlich. Dennoch fand sie die Zeit, ihren ersten Roman »Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv« zu schreiben und als E-Book selbst zu veröffentlichen. Nachdem das Buch über 60 000 Leser begeisterte, erkannte endlich ein britischer Verlag ihr Potenzial und machte Jodi Taylor ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte. Ihre Hobbys sind Zeichnen und Malerei, und es fällt ihr wirklich schwer zu sagen, in welchem von beiden sie schlechter ist.
Die waghalsigen und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
* Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
* Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
* Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall
7. Doktor Maxwells waghalsiger Zeitbetrug
Weitere Bände in Vorbereitung
(bei den mit * versehenen Titeln handelt es sich um E-Only-Kurzgeschichten)
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Roman
Deutsch von Marianne Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Lies, Damned Lies, and History (The Chronicles of St. Mary’s Book 7)« bei Accent Press, Cardiff Bay.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Jodi Taylor
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (rudall30; Cattallina; Leremy)
HK · Herstellung: LvH
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29670-4V001
www.blanvalet.de
Prolog
Für Regeln war ich noch nie zu haben, ja für mich schienen sie nie so richtig zu gelten. Ich kann die vielen Male nicht mehr zählen, bei denen ich vor irgendeinem Schreibtisch stand, während mir jemand dahinter Vorträge hielt, die manchmal ausgesprochen lang waren. Das einzig Gute daran: Normalerweise war nur ich selbst an der Sache beteiligt.
Dieses Mal nicht. Dieses Mal steckte ich in echten Schwierigkeiten. Dieses Mal hatte ich etwas wirklich Schlimmes angestellt. Es spielte keine Rolle, dass ich es aus den besten Gründen getan hatte. Dieses Mal war ich zu weit gegangen.
Beklagen konnte ich mich allerdings nicht. Vor gar nicht langer Zeit hatte Dr. Bairstow, der immer viel weiter als jeder andere im St. Mary’s vorausblicken konnte, den Versuch unternommen, mich zu warnen, als er sagte: »Sie müssen sich vorsehen, Max. Sie müssen wirklich aufpassen, denn Sie fangen an, auf dem schmalen Grat zu wandeln zwischen dem, was noch hinnehmbar ist, und dem, was sich nicht mehr vertreten lässt. Es ist nur ein winziger Schritt, bis man feststellt, dass man abgerutscht ist und die falschen Dinge aus den richtigen Gründen getan hat. Ich warne Sie: Sie sollten in Zukunft sehr, sehr vorsichtig sein.«
Ich hätte auf ihn hören sollen und tat es nicht. Dieses Mal hatte ich nicht nur eine Linie überschritten – ich hatte mich praktisch mit einem Hochsprungstab darüber hinwegkatapultiert.
Und bei dieser Gelegenheit hatte ich Peterson mit hineingezogen, dessen Zukunft im St. Mary’s nun ausgesprochen ungewiss war.
Und Markham, der jetzt meinetwegen vermutlich niemals Major Guthrie als Chef der Sicherheitsabteilung nachfolgen würde.
Und das war noch nicht einmal das Schlimmste. Leute hatten ihre Jobs verloren. Roberts, mein jüngster Historiker, hatte seine Kündigung eingereicht. Er hatte darauf bestanden, alle Schuld auf sich zu nehmen. Es hatte ein kurzes Treffen mit Dr. Bairstow gegeben, in dem die beiden sich angebrüllt hatten, und dann war Roberts verschwunden; er war durch den Haupteingang nach draußen gestürmt und hatte in seinem Wagen die richtigen Gänge nicht mehr gefunden, so eilig hatte er es gehabt, die Auffahrt hinunter und durchs Tor zu rasen. Angesichts der Gemütsverfassung, in der er sich befand, hätte ich das gar nicht zulassen dürfen, aber er hätte sich durch nichts aufhalten lassen.
Und David Sands – mein langjähriger Freund und Verbündeter: Auch er hatte gekündigt.
Was aber das Allerschlimmste war: Die Kanzlerin der Universität von Thirsk, Dr. Chalfont, die so oft auf unserer Seite gestanden hatte, war ebenfalls draußen. Sie hatte sich nicht beirren lassen und sich für uns eingesetzt, und das war wirklich nett von ihr, denn sie war noch wütender auf mich als sonst irgendjemand, Dr. Bairstow eingeschlossen. Diejenigen, die schon seit Jahren darauf gewartet hatten, mit harten Bandagen zu kämpfen, nutzten die Gunst der Stunde. Man erlaubte der Kanzlerin, in den Ruhestand überzugehen. Ihre Gesundheit sei angeschlagen, erzählte man, aber das war nur die Show, die man für die Öffentlichkeit abzog. Ich war schuld daran, dass man auch sie abgesägt hatte. Und Dr. Bairstows Zukunft hing ebenso am seidenen Faden.
Ich hatte schon früher dumme Sachen gemacht und war waghalsig gewesen, aber noch nie hatte ich so viele Leben ruiniert oder eine solche Spur der Verwüstung hinter mir hergezogen.
Ich schätze, die Geschichte begann mit Bashfords Versuch, Wilhelm Tell nachzuahmen.
Kapitel 1
»In Ordnung, Leute«, sagte ich, als ich durch die Tür zum Männertrakt des Krankenflügels platzte, einen Becher Tee in der einen Hand, das Unfallbuch in der anderen. »Was ist passiert?«
Sie warfen mir schuldbewusste Blicke zu. Die Historiker Bashford und Roberts verstießen gegen die Regeln und Vorschriften, indem sie auf dem Bett saßen. Sands hing lässig über der Rückenlehne eines Stuhls; Miss Lingoss hockte auf dem Platz in der Fensternische und bot uns allen einen erstklassigen Blick auf ihre heutige extravagante Haarpracht, die wie eine explodierende Sonne in Rot, Gold und Orange um ihren Kopf herum abstand. Sie sah aus wie ein üppig blühender Kaktus.
Der Schurke in diesem Stück – oder, in Dr. Bairstows Wortlaut, der Idiot, der für die fragliche Katastrophe verantwortlich war, wurde von Kissen gestützt und sah auf interessante Weise bleich aus. Sein linkes Ohr war unter einem gewaltigen Wundpflaster verschwunden, das seinerseits von einem wild herumgewickelten Verband an Ort und Stelle gehalten wurde.
Irgendjemand holte mir einen Stuhl. Einer der wenigen Vorteile, die das Schwangersein mit sich bringt, besteht darin, dass man nicht herumstehen darf; Gott allein weiß, warum nicht. Wenn man sich hinsetzt, ist man ja schließlich noch genauso schwanger. Egal, ich machte es mir bequem, legte die Füße auf Markhams Bett, zog seine Schale mit Obst zu mir herüber und bediente mich an den Weintrauben. Markham war klug genug, keinen Einspruch zu erheben. Schließlich steckte er – wie alle anderen ebenfalls – wirklich in der Scheiße. Da das durchaus regelmäßig der Fall war, schien sich jedoch niemand groß drum zu scheren.
Mein Name ist Maxwell, und ich trage die Verantwortung für die Historische Abteilung – oder für Die üblichen Verdächtigen, wie ihre Mitglieder auch gerne genannt werden. Alle Anwesenden gehörten zu mir, mit Ausnahme von Markham – manchmal auch als Der Patient bekannt. Oder bei der einen oder anderen Gelegenheit auch als Der Beschuldigte.
Im Augenblick war er nicht sehr begeistert über meine Stiefel auf seinem Bett.
»Wenn Schwester Hunter reinkommt, kriege ich den ganzen Ärger ab«, jammerte er. Auch das ist noch bemerkenswert an Markham: Weitaus öfter, als es vermutlich gut für ihn ist, verhält er sich mutig wie ein Löwe, fängt sich eine Kugel ein, lässt sich in die Luft jagen und in Brand stecken, fällt irgendwo herunter oder gerät unter Wasser. Das alles perlt an ihm ab. Aber ein einziges harsches Wort von der blonden, liebenswerten Schwester Hunter lässt ihn wie ein Hündchen aussehen, dem man einen Ziegelstein um den Hals gebunden hat.
»Je eher wir die Sache klären, desto schneller bin ich wieder verschwunden«, sagte ich. »Wer will anfangen?«
Keine Ahnung, warum ich mir überhaupt die Mühe machte zu fragen. Niemand im St. Mary’s hält sich je zurück, wenn es darum geht, die eigene Seite einer Geschichte zu schildern. Natürlich plapperten jetzt alle gleichzeitig los, und es wäre schlau gewesen, wenn sie sich vorher auf eine offizielle Version geeinigt hätten. Irgendwann aber näherten wir uns dem Kern der Sache.
»Wilhelm Tell«, sagte Roberts, und von diesem Moment an war alles sonnenklar. Allerdings sah ich keinen Grund, warum ich nicht noch etwas Spaß haben sollte.
Allem Anschein nach war ein Streit – Verzeihung, eine akademische Debatte – über verschiedene Mythen und Legenden entbrannt, und irgendjemand hatte Wilhelm Tell ins Spiel gebracht. Von diesem Punkt an war es nur eine kurze Reise bis zu der Geschichte, wie Tell auf einen Apfel schießt, der auf dem Kopf seines Sohnes ruht. Nun war man noch schneller bei der Frage, wie wahrscheinlich eine solche Tat war. Und von da ab war es ein winziger Schritt zu dem Entschluss, es einfach mal selbst auszuprobieren. So sicher, wie ein Politiker seine Spesenabrechnung frisiert, war es an dieser Stelle, dass Markham dabei ein Stückchen seines Körpers einbüßen würde.
Damals im 14. Jahrhundert war die Schweiz von den Österreichern besetzt. Sie stülpten einen Hut auf einen Pfosten auf dem Marktplatz von Altdorf und verlangten, dass die Menschen sich davor verbeugten, wenn sie vorbeigingen. Wilhelm Tell weigerte sich. Er war berühmt dafür, wie geschickt er mit der Armbrust umgehen konnte. Die Österreicher bewiesen ihren Sinn für Humor, für den sie so bekannt waren, und hielten es für eine köstliche Idee, seinem Sohn einen Apfel auf den Kopf zu legen und Wilhelm Tell aufzufordern, ihn herunterzuschießen.
Was er tat.
Offensichtlich hatten sich verschiedene Historiker verächtlich darüber geäußert. Eines führte zum anderen, und eine Minute später war das halbe St. Mary’s mit einer Armbrust und einer Schale Obst nach draußen geeilt.
Inzwischen ahnt jeder, worauf das Ganze hinauslief, oder?
»Wessen Idee war das?«, fragte ich, und die Art und Weise, wie jeder vermied, den Blick zu Miss Lingoss wandern zu lassen, verriet mir alles, was ich wissen wollte.
»Und warum lag der Apfel dann auf Markhams Kopf und nicht auf dem von Miss Lingoss?«
»Ach, komm schon, Max«, sagte Sands. »Leg ihr einen Apfel auf den Kopf, und du wirst ihn nie wieder zu Gesicht bekommen.«
Was vermutlich den Tatsachen entsprach.
»Wer hat den Bolzen abgeschossen?«, erkundigte ich mich, und überraschenderweise konnte sich niemand daran erinnern.
Ich seufzte und klappte das Buch zu. Der einzige Grund, warum wir nicht schon vor Jahren von der Gesundheits- und Sicherheitsbehörde geschlossen worden waren, war der, dass wir den offiziellen Papierkram nur dann einzureichen hatten, wenn jemand auch tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Und da wir unseren eigenen, gut ausgestatteten Krankenflügel hatten, konnten wir das meiste bei uns im Hause regeln. Sollte allerdings irgendjemand mal auf die Idee kommen nachzuforschen, wie genau wir es schafften, zwei Unfallbücher pro Monat zu füllen, würden wir ernsthaft Schwierigkeiten bekommen.
»Also gut, und was ist wirklich passiert?«, fragte ich und legte das Buch beiseite, damit alle wussten, dass das jetzt nicht mehr ins Protokoll kam.
»Er hat sich bewegt«, bemerkte Bashford empört.
»Hab ich gar nicht«, widersprach Markham noch eine Spur empörter.
»Jetzt hör aber auf. Ich habe nur drei Meter von dir entfernt gestanden. Ich hätte dich gar nicht verfehlen können. Du hast dich bewegt.«
»Du triffst ja nicht mal ein verdammtes Scheunentor«, antwortete Markham aufgebracht. »Wie ich dir schon gesagt habe: Wir hätten einfach einen Kürbis nehmen sollen.«
Ich erkundigte mich danach, wie schlimm der eigentliche Schaden war.
»Der obere Teil meines Ohrs ist hin«, sagte Markham stolz. »Ich sehe jetzt aus wie Spock. Nicht der Typ mit dem Babygesicht. Der andere.«
»Eigentlich«, sagte Lingoss, die das Ganze vermutlich verschuldet hatte, »sollten wir uns auch das andere Ohr vornehmen. Des Ausgleichs wegen.«
»Wenn man will, dass bei Markham irgendetwas ausgeglichen ist, muss schon eine Menge mehr passieren, als dass nur sein anderes Ohr auch noch gekappt wird«, sagte Bashford, der Markham offenbar nicht verziehen hatte, dass dieser sich über seine Treffsicherheit lustig gemacht hatte.
»Du findest aber nicht, dass das mein gutes Aussehen verdirbt, oder?«, fragte Markham besorgt.
»Nein«, erwiderte er, »das ist doch gar nicht möglich.«
Markham strahlte. »Danke.«
Ich glaube zwar nicht, dass es das war, was Bashford gemeint hatte, aber in diesem Augenblick tauchte Hunter mit einem Tablett voller medizinischer Instrumente und einem entschlossenen Ausdruck im Gesicht auf, und wir alle hatten plötzlich einen wahnsinnig wichtigen Grund, sofort irgendwo anders sein zu müssen.
***
Ich selbst hatte dafür sogar einen ganz ausgezeichneten Grund. Dr. Bairstow wollte mich nämlich sehen. Ich vermutete, dass er einen energischen Versuch unternehmen würde, Markham den Lohn zu kürzen, und zwar mit der Begründung, dass er den vollen Preis nur für jemanden mit zwei unversehrten Ohren zu zahlen gedächte; und nun saß er plötzlich mit jemandem in der Sicherheitsabteilung da, der nur noch eindreiviertel davon hatte.
Wie ich schon berichtet habe, ist mein Name Maxwell, und ich bin die Leitende Missionschefin hier im St. Mary’s, dem Institut für Historische Forschung auf dem Stiftsgelände vom St. Mary’s, um unseren vollständigen Namen zu nennen.
Wir beobachten und dokumentieren historische Ereignisse in zeitgenössischer Umgebung. Wer es Zeitreisen nennt, zieht sich den Zorn von Dr. Bairstow zu, und das will wirklich niemand. Dies war auch der Grund, warum ich meine Zeit auf dem Weg zu ihm damit zubrachte, einige Fakten zu streichen und andere neu zu arrangieren. Ich hatte vor, ihm einen zusammenhängenden und vor allem einigermaßen zutreffenden Bericht über die Ereignisse zum Besten zu geben, die dazu geführt hatten, dass Markham einen weiteren Körperteil einbüßte.
Ich übergab Mrs. Partridge das Unfallbuch, und sie winkte mich in sein Büro durch.
»Guten Morgen, Sir.«
»Dr. Maxwell. Bitte nehmen Sie Platz.«
Ich tat, wie aufgefordert, und beäugte die beiden Missionsmappen auf seinem Schreibtisch. Das sah interessant aus.
Er verschwendete niemals Zeit damit, mich zu fragen, wie ich mich fühle, was ich immer zu schätzen wusste. Es war auch nicht nötig. Ich hatte auffallend wenig unter Morgenübelkeit, geschwollenen Fußknöcheln, Heißhunger auf bizarre Kombinationen von Nahrungsmitteln und sonst irgendwelchen typischen Schwangerschaftssymptomen zu leiden. Hin und wieder machte mir eine gewisse Gedankenverlorenheit zu schaffen. Zweimal hatte Leon, mein Ehemann, sein Bier unter dem Waschbecken und den Kloreiniger im Kühlschrank vorgefunden, und wenn er das auf eine Schwangerschafts-Schusseligkeit schieben wollte, war mir das nur recht.
»Zwei Missionen. Beide von der üblichen Quelle.«
Damit meinte er die Leute von der Thirsk-Universität. Unsere Arbeitgeber. Das jedenfalls dachten sie gerne von sich.
»Also, was haben wir, Sir?«
»Bei der ersten geht es darum, der Krönung von Georg IV. beizuwohnen …«
»Okay«, antwortete ich und wies diese Mission in Gedanken bereits jemand anderem zu. Völlig egal wem.
»Und die zweite dreht sich um …« Er legte eine dramatische Pause ein, denn wenn er eine Schwäche hat, dann ist es die Tatsache, dass er eine große Show liebt. »Arminius.«
Ich war aus dem Häuschen. »Herman, the German! Wie cool!«
Er lehnte sich zurück. »Ja, aber nicht für Sie. Ich möchte Sie bitten, die Arminius-Mission an Mr. Clerk zu delegieren.«
»Was? Aber warum denn das?«
Eine Augenbraue hob sich.
»Ich bin schwanger, Sir«, sagte ich empört. »Nicht krank. Oder unpässlich. Oder unzulänglich.«
Er hob die andere Augenbraue und bedeutete mir damit unmissverständlich, dass ich sehr wohl alles Angesprochene gleichzeitig sein konnte.
»Das war die Abmachung, Dr. Maxwell. Keine gefährlichen Sprünge. Wenn Ihnen die Krönung nicht zusagt, kann ich auch immer noch Miss Sykes hinschicken. Sie kann die Erfahrung gebrauchen.«
»Also entweder Georg IV. oder gar nichts?«
»Wie schnell Sie begreifen, was ich Ihnen sagen will.«
»Schwanger zu sein, hat mir Superkräfte verliehen, Sir. Und diese könnten Sie zum Vorteil des St. Mary’s nutzen, indem Sie mich in den Teutoburger Wald schicken und Mr. Clerk nach Westminster, in die Abtei dort.«
»Ich glaube kaum, dass Ihnen diese Mission zu wenig Aufregung bieten wird.«
»Aber das ist so …« Ich machte eine Pause.
Er schaute hoch. »So …?«
»So … ein Mädchending, Sir.«
Er lehnte sich zurück und bereitete sich darauf vor, sich einen kleinen Spaß zu gönnen. Ich denke manchmal, mich aufzuziehen ist die einzige kleine tägliche Freude, die er sich selbst zugesteht.
Ich knirschte mit den Zähnen und blieb hartnäckig. »Die Schlacht im Teutoburger Wald ist die Schlacht, die den Vormarsch der Römer durch Deutschland aufhält. Ein entscheidender Punkt in der Geschichte. Und da das so ist, Sir, brauchen Sie eine erfahrene Historikerin, die diese Mission leitet, und …«
»Zweifeln Sie an Mr. Clerk?«
»Nein, Sir, er ist sehr kompetent. Es ist einfach nur so, dass er nicht …« Ich zögerte und suchte nach dem passenden Wort, was sich als Fehler erwies.
»… schwanger ist«, beendete Dr. Bairstow den Satz für mich. »Der Deal war, dass Sie so lange springen dürfen, wie es Ihre Gesundheit zulässt – und ich muss sagen, dass es eine Freude ist zu sehen, wie wohlauf Sie zu sein scheinen. Im Moment vielleicht ein bisschen erhitzt. Sie wollten sich nur den … weniger aufreibenden … Missionen anschließen. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich Ihnen diese Bedingungen genannt habe, und noch lebhafter ist mir im Gedächtnis, wie Sie eingewilligt haben.«
Jetzt hatte er mich. Tatsächlich war ich damals so dankbar gewesen, nicht von der Liste der aktiven Mitglieder gestrichen worden zu sein, dass ich mich auf praktisch alles eingelassen hätte. Aber den großen Arminius – Herman, the German – zu sehen … Im Teutoburger Wald zu sein … Die Schlacht zu beobachten, bei der die Römer zurückgedrängt wurden …
»Ich glaube nicht, dass Sie die Krönung öde finden werden, Dr. Maxwell, wenn es das ist, was Ihnen Sorge bereitet.«
»Mehr oder weniger öde als eine Schlacht ganz großen Ausmaßes, Sir?«
Er reichte mir die Aktenordner. »Ich bin mir sicher, dass Sie etwas daraus machen werden. Nehmen Sie Mr. Markham mit. Ein Paar vollständige Ohren ist für die Mission vermutlich keine zwingende Voraussetzung.«
Markham würde auch nicht sonderlich erfreut sein. Eine große militärische Auseinandersetzung würde im Teutoburger Wald toben, und keiner von uns beiden sollte dabei sein. Manchmal ist das Leben sehr hart. Krönungen sind gewöhnlich ausgesprochen lange, würdevolle, majestätische und vor allem gesittete Angelegenheiten, voller Pomp und Zeremoniell, bei denen alle ihr bestes Benehmen an den Tag legen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man vergisst, aufs Klo zu gehen, bevor die mindestens sechs Stunden lange Zeremonie ihren Lauf nimmt.
Diese spezielle Krönung hatte allerdings ein paar Besonderheiten aufzuweisen, die einen entschädigen könnten, nämlich die beiden unattraktivsten Menschen des Planeten. Ich darf vorstellen: die Protagonisten.
Zur Rechten, meine Damen und Herren, befindet sich Georg August Friedrich, früherer Prinzregent, jetzt Georg IV., König des Vereinigten Königreichs Großbritannien, Wales und Irland sowie Hannover. Fett. Ausschweifend. Von gewaltigen Schulden geplagt. Ein Spieler. Säufer. Was man sich auch vorstellen kann – er hat darauf gewettet, es gevögelt, runtergekippt oder an den höchsten Bieter verjubelt. Ach ja, und er war unrechtmäßig vermählt, nämlich mit einer katholischen Witwe namens Maria Fitzherbert.
Zu meiner Linken: seine angetraute Ehefrau, Caroline Amalie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel. Fett. Ausgesprochen angespannt – in Ordnung: verrückt. Hysterisch. Fordernd. Rechthaberisch. Unhygienisch. Promiskuitiv. Laut.
Wirklich, man könnte anführen, dass die beiden der Welt einen guten Dienst erwiesen, als sie sich gegenseitig vom Markt nahmen.
Wie dem auch sei, die Ehe war eine Katastrophe, selbst für königlichen Standard, bei dem die Messlatte für ein Desaster ziemlich hoch liegt. Offenkundig war Georg die drei Tage vor seiner Eheschließung sturzbetrunken gewesen und verbrachte dann die Hochzeitsnacht besinnungslos im Kamin, wo ihn seine frischgebackene Ehefrau ihren eigenen Schilderungen der Ereignisse nach zum Schlafen hingeschickt hatte. Den Gerüchten zufolge war das die einzige Nacht, in der sie je beieinandergelegen hatten. Da Caroline neun Monate später ein kleines Mädchen zur Welt brachte, können wir nur annehmen, dass er die entschlossensten Spermien in der Geschichte der … na ja, der Spermien hatte.
Egal. Als sein Vater, der verrückte Georg III., starb – der, der einen Baum für den König von Preußen gehalten hatte (was ja leicht mal passieren kann, sollte man meinen) und blauen Urin pinkelte –, bestieg Georg den Thron. Seine Frau tauchte bei der Krönung auf und musste sich die Türen von Westminster Abbey vor der Nase zuknallen lassen.
So was bleibt dann für einen übrig, wenn man als Historikerin schwanger ist.
Alle anderen würden sich auf den Weg zur Schlacht im Teutoburger Wald machen, die den Lauf der Geschichte verändern würde, und ich bekam die elendige Caroline von, verdammt noch mal, Braunschweig-Wolfenbüttel. Das bemerkte ich Leon gegenüber, der die Schuld für diese ganze Misere trug.
»Ich mache dich dafür verantwortlich«, sagte ich. »Es ist dein ständiges Verlangen nach Sex, das mir diese durchgeknallte Schnepfe von Braunschweig-Wolfenbüttel eingebrockt hat.«
»Wirklich?«, hakte er nach, auf empörende Weise unbeeindruckt von meinem Elend. »Ich kann mich an keine Einwände erinnern. Genau genommen erinnere ich mich daran, dass du seinerzeit ziemlich begeistert warst. Du hast das mit dem … du weißt schon … gemacht.«
»Ja, ja, das spielt jetzt keine Rolle«, sagte ich eilig. Die einzige Art und Weise, wie man mit peinlichen Fakten umgeht, besteht darin, sie zu ignorieren. Wie ein Politiker. »Tatsache ist, dass ich nach London ins 19. Jahrhundert springe, um mir einen Haufen fetter Deutscher anzugucken, die einander ankeifen, und dabei werde ich eines der bedeutendsten Ereignisse der Geschichte verpassen.«
»Aber das war der Deal«, sagte er sanft. »Du darfst auch weiterhin dabei sein, aber nur bei den ruhigeren Sprüngen. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass das deine eigene Idee war.«
»Ja, aber nur, weil die andere Option darin bestand, überhaupt nicht mehr springen zu dürfen.«
»Worauf wir ganz leicht zurückkommen können, wenn du mit dem augenblicklichen Arrangement unzufrieden bist.«
Ich seufzte. »Nein, ist schon gut.«
»Ganz sicher?«, fragte er und klang plötzlich besorgt.
Ich spürte den üblichen Anflug von schlechtem Gewissen. Der arme Leon. Er beklagt sich zwar nie, aber manchmal ist das alles doch nicht so leicht für ihn.
»Ist schon gut«, wiederholte ich, und plötzlich bemerkte ich, dass das stimmte.
Kapitel 2
Obwohl Georg seinem Vater im Januar des Jahres 1820 auf dem Thron nachfolgte, fand seine Krönung nicht vor dem 19. Juli des folgenden Jahres statt. Er brauchte so lange, um sie zu planen. Vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, dass er auch sehr eitel war. Er wollte die größte und bemerkenswerteste Krönung aller Zeiten. Sie sollte sogar die von Napoleon übertreffen, und der war Kaiser.
Die Summe, die er ausgab, war kolossal. Das Parlament gestand ihm 100 000 Pfund zu – was selbst heutzutage noch eine Menge Geld ist –, und als dann offensichtlich wurde, dass dieser Betrag nicht einmal annähernd ausreichen würde, gewährte es ihm weitere 138 000 Pfund. Heutzutage wäre es also eine Gesamtsumme von rund 9,5 Millionen Pfund gewesen. Er gab eine neue Krone in Auftrag, denn er lehnte die traditionelle Krone von König Edward ab. Er erwarb sogar den Hope-Diamanten, der zuvor aus den französischen Kronjuwelen herausgeschnitten worden war. Man muss sich nur mal den Brighton-Pavillon ansehen, Georgs bescheidene, kleine Residenz am Meer, um festzustellen, dass er keine halben Sachen machte. Traurig für ihn war allerdings, dass seine Krönung trotz all seiner Bemühungen nicht etwa deswegen zu Berühmtheit gelangte, weil sie so spektakulär oder extravagant war, nicht einmal aufgrund seiner phänomenalen Erscheinung, sondern wegen seiner Frau, der grässlichen Caroline von Braunschweig, die ihm die Show stahl. Und zwar aus den völlig falschen Gründen.
Der 19. Juli war ein heißer Tag. Zur Abwechslung war die Mode mal ein Vorteil für die Frauen. Ich trug eine hübsche Sommerhaube, die ich ziemlich keck unter einem Ohr zusammengebunden hatte, und ein Ausgehkleid mit hoher Taille aus hellblauer Seide. Da ich kein junges Mädchen mehr war, hatte mein Kleid lange Ärmel und nur eine moderate Menge an Volants. Das Material war leicht und bequem. Und es gab kein Korsett.
Markham hingegen war ziemlich eingeengt mit einem dunkelgrünen Frack und einer exotisch bestickten Weste. Er trug eine kompliziert geknotete Krawatte, die sein Kinn hochdrückte und für den authentischen herablassenden Blick die eigene Nase hinunter sorgte, mit dem die engen Kniebundhosen und Stiefel der Bauern bedacht wurden. Er schwitzte, noch bevor wir überhaupt aufgebrochen waren. Ich versuchte, nicht allzu schadenfroh zu sein.
Treffpunkt war im Hawking-Hangar vor Pod Nummer acht, meinem Lieblingspod. Stimmt schon, er sah dieser Tage ein bisschen mitgenommen aus, aber ging uns das nicht allen so?
Die Pods bilden das Herzstück unserer Arbeit. Bei ihnen handelt es sich um massive, dem Anschein nach aus Stein gebaute Hütten, die mit uns zurückspringen in jedwede Zeitperiode, für die wir einen Auftrag erhalten. Es ist eng darin, sie sind schmuddelig, und nie funktioniert das Klo richtig. Nummer acht roch wie immer – nach ungewaschenen Leuten, überhitzter Elektronik, undichten Rohren, muffigem Teppichboden und Kohl.
Wir betraten den Pod und verstauten unsere Ausrüstung in den Schrankfächern. Die Konsole befand sich unter dem an der Wand befestigten Bildschirm, der uns im Moment einen Blick auf die herumwuselnden Techniker bot, die ihr Zeug zurück hinter die Sicherheitslinie wuchteten. Die beiden Sitze, die fest am Boden verschraubt waren, hatten Kissenflächen voller Dellen und Beulen und waren ungemütlich, aber die wirklich lebenswichtigen Dinge – ein Teekocher und ein paar Becher – waren genau richtig und standen startklar. Da dies hier mein Pod war, durften auch die Schokoladenkekse nicht weit sein.
Bündel von dicken Kabeln führten an den Wänden empor und hingen in Bögen von der Decke. Lichter flackerten auf den unzähligen Skalen, Messinstrumenten und Anzeigen auf der Konsole. Insgesamt herrschte eine Atmosphäre von schäbigem Hightech. Heruntergekommen und abgewetzt. Genau wie wir. Eigentlich genau wie das ganze St. Mary’s.
Als Chef der Technischen Abteilung überprüfte Leon die Koordinaten. »Alles eingegeben. Auch für euren Sprung zurück.«
»Vielen Dank«, sagte ich, setzte mich auf den Sitz linker Hand und nahm ebenfalls alles noch einmal in Augenschein.
»Pass auf dich auf«, sagte Leon, wie er es immer tat.
»Natürlich«, antwortete ich, wie jedes Mal.
Er lächelte nur für mich und verschwand nach draußen durch die Tür, die sich hinter ihm schloss.
Ich schaute zu Markham. »Alles klar?«
»Bereit, wenn du es bist.«
»Computer, Sprung initialisieren.«
»Sprung initialisiert.«
Und die Welt wurde weiß.
Heute tummelten sich viele Menschen auf den Straßen, aber immerhin war dies London, und da sind jeden Tag viele Leute unterwegs. In Anbetracht der Tatsache, dass es der Krönungstag war, waren es jedoch nicht so viele, wie es hätten sein können. Um die Menschen von jeder denkbaren Szene abzulenken, für die seine Frau vielleicht sorgen würde, war ein volles Programm mit öffentlichen Veranstaltungen fernab von Westminster Abbey geplant. Es sollte ein Ballon vom Green Park aus abheben. Sogar eine ganze Herde von hölzernen Elefanten sollte die Themse heraufgerudert werden. Etwas, das meiner Meinung nach deutlich unterhaltsamer zu werden versprach, als Prinny und seinen fetten Freunden zuzusehen.
Zu dieser frühen Stunde empfand ich die Temperatur als angenehm kühl. Einen Moment lang standen wir einfach nur da und sogen die Düfte von frischgebackenem Brot und – meiner Erinnerung nach zum ersten Mal während einer Mission – von Kaffee ein. Oh, und natürlich rochen wir Pferde. Erhitzte, aufgeregte Pferde haben immer eine starke olfaktorische Präsenz. Die Straßen waren bereits von tiefem Schlamm bedeckt. Kehrburschen waren überall und fegten eifrig einen Weg über die Straße frei, wofür sie mit einem beiläufig zugeworfenen Penny entlohnt wurden. Ich war froh über mein knöchellanges Kleid und die klobigen Halbstiefel. Keine Historikerin geht je irgendwo mit unangemessenem Schuhwerk hin, denn das beschwört Ärger ja geradezu herauf.
Richtung Westminster Abbey waren die Straßen sauberer; offenbar hatte man sie für dieses Ereignis gefegt. Aber es wurde auch voller.
»Immer schön die Hand auf dem Geld lassen«, riet mir Markham und schob mich durch die Menge.
»Wie bitte?«
»Taschendiebe.«
»Ah.«
Die Abtei von Westminster hatte ich schon immer als eine alte Freundin betrachtet.
»Ich war hier schon mal«, vertraute ich Markham an, als wir uns mit den Ellbogen einen Weg durch die begeisterte Menschenmenge bahnten, um eine vernünftige Sicht zu bekommen. »Vor achthundert Jahren. Meine erste richtige Mission. Peterson und ich waren hier, als die Grundsteine gelegt wurden. Kurz bevor Eduard der Bekenner starb.«
»Wirklich?«, fragte Markham und wimmelte einen Mann ab, der uns eine Fahne andrehen wollte. »Und wie lief das?«
»Eigentlich ganz gut. Ein verdammt großer Steinblock verfehlte uns um ein paar Zentimeter, und Peterson hat mich angepinkelt.«
»Also ein großer Erfolg, gemessen am St. Mary’s-Standard.«
Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, standen wir schweigend da und warteten. Ich hatte mein Aufnahmegerät in der Hand. Eine Betäubungswaffe und Pfefferspray waren in dem hübschen Retikül verstaut, das an meinem Handgelenk baumelte. Wir waren startklar. Und wir mussten nicht so lange warten, wie wir gedacht hatten. Die Königin hatte vermutlich geglaubt, eine frühere Ankunft würde einen leichteren Zugang bedeuten, und kam deshalb zeitig. Hufgeklapper und die Rufe eines Kutschers, mit denen er kleine Jungen aus dem Weg scheuchte, verkündeten das Eintreffen ihres Gespanns. Eine vorfreudige Aufregung machte sich in der Menge breit, denn alle wussten, dass sie nicht eingeladen worden war. Das versprach ein Spektakel zu werden.
Gütiger Himmel, sie war wirklich fett. Und was hatte sie an? Dankenswerterweise hatte irgendjemand sie davon abgehalten, ihren üblichen Kleidungsstil zu pflegen, denn es hatte Gelegenheiten gegeben, bei denen sie sich mit einem Kleid, das bis zur Taille aufklaffte, in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Vermutlich aus Rücksicht auf den feierlichen Anlass hatte sie diesmal einen Gang heruntergeschaltet, mehr aber auch nicht.
Sie trug ein voluminöses weißes Satinkleid, das unter ihrem riesigen Busen zusammengerafft war und bis zum Boden fiel, wo es in einer kurzen Schleppe endete. Ihr dunkles Haar, das eindeutig zu dunkel war, um natürlich zu sein, war auf ihrem Kopf aufgetürmt und mit wippenden weißen Straußenfedern geschmückt. Korkenzieherlöckchen umrahmten ihr bereits gerötetes Gesicht. Eine außerordentlich hässliche Diamantenkette half mitnichten dabei, die üppigen Massen an Busen, die entblößt waren, zu verdecken. Die ebenso unansehnliche Kette um ihr Handgelenk schnitt in das gefleckte Fleisch ihrer plumpen Arme. Verschiedene Broschen waren überall auf den gewaltigen Mengen weißen Satins befestigt. Ich schwöre: Wenn sie vor einem Spiegel gestanden und zu ihren Zofen gesagt hätte: Schmeißt alles auf mich und pinnt es fest, wo es hängen geblieben ist, hätte es auch nicht schlimmer ausgesehen. Es muss ihren Bediensteten in der Berufsseele wehgetan haben, sie in diesem Aufzug auf die Straße zu lassen.
Ich hatte keine Ahnung, was das ganze Fleisch davon abhielt, aus ihrem Kleid zu platzen.
»Du meine Güte«, sagte Markham neben mir. »Na, die ist ja mal ’ne Marke.«
Sie kletterte unbeholfen aus ihrer Kutsche und benötigte dabei die Hilfe von zwei kräftigen Dienstboten, hielt inne, damit die versammelte Menge in erstaunter Bewunderung kollektiv nach Luft schnappen konnte – was nie passierte –, und machte sich dann auf den Weg zu den Türen der Abtei, die noch immer für die letzten eintretenden Gäste offen standen.
Als sie näher kam, verstellte ihr eine Reihe riesiger, hässlicher Männer, die vollkommen albern als Pagen verkleidet waren, den Weg. Ihr Ehemann, der seine Gattin kannte und Ärger erwartet hatte, hatte professionelle Preisboxer angeheuert, angeführt von dem berühmten Gentleman Jackson höchstpersönlich, nur um sie draußen zu halten. Was an sich eine schlaue Idee gewesen war. Der Einfall, sie als Pagen auszustaffieren, war hingegen vermutlich eher nicht so clever gewesen.
Ob sie sie tatsächlich vor den Augen der gaffenden Menschenmenge körperlich angegangen wären, würden wir nie erfahren. Die Massen spürten, dass sich ein Drama anbahnte, und wurden still. Die Königin stand vor ihnen, ohne die Begleitung von auch nur einer einzigen Zofe. Ich dachte bei mir, dass sie ziemlich klein (wenngleich immer noch extrem beleibt) und bemitleidenswert aussah. Sie hob den Kopf und kreischte: »Die Königin. Ich bin die Königin. Aufmachen.«
Zu behaupten, dass ihre Stimme weithin trug, wäre noch eine Untertreibung gewesen. Zwar bäumten sich keine Pferde auf, aber Schwärme von Tauben erhoben sich in die Luft, vermutlich, um nie mehr zurückzukehren.
Die Menge brüllte wohlwollend ob dieses Dramas, das sich noch vor der Krönung vor ihren Augen abspielte, und nahm ihren Ruf auf:
»Die Königin. Die Königin.«
Nichts geschah, und das Geschrei erstarb wieder, während alle abwarteten, was sie wohl als Nächstes tun würde.
Von der Stelle aus, an der wir standen, konnte ich alles ganz gut verstehen.
Ihr Englisch hatte einen starken Akzent, aber mit enormer Würde sagte sie: »Ich bin die Königin von England«, raffte ihre Röcke hoch und versuchte, sich zwischen zwei Pagen mit Blumenkohlohren, beide Männer ungefähr in der Größe des Kolosses von Rhodos, vorbeizuzwängen.
Irgendwo kurz hinter dem Eingang zur Abtei brüllte ein Amtsträger, der für uns nicht zu sehen war: »Tut eure Pflicht, bei Gott«, und mit einem ohrenbetäubenden Knallen, dessen Echo vermutlich noch drei Straßen weiter zu hören war, wurden die dicken Türen ins Schloss geworfen.
Die Menge keuchte. Das war eine unfassbare Beleidigung. Es stimmte schon, sie war gar nicht wirklich zur Königin gekrönt worden, aber sie war die Ehefrau des Königs, und ganz gleich wie sehr die beiden einander verabscheuten– und das taten sie –, es blieb doch eine schreckliche öffentliche Schmach.
Wäre besser gewesen, sie wäre wieder verschwunden. Sie hätte sich zusammenreißen, in ihre Kutsche steigen und zurückfahren sollen. Wenn sie in diesem Augenblick weggefahren wäre, solange ihre Würde und Gesundheit noch intakt waren, wäre sie an diesem Tag als Siegerin hervorgegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Menge hinter sich. Da sie aber nun mal Caroline war, vergeigte sie die Sache.
Sie stieß ein wutentbranntes Kreischen aus, schleuderte ihren Fächer aus Straußenfedern auf den Boden, hob die Röcke, entblößte dabei eine skandalöse Menge ihrer knubbeligen Beine und stürmte los.
Sie ging nicht etwa, sie spazierte, schlenderte, flanierte, stolzierte, watschelte nicht – sie rannte, und dies war nicht das Zeitalter, in dem hochgeborene Frauen wie eine Stute durch die Gegend galoppierten. Und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Die meisten von ihnen wussten vermutlich nicht einmal, wie das ging. Für eine Prinzessin, eine Angehörige des Königshauses, war es einfach undenkbar, vor den Augen der Massen die Röcke zu heben und die Beine zu zeigen.
Doch genau das geschah. Sie rannte. Na ja, eigentlich nicht, denn wenn man es genau nahm, dann trampelte sie.
Die Menge war ganz scharf darauf zu sehen, was wohl als Nächstes geschehen würde, und folgte ihr auf dem Fuße.
»Komm schon«, sagte Markham; er griff nach meinem Arm, und wir ließen uns mittreiben.
Im Grunde machte ich mir Sorgen um sie. Auch wenn es noch früh am Morgen war, war es ein heißer Tag. Sie war aufgebracht. Und extrem übergewichtig. Außerdem sprintete sie – das konnte nicht gut für sie enden. Heute Abend würde sie krank werden, und drei Wochen später würde sie schon tot sein. Sie sollte wirklich nicht tun, was sie gerade tat.
Sie stürmte außen um die Abtei herum und schubste dabei verblüffte Fußgänger aus dem Weg, die ihr entgegenkamen und die sich alle fragten, was zur Hölle gerade vor sich ging.
Wir wussten, dass sie auf den Kreuzgang zuhalten würde.
»Heilige Scheiße«, sagte Markham, der meinen Arm fest umklammert hielt, während die Leute an uns vorbeidrängten. »Ist sie denn verrückt geworden? Sie werden sie doch niemals reinlassen. Warum geht sie denn nicht einfach nach Hause? Das wird noch ganz schön Ärger geben.«
Sie versuchte es zuerst an den Türen auf der Ostseite des Kreuzgangs, aber im Innern war jemand schneller als sie da gewesen, und so war auch dieser Eingang versperrt. Sie rüttelte an der Klinke und hämmerte gegen die Tür, aber sie öffnete sich nicht. Gewaltig und schweigend ragte die Abtei über ihr auf.
Einen Moment lang hielt sie inne, und dann, kein bisschen entmutigt, stürmte sie weiter. Dieses Mal zur Westseite des Kreuzgangs, denn sie war wirklich wild entschlossen, einen Weg hinein zu finden. Ich fragte mich, was derweil im Innern vor sich ging. Konnten sie dort über die Musik hinweg den Tumult hier draußen hören? Saßen sie dort alle in der Kühle und lauschten dem Aufruhr, der sich draußen einmal ums Gebäude herumbewegte?
Auf der Westseite hatte sie genauso wenig Glück. Sie machte halt, das Gesicht rot erhitzt, die Brust heftig bebend. Und man darf mir glauben: Es gab eine Menge Brust, die bebte. Ihr Federputz saß schief, und ihr Kleid war so derangiert, dass man es kaum noch schicklich nennen konnte. Jetzt war eindeutig der Moment gekommen, wo jemand aus ihrem Haushalt auf sie zugehen, ihren Arm packen und sie zurück zur Kutsche führen sollte. Wenn sie denn irgendwelche Freunde in diesem Land gehabt hätte, dann wäre genau das deren Aufgabe gewesen. So aber stand sie ziemlich allein inmitten eines großen Kreises an Menschen, die alle schweigend abwarteten, was ihr wohl nun einfallen mochte. Ich fragte mich, ob das der Augenblick war, in dem ihr dämmerte, wie allein sie war.
Andererseits war sie sich selbst die schlimmste Feindin. Sie wirbelte herum, schob einzelne Leute aus der Menge, die sich hinter ihr versammelt hatte, beiseite und setzte sich wieder in Bewegung. Dieses Mal ging es Richtung Westminster Hall, dem Ort, an dem das Krönungsbankett stattfinden sollte und wo sich trotz der frühen Stunde bereits eine beträchtliche Zahl an Gästen eingefunden hatte.
Und dort war plötzlich Schluss mit lustig, heißt: Es wurde mit einem Schlag sehr ernst. Dies war England. Man kann sich nicht einfach dem Establishment widersetzen. Das kann man heutzutage nicht, und ganz sicher durfte man das im Jahr 1821 nicht tun. Mochte es auch veraltet, also alt, betulich, selbstbezogen und sich selbst erhaltend sein – nun ja, genau genommen ist es veraltet, betulich etc., aber es ist der Sitz der Macht in diesem Land. Es bewegt sich ungefähr so schnell wie ein arthritischer Gletscher, aber es bedarf keiner Geschwindigkeit. Das Establishment streckt einfach die Arme aus und zermalmt ganz langsam und unweigerlich alles, was es zu greifen bekommt. Unbequeme Prinzessinnen stellen das geringste Problem dar, und das war noch nie anders gewesen. Ein Befehl wurde gerufen. Soldaten traten auf den Plan, und mit einem Mal wurde alles ganz leise und sehr still.
Die Soldaten hielten Caroline ihre Bajonette vors Gesicht. Und sie meinten es ernst. Dieses Mal stand sie stocksteif und ungläubig da; der Schweiß lief ihr über ihr geschminktes Gesicht, ihr Haar war zerzaust. Der Saum ihrer Röcke und ihre kleinen, weichen Schuhe waren fleckig vom Matsch und Pferdemist. Dunkle Ringe breiteten sich unter ihren Armen aus. In der plötzlichen Stille konnten wir sie schnaufen hören.
Sie tat mir so leid. Aber auf der anderen Seite schien sie kein Problem damit zu haben, sich öffentlich zum Gespött zu machen, und ihre Stimme hätte Häuser zum Einstürzen bringen können. Sie war definitiv unzufrieden. Und sie hatte noch längst nicht aufgegeben.
Was dann geschah, konnten wir nicht sehen, weil alle um uns herum drängelten, um einen guten Blick zu bekommen. Aber ich weiß, dass Caroline alle ignorierte und versuchte, sich mit Gewalt einen Weg nach drinnen freizumachen. Ihre Stimme, die hysterisch und schrill klang, und ihr deutscher Akzent, der sich von Minute zu Minute mehr Bahn brach, war klar und deutlich rauszuhören, selbst für uns, die wir nicht nahe genug kommen konnten, um etwas zu sehen. Das Wohlwollen der Menge begann langsam nachzulassen, und gerade hatte es den Anschein, als wenn die ganze Sache in eine öffentliche Rangelei ausarten würde, als der stellvertretende Lord Chamberlain die Probleme aller Beteiligten löste. Wieder einmal wurden ihr die Türen vor der Nase zugeschlagen.
Man könnte doch meinen, dass sie es nun auf sich beruhen lassen würde, oder?
Immer noch unbeeindruckt, lupfte sie wiederum ihre Röcke und rannte los, wobei sie auch dieses Mal einen großen Teil ihrer unattraktiven Knöchel und Beine zeigte. Es ging zurück zu der Tür in der Abtei, die zur Dichterecke führte. Markham und ich hatten gewusst, wo sie als Nächstes hinlaufen würde, und so hatten wir uns schon auf den Weg gemacht und waren an Ort und Stelle, als sie auftauchte. Ihr Gesicht war vor Anstrengung dunkelrot, und ihr Busen hing ihr halb aus dem Kleid heraus. Sie wurde verfolgt von einer johlenden Menge, die zwar daran gewöhnt war, dass ihre Königsfamilie sich im Laufe der Jahre öffentlich lächerlich gemacht hatte, die dieses sehr unkönigliche Schauspiel allerdings nicht mehr gutheißen konnte. Caroline hatte eine Linie überschritten.
Ich bemitleidete sie, auch wenn sie wirklich schrecklich war. Sie war vor den Augen ganz Londons öffentlich gedemütigt worden. Diese Geschichte würde überall in Europa die Runde machen. Wenn sie länger gelebt hätte, wäre sie ausgelacht worden, wo auch immer sie sich hätte sehen lassen.
Aber sie lebte nicht mehr lange. Heute – in ebendieser Nacht – würde sie krank werden. Niemand war sich je ganz sicher, worunter sie eigentlich litt, aber innerhalb von drei Wochen wäre sie tot. Sie würde behaupten, dass sie heute irgendwann im Laufe des Tages vergiftet worden sei. Und interessanterweise würde sie auf dem Sterbebett sehr genau von einem Mann namens Stephen Lushington überwacht werden, der bei Lord Liverpool in Lohn und Brot stand, dem damaligen Premierminister. Die wirklich traurige Tatsache war: Es konnte gut möglich sein, dass sie ermordet worden war. Wir werden es nie erfahren, und damals interessierte es niemanden.
Aber jetzt, unmittelbar vor mir, versuchte Sir Robert Inglis sie leise davon zu überzeugen, dass sie sich besser zurückziehen solle.
Ich begann, mich durch die versammelten Menschen hindurch weiter an sie heranzuschieben, denn es gab etwas, das ich gerne sehen wollte. Alle Blicke waren auf die Prinzessin gerichtet. Sie presste sich beide Hände auf ihre gewaltige Brust und kämpfte darum, wieder zu Atem zu kommen. Es war mehr als offensichtlich, dass man sie niemals in die Abtei hineinlassen würde. Sir Robert redete sehr höflich und ruhig mit ihr, und während die Preisboxer und die zugeschlagenen Türen sie nur umso entschlossener gemacht hatten, Einlass zu finden, begann diese respektvolle, überzeugende Ansprache ein bisschen Wirkung auf sie auszuüben.
Was aber meine Aufmerksamkeit erregt hatte, war ein kleiner hellroter Blutfleck auf der Rückseite ihrer weißen Handschuhe. Er war winzig, und man konnte ihn kaum erkennen. Vielleicht war es nicht einmal ihr eigenes Blut. Es war durchaus denkbar, dass sie jemand anders gestreift hatte. Oder jemand hatte sie berührt. Aber nur mal angenommen, es wäre ihr Blut. Und in dieser Nacht würde sie krank werden. Und drei Wochen später wäre diese unbequeme Prinzessin tot.
Ich weiß nicht, was Sir Robert zu ihr sagte. Vielleicht fing sie auch schon an, sich unwohl zu fühlen. Aber aller Kampfgeist entwich. Ich sah, wie ihre Schultern nach vorne sackten. Selbst die Federn in ihrem Kopfputz baumelten nach unten. Drei grobschlächtige Pagen führten sie still an dem johlenden Volk vorbei, und sie wuchtete sich in ihre Kutsche hinein. Trotzig bis zum Ende, winkte sie der feindseligen Menge zu und wurde weggeschafft.
Unwillkürlich kam mir ein sehr wenig schmeichelhafter Spottreim über sie in den Sinn, der überall grassierte.
Hochverehrte Königin, wir bitten Euch sehr,
geht davon und sündigt nicht mehr.
Und wäre das zu viel verlangt,
verschwindet trotzdem unbedingt.
Markham und ich ließen uns einen Augenblick Zeit, um uns auf den nächsten Teil dieser Mission vorzubereiten. Auf den König selbst.
Markham wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Ich überprüfte meinen Rekorder und machte einige Aufnahmen von der Gegend rings um die Abtei herum. Wir fanden eine ziemlich gute Position an der Westtür und warteten geduldig darauf, dass die Prozession den Weg von der Westminster Hall aus zurückgelegte, denn wir wussten, dass der König spät dran sein würde.
Im 19. Jahrhundert gab es keine Absperrgitter oder sonst irgendeine Möglichkeit, die Massen zu lenken und zu kontrollieren, sodass jeder einfach fröhlich herumspazierte und eine gute Zeit hatte. Die Straßen waren voller Kutschen, die versuchten vorwärtszukommen. Droschken und Fuhrwerke kamen sich mit Fußgängern, Amtsträgern, die alle Hände voll zu tun hatten, Bettlern und Zuschauern ins Gehege.
Die Kutscher verfluchten die Leute, die ihrerseits munter zurückschimpften. Der heiße Tag war erfüllt vom Anblick und den Geräuschen erhitzter Pferde und Menschen. Der Geruch, der in der Luft lag, war durchdringend, um es vorsichtig auszudrücken.
Und der Lärm war gewaltig; Menschen brüllten, die Räder der Kutschen ratterten über den Straßenbelag, und irgendwo spielte eine Kapelle. Ich konnte überall um uns herum Hunde bellen hören, auch wenn ich sie nicht sehen konnte, weil der Pulk um mich herum zu dicht war. Ich nahm mir fest vor, später nachzuprüfen, ob es in dieser Epoche wilde Hunderudel in London gegeben hatte.
Es sprach sich rasch herum, dass die Prozession von der Westminster Hall aus aufgebrochen war, und die Zuschauer um uns herum begannen damit, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und die Hälse zu recken.
Wir verbrachten unsere Zeit damit, unauffällig die Ankunft wichtiger Leute zu filmen. Jeder sah verschwitzt und unter Druck aus. Georg selbst hatte ihre Kleidung entworfen, die auf elisabethanischem und Stuart’schem Design beruhte. Er hatte seinen Beruf verfehlt. Ganz egal ob er der König war oder nicht – er hätte Party-Planer werden sollen.
Die Prozession wurde von einer Gruppe junger Frauen mit Körben angeführt, und ich war erfreut zu sehen, dass sie an der mittelalterlichen Tradition festhielten, als Schutzmaßnahme gegen die Pest Kräuter vor die Füße des Königs zu streuen.
Dann sahen wir zu, wie die Kronjuwelen und die Krönungsinsignien feierlich in die Abtei getragen wurden. Fast lohnte es sich schon, hier zu sein, nur um das mächtige, gewaltige Prunkschwert zu sehen. Einige Bischöfe folgten dahinter. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, denn für mich sieht ein Bischof wie der andere aus, aber später würde ich schon irgendjemanden auftreiben, der sie für mich identifizieren könnte.
Dann gab es eine Flaute. Alle um mich herum strengten sich an, einen ersten Blick auf den König erhaschen zu können. Man tuschelte sich zu, dass er sich wohl verspäten würde. Offenbar hatte er unmittelbar vor seinem Aufbruch etwas zerrissen, und da er nun mal Georg war, hatte ihn das ein bisschen in Panik versetzt.
Unfreiwillig wurden wir herumgeschubst und -geschoben, aber alle waren gutmütig, und es baute sich eine vorfreudig gespannte Atmosphäre auf.
Und endlich kam er. Prächtig gekleidet, fettleibig wie immer und doch merkwürdig beeindruckend. Alles an ihm war übertrieben. Seine Schleppe war beinahe zehn Meter lang und mit wunderbaren verschlungenen Stickereien versehen. Große weiße Federn wippten an seinem Hut. Die Menge wurde still, und jeder reckte den Hals, um noch besser sehen zu können. Männer nahmen ihre Hüte ab. Frauen knicksten, als der König vorbeikam. Wie gesagt: Er war fett. Er war unbeliebt. Er hatte für diesen Tag ein Vermögen verschleudert – aber die Menschen, die er passierte, wurden trotzdem respektvoll still. Er war ihr König, und in diesem Moment war er alles andere als albern.
Mir war heiß in meinem Sommerkleidchen. Markham musste kochen, und ganz sicher würde Georg jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Um sicherzustellen, dass auch jeder die Gelegenheit hatte, seine prunkvolle Thronbesteigung bewundernd zu verfolgen, hatten irgendwelche Dummköpfe die Anweisung gegeben, dass sein Baldachin hinter ihm hergetragen werden sollte. Auf diese Weise war er der knallenden Sonne ungeschützt ausgesetzt. Sein rundes rotes Gesicht mit den Hängebacken war schweißüberströmt. Er hielt ein seidenes Taschentuch in der Hand, mit dem er sich abwechselnd das Gesicht abwischte und der Menge zuwinkte. Gerade als ich hinsah, nahm es ihm einer seiner Diener ab und ersetzte es durch ein frisches.
Eigentlich war es wirklich ziemlich traurig, denn in seiner Jugend war er offenbar ein blendend aussehender Kerl gewesen. Jetzt gab es keine Spur mehr von dem schneidigen jungen Prinzen. Außer natürlich in seiner eigenen Erinnerung. Ich fand, dass er wie ein verdrießliches Baby aussah mit seinen hervorquellenden Augen und dem winzigen Mund, der – mit Verlaub – an eine Rosenknospe erinnerte. Aber er war sehr gutmütig. Er drehte sich hin und her und winkte den Leuten zu, die nun, einem typischen Herdentrieb folgend, allesamt dem Mann zujubelten und zuwinkten, den sie zuvor bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Buhrufen und Pfiffen bedacht hatten. Er wusste, wie man eine Menschenmenge für sich einnahm, und selbst ich fand es schwer zu glauben, dass das der Mann sein sollte, der seine Ehefrauen schlecht behandeln, seine Freunde hintergehen und in jeden nur denkbaren Skandal verwickelt sein würde.
Draußen vor der Abtei blieb er stehen. Seine Pagen – echte dieses Mal – richteten seine zehn Meter lange Schleppe aus. Ich konnte seine merkwürdig hohe Stimme hören, mit der er sie anwies, sie weiter auszubreiten, damit auch wirklich jeder die exquisite Goldstickerei bewundern konnte. Und dann, unter den Fanfarenklängen von Trompeten und mit einem letzten Winken in die Menge, betrat er die Abtei, um von Gottes Gnaden zu Georg gekrönt zu werden, König von Großbritannien, Irland und Hannover.
Um uns herum senkte sich Stille, als die Fanfarenklänge erstarben und der Rest der Prozession ihm nach drinnen folgte.
»Tja«, sagte ich zu Markham, und man sollte doch wirklich meinen, dass ich es inzwischen besser wüsste, »das ist ja mal gut gegangen.«
Kaum hatten die Worte meinen Mund verlassen, als ein korpulenter Mann, dessen Gesicht in der Hitze rot angelaufen war und der versuchte, die Aufmerksamkeit von jemandem, den ich nicht sehen konnte, zu erregen, gegen mich prallte und mir geradewegs das Aufnahmegerät aus der Hand schlug.
Normalerweise hätte ich den Rekorder mit einer Schlinge um mein Handgelenk befestigt getragen, und zwar genau für solche Fälle. Keine Ahnung, warum ich das an diesem Tag nicht getan hatte. Ich hörte, wie das Gerät auf dem Kopfsteinpflaster aufschlug, und versuchte zu entdecken, wo es gelandet war. Wieder hörte ich es, als es über den Boden schlitterte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand drauftreten würde, und dann wäre ich in Schwierigkeiten.
Ich glaubte, den Rekorder ausfindig gemacht zu haben, und beugte mich vor, um zwischen den Beinen der Umstehenden hindurchspähen zu können. Die Menge war dabei, sich zu verteilen, und alle spazierten herum, sammelten Freunde und Familie zusammen und gingen gleichzeitig in eine Million verschiedene Richtungen davon. Irgendjemand versetzte mir dabei einen ordentlichen Hieb, und schon stürzte ich zu Boden.
Ich hörte, wie Markham gellend schrie: »Max.«
Auf die wunderbare Gelegenheit, die dreckverkrusteten Kopfsteinpflaster einer näheren Betrachtung zu unterziehen, verzichtete ich wohlweislich und rollte mich stattdessen zu einer Kugel zusammen, während Füße und Beine an mir vorbeizogen.
Wieder hörte ich ihn: »Wo bist du?«
»Hier.« Mühselig versuchte ich, mich aufzurappeln, und offenbarte dabei ganz unzüchtig mindestens ebenso viel Bein wie die bald schon ehemalige Prinzessin von Wales.
»Ja, das ist wahnsinnig hilfreich. Wie wär’s mit etwas mehr Informationen?«
»Bitte sehr, meine Liebe«, sagte eine Stimme, und eine große rosafarbene Hand zerrte mich auf die Beine. »Macht der Dame mal ein bisschen Platz«, brüllte mein Helfer, und die Leute gehorchten.
Da stand ich also wieder, die Haube schief, meine Würde im Augenblick noch unten in der Gosse, in der ich gerade selbst gelegen hatte. So gut ich konnte, strich ich meine Kleidung glatt und versuchte nicht daran zu denken, was Mrs. Enderby sagen würde, sobald sie entdeckte, dass ich die Straße mit ihrer blauen Seidenkreation gewischt hatte. Dann sagte ich: »Danke sehr, Sir. Ich bin Ihnen wegen Ihrer Freundlichkeit sehr verbunden.«
Markham tauchte auf, rot und außer Atem.
»Bist du in Ordnung?«
Ich nickte. Der große Mann, gekleidet in einen blauen, zweireihigen Serge-Mantel, der seine breite Brust sogar noch breiter wirken ließ, setzte eine ausgesprochen finstere Miene auf, die Markham unmissverständlich klarmachte, dass er zukünftig besser auf mich aufpassen sollte. Dann berührte er kurz seinen Hut und verschwand.
»Ich habe meinen Rekorder fallen lassen«, äußerte ich stöhnend und war außer mir vor Panik, denn mittlerweile konnte er schon überall sein.
»In Ordnung«, sagte Markham und sah sich angestrengt um. »Bislang hat ihn wahrscheinlich noch niemand gesehen, geschweige denn aufgehoben. Also ist das Schlimmste, was passiert sein kann, dass er kaputtgetrampelt worden ist. Dr. Bairstow wird dir einen bösen Blick zuwerfen, aber nichts Ernsteres als das.«
Doch ich hörte ihm kaum zu und drängte: »Wir müssen das Gerät finden.«
»Ja, das müssen wir, aber versuch diesmal, dich auf den Beinen zu halten. Die Leute denken sonst, du hättest zu viel Gin intus.«
»Ach, schön wär’s.«
Er griff mich fest am Arm. »Du schaust links, ich nehme die rechte Seite.«
»Es ist nicht mehr hier. Ich habe gehört, wie er auf der Straße weitergekickt worden ist.«
Die Menschenmenge dünnte langsam aus. Die Krönungszeremonie selbst würde ja sechs Stunden andauern, und so verschwanden die meisten Leute auf der Suche nach Zerstreuung, Erfrischungen und einer stillen Ecke, wo sie pinkeln konnten. Es gab noch keine öffentlichen Toiletten, und deshalb pieselten die meisten gegen eine Wand oder hockten sich auf die Straße. Auf der ich kürzlich noch gelegen hatte. Ich wünschte wirklich, mir wäre dieser Gedanke gerade nicht gekommen.
Wir hatten Glück – und auch Pech.
Glück, weil wir den Rekorder entdeckten, obwohl die Aussichten darauf so gering gewesen waren.
Und Pech, denn er lag zwar nur drei bis vier Meter entfernt, als wir darauf zustürzten, doch jemand anders kam uns zuvor.
Kapitel 3
Dieser Jemand hatte keinen Hut auf dem Kopf, und seine langen, strähnigen Haare fielen ihm ins Gesicht. Er trug eine Art bodenlangen, speckigen Kapuzenmantel, der selbst aus der Entfernung muffig roch. Ich sah zu, wie er sich bückte und meinen angestoßenen, aber äußerlich immer noch intakten Rekorder aufhob und ihn in den Händen drehte.
Ich wurde ganz steif.
Markham ließ meinen Arm los und schlenderte auf den Burschen zu.
»Ah, Sir, wie ich sehe, haben Sie ihn gefunden. Besten Dank.«
Der Mann erwiderte nichts, sondern starrte uns nur misstrauisch an. Auch wenn Dr. Bairstow mich später umbringen würde, hoffte ich wirklich, dass das Ding nicht mehr funktionsfähig war, denn ansonsten würde der Mann es jetzt jeden Augenblick versehentlich einschalten und ein drei Meter großes Bild von Prinzessin Carolines Brüsten an das nächste Gebäude projizieren, und das würde uns in einige Erklärungsnöte stürzen.
Der Mann starrte Markham einen Moment lang an, und wir sahen seine schlechte Haut und den noch schlimmeren Zustand seiner Zähne. Dann drehte er sich um und nahm die Beine in die Hand.
Verdammt!
»Na los«, rief ich Markham zu. »Ich komme nach. Lass deine Kom-Verbindung offen.«
Er verschwand in der Masse, und ich folgte, so gut ich konnte. Ich hörte Markham schnaufen und fluchen, während ich mir meinen eigenen Weg bahnte. Die Leute waren hier nicht mehr so höflich, wie sie es rund um die Abtei gewesen waren. Als ich nach unten sah, stellte ich fest, dass mein wunderbares Kleid vorne voller unschöner brauner Flecken war. Zusammen mit meiner schiefen Haube sah ich vermutlich wie einer dieser Hogarth-Stiche aus, die die Armen der Arbeiterklasse und ihre enge Beziehung zum Dämon Alkohol zeigen.
Die Menschenmenge löste sich jetzt immer weiter auf. Wahrscheinlich waren alle Richtung Fluss unterwegs, denn wer wollte nicht dabei zusehen, wie eine Herde hölzerner Elefanten die Themse entlanggezogen wurde? Ich selbst hatte mich darauf gefreut.
Etwas unschlüssig lehnte ich mich mit dem Rücken gegen eine Mauer, fächelte mir Luft zu, kam wieder zu Atem und fragte leise: »Wo steckst du?«
»Ich muss ungefähr hundert Meter vor dir sein. Er ist in eine Gasse eingebogen. Da ist ein Straßenhändler an der Ecke, der irgendwelchen Kram verkauft. Jetzt habe ich ihn.«
»Um Gottes willen, sei bloß vorsichtig. Hunter wäre wirklich sauer auf mich, wenn ich dich in Einzelteilen zurückbringe.«
Keine Antwort.
Und noch einmal: So ein Mist.
Ich machte mich auf den Weg und hielt die Augen offen, ob es irgendwo Ärger gab. Den Straßenhändler fand ich völlig problemlos; kaum war ich um die Ecke gebogen, blieb ich wie angewurzelt stehen, denn ich war in einer anderen Welt gelandet.
Die breiten Straßen, Steingebäude, die gut gekleideten Leute und alle anderen Zeichen einer blühenden Metropole waren verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Selbst der Sonnenschein war weg. Alles, was es an diesem besonderen Tag zu hören und sehen gegeben hatte, war fort und verstummt. Hier gab es nur noch Düsternis und Stille.
Diese kleine Gasse maß an der breitesten Stelle nicht mehr als drei Meter. Die Gebäude – ich konnte sie nicht Häuser nennen – erhoben sich rechts und links davon. Sie waren nicht hoch, aber sie ragten einander über den schmalen Spalt hinweg entgegen wie alte Frauen, die die Köpfe zusammensteckten, um ein bisschen zu tratschen. Sie warfen lange, tiefe Schatten über den Weg, der trotz der Sommerhitze ein einziger Morast war. Der Boden schien schon vor langer Zeit vollkommen unter Dreck, Abwasser, Haushaltsabfällen, Tiermist, Schlamm und verrottendem Stroh verschwunden zu sein, und all das Zeug war im Laufe der Jahre immer weiter angewachsen und hatte dafür gesorgt, dass der Weg beträchtlich höher lag als die Türen. Jedes Mal, wenn es regnete, schwappte diese übelriechende Brühe wohl geradewegs in die Häuser und erreichte dort wahrscheinlich eine ziemliche Höhe.
Sich im Obergeschoss aufzuhalten war vermutlich nicht viel angenehmer. Nur wenige Dächer waren gedeckt, und kein einziges sah wasserfest aus. Oder sicher. Die Fenster waren winzig, und viele davon fest verrammelt. Es gab keine Scheiben. Die Wände waren von schleimigen Flecken bedeckt, die von den kaputten Dachrinnen abgingen, und ganz ähnliche Flecken wuchsen von dem Schlamm aus, in dem die Häuser standen, nach oben. Wenn sich die beiden irgendwann trafen, würden die Gebäude vermutlich zusammenfallen.
Der Gestank war widerlich. Die Industrialisierung in London nahm gerade an Fahrt auf, aber die Infrastruktur hinkte weit hinterher. Die Lebensbedingungen der Armen ließen sich nur als entsetzlich beschreiben. Es gab nur wenig Zugang zu sauberem Wasser und keine Abwasseranlagen. Die Flüsse von London waren braun vom Unrat. Für viele Menschen waren Krankheit, Armut und Verzweiflung das Einzige, woran sie keinen Mangel hatten.
Ich hörte ein Geräusch in der Nähe, holte meine Betäubungswaffe aus meinem Retikül und bewegte mich leise an einer der feuchten Wände entlang.
Und da waren sie. Zwei undeutlich zu erkennende Gestalten, die in einem Türeingang miteinander rangelten. Ich öffnete den Mund, schrie »Hey« und watete zu Hilfe. In diesem Moment packte mich jemand von hinten und versuchte, mir mein Retikül zu entreißen.
Ganz sittsam sagte ich: »Oh, bitte, Sir, berauben Sie mich nicht«, wirbelte herum und machte ihn unschädlich.
Ich hörte, wie Markham »Max« rief, und dann das Geräusch eines weiteren Körpers, der auf dem Boden aufschlug. Wieder geriet ich in Panik, denn auch wenn Hunter sehr biestig werden konnte, falls ich Markham verletzt zurückbrachte, war das nichts im Vergleich dazu, was sie tun würde, wenn ich ihn tot im Gepäck hätte.
Aber meine Sorge war unbegründet. Lässig löste er sich aus den Schatten und hielt in den Händen meinen angeschlagenen Rekorder.
»Erstaunlich, er funktioniert immer noch.«
Ich nahm ihn entgegen. »Danke. Mit dir alles in Ordnung?«
»Nur eine kleine Messerwunde.«
»Wie bitte?«
»Schon gut«, sagte er abwinkend. »Es ist wirklich nur ein Kratzer, und ganz ehrlich, Max, ich habe so viele Stoffschichten übereinander, dass man schon mit Belagerungsgerät auf mich schießen müsste, um da durchzudringen.«
Er blutete aus einem langen, aber nicht tiefen Kratzer auf seinem Handrücken. Ich kramte nach einem Taschentuch, verband ihn und erkundigte mich, wann er sich seine letzte Tetanusimpfung abgeholt hatte.
»Keine Ahnung«, antwortete er, »aber Hunter pikst mich ständig mit irgendwas, also mache ich mir keine großen Sorgen. Vergiss nicht, ihr zu erzählen, wie heldenhaft ich war, ja?«
Wir tauchten wieder aus der Gasse auf, richteten dabei unsere Kleidung und passierten einen Geistlichen mit Gamaschen und breitkrempigem Hut. Er missverstand die Sache völlig, warf uns einen vorwurfsvollen Blick zu und verlangsamte seinen Schritt. O Gott, unsere Seelen sollten gerettet werden.
Wir alle starrten einander an. Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können. Der Kirchenmann wühlte in seinen Taschen. Würden wir jetzt auch noch Pamphlete aufgedrückt bekommen?
Es war Markham, der, wie er hinterher behauptete, den Tag rettete.
Er schob mich nach vorne und sagte: »Sehr nettes Mädchen, Euer Ehren. Sehr sauber. Sehr geschickt. Und schon einen Braten in der Röhre, also keine Probleme mit irgendwelchem Nachwuchs in den Reihen der Geistlichkeit, der in ein paar Jahren an Eure Tür klopfen könnte, wenn Ihr meinen Gedanken folgen könnt. Also gut, Sir, ich bin immer froh, der Kirche zu dienen. Für Euch hier und heute zum besonderen Preis. Für Dienste, die Handfertigkeit und …«
Der Mund des Kirchenmannes öffnete und schloss sich wieder, während er nach Worten suchte, mit denen er unsere moralische Verwerflichkeit hätte beschreiben können. Dann hörte er die Stimmen von Näherkommenden, und da er vermutlich befürchtete, die Leute könnten die Situation für genau das halten, was sie auch war, machte er auf dem Absatz kehrt und hastete schnellen Schrittes die Straße hinunter. Markham lupfte hinter dem Davoneilenden höflich den Hut.
Ich boxte ihn auf den Arm. »Jetzt verhökerst du mich schon?«