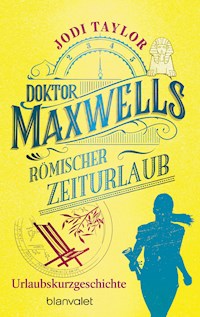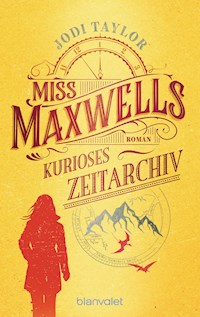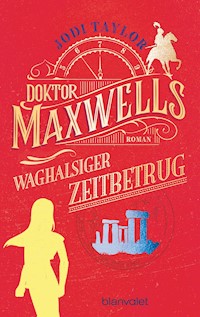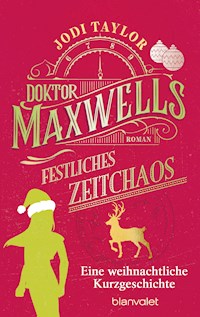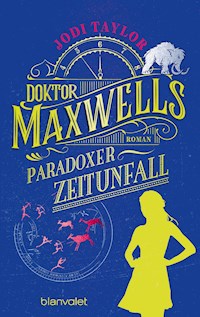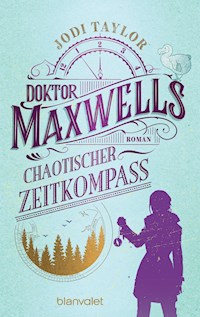9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von St. Mary’s
- Sprache: Deutsch
Kondome schützen! Wie Sie mit ihnen auch schwer bewaffnete Truppen abwehren, erfahren Sie im vierten Roman um die Zeitreisende Madeleine »Max« Maxwell.
Madeleine »Max« Maxwell freut sich auf ein friedvolles Leben an der Seite ihres geliebten Leon. Leider hält der Frieden nicht mal bis zum Mittagessen … Die Zeitpolizei taucht auf, um Max für ein Verbrechen zu verhaften, das sie nicht begangen hat – zumindest nicht in diesem Universum. Max und Leon bleibt nur die Flucht durch die Zeit, ein abenteurlicher Trip ins alte Ägypten, bis sie schließlich getrennt werden und Max sich allein den Schergen der Zeitpolizei stellen muss. Doch erst im St. Mary's Institut für historische Forschung, wo alles begann, wird die wilde Jagd durch die Zeit enden …
Die wunderlichen und unabhängig voneinander lesbaren Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
5. Doktor Maxwells spektakuläre Zeitrettung
6. Doktor Maxwells paradoxer Zeitunfall
E-Book Short-Storys:
Doktor Maxwells weihnachtliche Zeitpanne
Doktor Maxwells römischer Zeiturlaub
Doktor Maxwells winterliches Zeitgeschenk
Weitere Bände in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Madeleine »Max« Maxwell freut sich auf ein friedvolles Leben an der Seite ihres geliebten Leon. Leider hält der Frieden nicht mal bis zum Mittagessen … Die Zeitpolizei taucht auf, um Max für ein Verbrechen zu verhaften, das sie nicht begangen hat – zumindest nicht in diesem Universum. Max und Leon bleibt nur die Flucht durch die Zeit, ein abenteuerlicher Trip ins Alte Ägypten, bis sie schließlich getrennt werden und Max sich allein den Schergen der Zeitpolizei stellen muss. Doch erst im St. Mary’s-Institut für historische Forschung, wo alles begann, wird die wilde Jagd durch die Zeit enden …
Autorin
Jodi Taylor war die Verwaltungschefin der Bibliotheken von North Yorkshire County und so für eine explosive Mischung aus Gebäuden, Fahrzeugen und Mitarbeitern verantwortlich. Dennoch fand sie die Zeit, ihren ersten Roman »Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv« zu schreiben und als E-Book selbst zu veröffentlichen. Nachdem das Buch über 60 000 Leser begeisterte, erkannte endlich ein britischer Verlag ihr Potenzial und machte Jodi Taylor ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte. Ihre Hobbys sind Zeichnen und Malerei, und es fällt ihr wirklich schwer zu sagen, in welchem von beiden sie schlechter ist.
Die chaotischen Abenteuer der zeitreisenden Madeleine »Max« Maxwell bei Blanvalet:
1. Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
2. Doktor Maxwells chaotischer Zeitkompass
3. Doktor Maxwells skurriles Zeitexperiment
4. Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck
Weitere Titel in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
Roman
Deutsch von Marianne Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »A Trail Through Time (The Chronicles of St. Mary’s Book 4)« bei Accent Press, Cardiff Bay.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Jodi Taylor
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvaletin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraftunter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (Michal Sanca; VectorPixelStar)
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26651-6V001
www.blanvalet.de
Dieses Buch ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – gegenwärtigen und früheren – des North-Yorkshire-Bibliotheksdienstes gewidmet. Danke für eure Geduld und eure Freundschaft in all diesen langen, dunklen Jahren voller Angst und Mühsal.
Prolog
Und wieder einmal rannte ich.
Ich rannte, verflucht noch mal, ständig.
Im Laufe der Jahre war ich vor Jack the Ripper weggelaufen, vor blutrünstigen Dinosauriern, einem Mob aufgebrachter Bürger von Cambridge, die ganz versessen darauf gewesen waren, mich wegen des Diebstahls eines Spiegels und Hexerei anzuklagen – und vor assyrischen Soldaten. Was immer einem einfällt, ich bin davor abgehauen. Mit unterschiedlich viel Erfolg.
Was ich hier eigentlich sagen will: Ich hatte bisher immer gewusst, wovor ich wegrannte. Nur selten hatte ich eine Ahnung, wohin ich flüchtete – ich bin Historikerin, und wir planen nicht immer so weit im Voraus. Aber wovor ich floh, wusste ich in der Regel schon.
In diesem Fall bedauerlicherweise nicht. In diesem Fall rannte ich um mein Leben und hatte keinen verdammten Schimmer, warum.
Was jetzt folgt, ist schwer zu erklären. Wir müssen uns alle konzentrieren, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das selbst verstehe.
Ich bin Madeleine Maxwell, eine Historikerin. Ich arbeite für das St. Mary’s-Institut für Historische Studien. Wir untersuchen größere geschichtliche Ereignisse in zeitgenössischer Umgebung. Okay, wir unternehmen Zeitreisen. Dafür benutzen wir kleine, dem Anschein nach aus Stein gebaute Hütten, auch als Pods bekannt, und wir springen in jede beliebige Zeit, für die uns ein Auftrag erteilt wird, beobachten, dokumentieren, zeichnen auf, tun unser Bestes, uns aus Ärger herauszuhalten, und kehren erfolgreich ins St. Mary’s zurück. Unsere Pods sind klein, vollgestopft, häufig ein bisschen verwahrlost, und das Klo funktioniert nie anständig. Aus irgendeinem Grund riecht es in ihnen immer nach Kohl, aber es sind halt unsere Pods, und wir lieben sie.
Nach dem Tod von Leon Farrell hatte ich den Posten der stellvertretenden Direktorin im St. Mary’s übernommen und war zu meinem letzten Sprung aufgebrochen. Aus sentimentalen Gründen hatte ich mich für Frankreich entschieden, 1415, die Schlacht von Azincourt. Wie üblich strapazierten wir – mein Kollege Peterson und ich – unser Glück, aber diesmal trieben wir es zu weit.
Peterson wurde beim Angriff auf den Tross schwer verletzt. Beim Versuch, unsere Verfolger wegzulocken, schlug ich ihm mit einem glatten Stein auf den Kopf (eine ungewöhnliche Vorgehensweise, das stimmt, aber ich war zu diesem Zeitpunkt bemüht, ihm das Leben zu retten), rollte den Bewusstlosen unter einen Busch, wo ihn die Rettungsmannschaft auf jeden Fall finden würde, und rannte wie verrückt in die entgegengesetzte Richtung. So weit weg und so schnell, wie ich nur konnte, bis mir jemand mit einem Schwert das Herz durchbohrte. Eine tödliche Wunde.
Ohne allzu großes Bedauern fügte ich mich in mein Schicksal und empfahl meine Seele dem Gott der Historiker, der, wie gewöhnlich, nicht besonders auf Zack war. Ich fiel nämlich nach vorn, landete aber nicht, wie erwartet, in der Vergessenheit, sondern stattdessen auf einem harten, fransigen Axminster-Teppich.
Kann mir noch jeder folgen?
Mrs. Partridge, persönliche Assistentin des Direktors vom St. Mary’s-Institut und in ihrer Freizeit die Muse der Geschichte, riss mich aus meiner Welt und lud mich – durcheinander, wie ich war, und unter großen Schmerzen leidend – in einer anderen ab. In dieser Welt. Sie blieb eben noch lange genug, um mich darüber zu informieren, dass ich einen Job zu erledigen hätte und mich an die Arbeit machen sollte, und schon war sie wieder weg. Denn Gott bewahre, dass sie die Dinge jemals einfach für mich machen würde. Ich dachte, ich sei gerettet worden. Und ja, das war ich auch, aber nur so, wie man Truthähne bis Weihnachten verschont.
In dieser neuen Welt war ich es gewesen, die gestorben war, und Leon war derjenige, der überlebt hatte. Er hatte meinen Tod nicht sehr gut verkraftet. Und so war ich davon ausgegangen, dass mich Mrs. Partridge seinetwegen hierhergebracht hatte, damit ich ihn rettete. Ihn tröstete. Aber da hatte ich wohl etwas falsch verstanden.
Leon und ich hatten ein schmerzhaftes und irritierendes Zusammentreffen, bei dem ich ihn mit einer blauen Plastikmüllschippe vermöbelte. Lange Geschichte.
Egal, das Gute daran war, dass ich mich jetzt hier befand und in dieser neuen Welt lebte, die meiner eigenen in weiten Teilen ähnelte. Allerdings nicht in allen, wie ich bald schon feststellen sollte.
Leon und ich waren einander fremd geworden und hatten eine Heidenangst, unsere zweite Chance zu vermasseln, weshalb wir übereingekommen waren, es langsam angehen zu lassen. Wir hatten vor, gemeinsam ein neues Leben in Rushford zu beginnen, außerhalb des St. Mary’s-Instituts, und abzuwarten, was passieren würde.
Was passierte, war noch mehr Schmerz, noch mehr Verwirrung und viel Davonlaufen.
Nun, da ich es aufgeschrieben habe, bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich mir das alles selber abnehme.
Der springende Punkt ist allerdings, dass ich geglaubt hatte, ich wäre in Sicherheit. Dass ich endlich zur Ruhe kommen würde. Die Redensart Und sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage hatte sich unwillkürlich aufgedrängt. In meinem Fall allerdings war das Und sie lebte der entscheidende Teil. Der Part danach, bis ans Ende ihrer Tage, war mir wie ein netter Zusatz erschienen. Mein Plan hatte darin bestanden, dass ich ein ruhiges Leben mit Leon führen wollte. Ich würde malen, er würde Dinge erfinden, und wir würden endlich ein friedliches Beisammensein genießen.
Einen Tag lang taten wir das. Aber keineswegs einen ganzen. Wir schafften es nicht mal bis zum Mittagessen.
Eins
Der erste Morgen meines neuen Lebens.
Ich hatte eine Nacht lang tief und fest geschlafen, ein ausgedehntes heißes Bad genommen und mehrere Becher Tee getrunken. So gerüstet und in der ganzen Pracht meines gelb-weiß gepunkteten Schlafanzugs, fühlte ich mich wieder ein bisschen mehr obenauf und bereit, das neue Leben in Angriff zu nehmen.
Zwischen uns herrschte eine leichte Befangenheit, da wir beide nicht wussten, wo wir anfangen sollten. Um diese zu überbrücken, wuselte Leon in der Küche herum und bereitete Tee und Toast für mich zu, da ich das Frühstück verpasst hatte. Ich war am Küchentisch beschäftigt.
»Was machst du da?«, fragte er und stellte knallend einen Becher mit dampfendem Tee auf den Tisch vor mir.
»Ich schreibe meinen Nachruf.«
»Warum denn das um alles in der Welt?«
»Na, du kannst das schlecht tun, oder? Vor dem gestrigen Tag kannten wir uns noch gar nicht.«
»Meine Überraschung bezog sich weniger auf die Tatsache, dass wir uns kaum kannten, als vielmehr darauf, dass du genau betrachtet gar nicht tot bist.«
»Nein, aber ich war es. Vielleicht bin ich ein Zombie. Menschenhirne … Ich brauche Gehirne …«
»Bedaure, keine Gehirne, nur Marmite«, sagte er und stellte ein kleines bauchiges Glas auf den Tisch.
»Eine sehr akzeptable Alternative.«
Es gab eine kleine Pause. Ich fragte mich, ob Leons Max diese vegetarische Würzpaste vielleicht nicht gemocht hatte. Würde es von jetzt ab immer so sein, dass wir beide im Stillen diese neue Version von uns mit der alten verglichen? Ich mochte Marmite – seine Max vielleicht nicht. Ich mochte keine Milch – vielleicht hatte seine Max in dem Zeug gebadet. Dieser Leon trug schwarze Socken – das hatte mein Leon nicht getan. Mein Leon war Dynamit im Bett. Wir waren gut zusammen. Und nur mal angenommen, dass es jetzt nicht mehr so wäre …
Gedankenversunken legte ich meine Hände um den Becher. Es war so schwer, sich vorzustellen, wie das alles funktionieren sollte. Schon in der ersten Runde waren die Dinge nicht so gut für uns gelaufen, und dann war er gestorben, und dann ich … Nun ja, wäre ich jedenfalls, wenn Mrs. Partridge mich nicht hierhergeschafft hätte. Wir beide hatten eine so lange Geschichte … Falls irgendetwas schiefgehen würde – und das würde es –, dann war ich mir nicht sicher, ob ich es noch einmal überleben könnte, ihn zu verlieren. Doch dann dachte ich an den wunderbaren, herzzerreißenden, die Seele erhebenden Augenblick in seiner Werkstatt, als ich ihn wiedersah und wusste, dass zwischen uns beiden nichts und alles möglich wäre.
Ich schaute hoch, sah, dass er mich beobachtete. Er hatte jeden meiner Gedanken mitverfolgt. Das jedenfalls hatte sich nicht geändert.
»Das wird kein Problem werden«, sagte er leise. »Wir müssen nichts überstürzen. Wir haben noch unser ganzes Leben vor uns, und wir werden jeden Tag so nehmen, wie er kommt. Ganz oben auf der Liste steht, dass du wieder fit und gesund wirst. Ich mag es nicht, wenn Frauen mit großen Löchern in der Brust in der Wohnung herumlaufen. Dann sieht gleich der ganze Ort irgendwie schlampig aus.«
»Alles schon wieder zu«, sagte ich. »Ab und an zwackt es ein bisschen.«
Eigentlich tat es sogar ziemlich weh. Mrs. Partridge hatte schon gewusst, was sie da tat. Ich hatte keine andere Wahl, als hierzubleiben und alles etwas gemächlicher anzugehen. Mindestens noch eine Woche lang.
Eine ganze Menge konnte in einer Woche geschehen.
Und das würde es auch.
Das Telefon klingelte.
Leon war gerade damit beschäftigt, Toast zu buttern; deshalb ignorierte er das Läuten, und der Anrufbeantworter schaltete sich ein.
Ich hörte seine Stimme. »Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.«
Pause.
Ein Piepton.
Dann Dr. Bairstow, dessen Stimme heiser und drängend war, als er sagte: »Leon. Verschwinde. Sie sind hier. Lauf!«
Dann war die Leitung tot.
Das Buttermesser fiel Leon aus der Hand. Ich sah, wie es eine schmierige Spur auf dem Fußboden hinterließ. Er würdigte sie keines Blickes.
»Du hast dreißig Sekunden. Schnapp dir alles, was dir was bedeutet. Los!«
Ich machte mir nicht die Mühe, Fragen zu stellen. Er hätte sich nicht die Mühe gemacht, sie zu beantworten. Stattdessen war ich mit einem Satz im Wohnzimmer und griff mir das Trojanische Pferd, das er früher mal für mich geschnitzt hatte. Ich sah mich kurz um und nahm dann auch noch mein kleines Buch über Azincourt – das einzige Überbleibsel aus meiner Kindheit – und mein eines Foto von Leon und mir mit. Ich wickelte mir meine rote Schlange um den Hals, die ich im Krankenhaus gehäkelt hatte, als ich mich von Jack the Ripper erholte – die ich auf gar keinen Fall zurücklassen würde –, und fand mich einige Sekunden vor Ablauf der Zeit an der Hintertür ein.
Leon beäugte die Schlange. »Eines Tages müssen wir uns mal die Zeit nehmen und uns über deine merkwürdigen Prioritäten unterhalten.« Er schob mich durch die Hintertür nach draußen, die Treppe hinunter und in den Garten.
Auf der anderen Seite der Grundstücksmauer konnte ich Geräusche hören. »Willst du denn nicht abschließen?«
»Würde nicht das Geringste nützen. In den Pod. Schnell.«
Sein Pod schmiegte sich in eine Ecke seines winzigen Gartens und war getarnt als unauffälliger Schuppen. Ich rief nach der Tür, die sich öffnete, während Leon die Wäscheleine wegriss und die Regentonne mit dem Fuß zur Seite schob.
Mir blieb gerade noch genug Zeit, den vertrauten Pod-Geruch einzuatmen: überhitzte Elektronik, menschliche Ausdünstungen, feuchter Teppich und Kohl. Dann drängte sich Leon hinter mir herein und schlug auf den Türschalter.
»Keine Sorge«, sagte er ruhig. »Hier drinnen sind wir ziemlich sicher. Ich aktiviere das Tarnsystem. Wir warten einfach still und leise ab. Mit ein bisschen Glück werden sie uns nicht finden und wieder verschwinden.«
Ich hätte fragen sollen – wer sind denn die? Warum sollten wir nicht in Sicherheit sein? Und die allumfassende Frage: Was zum Teufel ist hier eigentlich los?
Aber das tat ich nicht. Vor allem deshalb nicht, weil Leons ganze Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gerichtet war, wo er nach irgendwelchen Bewegungen Ausschau hielt. Wahrscheinlich hätte er mich auch gar nicht gehört. Ich stand da, beladen mit Buch, Bild und Schlange, und spürte, wie meine Brust heftig puckerte. Und ich hatte noch nicht mal mein Frühstück verputzt.
»Hier.« Er drehte den zweiten Sitz in meine Richtung, und ich war froh, mich hineinsinken zu lassen. Vielleicht war ich doch noch nicht annähernd so fit, wie ich geglaubt hatte.
Schweigend warteten wir ab. Es dauerte nicht lange.
Sie kamen geradewegs durch das Gartentor, und sie hielten sich nicht damit auf, es vorher zu öffnen. Krachend brach es aus den Angeln und wirbelte sich mehrfach überschlagend davon. Männer strömten in den kleinen Garten und verteilten sich. Es waren ungefähr sechs Leute, soweit ich das sehen konnte, aber vermutlich standen noch zwei oder mehr draußen und sicherten den Eingang.
Sie waren beängstigend schnell, leise und professionell.
Zwei stürmten die Stufen hoch, traten die Hintertür auf und verschwanden in der Wohnung.
Der Rest machte sich ohne Umschweife auf den Weg zu uns. In den Garten. Unmittelbar auf den Pod zu.
Sie konnten uns unmöglich sehen. Es gab nichts zu entdecken. Wir waren getarnt. Vor dem Hintergrund einer einfachen Steinmauer waren wir unsichtbar.
Trotzdem spürte ich einen Anflug von Sorge. Sie wussten, dass wir da waren. Sie mochten vielleicht nicht in der Lage sein, uns zu sehen – wer auch immer sie waren –, aber sie wussten, dass wir irgendwo stecken mussten.
Mein erster Eindruck war, dass sie zum Militär gehörten. Volle Kampfmontur! Helme mit schwarzen Visieren verliehen ihnen ein unheilvolles Aussehen, und sie hatten einige schwere Waffen dabei. Keine Gewehre, aber in der Form von Karabinern, mit irgendeiner Art von Unterbau. Die Männer bewegten sich geschmeidig, sehr effizient und abgestimmt aufeinander. Wir steckten auf jeden Fall tief in der Scheiße.
Leon fluchte leise.
Die Eindringlinge ließen sich auf den Boden fallen, und mit ihren Waffen deckten sie jeden Zentimeter des kleinen Gartens ab. Wie konnten sie wissen, dass wir hier waren? Was ging hier vor sich?
Der Soldat ganz hinten hob jetzt, da jeder Winkel im Blick behalten wurde, etwas in die Luft, das für mein nichttechnisches Auge wie ein Föhn aussah.
War das ein EMI-Gerät? Ein elektromagnetischer Impuls würde den Pod und uns ausschalten!
Jetzt fluchte Leon so richtig, schubste mich von meinem Sitz aus auf den Boden und schrie im gleichen Moment: »Computer! Sprung initialisieren.«
»Sprung initialisiert.«
Und die Welt wurde weiß.
Wir landeten ohne die geringste Erschütterung. Leon warf einen raschen Blick auf die Konsole, legte mehrere Schalter um und fuhr Systeme runter. Seine Hände tanzten in einer mir sehr vertrauten Art und Weise über die Kontrollregler. Da er beschäftigt war, blieb ich still auf dem Boden liegen, wohin er mich befördert hatte, starrte hoch an die Decke und dachte nach.
Ganz offensichtlich hatten die Männer entweder nach ihm oder nach mir gesucht. Und da Leon sich inzwischen schon seit einiger Zeit in Rushford aufgehalten und vermutlich ein unbescholtenes Leben geführt hatte, wohingegen ich vor Kurzem als fremder Eindringling in seiner Welt aufgetaucht war, schien es naheliegend, dass ich diejenige war, die sie finden wollten.
Dass sie in irgendeiner Weise mit dem St. Mary’s-Institut in Verbindung standen, bezweifelte ich nicht. Sie hatten ein paar wirklich coole Spielereien dabeigehabt. Und dann war da ja auch noch der warnende Anruf von Dr. Bairstow. Sie hatten also beinahe gleichzeitig im St. Mary’s und in Rushford zugegriffen. Irgendetwas Schlimmes war vorgefallen, und beinahe mit Sicherheit ging es dabei um mich. Wie hatten sie mich so schnell ausfindig machen können? Und wenn sie mich geschnappt hätten – was hätten sie dann mit mir gemacht?
Als ob ich darauf nicht die Antwort wüsste.
Vielen Dank auch, Mrs. Partridge. Sie war es gewesen, die mich aus meiner eigenen Welt gerissen und mich in dieser abgeladen hatte. Vom Regen in die Traufe, wie man so schön sagt. Ohne Vorwarnung. Ohne Frühstück. Und jetzt war irgendetwas hinter mir her. Etwas Ernstzunehmendes. Was war denn jetzt mit mir und dem ruhigen Leben?
Leon setzte sich neben mir auf den Boden. »Danke, dass du mich nicht mit Fragen bombardiert hast.«
»Nur eine kurze Atempause. Genieß sie.«
»Habe ich dir wehgetan?«
»Im Gegenteil. Ich bin noch nie mit so viel Stil zu Boden befördert worden. Neun Komma fünf Punkte dafür.«
»Dann hoch mit dir.«
Ich ließ mich auf den Sitz sinken und starrte auf den Schirm und die vertrauten Koordinaten. Ich wusste, wo wir waren.
Mein Leon und ich hatten einen ganz speziellen Ort zu einer ganz bestimmten Zeit gehabt. Eine kleine Insel im östlichen Mittelmeer, Tausende von Jahren in der Vergangenheit, bevor dort zum ersten Mal Menschen aufgetaucht waren. Das St. Mary’s-Institut war mir lieb und teuer, aber manchmal will man einfach allein sein. Dann kamen wir hierher, an diesen besonderen Ort, um eine kleine Auszeit miteinander zu verbringen. Das Beste daran war, dass absolut niemand davon wusste. Manchmal taucht dieser Platz auf uralten Karten als die Insel von Skaxos (nicht Skagos, oder?) auf, aber meistens ist sie zu klein, um auf Karten eingezeichnet zu sein, ganz zu schweigen davon, mit Namen versehen zu werden. Hier dürften wir also ziemlich sicher sein.
Leon beendete seine Arbeit an der Konsole. »Es ist immer noch dunkel draußen. Sollen wir mal kurz durchschnaufen?«
»Gute Idee. Und dann kannst du mir erzählen, worum es hier eigentlich geht.«
Er stand auf und machte den Wasserkocher an. Die traditionelle Methode, wie man in St. Mary’s mit Krisen umgeht.
Wie ich schon berichtet habe, ist mein Name Madeleine Maxwell. Leitende Missionschefin im St. Mary’s-Institut für Historische Studien. Besser gesagt: Ich war das. Da ich nie als stellvertretende Direktorin bestätigt worden war, fühlte ich mich im Unklaren darüber, was ich jetzt war. Abgesehen von klein, rothaarig und etwas konfus, natürlich, aber da das im Grunde meine Werkseinstellung ist, sollte man das nicht weiter beachten.
Vor einer Woche war ich in der Kreidezeit gewesen, wo ich einen hungrigen Deinonychus-Saurier mit einem Feuerlöscher und harten Worten abgefertigt hatte. Gestern um diese Zeit war ich in Azincourt gewesen und hatte auf das Schwert in meiner Brust gestarrt, kurz bevor ich in eine neue Welt geschubst worden war. Ich hatte eben noch Zeit genug gehabt, ein Bad zu nehmen, und jetzt war ich hier und wurde auf der Zeitlinie herumgeschleudert – im Schlafanzug. Irgendjemand schuldete mir eine Erklärung. Und Frühstück.
Leon legte mir meinen Morgenmantel um die Schultern.
»Danke«, sagte ich überrascht.
»Nun, einige von uns waren etwas fokussierter, als es darum ging, sich wichtige Dinge zu schnappen, die uns durch die augenblickliche Krise bringen würden.«
Traurig lächelte ich meinen kleinen Haufen Besitztümer an. »Das ist alles, was ich auf der Welt habe. Du kannst mir keinen Vorwurf machen.«
»Ich sage es dir immer wieder – die Hälfte von allem gehört dir. Du hast mir alles in deinem Testament hinterlassen.«
Wir machen alle unser Testament. Bei unserem Lebenswandel ist das unerlässlich. Sämtliche diesbezüglichen Schriftstücke liegen bei Dr. Bairstow. In meiner Welt hatte ich alles Leon vermacht und dann, als er gestorben war, zwischen engen Freunden aufgeteilt: Markham, Peterson und Kal. Zusätzlich hatte ich gewisse Vorkehrungen getroffen, indem ich ein bisschen was hinter der Theke deponiert hatte. Zweifellos veranstalteten sie daheim in meinem St. Mary’s just in diesem Moment ein erstklassiges Besäufnis. Es ist immer gut zu wissen, dass man auch nach seinem Tod noch die Dinge aufmischen kann. Ein posthumer Stachel im Fleisch des Managements.
»Also, was sind das für Leute, Leon? Und was wollen sie?«
»Das ist die Zeitpolizei.«
Das sagte mir überhaupt nichts. Ich muss entsprechend verblüfft ausgesehen haben.
»Die gibt es in deiner Welt nicht?«
»Nein.«
»Tja, hoffen wir, dass es so bleibt.«
Schweigen. Er bereitete den Tee zu.
»Also gut. Pass auf. Vor langer Zeit erzählte ich meiner Max, dass Dr. Bairstow und ich aus der Zukunft kommen.«
Ich nickte. »Du hast mir berichtet, dass ihr zurückgeschickt worden seid, um das St. Mary’s-Institut zu beschützen. Dass wir bedroht wurden … werden würden.«
»Nun, es sieht so aus, als wäre die Zeit jetzt gekommen.«
»Warte mal. War das nicht dieser Clive Ronan?«
»Ja, auf seine eigene Weise. Aber die wirkliche Bedrohung für das hiesige St. Mary’s ist die Zeitpolizei. Irgendwann in der Zukunft – und das hat, Gott sei Dank, nichts mit St. Mary’s zu tun – entdecken mehrere Länder beinahe gleichzeitig, wie man durch die Zeit reisen kann. Plötzlich will das jeder, weil alle denken, sie könnten dann die eigene Vergangenheit ändern, und dabei will jeder der Erste sein. Es wird der Versuch unternommen, ein internationales Abkommen zu schließen, das beschränkte und streng kontrollierte Zeitreisen erlaubt, während die Zeitlinie weiterhin geschützt bleibt. Eine Weile lang geht auch alles gut. Eine sehr kurze Weile – aber die Versuchung, zurückzukehren und alte Kriege neu auszufechten, dieses Mal mit dem späteren Wissen, ist einfach zu groß.«
Er sah mich an. »Kannst du dir das vorstellen?«
Ich nickte. Das konnte ich in der Tat.
Ich hatte noch nie eine sonderlich hohe Meinung von der menschlichen Rasse gehabt, und bislang hatte ich in dem Punkt nicht unrecht. Man muss uns doch nur anschauen. Wir haben dieses Geschenk bekommen, dieses wunderbare Geschenk. Als einzige Spezies auf dem Planeten sind wir in der Lage, unsere eigene Vergangenheit zu betrachten. Auf unseren Triumphen aufzubauen. Aus unseren Fehlern zu lernen. Aus erster Hand zu erfahren, wie genau wir dorthin gekommen sind, wo wir uns heute befinden. Und anstatt das als die wunderbare Gabe zu betrachten, die es ist, haben wir versucht, sie für nichts Besseres zu nutzen, als alte Konflikte aufzuwärmen.
Ich persönlich denke, dass wir Menschen so weit gekommen sind, wie wir kommen können. Wir zerstören den Planeten. Wir sind nie um eine Ausrede verlegen, wenn es darum geht, einander auszulöschen. Falscher Gott. Falsche Rasse. Falsche Hautfarbe. Falsches Geschlecht. Tatsächlich bin ich ziemlich erstaunt darüber, dass nicht längst die wirklich angepisste Geschichte ein flammendes Schwert geschwungen hat, woraufhin wir alle wieder in Höhlen im Schnee hausen und auf halb garem Mammutfleisch herumkauen. Und selbst das wäre eigentlich schon mehr, als wir verdienen.
Kein Wunder, dass wir es noch nicht bis zum Mars geschafft haben. Ich vermute, dass das Universum verdammt genau darauf achtet, dass wir nicht die Chance bekommen, auch andere Planeten mit unserer Dummheit zu ruinieren. Es sorgt dafür, dass wir auf diesem hier bleiben, auf dem wir nichts anderes zerstören können als uns gegenseitig.
Leon nahm einen Schluck Tee und fuhr fort: »Stell dir vor, was passieren könnte, Max. Nationen würden kurz aufflackern und wieder verschwinden. Menschen würden leben, dann sterben, dann wieder leben. Ereignisse würden sich zutragen. Dann hätte es sie plötzlich nie gegeben. Und dann würden sie noch einmal geschehen, aber dieses Mal anders. Vielleicht würde es irgendwelche entscheidenden Ereignisse nie geben. Die Geschichte könnte so viele Male verändert und neu geschrieben werden, dass sie völlig überfordert wäre. Es könnte das Ende von allem bedeuten.«
Selbst im warmen Sonnenschein spürte ich, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief.
»Aber – das ist nie geschehen? Oder doch?«
»Nein, es ist nicht geschehen. Als alles zusammenzubrechen drohte, wurde die Zeitpolizei gegründet. Um alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Sie setzt sich aus dem Militär, der Polizei und einigen Mitgliedern aus dem St. Mary’s-Institut zusammen. Ihr Aufgabengebiet ist weit gefasst. Einige würden sagen: zu weit gefasst. Sie haben nur ein einziges Ziel: was auch immer zu tun nötig ist, um die Zeitlinie zu schützen, egal, mit welchen Mitteln. Und das tun sie. Sie machen einen ausgezeichneten Job. Aber wenn ich sage, sie tun, was auch immer erforderlich ist, um den Job zu Ende zu bringen, dann verstehst du sicherlich, was ich meine, oder?«
Ich verstand. Ihr Job war es, alles auszulöschen, was die Zeitlinie bedrohen könnte. Und ich war, wenn vielleicht auch keine Bedrohung, so doch mindestens eine Anomalie. Und sie wussten, dass ich hier war. Und sie würden nicht eher ruhen, bis sie mich gefunden hatten.
Er fuhr fort. »Nationen werden dazu … genötigt, Zeitreisen aufzugeben. Ohnehin will das eigentlich niemand mehr. Mittlerweile haben alle herausgefunden, dass Zeitreisen nichts anderes als eine Schlange in der Hand sind. Früher oder später wird sie sich immer in deiner Faust herumwinden und zubeißen. Und sie haben alle herausgefunden, dass sie nicht einfach in der Vergangenheit plündern können. Also hat man zwar einen Haufen Ausgaben, aber man kriegt nichts dafür. Außerdem sind allen die möglichen Konsequenzen ihrer Taten ganz unmissverständlich klargemacht worden. Natürlich will keiner der Erste sein, der die Zeitreisen einstellt, aber die Zeitpolizei sorgt für internationale Übereinkünfte, und nach einer Menge Hin und Her fügt sich alles wieder. Wie ich schon sagte, findet all das in der Zukunft statt. Im St. Mary’s-Institut hat man in der ganzen Zeit versucht, die Füße stillzuhalten und nicht aufzufallen, und so wurde es uns erlaubt, weiter zu existieren, allerdings unter strenger Kontrolle. Die Zeitpolizei bewegt sich die Zeitlinie rauf und runter und überwacht alle Inkarnationen des Instituts, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jeder Sprung muss genehmigt werden. Wir müssen tonnenweise Papierkram einreichen, Risikobewertungen, erwartete Gewinne, angewandte Methoden, beteiligtes Personal, Ziele und Hindernisse – dieses ganze Zeug eben. Wir müssen eine Genehmigung für jeden Sprung haben, und es werden nicht sehr viele erteilt.«
»Wer ist für die Genehmigungen zuständig?«
»Der Erstantrag geht an unseren Arbeitgeber – die Thirsk-Universität. Und dann leitet Thirsk den Antrag weiter an die Zeitpolizei, zusammen mit einer eigenen Empfehlung.«
Wieder machte er eine Pause, um seinen Tee zu trinken, und ich dachte derweil nach.
»Und was ist dann schiefgelaufen?«
»Von der Überwachung ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Kontrolle. Und das ist es, was sie von Anfang an wollten. Die vollständige Kontrolle über alle Inkarnationen von St. Mary’s. Und im Großen und Ganzen hatten sie auch Erfolg. Kannst du dir vorstellen, was ihnen das für eine Macht verleiht? Es existieren nur noch ein paar vereinzelte unabhängige Zellen. Unser St. Mary’s gehört dazu.«
»Und deshalb sind sie hinter uns her?«
»Nein. Ich glaube, sie sind durch deine Anwesenheit aufgescheucht worden. Im besten Falle wollen sie dich nur befragen. Im schlimmsten allerdings …«
Wir schwiegen beide und starrten in unsere leeren Becher.
»Los, komm«, sagte Leon entschlossen und zog mich auf die Beine. »Es wird hell. Wir überprüfen unsere Vorräte, und dann gehen wir nach draußen und schlagen unser Lager auf.«
Wir verließen den Pod, gerade als sich die erste Morgensonne über die Landschaft ergoss und Leben und Farbe in die Welt zurückbrachte. Einen Moment stand ich da und ließ einfach nur den Frieden auf mich einwirken. Ich war schon lange nicht mehr hier gewesen. Das letzte Mal war kurz vor Troja gewesen. Nach Troja sprachen mein Leon und ich nicht mehr miteinander, ganz zu schweigen davon, dass wir in romantischen Augenblicken schwelgten. Alles war noch genau so, wie ich es in Erinnerung hatte, und doch war ich noch nie hier gewesen. Dies war nicht meine Welt.
Eine große Welle der Trauer kam aus dem Nichts. Trauer um mein St. Mary’s-Institut, das ich nie wiedersehen würde. Um Tim, der verletzt und niedergeschlagen dalag. Um Kalinda, meine Freundin. Um Markham und Guthrie. Um den Boss. Selbst um Mrs. Partridge. Ich erinnerte mich an den Frühstücksgeruch am Morgen, das Trappeln der Füße auf den uralten Holzböden, den Klang von wütenden Streitigkeiten zwischen Dr. Dowson und Professor Rapson – oder gelehrte Debatten, wie die beiden es beharrlich zu nennen pflegten. Ich erinnerte mich an das Klackern des Gehstocks vom Boss auf den Steinböden. All das war fort. Für immer.
Dann ebbte die Trauer ab und machte der Angst Platz. Ich war allein in einer vertrauten, aber seltsamen Welt, und jetzt sah es auch noch so aus, als wäre ich auf der Flucht. Ohne einen weiteren Gedanken zu riskieren, war ich in diesen Pod gesprungen, und es dämmerte mir jetzt (natürlich viel zu spät), dass das möglicherweise nicht der klügste Schachzug gewesen war.
Auf der anderen Seite bin ich Historikerin. Ich arbeite für das St. Mary’s-Institut. Ich würde einen schlauen Schachzug nicht einmal dann erkennen, wenn er eine rote Fahne schwenkte.
Leon unterbrach diese völlig nutzlosen Gedanken.
»Wollen wir uns hinsetzen?«
Er breitete eine Decke aus, und wir lehnten uns in der Sonne an einen großen Stein. Genau so, wie ich es immer mit meinem Leon getan hatte.
Ich schloss die Augen und rutschte noch ein bisschen hin und her.
»Hast du Schmerzen? Tut dir deine Brust weh?«
Was sollte ich sagen? Wie sollte ich diese plötzlichen, beinahe überwältigenden Gefühle von Panik, Isolation und Furcht vermitteln?
Vorsichtshalber hielt ich die Augen noch für eine Weile geschlossen. Er sagte nichts, was ich zu schätzen wusste.
Schließlich begann ich: »Es tut mir leid. Das war nur so ein Moment. Jetzt ist alles wieder okay.«
»Was wünschst du dir von mir? Was soll ich tun? Soll ich dich ein bisschen allein lassen? Über was anderes sprechen? Dir einen ordentlichen Becher frischen Tee bringen?«
Ich holte tief Luft. »Eigentlich will ich … Was ich wirklich, wirklich will … ist, einen Augenblick lang einfach nur hier sitzen.«
Er machte Anstalten aufzustehen, aber ich zog ihn wieder zu mir. »Nein, das ist gut so. Bitte bleib. Vielleicht ist jetzt der Moment, um … um …«
Er setzte sich wieder, griff nach einem Stock und begann, damit Muster in den Boden zu kratzen, während die beiden Menschen auf diesem Planeten, die am schlechtesten über Emotionen reden können, um ihre Gefühle herumschlichen.
Dann begann ich: »Das muss auch für dich schwer sein.«
Er zögerte. »Das ist es, aber ich denke, ich bin bei alldem der Gewinner. Ich habe nichts verloren, ich habe nur gewonnen. Habe dich wiedergewonnen. Aber du hast alles verloren, und alles, was du gewonnen hast, bin ich. Und ich bin nicht der richtige Leon.«
Er verstand alles. Ich hätte mehr Vertrauen haben sollen.
Und so lächelte ich. »Ich betrachte mich keineswegs als Verliererin. Und lass uns doch den Tatsachen ins Gesicht sehen: Im Augenblick haben wir beide nichts außer den anderen. Und unseren Flüchtlingsstatus natürlich.«
»Ja, das ging schnell, oder? In einem Moment bin ich noch respektabler Besitzer eines kleinen Unternehmens in einer der beschaulichsten Marktstädte in ganz England, und dann tauchst du auf und setzt die Mächte der Dunkelheit frei. Und jetzt verstecken wir uns auf einer kleinen Insel, fünftausend Jahre vor unserer Zeit.«
»Ohne Frühstück«, fügte ich hinzu, um ihn auf das Wesentliche hinzuweisen. »Ich wette, du hast nicht daran gedacht, mir meinen Toast mitzubringen, oder?«
Er seufzte. »Nichts als Klagen.«
»Hätte es dich umgebracht, dir auf dem Weg nach draußen noch schnell eine Scheibe zu schnappen? Ich könnte schwören, dass diese Zeitpolizei sich gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, über mein Frühstück hermacht.«
Eine Weile saßen wir da, während die Welt leuchtender und wärmer wurde.
Dann veränderte Leon seine Sitzposition. »Ich wollte dich das fragen, aber du musst nicht darüber sprechen, wenn du nicht willst: Wie bist du hierhergekommen?«
»Du meinst hierher, in diese Welt?«
»Ja. Was ist in Azincourt geschehen?«
Ich begann langsam. »Es war mein letzter Sprung. Tim Peterson und ich. Weißt du, ich sollte stellvertretende Direktorin werden.«
»Ich kann nur annehmen, dass Dr. Bairstow kurzzeitig geistig umnachtet war. Und du hast es geschafft, dich in der Schlacht von einem Schwert durchbohren zu lassen? Wart ihr zu nahe dran?«
»Tja, na klar waren wir viel zu nahe. Wir waren oben bei den Bogenschützen. Aber nein, es geschah, als wir uns den Tross hinter der Front ansehen wollten.«
Wieder schloss ich die Lider, und vor meinem geistigen Auge erwachte alles wieder zum Leben.
»Der Versorgungszug war hinter den Schlachtreihen. Genauso wie Hunderte von französischen Gefangenen. Wir wollten prüfen, ob Heinrichs Befehl, sie zu töten, gerechtfertigt war. Und ob er überhaupt ausgeführt wurde. Gerade als wir eintrafen, tauchte aus heiterem Himmel ein Haufen französischer Bauern auf. Sie kämpften nicht in der Schlacht, sie waren da, um zu plündern, die Gefallenen und Verwundeten auszurauben, die Pferde zu stehlen – all diese Dinge.
Ich weiß, was du sagen wirst, aber wir waren eigentlich schon auf dem Rückzug. Wir waren auf dem Weg zurück zum Pod. Überall um uns herum wurde gekämpft. Diese Bastarde töteten die Verletzten, die Priester, die kleinen Jungen, jeden, der ihnen in die Hände fiel. Einer kam aus dem Nichts und trennte Peterson beinahe einen Arm ab.«
Ich brach ab und schluckte, als ich diesen Moment noch einmal durchlebte.
»Er war … so tapfer. Ich habe ihn weggeschleppt und seine Wunde verbunden. Er war bei Bewusstsein, konnte aber kaum noch sprechen. Der Pod war nicht mehr weit entfernt, es war aber klar, dass er das nicht mehr schaffen würde. Leon, ich hatte bereits dich verloren. Ich konnte nicht auch noch ihn verlieren.«
Ich hielt inne.
»Was hast du getan?«
»Ich habe ihn in eine Senke geschoben, ihm einen Stein über die Rübe gezogen, ihn unter Blättern vergraben und ihn zurückgelassen.«
»Ein Glück, dass er ein Freund von dir war. Was machst du mit Leuten, die du nicht leiden kannst?«
Ich presste ein Lachen hervor.
Leon streichelte mir über den Arm. »So ist es schon besser. Und was dann?«
»Dann bin ich weggelaufen. Ich bin immer weitergerannt. Durch den nassen Wald. Ich habe so viel Lärm gemacht, wie ich konnte. Sie sind mir gefolgt. Einer war vor mir. Ich bin einfach gegen ihn geprallt. Während ich mit ihm beschäftigt war, hat mich jemand anders mit seinem Schwert durchbohrt. Ich habe nichts davon mitbekommen.«
Wieder geriet ich ins Stocken. Leon ritzte noch immer Dreiecke in den Erdboden. Ich holte tief Luft und ging alles noch einmal durch. »Es wurde sehr still und unbewegt ringsum. Als ich hochsah, waren da schwarze Äste und der weiße Himmel. Nichts rührte sich.«
Jetzt sprach ich mit mir selbst.
»Ich spürte nicht den Drang zu atmen. Alles war zum Ende gekommen. Alles war vorbei. Ich spürte kein Bedauern. Ich hatte Tim eine Überlebenschance verschafft. Dann fiel ich nach vorn. Auf deinen Teppich. Den ich überall vollgeblutet habe. Wahrscheinlich verlierst du deine Kaution. Tut mir wirklich leid.«
»Und das ist alles, was passiert ist?«
Ich nickte. Was ich ihm erzählt hatte, war die Wahrheit. Nur eben nicht die ganze. Ich hatte Mrs. Partridge und ihren Anteil an der ganzen Sache nicht erwähnt. Ich meine, was sollte ich schon sagen? Oh, ich bin im 15. Jahrhundert gestorben, und dann hat mich die Muse der Geschichte aus meiner Welt gepflückt und mich in deine fallen lassen – damit ich eine Aufgabe erledige, über die sie mir nichts verraten wollte.
Ich weiß nicht, warum ich Mrs. Partridge nicht erwähnen wollte. Es ist ja nicht so, als ob ihre Rolle die ganze Geschichte noch schräger gemacht hätte oder unglaubwürdiger oder noch unwahrscheinlicher. Das war schließlich gar nicht möglich. Die ganze Angelegenheit ist vollkommen schräg, unglaubwürdig und unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite reise ich berufsmäßig durch die Zeit, also sollte man mir besser nichts von schräg, unglaubwürdig und unwahrscheinlich erzählen. Wirklich, ich schätze, anstatt mich zurück- und wieder vorwärtszubewegen, war ich einfach – seitwärtsgesprungen.
Man wiederhole diese Theorie bitte nie in Gegenwart eines angesehenen Physikers. Ich will nicht, dass man mich auf der Straße anspuckt.
Ich überließ es Leon, das Lager aufzuschlagen, und schlenderte langsam zwischen den Bäumen, um einen ersten Blick auf das glitzernde türkisfarbene Meer zu werfen, den Vögeln zu lauschen, die den neuen Tag begrüßten, und in der Ferne das Brechen der Wellen in der Brandung zu hören und den Klang des Windes, der durch die Pinien strich. Das war immer ein ganz besonderer Moment für mich. Ich saß auf einem Stein und ließ freudige Erinnerungen in mir aufsteigen.
Die Bäume reichten bis ans Ufer hinunter, und ihre giftgrünen Nadeln bildeten einen starken Kontrast zur rostroten Erde und den Steinen. Alle Farben waren strahlend und frisch. Die Sonne brannte von einem wolkenlosen tiefblauen Himmel. Später würde es richtig heiß werden. Alles war still und friedlich. Dies war schon immer ein kleines Stück vom Paradies gewesen. Hier war noch nie etwas Schlimmes passiert.
Nicht dass ich das lange genießen durfte. Wie üblich, so war ich auch jetzt die verantwortliche Holzsammlerin und Wasserholerin. Ich wäre auch zur hauptamtlichen Schlepperin schwerer Lasten bestimmt worden, aber glücklicherweise hatte ich eine tödliche Wunde in der Brust, von der ich mich erholen musste, und so durfte ich mich nicht überanstrengen. Auch nicht kochen. Tatsächlich war ich nicht nur von Kochpflichten befreit, sondern es war mir sogar streng verboten, auch nur in die Nähe von irgendeinem Bereich zu kommen, in dem Speisen zubereitet wurden. Was keine so harte Strafe war, wie es vielleicht aussehen mochte.
Leon war damit beschäftigt, das Feuer anzuzünden, und ich brach auf zur endlosen Suche nach Feuerholz. Ich schlüpfte aus meinen Latschen, schüttelte den Morgenmantel ab und wanderte vertraute Wege entlang. Unter meinen Fußsohlen spürte ich den Teppich aus weichen Nadeln, ich sog den Geruch von Pinien und Meer ein und lauschte den Seevögeln, die kreischend über dem felsigen Ufer ihre Runden drehten.
Nichts hatte sich verändert. Jahreszeiten kamen und gingen, aber nichts veränderte sich hier jemals. Es würden noch Tausende von Jahren vergehen, ehe zum ersten Mal Menschen auf dieser kleinen Insel landen würden.
Es lag viel Holz herum, und ich spazierte gemächlich zwischen den Bäumen und bückte mich unter Schmerzen, um kleinere Stücke aufzusammeln.
Und dann stieß plötzlich irgendwo hinter mir ein Vogel einen schrillen Schrei aus, der wie eine Warnung klang, und schoss hinauf in die Luft. Die Flügel flatterten hektisch, als er versuchte, an Höhe zu gewinnen.
Sofort setzte bei mir der Instinkt ein. Ich zog mich hinter einen Baumstamm zurück und blieb stocksteif stehen. Abwartend.
Ich bemerkte die Bewegung, einige Sekunden bevor ich begriff, was ich da sah. Und dort. Und da drüben ja auch.
Eine Reihe von mittlerweile hinreichend bekannten schwarz gekleideten Soldaten bewegte sich langsam den Hügel hoch. Die Männer griffen nicht an, bewegten sich lediglich in langsamer, geduckter Haltung. Sie blieben dabei in strikter Formation. Das war keine Attacke – sie pirschten sich an. Stellten sicher, dass nichts an ihnen vorbeigelangen konnte.
Scheiße! Wie konnten die uns gefunden haben?
Aber jetzt war keine Zeit für irgendwelche Tricks. Sie würden mich sehen, sobald ich mich bewegte. Es gab keine Umgebung auf der Welt, in der ein gelb-weiß gepunkteter Pyjama mühelos mit der Umgebung verschmelzen konnte.
Ich ließ das Holz fallen, schrie Leon eine Warnung zu und setzte mich in Bewegung. Rannte hügelaufwärts, so schnell, wie ich nur konnte, und meine Brust schmerzte unter der Belastung. Mein Tod war einfach noch nicht lange genug her für solche Anstrengungen.
Hinter mir brüllte jemand einen Befehl. Sie hatten mich also gesehen.
Halb erwartete ich einen Kugelhagel, aber der kam nicht. Vielleicht war die Sicht auf mich durch die Bäume hindurch nicht klar genug für Beschuss.
Leon warf unser Zeug zurück in den Pod.
Ich riskierte einen Blick über die Schulter und sah, dass zwei von ihnen wieder mit ihrem Föhn-Ding zielten.
Wenn das EMIs waren, dann mussten die Typen gar nicht auf uns schießen. Sie konnten einfach den Pod außer Gefecht setzen und uns dann in aller Seelenruhe einsammeln. Dies hier war eine kleine Insel. Wir würden ihnen nicht lange aus dem Weg gehen können.
Mühsam kämpfte ich mich weiter den Hügel hoch. Meine Brust stach, und ich bekam kaum Luft. Gestern um diese Zeit war ich noch tot. Was erwarteten die Leute eigentlich von mir?
Ich schrie Leon zu: »Verschwinde! Weg mit dir!«
Er ignorierte mich. Stattdessen kam er mir entgegengerannt, packte mich am Arm und schleifte mich buchstäblich in den Pod. Als wir durch die Tür stürzten, brüllte er bereits: »Computer, Notrückholung. Jetzt.«
Ich machte mich bereit, denn ich wusste, dass das wehtun würde.
Und das tat es auch.
Die Welt wurde schwarz.
Zwei
Ich lag auf dem Rücken, inmitten eines Durcheinanders von Sachen, und starrte nach oben an die Decke.
Zur Hölle, nicht noch einmal.
Notrückholungen sind – wenig überraschend – für Notfälle gedacht. Für Situationen, in denen es wichtiger ist, schnell rauszukommen, als auf sichere Art und Weise zu verschwinden. Denn es tut weh. Man erklärt einen Notfall, und der Pod wirbelt einen in einer Geschwindigkeit von der Katastrophe weg, bei der man Nasenbluten bekommt. Kurz darauf folgt ein knochenzermalmender Aufprall auf dem Boden. Ob man es glaubt oder nicht, es gibt hin und wieder einen Historiker, der noch nie eine Notrückholung angefordert hat. Ich hingegen habe längst den Überblick über die vielen Male verloren, in denen mir das zugestoßen ist. Und nie wird es leichter.
Ich drehte den Kopf. Leon stemmte sich langsam vom Boden hoch.
»Bleib, wo du bist, Max.«
Als ob ich irgendeine Wahl gehabt hätte.
»Wir müssen überprüfen, ob sie uns wieder gefolgt sind. Lieg einfach ganz still. Ich kümmere mich in einer Minute um dich.«
Ich war froh zu sehen, dass persönliche Belange nicht seine Prioritäten verschoben. Es würde nichts bringen, wenn er sich ängstlich über mich beugen würde, während die Zeitpolizei durch die Tür brach.
Schwerfällig stand er auf und ließ sich auf einen der Sitze fallen, wo er mit verzerrtem Gesicht seine Schultern knetete. So etwas wie eine schmerzlose Notrückholung gibt es nicht. Ich hatte keine Schwierigkeiten damit, seine Anweisungen zu befolgen und unbeweglich liegen zu bleiben.
Dann sagte er schließlich: »Also, es ist das 17. Jahrhundert. London, glaube ich, und es ist kalt. Genau genommen ist es sogar sehr kalt.«
Ja, das glaubte ich gerne. Großbritannien litt zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert unter einer kleinen Eiszeit. Ich stöhnte vor mich hin. Da im Computer keinerlei Koordinaten für die Rückkehr eingegeben worden waren, hatte er einfach zufällig eine Zeit und einen Ort gewählt. Für ihn war es am wichtigsten, den Pod und die Besatzung in Sicherheit zu bringen. Vermutlich in genau dieser Reihenfolge. Da fünfzig Prozent der Mannschaft immer noch im Schlafanzug steckten, wäre ein Ort, an dem es ein bisschen wärmer war, sehr viel willkommener gewesen.
»Ich glaube«, sagte Leon nachdenklich, »dass wir auf der Themse gelandet sind. Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor.«
Er begann damit, durch verschiedene Bildschirme zu scrollen.
»Doch«, sagte ich. »Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, du wirst feststellen, dass die Themse zugefroren ist. Ob sie unser Gewicht trägt?«
Er sah mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm. »Sie scheint das Gewicht von jedem auszuhalten. Da draußen gibt es eine kleine Stadt. Buden, Zelte, Stände, Menschen, Lagerfeuer, gebratene Tiere am Spieß und … ich glaube … ja, da ist ein Bär. Ich schätze, ein kleiner Pod macht da auch keinen Unterschied mehr.«
»Bist du sicher? Wir sind mit ziemlichem Karacho runtergekommen.«
»Ich weiß«, sagte er und rieb sich den Ellbogen. »Aber es gibt keine Anzeichen für Eisbruch. Und wir sind getarnt, also gibt es auch kein Gekreische und keine Panik. Was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass es hier schon seit beinahe fünf Minuten eine Historikerin vor Ort gibt. Kann es sein, dass du langsam alt wirst?«
»Sehr witzig«, gab ich zurück und rappelte mich auf. »Ich persönlich sage ja immer, dass eine Landung, nach der man auf den eigenen zwei Beinen weiterlaufen kann, eine gute war. Selbst wenn ein Techniker am Steuer saß.«
»Im Ernst? Das ist deine Definition von einer guten Landung?«
»Nun, wie du schon gesagt hast – keine Panik da draußen und keine inneren Verletzungen. Ein riesiger Erfolg nach herrschendem St. Mary’s-Standard.«
Ich gesellte mich zu ihm an den Bildschirm. »Oh, cool. Das ist ein Frostjahrmarkt.«
»Ein was?«
»Weißt du denn nichts über Frostjahrmärkte?«
»Ich bin Techniker. Ich habe andere Prioritäten.«
»Also ist es wohl mal wieder die Historikerin, die den Tag mit den entscheidenden Informationen rettet, über die der Techniker dringend verfügen muss.«
»Und bitte in weniger als zweihundert Worten, wenn du das schaffst.«
»In Ordnung. Hör zu. In früheren Tagen war die Themse viel flacher und breiter als heute. Keine Uferbefestigung. All der Schutt und Abfall türmten sich rings um die schmalen Piers an der London Bridge und brachten den Fluss beinahe zum Stillstand. Also fror dieser zu. Das Wetter war auch viel kälter. So kalt, dass Vögel tot vom Himmel fielen. Das Rotwild in den Parks verendete. Die Menschen starben auf den Straßen, und öffentliche Wohltätigkeitsaktionen wurden gestartet, um die Armen mit Heizmaterial zu versorgen und ihnen so beim Überleben zu helfen. Los, komm.«
»Du willst doch nicht etwa da raus?«
»Das lasse ich mir nicht entgehen.«
»Bist du wahnsinnig?«
»Leon, das muss ich sehen. Das ist meine einzige Chance. Ich werde nie wieder hierher zurückkommen.«
»Wenn es so kalt ist, dass die Vögel vom Himmel fallen – willst du dann wirklich im Schlafanzug draußen rumlaufen?«
Ich klappte einige Schranktüren auf. »Hier muss es doch irgendetwas geben.«
Unwillig zog Leon ein Sammelsurium an nicht zusammenpassenden Kleidungsstücken heraus: Sweatshirts, Socken, Handschuhe. Ich wusste doch, dass er irgendetwas dabeihaben würde. Das war sein ganz persönlicher Pod, den er schon seit was-weiß-ich-wie-vielen Jahren besaß. Zusätzlich zu seiner eigenen Ausrüstung bei Kälte und schlechter Witterung war es undenkbar, dass er nicht noch allen möglichen anderen nützlichen Kram angesammelt hatte.
Ich schlüpfte in so viele Kleidungsstücke wie möglich und stopfte die Hosenbeine meines Pyjamas in mehrere Paar alte Socken. Leon nahm eine Decke und schnitt einen Schlitz für meinen Kopf hinein, sodass ich sie in Clint-Eastwood-Manier über meinem Morgenmantel tragen konnte. Und ja, er hatte recht. Ich sah in der Tat sehr merkwürdig aus, besonders, da ich mit drei Paar Socken in seinen viel zu großen Gummistiefeln herumschlurfte. Aber da draußen würde beinahe mit Sicherheit jeder jedes einzelne Kleidungsstück, das er besaß, tragen und vermutlich auch noch die Bettbezüge, also würde ich mich gut einfügen, wie ich Leon gegenüber betonte.
Er sagte nichts, sondern schwieg vielsagend.
Wir traten nach draußen. Er hatte so was von recht. Es war kalt.
Zur Hölle, war das kalt.
O Gott, war das kalt.
Nur mein Stolz hielt mich davon ab, postwendend zurück in den Pod zu marschieren. Ich spürte, wie mir die Haare in den Nasenlöchern festfroren. Leon wickelte mir einen Schal um Kopf und Gesicht.
»Ich hab’s dir ja gesagt.«
Über den Schal hinweg funkelte ich ihn an.
Er lächelte. »Du hast Schnee in den Wimpern.«
Ehe mir etwas einfiel, das ich hätte sagen können, redete er weiter. »Atme durch den Schal und huste auf gar keinen Fall, denn dann wirst du nie wieder aufhören.«
Ich merkte, wie die Kälte durch die Gummisohlen und die drei Paar Socken drang. Augenblicklich verwandelten sich meine Füße in Eisblöcke. Es wehte kaum Wind, aber die Kälte kroch trotzdem mühelos durch meine Kleiderschichten und ließ mir das Mark in den Knochen gefrieren. Ich hatte Mitleid mit den Armen, die sich in ihren zugigen Behausungen eng aneinanderdrängten. Einige dieser Hütten hatten kein vernünftiges Dach und manche vermutlich auch keine richtigen Wände. Jeder versuchte, sich warm zu halten. Versuchte, am Leben zu bleiben.
»Jetzt los«, sagte Leon. »Bewegung oder zurück in den Pod.«
Wir drehten uns um, weil wir uns mit dem Standort des Pods vertraut machen wollten, denn manchmal ist es ziemlich heikel, etwas wiederzufinden, das man nicht sehen kann. Wir befanden uns neben einer rot-weiß gestreiften Bude und gegenüber einer schmuddeligen weißen Markisenplane mit hochgebundenen Seiten, unter der gewaltige Mengen Bier ausgeschenkt wurden.
Es lag viel schmutziger Schnee auf dem Eis, der uns sicheren Tritt ermöglichte, sodass wir zügig loslaufen konnten. Leon schob seinen Arm unter meinen.
»In Ordnung?«
Ich nickte nur, damit er nicht hören konnte, wie mir die Zähne klapperten.
Ich schätzte, dass es später Nachmittag war. Die Sonne war bereits im Begriff unterzugehen. Blasse Sterne erschienen über uns am Himmel. Hin und wieder schwebten ein paar Schneeflocken vorbei. Immer mehr Menschen tauchten auf dem Eis auf, riefen sich etwas zu und lachten.
Man sagt: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Für Londoner hieß das offenbar: Wenn das Leben dir eine zugefrorene Themse und bitterkalte Minusgrade gibt, dann halte einen Frostjahrmarkt ab und verdien ein bisschen Geld. Sie verwandelten einen Überlebenskampf in die Gelegenheit, sich zu zerstreuen.
Der Qualm aus Tausenden von Kaminen verbreitete sich horizontal durch die kalte Luft und drohte die Stadt zu ersticken. Der letzte Rest von Farbe verschwand vom Himmel. Mit einem Schlag wurde mir noch kälter, falls das überhaupt möglich war.
Trotzdem: Das war London zur Restaurationszeit, 1683, und es war unmöglich, nicht aufgeregt zu sein. Das war England unter dem lustigen Monarchen, Charles Stuart.
Kaum war der nicht ganz so lustige Olly Cromwell gestorben, stießen die Engländer einen Seufzer der Erleichterung aus, beschlossen, so etwas nie wieder zu wagen, und installierten die Monarchie neu, und zwar in Person dieses cleveren Partylöwen Charles II. Charles war berühmt für seine Gespielinnen, den Englisch-Niederländischen Krieg, seine Spaniels, das Große Feuer von London (als er neben seinen Landsleuten in London gegen das Feuer kämpfte), die Königliche Gesellschaft (Royal Society) und mindestens vierzehn uneheliche Kinder. Er stopfte eine ganze Menge in seine fünfundzwanzig Jahre währende Regentschaft.
England wischte die sozialen und religiösen Restriktionen von Cromwells Commonwealth-Regelung beiseite, holte tief Luft – und machte Party. Die Ausschnitte der Frauenkleider und auch die Moral rutschten nach unten. Röcke hingegen wurden bei jeder sich bietenden Gelegenheit gelupft. Das Land explodierte in überschäumender Promiskuität und aufrührerischem Benehmen. Immer mehr der streng religiösen Bürger brachen – ohne calvinistische Separatisten zu sein – voller Abscheu Richtung Amerika auf.
Das normale Prozedere jeder Mission sollte darin bestehen, dass wir unsere Umgebung unter die Lupe nehmen und auf mögliche Gefahren hin absuchen. Auf einem Schlachtfeld ist das immer ein großer Spaß. Man studiert die Menschen, ihr Verhalten und ihre Kleidung, zeichnet alles auf und dokumentiert so, was zu diesem Zeitpunkt passiert.
Unter den augenblicklichen Bedingungen bestand allerdings nicht viel Aussicht auf irgendetwas davon, denn alles war unter Schnee begraben. Gewaltige, lange Eiszapfen hingen an Buden und Gebäuden in der Nähe, da die Temperaturen am Tag leicht anstiegen und dann über Nacht wieder fielen. Auf allen ebenen Flächen glitzerte eine dicke Eisschicht. Jeder war in viele Lagen Kleidung gewickelt, sodass keine Chance bestand, einen Blick auf die Mode der Zeit zu werfen. Wir mussten das Beste aus dem machen, was uns noch übrig blieb.
»Sieh mal«, sagte Leon und zeigte auf etwas. Die Menschen hatten sich Tierknochen unter die Füße gebunden und bewegten sich mithilfe von Stöcken und langen Stangen vorwärts. Es gab viel Geschrei und Gelächter. Und eine Menge Stürze.
Trotz der Kälte und der Sorge spürte ich, wie mir leichter ums Herz wurde. Ich bin Historikerin. Das ist es, wofür ich geboren bin. Vor Aufregung hüpfte ich kurz auf und ab; ich konnte nicht anders.
Hier und da wurden Tiere an Spießen gebraten. Struppige Hunde und noch struppigere Kinder drückten sich herum und hofften darauf, dass etwas für sie abfallen würde. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Der Duft war verführerisch. Und wieder dachte ich wehmütig an meinen verpassten Toast.
Auf dem Eis wanderten Pastetenhändler mit Bauchläden herum und priesen lautstark ihre Waren an. Überall um uns herum konnte ich Stelzenläufer und Jongleure sehen. Lehrburschen spielten mit großem Enthusiasmus und wenig Können Fußball. Kichernde Damen mit gepuderten Haaren, eingewickelt in dicke Felle, waren in eine artige Kegelpartie vertieft. Musikanten marschierten auf und ab, die Wangen rot vor Kälte. Niemand konnte es sich leisten, längere Zeit still zu stehen. Nicht bei diesen Temperaturen.
Verflucht noch eins, war das kalt. Ich konnte spüren, wie sich Eis auf meinen Wimpern bildete.
Wir sollten ebenfalls in Bewegung bleiben. Außerhalb der kleinen warmen Inseln rings um die vereinzelten Feuerschalen war die Luft schneidend kalt. Ein paar mehr Schneeflocken rieselten nun zu Boden und vermischten sich mit dem Ruß der Feuer. Ich machte vorsichtige, flache Atemzüge durch meinen Schal hindurch, was die beste Art und Weise zu sein schien, wenn man vermeiden wollte, dass man sich einen oder beide Lungenflügel aus dem Leib hustete. Ich hatte es schon lange aufgegeben, noch meine Füße zu spüren. Mir fiel ein, dass die Temperatur meiner Füße und die interessanten Orte, zu denen ich gelangt war, um sie zu wärmen, in der Vergangenheit zu einer Vielzahl von hitzigen Debatten geführt hatten …
Auf jeden Fall schienen hier alle eine wunderbare Zeit zu verbringen. Bei denjenigen, die hochprozentige Getränke ausschenkten, blühte das Geschäft. Menschen riefen sich etwas zu, begrüßten lautstark Freunde und lenkten die Aufmerksamkeit auf den einen oder anderen sonderbaren Anblick. Überall war laute Musik zu hören. Es war ein bisschen wie das Glastonbury Festival bei Eis und Schnee statt im Schlamm. Und es gab sogar noch weniger Klos.
Jetzt, da die Dunkelheit hereingebrochen war, entzündeten die Standbesitzer überall auf dem Eis ihre Laternen, und die Lagerfeuer flackerten noch höher zu den Sternen hinauf. Aufregung lag in der Luft. Die Menschen waren offenbar entschlossen, sich zu vergnügen. Bei diesen Temperaturen konnten sie morgen um diese Zeit auch schon tot sein.
Genauso wie wir.
Fix schob ich diesen Gedanken beiseite. Während es immerhin möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich gewesen war, dass die Zeitpolizei irgendwie von der Existenz von Skaxos gewusst hatte und uns dorthin gefolgt war, hatten wir es doch geschafft, sie dort abzuhängen. So viel Geschichte, wie es da draußen gab, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie uns auch noch hier aufspüren könnten.
Ich hatte gerade viel Spaß dabei, zwei waghalsige junge Männer zu beobachten, die versuchten, eine Gruppe von Mädchen mit ihren Schlittschuhkünsten zu beeindrucken, als wir einen besonders lauten Tumult hörten. Wenn wir nicht auf solidem Eis gestanden hätten, hätte ich gesagt, der Lärm komme aus Richtung flussabwärts. Menschen kreischten, aber nicht freudig. Hunde bellten. Rings um uns herum reckten die Leute die Hälse und versuchten herauszufinden, was da vor sich ging. War irgendjemand im Eis eingebrochen? Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und gab mir Mühe, durch die Menschenmenge hindurchzuspähen. Vielleicht hatte jemand einen Taschendieb gefasst.
Leon packte meinen Arm und sagte leise: »Hier entlang«, und zog mich von der allgemeinen Aufregung fort.
»Was ist denn los?«
»Sie sind hier.«
»Was? Wie kann das sein? Wie haben sie uns denn finden können?«
»Das werden wir später rauskriegen. Geh nicht schneller. Und schau nicht hinter dich. Schlendere einfach zurück zum Pod.«
Etwa hundert Meter waren wir jetzt vom Pod entfernt, und der Tumult hinter uns rückte immer näher.
»Sieh nicht zurück«, wiederholte Leon. »Das ist eine gängige Praxis. Sie sorgen hinter uns für Aufregung, und während wir wegrennen, erwartet uns deren überwiegende Mehrzahl vor uns, sodass wir ihnen blindlings in die Arme laufen.«
»Irgendwelche hilfreichen Gedanken?«
»Lass uns vom Fluss verschwinden. Hier sind wir zu exponiert. Wir tauchen in den Straßen unter und suchen uns später den Weg zurück.«
»Nimm mal an, sie finden den Pod.«
Er blieb stehen.
»Guter Gedanke.«
Allerdings. Manchmal habe ich solche Momente. Wenn die Zeitpolizei den Pod finden und unbrauchbar machen würde, wären wir hilflos. Eigentlich war das alles, was sie tun mussten. Wenn wir bei diesen Temperaturen keinen Zugang bekämen, könnten wir innerhalb weniger Stunden tot sein. Vielleicht würde es nicht einmal so lange dauern. Und erneut spürte ich ein ängstliches Ziehen. Ich habe das früher schon einmal gesagt. Es ist nicht leicht, außerhalb der eigenen Zeit zu leben. Jeder hat einen Platz in der Gesellschaft, und ohne den Rückhalt durch die Familie, durch Freunde, eine Handwerkszunft, einen Stamm, ein Dorf sind wir praktisch nichts. Sich am Leben zu halten, indem man stiehlt, macht nicht viel Spaß. Und es hatte den Anschein, dass diese Leute nur ein paar Stunden nach uns auftauchten, wo auch immer wir hinsprangen. Wir konnten in argen Schwierigkeiten stecken.
Leon sah zu mir runter. »Kannst du rennen?«
Ich öffnete den Mund, um Ja zu sagen, aber heraus kam ein Nein.
Manchmal siegt die Vernunft über die Dummheit. Sogar bei mir.
Ganz lässig bogen wir vom Fluss ab, stapften durch den knirschenden Schnee, stiegen ein paar vereiste Stufen hoch und kletterten über eine niedrige Mauer.
»Sieh nicht zurück und renne nicht. Ganz ruhig jetzt.«
Wir gingen langsam und erreichten ein Gewirr kleiner Gassen, die von schmalen Holzhäusern gesäumt waren, welche sich wenig vertrauenerweckend über die Straße beugten. Fast zwanzig Jahre nach dem Großen Feuer von London waren die Straßen hier noch immer eng und gekennzeichnet von bestialischem Gestank. Ich wusste, dass es ehrgeizige Pläne für eine moderne Stadt gegeben hatte, mit Boulevards und Alleen. Aber die einfachen Leute hatten Angst, dass ihre winzigen Stückchen Land von diesen Entwürfen geschluckt werden würden, und hatten mit dem Wiederaufbau angefangen, noch bevor die Asche kalt geworden war. Das Ergebnis war, dass sich das neue London in großen Teilen kaum vom alten unterschied.
Hier, weit weg von den Lichtern und den Feuern auf dem Jahrmarkt, schien alles noch dunkler und voller Schatten. Und noch viel, viel kälter. Der Schnee, der hier lag, war schwarz und matschig. Die wenigen Leute auf den Straßen wankten nach Hause und umklammerten so viel Holz, wie sie nur hatten auftreiben können. Winzige Fenster waren zum Schutz gegen die Kälte verrammelt, und alle Ritzen, die es gab, waren mit steif gefrorenen Lumpen verstopft. Nur wenige Lichter waren zu sehen. Die Luft war rauchgeschwängert und kratzte in meiner Kehle. Ich versuchte, nicht zu husten.
Wir liefen durch das Labyrinth. Die verlassenen Straßen standen in seltsamem Kontrast zu den Lichtern und dem bunten Treiben auf dem Jahrmarkt, nur wenige hundert Meter entfernt. Ich bibberte unter den vielen Schichten meiner ausgefallenen Kleidung. Leise rieselten Schneeflocken vom dunklen Himmel. Mittlerweile waren wir die einzigen Menschen, die noch draußen unterwegs waren.
Eigentlich war die Stille ein bisschen besorgniserregend. Wo steckten die wilden Hunde, Katzen, Ratten und Prostituierten, die normalerweise an solch dunklen Orten zu finden waren? Die Antwort war: Sie mieden die Kälte. Hunde, Katzen, Ratten und Huren hatten offenbar sehr viel mehr Verstand als wir. Was nicht schwer war.
»Keine Prostituierten«, sagte ich.
»Natürlich nicht. Nur ein Verrückter würde in einer Nacht wie dieser seinen Schwanz rausholen, denn der würde ihm schon in der Hand abbrechen.«
Wir schlichen noch ein bisschen weiter. Jetzt wurde das Schneegestöber dichter. Die Kälte war beinahe unerträglich.
»Wir sind auf dem Weg zurück zum Pod«, sagte Leon leise, und sein Atem gefror zu einer Wolke um seinen Kopf. »Wir laufen jetzt parallel zum Fluss. Wenn wir die nächste Abbiegung links nehmen, sollten wir irgendwo in der Nähe des Pods herauskommen.«
Leise schlüpften wir von Schatten zu Schatten. »Beinahe da«, sagte er, und kaum dass die Worte aus seinem Mund gekommen waren, erschienen drei oder vier dunkle Gestalten am Ende der Straße, blickten aber glücklicherweise nicht in unsere Richtung. Noch nicht.
»Hier rein«, sagte er, und wir drängten uns nach links in eine Gasse, die so schmal war, dass wir uns an manchen Stellen seitwärts hindurchschieben mussten.
Die gute Nachricht war, dass die überhängenden Dächer diesen beengten Raum relativ schneefrei gehalten hatten. Die schlechte Nachricht war, dass man diese Gasse auch mit Fug und Recht die Gasse der Körperflüssigkeiten hätte taufen können. Der Gestank war schon schlimm genug, aber wir rutschten immer wieder in den Pfützen von gefrorenem Urin aus. Vereiste Kothaufen knirschten unter meinen Füßen. Eines Tages würde ich mich bestimmt mal an einem Ort wiederfinden, an dem ich nicht knietief in Ausscheidungen stehen würde. Eines schönen Tages, bitte, bitte.
Leon blieb wie angewurzelt stehen, und ich prallte gegen seinen Rücken. Ganz langsam zog er mich zur Seite hinter ein kaputtes Fass. Ich hockte mich unter Schmerzen hin. Wir beide atmeten in unsere Ärmel, damit uns unser gefrierender Atem nicht verraten würde. In einer halben Stunde würden wir gut getarnt sein. Und steif gefroren natürlich auch.