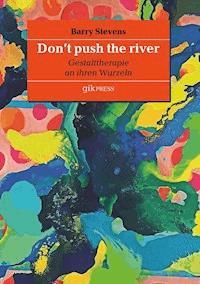
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch möchten wir eine bemerkenswerte Frau vorstellen, die in der Entwicklung der Gestalttherapie eine bedeutende Rolle gespielt hat, aber in Deutschland bisher leider kaum bekannt ist: Barry Stevens (1902-1985). Sie war bereits 65 Jahre alt, als sie 1967 zum ersten Mal Fritz Perls und der Gestalttherapie begegnete. Als Fritz Perls 1969 die Gestaltgemeinschaft am Lake Cowichan in der Nähe von Vancouver in Kanada gründete, folgte sie ihm dorthin und begann, zusammen mit rund zwanzig Personen, ihre Gestalttherapie-Ausbildung. Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Überlegungen aus dieser Zeit bilden die Grundlage des hier vorliegenden Buches, das mit Fug und Recht als Klassiker der Gestalttherapie bezeichnet werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Celestial Arts, Berkeley/California
Barry Stevens
(1902 – 1985) war bereits 65 Jahre alt, als sie 1967 zum ersten Mal Fritz Perls und der Gestalttherapie begegnete. Und als Fritz Perls 1969 die Gestaltgemeinschaft am Lake Cowichan in der Nähe von Vancouver in Kanada gründete, folgte sie ihm dorthin und begann, zusammen mit rund zwanzig weiteren Personen, ihre Gestalttherapie-Ausbildung.
Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Überlegungen aus dieser Zeit bilden die Grundlage des hier vorliegende Buches, das mit Fug und Recht als Klassiker der Gestalttherapie bezeichnet werden kann.
Ein weiteres Buch von Barry Stevens (das sie gemeinsam mit Carl R. Rogers, dem Begründer der Klientenzentrierten Gesprächsführung, verfaßt hat) ist in der gikPRESS erschienen: Von Mensch zu Mensch. Möglichkeiten, sich und anderen zu begegnen.
Inhalt
Erhard Doubrawa:
Vorwort
Don’t Push the River
See
Blatt
Fata Morgana
Nebel
Stein
Detlev Kranz:
Barry Stevens. Eine bemerkenswerte Frau
Zur Künstlerin des Covers: GEORGIA VON SCHLIEFFEN
Georgia von Schlieffen, geb. 1968. »Seit meiner Studienzeit intensive Beschäftigung mit der Malerei. Jedoch ging ich erst einmal ganz andere Wege über ein Studium der Vergleichenden Religionswissenschaft und der Internationalen Beziehungen und einer mehrjährigen Tätigkeit in den Bereichen Projektmanagement und Flüchtlingsarbeit für mehrere Nichtregierungsorganisationen. 2010 nahm ich an Studienwochen bei Markus Lüpertz und Gotthard Graubner an der Reichenhaller Akademie teil. Ab 2011 studierte ich Malerei bei Professor Jerry Zeniuk, Akademie für Farbmalerei, Kunstakademie Bad Reichenhall, und derzeit bei Heribert C. Ottersbach.«
Georgia von Schlieffen illustrierte zwei Lyrik-Bände von Stefan Blankertz, »Ambrosius: Callinische Hymnen« und »Ruan Ji: Zustandsbeschreibungen« sowie den Gedichtband »kleine gebete« von Paul Goodman, der in der gikPRESS erschienen ist.
Bitte besuchen Sie die Seite der Künstlerin auf theartstack.com oder verbinden Sie sich auf linkedin.com mit ihr.
Vorwort
Barry Stevens war eine bemerkenswerte Frau: Schon hoch in ihren 60ern entschied sie sich, Gestalttherapie bei Fritz Perls in der gerade neu gegründeten Gestalt-Gemeinschaft am Lake Cowichan in British Columbia/Kanada zu lernen. Ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Überlegungen aus dieser Zeit finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Buch. Im Anhang dieses Buches stellt der Hamburger Gestalttherapeut Detlev Kranz Ihnen Leben und Werk der Autorin vor. Ihm verdanken wir übrigens, daß Barry Stevens in Deutschland nicht in Vergessenheit geraten ist und letztlich sogar die Idee, dieses Buch zu veröffentlichen.
»Don’t push the river« ist ein bemerkenswertes Buch. Gestalttherapie an ihren Wurzeln. Einfach und kraftvoll. Voller Enthusiasmus. Gestalttherapie hat mit Begeisterung zu tun. Und mit dem, was dem Herzen nahe ist. Sie ist weit mehr, als nur irgend eine weitere therapeutische Methode. Sie ist eine Lebensweise. So hat auch Barry Stevens Gestalttherapie verstanden. Als Haltung, die gelernt und immer wieder eingeübt werden will.
So liest sich denn auch ihr hier endlich in deutscher Sprache vorliegendes Buch: Dem, was hier und jetzt ist, die ganze Aufmerksamkeit schenkend. Dem Inhalt, den sie niederschreiben will. Und ihren Gefühlen dabei und darüber. Ihren Erinnerungen, die beim Schreiben an die Oberfläche steigen. Solchen aus der Lerngruppe mit Fritz Perls. Und auch solchen aus ihrem reichen Leben. Ihren Erfahrungen mit den Eingeborenen auf Hawaii in den 1930er und 1940er Jahren ebenso, wie jene mit den amerikanischen Indianern in den 1950ern und 1960ern. Und schließlich ihren zahlreichen Freundschaften – u.a. mit Aldous Huxley und Bertrand Russel.
Dieses Buch kann mit Fug und Recht als Klassiker der Gestalttherapie bezeichnet werden. Der Buchtitel ist inzwischen schon längst ein geflügeltes Wort geworden: Auch der bekannte Song des Pop-Musikers Van Morrison »Don’t push the river« aus den 1970er Jahren hat seinen Titel nach diesem Buch.
»Don’t push the river«. Du brauchst den Fluß nicht anzuschieben – er fließt von selbst. Ein anderes Bild: Karotten wachsen nicht schneller, wenn man an ihnen zieht. Und das ist in der Psychotherapie genauso. Der Therapeut kann den Klienten nicht verändern. Gestalttherapie hat das tiefe Vertrauen, daß der Klient das selbst tun muß und kann. Und dabei muß der Therapeut sich in Demut üben und immer wieder beachten, daß jede Seele ihre eigentümliche Wachstumsgeschwindigkeit hat.
Schließlich schildert Barry Stevens in ihrem Buch freundlich einen (entgegen dem landläufigen Bild) liebevollen und weisen Fritz Perls. Der Vater der Gestalttherapie ist in seinen letzten Lebensjahren sanfter und wohlwollender geworden. Er selbst sagt es so: »Zum erstenmal in meinem Leben lebe ich in Frieden. Kämpfe nicht mehr gegen die Welt an.«
Ich freue mich, dass die vorliegende Neuauflage dieses Klassikers in unserer Edition gikPRESS mit einem Acrylbild der Künstlerin Georgia von Schlieffen ein neues buntes und lebendiges Cover erhalten hat – bunt und lebendig wie die 1960er Jahre, in denen und in deren Geist dieses Buch geschrieben wurde.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
Erhard Doubrawa
Leiter der Gestalt-Institute Köln und Kassel (GIK)
See
Lake Cowichan, British Columbia. September 1969. Am Himmel ein paar blaue Flecken und lichterfüllte Wölkchen. Ansonsten vor allem schwere, graue und regenschwangere Wolken über einem rauhen, gekräuselten See. Auf den Wiesen trockene, raschelnde Ahornbäume. Wehende Riedgräser. Reglos die Bäume am anderen Ufer.
In mir geht etwas Seltsames vor. Ich weiß nicht, was ich will. ... Kaum habe ich das aufgeschrieben, weiß ich es.
Im Oktober 1967 schickte mein Sohn mir ein Anmeldeformular und einen Brief, in dem stand: »Melde dich an! Du wirst es nicht bereuen.« Ich meldete mich an. Eine Woche am Gestalt-Institut San Franzisko, morgens von neun bis zwölf, bei einem Mann namens Fritz Perls. Ich hatte keine Idee worauf ich mich da einließ.
Am Montagmorgen trafen sich fünfzehn Leute mit Fritz Perls in einem großen, kahlen Tanzsaal. Das Gestalt-Institut befand sich im Dachgeschoß von Janie Rhynes Haus. Der Gruppenraum wurde von einer anderen Gruppe benutzt. Durch eine der hinteren Ecken des Tanzsaals kam ein wenig Tageslicht herein – dahinter lag ein Raum mit Fenstern. Es gab einen großen, einigermaßen bequemen Stuhl für Fritz. Wir anderen saßen auf Klappstühlen. Fritz sagte: »Ich finde es schwierig, mich in diesem Raum behaglich zu fühlen.« Wir waren eine kleine Gruppe von Leuten inmitten eines recht großen, nackten Raumes. Ich hatte kalte Füße und wünschte, ich hätte mir Wollsocken und feste Schuhe angezogen, anstatt in Sandalen zu gehen.
Fritz bat jeden von uns zu sagen, wie wir uns in dem Raum fühlten. Allen war irgendwie kalt. Eine Frau meinte, daß wir in ihre Wohnung umziehen könnten. Fritz fragte uns, wie wir das fänden, aber wir wollten nicht.
Das ist alles, was ich heute dazu schreiben will. Zwei Jahre später kommt mir das alles schon so weit weg vor, und jetzt sitze ich im Gestalt-Institut von Kanada, Lake Cowichan, British Columbia.
Bei der Arbeit mit Fritz in San Franzisko kam ich mehr und mehr durcheinander. Er wußte natürlich, was er da tat und erzielte gute Ergebnisse. Aber wie zum Teufel machte er das?
Jetzt weiß ich es, und ich vermisse die Verwirrung. Manchmal, wenn ich tue, was er tat, kommt sie zurück, obwohl sie auch anders ist, denn jetzt bin ich es ja. In diesen Momenten geht es mir sehr, sehr gut.
Einmal erklärte ich Fritz, warum ich etwas, wozu er jeden von uns der Reihe nach aufgefordert hatte, nicht tun wollte. Doch dann dachte ich, daß es vielleicht einen Wert haben könnte, der mir nicht klar war, und ich fragte ihn: »Willst du, daß ich es trotzdem mache?« Er sagte nichts. Aber nach Art der Indianer sagte er damit gleichzeitig alles. Er machte nicht einmal die Andeutung einer Aussage. Es war meine Entscheidung.
Ein anderes Mal, als ich mich auf den heißen Stuhl setzen wollte, fiel mir auf, daß auf dem Stuhl eine Mappe mit Manuskripten lag. Ich sagte: »Soll ich mich da draufsetzen, oder soll ich die Mappe wegnehmen?« Er sagte: »Du fragst mich.«
Beide Male mußte ich selbst entscheiden. Jetzt frage ich nicht mehr soviel. Das gibt mir einen Teil meiner Kraft zurück.
Ein Freund von mir, der in der Mittelstufe unterrichtet, brachte seinen Schülern bei, nicht mehr zu sagen: »Kann ich mir meinen Aufsatz bei Ihnen abholen?«, sondern: »Ich komme nach vorne und nehme mir meinen Aufsatz.« Die ganze Klasse lebte auf.
Als ich klein war, hatte ich ein Bild von der Welt, in dem die Leute vom Globus abstanden wie Haare von einem Kopf, und jeder verbeugte sich vor einem anderen. Jeder. Keiner tat das, was er wollte. In einer solchen Welt war jeder außen vor. Das war keine Welt für mich. In meiner Vorstellung war es ein tiefes Schwarz, durchzogen von brennenden Funken und Feuer. In dieser Welt wollte ich nicht leben, aber ich mußte.
Wenn ich sage »Bitte, darf ich?«, dann denke ich vielleicht, daß ich mich damenhaft und souverän verhalte. Aber gleichzeitig fühle ich mich unterlegen, schwach, bittend und auf die Gnade des anderen angewiesen. Der andere hat mein Leben in der Hand. Indem ich mich vor dir verbeuge, verliere ich mein Gefühl für mich selbst. Wenn ich es hingegen einfach tue (ohne deshalb unhöflich zu sein), fühle ich mich stark. Meine Kraft ist in mir. Wo sonst sollte meine Kraft sein?
Natürlich kann es sein, daß ich rausgeschmissen werde.
Fritz machte eine Vorführung in einem High School Auditorium. Jemand stand auf und gab die üblichen Hinweise über Brandschutzvorschriften, daß man nicht rauchen sollte, usw. Nach der Vorführung wurde Fritz, der wie immer die ganze Zeit über geraucht hatte, von einer jungen Frau gefragt: »Welches Recht hast du, einfach weiterzurauchen, während wir hier schmachten müssen?«
Fritz meinte: »Ich habe kein Recht es zu tun, und ich habe kein Recht, es nicht zu tun. Ich tue es einfach.«
Die junge Frau: »Aber stell dir vor, du wirst rausgeschmissen.«
Fritz: »Dann werde ich rausgeschmissen.«
Eine Horrorvision! All diese Leute sehen, wie ich rausgeschmissen werde. Ich habe nie ganz verstanden, was Introjektion oder Projektion bedeuten, also irre ich mich vielleicht, aber es kommt mir vor, als hätte ich die Vorstellung introjiziert, daß es schlecht ist, rausgeschmissen zu werden, und dann projiziere ich diese Vorstellung auf andere. Denn natürlich weiß ich nicht, wie viele der anwesenden Leute mich wirklich so betrachtet hätten, und wie viele mich dafür beneidet hätten, daß ich einfach getan hätte, was ich tun wollte – ganz abgesehen von den vielen Möglichkeiten, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Wenn ich in mir selbst ruhe, spielen die anderen keine Rolle.
Als ich jung war, wußte ich das. Meine Tante Alice hatte ein Haus am Strand. Für mich war dieser Strand ein magischer Ort. Der Wind wehte, die Sonne schien, oder die Wolken jagten über den Himmel, und die Brandung dröhnte in einem alles durchdringenden Rhythmus. Leuchtend weiße Muscheln. Golden schimmernde Muscheln. Ein kilometerlanger weißer Strand. Ständig wandernde Sanddünen. Riedgras. Rotgetupfte Stare. Winzige Puffottern. Hier und da ein Blaureiher auf einem Holunderbusch. Alles sang. Auch ich, selbst wenn ich keinen Laut von mir gab. Agito ergo sum.
Einmal im Sommer, ich war vierzehn, ließ Tante Alice mich mit einem jungen Mann allein. Er war sechsundzwanzig. Er war mir unsympathisch. Er war ein Schmarotzer, eine Schlange. Er meinte, »Mrs. B.« hätte ihm gesagt, daß ich für ihn kochen würde, und das hörte sich für mich irgendwie glaubwürdig an. Aber ich wollte nicht für ihn kochen, also sagte ich ihm das. Wenn ich für ihn kochen würde, wäre all meine Heiterkeit dahin, und er konnte sich ja auch selbst was kochen. Aber er hörte nicht auf, mich damit zu nerven. Ich wollte nicht. Vielleicht würde Tante Alice mich deswegen rausschmeißen und nach Hause schicken, aber wenn ich für Ruddy kochte obwohl ich ihn haßte, obwohl ich es haßte zu kochen, dann wäre ich haßerfüllt und könnte jetzt den Strand nicht genießen. Aber ich freute mich jetzt am Anblick des Strandes, und diese Freude konnte mir niemand nehmen.
Jetzt geht es mir ähnlich. Ich liebe Lake Cowichan, und wenn ich nicht bei mir bleibe, kann ich ihn nicht lieben, und dann es ist in Ordnung, wenn ich rausgeschmissen werde.
Ich habe wieder dieses seltsame Gefühl. Ich weiß nicht, was es heißt, »bei mir zu bleiben«.
Letzte Woche in Kalifornien habe ich etwas geschrieben, das vielleicht ganz gut hierher paßt:
Bevor ich mich heute morgen an die Schreibmaschine setzte, ging mir so viel durch den Kopf. Jetzt sitze ich vor der Schreibmaschine und nichts passiert.
Ich sitze auf einer Veranda und schaue durch das Fenster ins Haus. Der Garten hinter mir spiegelt sich im Fenster. Da, wo der Schatten meines Körpers das reflektierte Bild unterbricht, sehe ich einen Tisch – einen halben Tisch. Er endet genau da, wo auch mein eigenes Spiegelbild endet, und geht in eine Wiese mit Pflanzen und Bäumen über. Dazwischen hier und da ein Tischbein, ein Büfett oder eine Wand. Ich mag dieses Durcheinander. Nichts Festes. Keine klare Trennung zwischen »drinnen« und »draußen«.
»Ich bin so frustriert von dem Versuch, deutlich zu machen, daß Gestalttherapie nicht aus Regeln besteht«, meinte Fritz eines morgens in einer Gruppe am Lake Cowichan.
»Er ist neu in dem Job, aber er macht es ganz gut.« Ich lese diesen Satz und achte darauf, wie er sich anhört. Ich ersetze das aber durch ein und. »Er ist neu in dem Job, und er macht es ganz gut.« Ich lese diesen Satz, erfasse ihn – es ist nichts. Wenn ich es immer wieder einmal tue, dann wird es zu einem Teil von mir. Tue ich es hingegen immer, so daß ich gleichsam eine Regel befolge, dann wird es wieder zu nichts.
Nimm das, was gerade zur Hand ist.
Ein junger Mann setzte sich auf den heißen Stuhl und arbeitete so offen und freizügig an seiner Impotenz, als ob wir gar nicht da wären. Zwei Tage später setzte er sich wieder auf den heißen Stuhl, wibbelte hin und her und meinte: »Es ist mir peinlich, daß mich alle anschauen.« Fritz stand auf, ging in einen kleinen Nebenraum, holte einen Stapel Papier und reichte ihn herum. Jeder der Anwesenden nahm sich ein Blatt und gab den Stapel weiter. Alle fingen an zu lesen – es war ein Aufsatz von Fritz. Der junge Mann sagte: »Jetzt ärgert es mich, daß alle lesen, anstatt mich anzusehen.« Er lachte. »Eine witzige Art von Peinlichkeit!«
Er war auf etwas aufmerksam gemacht worden, dessen er sich vorher nicht bewußt gewesen war.
»Lernen heißt entdecken.«
»Selbst wenn ich mit meiner Interpretation recht habe: Wenn ich es ihm sage, nehme ich ihm die Gelegenheit, es selbst zu entdecken.«
In Kanada fuhr ein Vertreter des Bureau of Indian Affairs gemeinsam mit Wilfred Pelletier, einem Indianer, auf einer Fähre. Der Regierungsbeamte ging an Deck, und kaum daß er durch die Tür war, flog ihm fast der Hut davon. Er wußte, das Wilfred ihm folgte, wollte ihn warnen, tat es dann aber doch nicht. Wilfred kam nach draußen, und sein Hut flog weg. Er sagte: »Warum haben Sie mich nicht gewarnt?« Der Regierungsbeamte antwortete: »Ich wollte Sie schon warnen, aber dann fiel mir ein, daß Indianer andere niemals belehren. Sie lassen sie es selbst herausfinden.« Wilfred bog sich vor Lachen. »Sie werden nochmal ein richtiger Indianer!«
Was seinen wegfliegenden Hut betraf, war Wilfred kein Indianer. Er bemerkte den Wind nicht rechtzeitig. Er war nicht selbstsicher. Er war sich dessen nicht bewußt.
Der eine Vogel schimpft: »ch–ch–ch–ch–ch.« Ein anderer Vogel tiriliert in sanften Tönen. Jeder ist er selbst. Keiner versucht, der andere zu sein. Die Spottdrossel mach sich die Lieder und Klänge vieler anderer Vogelarten zu eigen – das ist ihre Eigenart.
Ich mache eine Pause. Ich spüre Schmerzen in der Brust – sanft, leicht und schmerz-voll. Was soll ich damit machen? Geschehen lassen, was geschieht. Mein Atem wird tiefer und kräftiger. Dann wieder flacher. Wasser in meinen Augen. ... Ohne zu versuchen es zu verstehen, nur darauf achtend, was geschieht, beginne ich, auf eine Weise zu verstehen, die nicht mitteilbar ist. Es ist mein ganz eigenes Wissen.
... Jetzt bin ich in den Autismus gegangen: Gedanken, Bilder und Szenen. Planen, wann ich was tun werde – und das ist nicht das, was ich wirklich tun werde. Unbewußt. Nicht bemerken. Keine Vögel, keine Lieder, keine Bäume, kein Ineinander von drinnen und draußen – nichts, außer dem, was sich in meinem Kopf abspielt, keine Verbindung mit der Wirklichkeit. Nicht einmal ein Spüren des Schmerzes an der Stelle, wo meine Oberschenkel die Stuhlkante berühren. Ohne Gewahrsein für den Schmerz in meiner Brust und an anderen Stellen meines Körpers.
Dieses »Jetzt« ist wie jedes Jetzt – wenn ich es bemerke, ist es bereits vergangen. Schon hat es sich in etwas anderes verwandelt.
Kennt jemand die Geschichte von Epaminodas? Epaminodas war ein kleiner Junge, der immer gut sein wollte und ständig Fehler machte. Ich weiß nicht mehr, wie er die Butter nach Hause brachte, aber sie war völlig geschmolzen und nicht mehr zu gebrauchen. Seine Großmutter sagte ihm, er hätte die kühle Blätter in seinen Hut legen, kaltes Wasser dazugeben und die Butter in diesem Gefäß nach Hause bringen sollen. Das nächste Mal brachte er einen kleinen Welpen mit. Er erinnerte sich an Großmutters Rat. Der Welpe ertrank. Seine Großmutter sagte ihm, wie er den Welpen hätte nach Hause bringen sollen, und beim nächsten Mal machte er es genau so, aber da ging es nicht mehr um einen Welpen, und wieder klappte es nicht. Und so weiter.
Ich habe mich daran erinnert, was ich in sechzig Jahren aus dieser Geschichte gelernt habe. Mir fiel ein, wie eine junge Frau mich einmal zum Flughafen brachte und darauf bestand, so lange zu warten, bis sie sicher war, daß ich gut weggekommen wäre. Sie meinte, sie hätte einmal zwei Leute mit ihren vier Kindern zum Flughafen gebracht, »und sie mußten zwölf Stunden warten!«
Was hat das mit mir zu tun?
Ich war allein, und manchmal, wenn alles schiefläuft, passieren tolle Dinge, und ich genieße das, was ich verpaßt hätte wenn alles glatt gelaufen wäre. Wenn nicht, kann ich ja schlafen.
Ich mag es nicht, so behandelt zu werden, als wäre ich jemand anderes. Das gibt mir das Gefühl, als gäbe es mich nicht.
Als ich an diesem sonnigen Septembertag auf der Wiese mit einer jungen Frau sprach, kamen wir irgendwie auf Weihnachten. Sie sagte, eigentlich möge sie Weihnachten nicht, aber sie käme damit klar, weil es ein paar Dinge gibt, die sie doch mag, wie z. B. Plätzchen zu backen und sie den Nachbarn zu schenken.
»Warum nur an Weihnachten?«
»Du meinst, man könnte sie das ganze Jahr über backen?« Sie wirkte ganz aufgeregt und klang auch so.
(»Es geht nicht um die Ketten, die den menschlichen Körper fesseln, sondern um die, die seinen Geist fesseln.«)
Einmal verschickte ich im Juni Weihnachtskarten. Viele Leute freuten sich über eine Weihnachtskarte im Juni. Weitaus mehr, als sich Weihnachten darüber freuen.
Als ich einmal krank und völlig am Ende war, schickte mir jemand ein Carepaket mit allem möglichen Zeug. Unter anderem war ein Kästchen mit lauter Geburtstagskarten dabei. Ich weiß nie, wer wann Geburtstag hat, und meistens vergesse ich sogar meinen eigenen. Ich verschicke »nie« Geburtstagskarten. Aber ich hatte welche, also schickte ich immer, wenn ich an jemanden dachte, den ich mochte und von dem ich eine Weile nichts gehört hatte, eine Geburtstagskarte. Eine ganze Reihe Leute schrieben mir, wie sehr sie sich gefreut hatten.
Es gibt drei Menschen, die immer an meinen Geburtstag denken und mir jedes Jahr eine Karte schicken. Ich finde das langweilig.
Auf einem Ast hinter mir ist gerade ein Vogel gelandet. Jetzt sitzt er auf dem Rasen, und ich sehe, daß es ein Rotkehlchen ist. Spielt es eine Rolle, was für ein Vogel es ist? Es gefällt mir, sein Spiegelbild zu sehen, etwas hinter mir zu sehen, anstatt immer nur das, was vor mir ist. Es gibt ein Augentraining-Experiment nach Bates-Huxley, das geht so: Man schließt die Augen und schaut auf einen Punkt am unteren Teil des Schädels, da wo der Kopf in den Hals übergeht. Das ist sehr beruhigend. Wen ich das mache, merke ich, wie meine Augen immerzu vorwärts, vorwärts, vorwärts drängen. Umkehrungen sind Teil der Gestalttherapie. Ein paar Ketten sprengen.
Die konzeptionellen Werkzeuge der Gestalttherapie sind zweifellos hilfreich. Es ärgert mich, wenn die Werkzeuge benutzt werden, ohne daß man wirklich oder aber nur unvollständig versteht, was Gestalt bedeutet. Ändere »es«. »Es« verschiebt alles irgendwo nach außen, so als ob es (!) nicht ein Teil von mir wäre. Ich bin ärgerlich.
»Wenn die falsche Person die richtigen Mittel einsetzt, funktionieren die richtigen Mittel falsch.«
Wenn diese Mittel von Leuten eingesetzt werden, die einen guten Willen haben und sie nicht oder nur unzureichend verstehen, passieren häufig gute Dinge. Manchmal wird jemand unnötig verletzt oder geschnitten. Das ist ein Schaden. Wenn jemand ohne diesen guten Willen – jemand, der seinen eigenen Kopf hat – diese Werkzeuge gebraucht, richten sie häufig Schaden an. Sind es also gute Werkzeuge? Sollten sie zur Verfügung stehen? Oder sollten wir das Skalpell, die Nadel usw. wegwerfen? Oder ihren Gebrauch beschränken?
Die Antwort liegt / lügt in der Person, die sie gibt. Dieses »liegt / lügt« gefällt mir. Es ist eine Lüge, wenn jemand glaubt, die richtige Antwort zu haben. Was er hat, ist nicht mehr als seine eigene Antwort.
Meine eigene Antwort, die sich sozusagen selbst aus mir herausreißt. ... Die Antwort bin ich, und was sich aus mir herausreißt, bin ich. Was also will ich sagen? Ich habe einen schützenden Teil, der nach Sicherheit strebt. Ich habe einen risikofreudigen Teil, der weiß, daß es meine Aufgabe ist, meinen eigenen Weg zu finden, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, und wenn ich zu viele verpatze, dann ist das eben so.
Wenn ich andere Leute für mich entscheiden lasse, blockiere ich mich. »Respektsperson« ist einer der erfolgreichsten Blockierer – eine Autorität zu respektieren, ohne daß es mir entspricht, also meiner eigenen Autorität oder Autor-schaft. Ich bemerke, verstehe und handle nicht aus mir selbst heraus. Ich denke. Ich denke, daß jemand anders recht haben muß, aufgrund seiner Position, seiner Ausbildung, seines Alters etc. Ich »sage mir«, daß er recht haben muß. Was immer ich mir selbst sage, gilt mir als Lüge, und ich bin diejenige, die ich belüge.
Ich war mit einer Frau zum Essen verabredet, die ich von früher her kannte. Damals hatte sie etwas sehr Rebellisches, und ihr Leben war von großer Unsicherheit geprägt gewesen. Während des Essens zeigte sich, daß sie ihren rebellischen Geist aufgegeben und jene Art von Sicherheit erreicht hatte, die sich darin äußert, daß man ein nettes Haus, ein gutes Einkommen und einen zuverlässigen Ehemann sein eigen nennt. Über Schwierigkeiten wurde nicht gesprochen. Alles war so richtig nett, und ich wurde traurig. Ich sagte mir, daß es in Ordnung sei, daß sie sich für diesen Weg entschieden hatte, und es war ja in der Tat sehr nett und angenehm und ganz bequem so. Ich war den ganzen Abend hindurch sehr »nett« (glaube ich). »Bring hier nichts durcheinander!« – Dieser Satz lag so klar und deutlich in der Luft. Wie Äther atmete ich diesen Satz und schläferte mich damit ein.
Sie fuhr mich nach Hause. Als sie fort war, bemerkte ich, daß ich eine Melodie summte, die ich nicht zuordnen konnte. Ich summte weiter, bis zum Schluß; erst da merkte ich, was mein organismisches Selbst da tat. Am Ende der Melodie kamen mir die Worte in den Sinn: »Armer Schmetterling«. Ich fühlte meine Traurigkeit, und sie war echt.
Nicht die anderen verwirren mich. Das tue ich selbst.
Fritz nennt diesen Bereich, in dem ich mich selbst verwirre, die »mittlere Zone«. Krishnamurti nennt es den »flachen Geist«, der seiner Natur nach keine Tiefe erreichen kann. Egal wieviel dieser Geist auch denkt, er denkt doch nur alle möglichen Dinge, die nicht meine sind und von denen ich doch als ich denke.
In seinem Buch Einbruch in die Freiheit schreibt Krishnamurti, wie er einmal zusammen mit zwei anderen Männern und einem Chauffeur durch Indien fuhr. Die beiden Männer sprachen über Gewahrsein und wandten sich mit einigen Fragen an Krishnamurti. Der Chauffeur überfuhr eine Ziege, die er übersehen hatte. Das bekamen die beiden Männer nicht mit. »Und bei den meisten von uns ist es genau dasselbe. Wir bekommen die äußeren und die inneren Dinge nicht mit.«
Fritz hat uns gelehrt, zwischen äußeren (»äußere Zone«) und inneren Dingen (»innere Zone«) hin und herzupendeln und dadurch Gewahrsein zu entwickeln.
Jetzt, in diesem Moment möchte ich zu den »konzeptuellen Mitteln« zurückkehren, zu meinem schützenden Selbst und meinem risikobereiten Selbst. ... Mein Geist ist wieder leer. Was vorhin noch da war, ist es jetzt nicht mehr. Ich merke, daß ich mir einen Tee machen möchte. Das ist keine Vermeidung! Wenn diese Schreibmaschine eine Taste für »Schreien« hätte, dann wäre mein Schrei jetzt auf dem Papier. Natürlich vermeide ich. Sehr häufig sogar. Es gibt gute und schlechte Vermeidungen, und manchmal ist es keine Vermeidung, leer zu sein. Ich schreie, weil Fritz die Vermeidung so sehr betont und die Leute nicht vermeiden läßt, was nicht vermieden werden sollte (Gewahrsein). Viele Leute hören, Vermeidung sei schlecht und wenden diese Regel auf alles an, was sie als Vermeidung betrachten.
Manchmal ziehe ich Zen vor, auch wenn das zwanzig Jahre dauert.
Ich bin mir nicht sicher, ob Gestalt nicht auch zwanzig Jahre braucht, um dasselbe Ziel zu erreichen.
Ich kenne überhaupt keine Methode, einschließlich Zen, durch die man den Mißbrauch verhindern könnte, den Menschen immer wieder betreiben.
Und so bin ich schließlich doch beim Problem des Mißbrauchs gelandet. Habe ich demnach die Tasse Tee, die ich nicht bekommen habe, vermieden? Oder hat mein Organismus – mein vollständiges Nichtdenken – von dem Gebrauch gemacht, was gerade zur Hand war, und mich auf andere Weise zu dem geführt, was ich will?
Jetzt weiß ich, was mir eine Weile gefehlt hat. Der schützende Teil meiner selbst will Sicherheit für alles und jeden – keine Betrüger, keine Schwindler, keine Ausbeuter, keine Quacksalber ... Was als nächstes kommt, mag ich nicht sagen, weil es so idiotisch ist – keine unvollkommene Therapie bzw. Therapeuten.
Gleichzeitig habe ich die Erfahrung und die Beobachtung gemacht, daß der Versuch, überall Sicherheit schaffen zu wollen (wie die USA das lange Zeit getan haben), zu einem Wahnsinn führt, der auch im Vietnamkrieg sichtbar wird. Hätten wir eine narrensichere Welt, dann könnten nur Narren in ihr leben. So eine Welt will ich nicht. Ich protestiere gegen das Sicherheitsbedürfnis meiner eigenen Gesellschaft.
Die Lebensweise der Indianer, die sich auf ihre eigenen Sinne verlassen, erscheint mir sinnvoll.
An dieser Stelle kommt ein Teil der Gestalttherapie ins Spiel, den ich mag. – Ein Teil? Es ist das Ganze:
»Lose your mind and come to your senses.«
Dieser Satz kann sowohl mißverstanden
als auch mißbraucht werden.
Als ich vor vier Tagen nach Lake Cowichan zurückkehrte, war ich verwirrt, teilnahmslos, nicht hier. Ich wußte nicht, was mit mir los war. Ich versuchte, es herauszufinden. Ich fand kein Ende, sondern immer nur neue Antworten, aber das brachte mir nichts.
Meine Betrübnis schien mit diesem Ort zu tun zu haben. Am 1. Juni zog Fritz mit zwanzig Leuten hier ein. Er kannte nicht jeden einzelnen, und viele von uns kannten höchstens einen der übrigen Teilnehmer. Wir hatten vorher noch nie zusammengelebt. Wir zogen ein, bauten um, richteten uns ein, und am nächsten Morgen um acht Uhr begann der erste Workshop. Um zehn Uhr sprachen wir über praktische Dinge wie z.B. die Verpflegung. Es war wunderbar zu sehen, was passierte, und daran teilzuhaben.
Fritz teilte uns mit, daß morgens von acht bis zehn Uhr Seminare statt finden würden, und daß danach zwei Stunden Arbeit in der Gemeinschaft auf dem Programm stünden. Von zwei bis vier Uhr hatte jeder die Möglichkeit, nach eigenem Belieben Massagen, Tanz, Kunst oder sonstwas anzubieten. Von vier bis sechs sollte gearbeitet werden. Von acht bis zehn gab es wieder Seminare und im Anschluß daran ein Gemeinschaftstreffen. Einiges wurde später abgeändert oder getauscht, manches auch wieder rückgängig gemacht – wie es gerade kam. Auf diese Weise lief das Ganze bis zum 24. August, als Fritz für einen Monat fortging. Ich selbst ging für drei Wochen, und viele andere gingen ebenfalls weg. In dieser Zeit machten Teddy und Don einen Workshop.
Als ich vor vier Tagen zurückkam, war alles ORGANISIERT. Listen. Wer wo wohnt, wann was getan werden muß. Pläne für die ganze Gruppe – wie die Ablösung der Wache – jene nicht-organismische Art von Organisation, die ich so überhaupt nicht mag und die für mich nichts mit Gemeinschaft zu tun hat.
Ich sah keine Möglichkeit, das zu ändern. (Abgesehen von der Frage: warum, und ob ich das könnte oder nicht.) Ich wollte nicht Teil dessen sein. Ich wollte hierbleiben. (Abgesehen von den Gründen hierfür.) Ich versuchte zu entscheiden, was ich tun wollte. Es gab ein paar Dinge, die ich tun konnte und wollte, und selbst die erschienen mir nicht attraktiv. Ich war irgendwie angewidert. Ich ging von dem Versuch, darüber zu lachen (ohne daran zu denken, daß versuchen lügen heißt) dazu über, auszuprobieren wie es ist, mich dem Ekel zu überlassen, mit ihm zu gehen – und wieder zurück. Ich beschloß, abzuwarten, bis Fritz am Ende der Woche zurückkäme. Spott. Das paßte mir nicht. Ich faßte Beschlüsse, verwarf sie, faßte andere Beschlüsse und verwarf auch diese. Keiner meiner Beschlüsse paßte. Offensichtlich. Ich hatte ein sonderbares Gefühl.
In der dritten Nacht konnte ich nicht schlafen. Das ist ungewöhnlich. Die Ölheizung machte Geräusche. Ich schaltete sie ab. Mir war kalt. Ich stand auf und machte mir eine Wärmflasche. Ich weiß nicht mehr, was in mir vorging, aber was immer es war, ich schaltete es ab oder wärmte es mit auf und geriet in ein neues Durcheinander. Gegen halb fünf ging ich schlafen. Als ich aufwachte, machte ich mir eine Tomatensuppe; das schien mir besser zu sein als Nudeln mit Huhn. (Ich habe meine Vorräte noch nicht aufgefüllt.) Während ich in der Suppe rührte, bemerkte ich, daß in meinem Kopf ein Lied summte. Ich hörte hin, um mitzubekommen, welches Lied es war, und hörte: »The old grey mare, she ain’t what she used to be, ain’t what she used to be. ...«
Welche Freude in meinem Lachen! Das Organismische – mein Organismus – ich bin wieder da, stimmig, direkt – von mir zu mir. Wie eine kleine Sonnenexplosion kam mein Gespür wieder und löste den Nebel der Taubheit auf, der mich eingehüllt hatte. Und dann geschahen Dinge, die vorher nicht möglich gewesen waren, als ich taub und von Sinnen gewesen war und nicht reagiert hatte. Ich bin eins mit mir selbst.
Das war gestern. Heute ist ein herrlicher Tag. Wolken am Himmel, Regen. Ich ziehe einen Poncho über den Schlafanzug, um nach oben ins Haupthaus zu gehen und ein Ferngespräch entgegenzunehmen. Es war Neville, der aus New York anrief, um nach den Terminen für die Workshops im Oktober und November zu fragen. Es war belanglos, und doch war ich so froh, mit ihm sprechen zu können. Ich bin immer noch froh, so als ob es auf der ganzen Welt nichts gäbe, was mir meine Freude nehmen könnte. Natürlich stimmt das nicht, aber gleichzeitig stimmt es doch. Nichts in der Welt kann mir jetzt meine Freude nehmen.
Was ich hier tun soll, ist verlorengegangen. Ich tue es. Ich bin raus aus der Zukunft, wo ich nichts tun kann, außer in meiner Phantasie, und in der Gegenwart gelandet, wo sich alles abspielt.
Ich habe etwas gelernt.
Ich habe etwas ent-deckt, oder aufgedeckt und wieder-entdeckt, so wie Fritz ein Wieder-entdecker von Gestalt ist.
––––•––––
Juni 1948. Ich wurde von der Verde Valley School gefeuert, die sich damals noch im Bau befand. In der Bretterbude, die das Büro bildete, warf Ham mich raus und meinte: »Es gefällt mir überhaupt nicht, das tun zu müssen. Du bist sehr tüchtig«, und ich versicherte ihm, daß es in Ordnung sei. Ich mag es nicht, Leute leiden zu sehen, selbst wenn sie etwas selbst vermasselt haben. Nur komme ich mir nachher selber lächerlich vor.
Willie, der Koch, fragte mich: »Wieviel Geld hast du noch, baby?«
Ein paar Hopi-Arbeiter luden mich ein, mit meinem dreizehnjährigen Sohn bei ihnen im Reservat zu wohnen.
Blackie, der Manager von Sedona Lodge, kam mit einer Hand auf dem Rücken auf mich zu. Kurz darauf kam die Hand zum Vorschein, und er bot mir ein tiefgefrohrenes Huhn an.
Lisbeth Eubank lud uns ein, sie in Navajo Mountain zu besuchen. Das liegt an der Grenze zwischen Arizona und Utah.
Ich fuhr in einem Wagen mit einer Krankenschwester namens Josephine Scheckner und ihrer Mitarbeiterin Grace Watanabe. Vor uns her fuhr ein große Laster, mit dem die Röntgenapparate transportiert wurden. Er hatte spezielle Stoßdämpfer, um die Geräte vor Erschütterungen zu schützen. Der Laster schwang auf den Stoßdämpfern hin und her und sah aus, als ob er jeden Moment umkippen würde. Mein Sohn fuhr in dem LKW mit. Am Red Lake verloren wir sie. Der Laster verschwand.
Ich halte inne. ... Eigentlich will ich darüber nicht schreiben. Das war eine sehr unsichere Zeit in unserem ohnehin ständig unsicheren Leben, und ich machte mir Sorgen um uns. Diesen Teil habe ich nicht vergessen. Und doch gab es so viel Lebendiges und Schönes, soviel Wärme – im glorreichen Red Rock Country – der blaue Himmel, die Sonne ...
Wir waren schon ganz in der Nähe von Navajo Mountain, als wir im Sand steckenblieben. Wir stiegen alle aus, gruben Löcher und legten Wacholderäste vor die Räder des Wagens. Ein Navajo tauchte auf. Er war nicht dagewesen, aber plötzlich war er da. Er war sehr dünn und trug eine zerrissene Schlafanzughose und ein abgenutztes schwarzes Jackett. Damals waren die Navajos ungeheuer arm. Er lächelte, gestikulierte und sagte ein paar Worte. Wir hatten keine Ahnung, wovon er sprach. Er zeigte zum Himmel und machte mit der Hand die Bewegung eines kreisenden Flugzeugs. Dann fragte er: »Lady doctor?«, und wir dachten, er meinte Josephine, die Krankenschwester, obwohl das Flugzeug nicht viel mit der Tatsache zu tun zu haben schien, daß wir im Sand feststeckten. Dann machte er eine Handbewegung, als ob er rauchte und fragte: »Cigarette?« Wir gaben ihm ein paar Zigaretten.
Josephine setzte sich ans Steuer. Grace und ich positionierten uns hinter dem Wagen, um ihn anzuschieben. Wir deuteten dem Navajo an, sich zwischen uns zu stellen und uns beim Schieben zu helfen. Er legte seine Hände auf das Heck des Wagens – genau wie wir. Josephine legte den Gang ein, und als der Wagen anfing, sich in Bewegung zu setzen, schoben Grace und ich mit aller Kraft, um ihn aus dem Sand zu befreien. Der Wagen fuhr zuerst sehr langsam weiter, dann schneller – und kam schließlich tatsächlich frei. Wir richteten uns auf und schauten zurück – und da stand der Navajo noch immer in exakt derselben Position, die wir ihm gezeigt hatten, so als ob der Wagen noch an genau der gleichen Stelle im Sand feststeckte. Er hatte überhaupt nicht geschoben! Er lachte mit dem freudigen Entzücken eines Kindes.
Als wir an den Berg kamen und Lisbeth von dem Navajo erzählten, meinte sie: »Oh, dieser Hosteen Yazzie!« Später, als Josephine und Grace fort waren, ging ich mit Lisbeth zu einem »sing«, einer rituellen Veranstaltung, die in einem Navajodorf etwa zehn Meilen weiter stattfand. Als wir dort ankamen, entdeckte ich unseren Komödianten. Als er mich sah, verdeckte er sein Gesicht mit den Händen, als ob er errötete. Er schüttelte sich vor Lachen. Ich war sicher, daß er sich köstlich darüber amüsiert hatte, die Gesichter dreier weißer Frauen zu sehen, die ernsthaft bemüht gewesen waren, den Schabernack, den er mit uns getrieben hatte, zu verstehen.
Ich hörte auf zu schreiben und machte einen Spaziergang durch den feuchten Nebel. Ich wollte wieder da sein. In mir war so viel traurige Erinnerung. Alles in mir war so traurig, daß ich selbst die Traurigkeit war.
Am Abend, nach dem Essen, machten mein Sohn und Robert Tallsalt archäologische Ausgrabungen. Die Gegenstände, die sie ausgruben, stammten von den Anasazi, nicht von den Navajo; aber die Anasazi waren gewissermaßen die Vorfahren der Navajo und lebten hier etwa 500 Jahre vor ihnen, deshalb hatte Robert keine Bedenken, sie auszugraben. Eines abends sagte mein Sohn zu Robert, der gerade mit Graben beschäftigt war: »Da ist eine Klapperschlange an deinem Fuß.« Robert erwiderte: »Die tut mir nichts«, und grub einfach weiter.
Nicht alle Navajos gingen so mit Klapperschlangen um.
Vorigen Monat erzählte mir ein kanadischer Medizinmann: »Mein Wissen ist nur ein Tüpfelchen von dem Wissen meiner Vorfahren.« Als er das sagte, machte er mit dem Zeigefinger einen Punkt in die Luft. Wir glauben, wieviel mehr wir wüßten als unsere Vorfahren. ... Jetzt denke ich an meine Eltern, die schon mit dreizehn Jahren nicht mehr zur Schule gingen. Ich weiß so viel mehr als sie damals – einerseits. Andererseits bin ich mir nicht so sicher. ... Sie verließen sich sehr viel mehr auf ihre eigene Wahrnehmung, ihre eigene Erfahrung, ihr eigenes Wissen, und so viel weniger auf Spezialisten und Autoritäten. Eben deshalb bin ich überhaupt am Leben. Nach meiner Geburt mußte ich in einen Brutkasten. Die Ärzte in Manhattan gaben mich meinem Vater zurück, weil ich sowieso sterben würde. (Meine Mutter blieb lange in der Klinik, sie war sehr krank.) Mein Vater studierte keine Bücher. Er studierte mich und machte eine Entdeckung. Und hier bin ich. (Seine Entdeckung wurde später von der Medizin bestätigt, als die Ärzte ihre Ansichten über die Behandlung Frühgeborener revidierten.)
Gewahrsein. Wahrnehmen. Das ist Gestalt. Es ist auch Gestalt. Und indianisch – auf die alte, ursprüngliche Weise, die es kaum noch gibt.
Während ich das hier schreibe, geht es mir gut. Ich fühle mich stark und froh. Die Traurigkeit ist weg.
Ich gehe zurück in das Jahr 1948. Natürlich gehe ich nicht zurück, ich erinnere mich, ich nehme Kontakt mit den Erfahrungen meiner Vergangenheit auf, die alle in mir verkörpert sind. Das ist der einzige Ort, an dem sie existieren. Wo ist »die Vergangenheit«? Vorbei. Die Erinnerung erzeugt in mir die Illusion (Täuschung?), es gäbe eine Vergangenheit.
Die Leute, die 1948 im Navajo-Reservat lebten, waren (in unseren Augen) unglaublich arm, hungrig und krank, und doch lebten sie sehr intensiv und hatten unglaublich viel Freude. Ich quälte mich förmlich mit einem Konflikt herum. Ich konnte unmöglich irgend jemandem wünschen, so arm zu sein, so hungrig und krank, und doch waren diese Menschen glücklicher als jeder andere Mensch, den ich kannte. Ich wußte nicht, wie ich damit umgehen sollte.
1966 sprach ich im Navajo-Reservat mit einem Händler. Er liebte Ayn Rand und haßte den »Kollektivismus«. Mit beiden Armen machte er eine Geste, in die er die armen Navajos (zu dieser Zeit waren nicht mehr alle Navajos arm, vielleicht nicht einmal die meisten), die außerhalb seiner Niederlassung auf dem Boden saßen, mit einschloß und sagte: »Hier sehen Sie, was der Kollektivismus anrichtet!«
Eines Tages erzählte er mir, daß er ein Haus in Farmington, New Mexico, besaß, »aber da kann ich nicht mehr leben. Außerhalb des Reservats werde ich verrückt«, sagte er. Ich fragte ihn, worin der Unterschied bestehe, und er meinte: »Das ist schwer zu sagen.« Ich fragte ihn noch ein paar andere Dinge, aber er konnte mir keine Antwort geben – er konnte einfach nicht. Dann sagte ich: »Was gefällt Ihnen so an den Navajos?«, und er antwortete sofort und ohne zu zögern: »Ihre Lebensfreude!«
Es ist eigenartig. Damals schien ich die Polynesier und ihre Lebensfreude völlig vergessen zu haben. Sie waren nicht so schrecklich arm und krank und hungrig. Als ich in Hawaii lebte (1934-1945) waren die meisten von ihnen weder das eine noch das andere. Ich erinnere mich nicht, mich im Navajo-Reservat 1948 daran erinnert zu haben.
1966 erzählte eine Navajo-Frau mir von ihrem Leben 1949. »Alle waren so glücklich, und irgendwie war es traurig, denken zu müssen ›Was werden wir morgen essen‹, wissen Sie? Und doch hatten wir so ein gutes Gefühl. Ich glaube, es liegt daran, daß wir zusammen gelebt und gearbeitet haben, damit haben wir uns gegenseitig glücklich gemacht. Und wenn der Frühling kommt, dann gehen alle raus aufs Feld und pflanzen Mais und alles Mögliche, und im Herbst essen sie entweder davon oder lagern es ein – für den Winter. ... (Ein Seufzer) Manchmal frage ich mich, was wir falsch gemacht haben.«
Als ich über diesen Sommer schrieb und Traurigkeit wurde, verglich ich hier mit dort. Jetzt vergleiche ich nicht mehr. Ich genieße wieder einmal Vancouver Island. Hier geht es mir gut. Die Wolken sind wunderschön, wie sie über die Berge ziehen. Was nicht hier ist, existiert nicht, nicht einmal die Wärme, die Sonne und das Schwimmen vor drei Monaten, im Juni. Ich finde es schwierig, mich an irgend eine Zeit vor diesem Augenblick zu erinnern, und jede noch kommende Zeit weigert sich, sich selbst in meinem Kopf zu phantasieren.
Vor einer Stunde fragte ich mich, wann wohl die Post kommen würde. Post erschien mir wichtig. Ich hungerte danach, etwas von draußen zu bekommen. Jetzt spielt es keine Rolle ob sie überhaupt jemals kommt.
So würde ich gerne bleiben. Aber es gibt keine Möglichkeit, wie ich mich selbst dazu bringen könnte. Wenn überhaupt, müßte ich mich selbst nirgendwohin bringen. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesmal hierher gekommen bin, ich erinnere mich nicht, was ich geschrieben habe oder was in mir vorging. Ich erinnere mich nur vage, daß ich traurig war.
Ich bin jetzt nicht das, was ich »glücklich« nenne. Ich fühle mich einfach nur gut, und alles ist in Ordnung. Ich sehe eine schwache Verbindung zwischen diesem Zustand und dem der Betäubung, und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, als mein Mann und ich ungeheuren Ärger hatten und ich Mononukleose bekam. Der Arzt gab mir ein paar Medikamente und ich fiel in ein leicht es Halbkoma. Er sagte: »Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das war meine Schuld«, und ich antwortete »Machen Sie sich nichts draus. Es ist herrlich.«
Damals fühlten sich meine Lippen komisch an, meine Aussprache war zäh und ungeschickt, und ich konnte nichts tun. Jetzt kann ich normal sprechen – ich habe es gerade ausprobiert. Ich kann tippen. Ich kann aufhören zu tippen und etwas anderes tun. Meine Fähigkeiten sind verfügbar. Ich kann mich selbst zum Lachen bringen. Wenn ich das versuche, fühlt sich mein Gesicht ganz merkwürdig an. Um lächeln zu können, muß mir nach Lächeln zumute sein. Wie ein Indianer? Hast du jemals versucht, einen Indianer zum Lächeln zu bringen?
Als den Hopi-Indianern, die auf der Baustelle der Verde Valley School arbeiteten, nicht nach Lächeln zumute war, versuchte Ham, sie »aufzuheitern«. Er sang »Come on and dance!« Er war »humorvoll«. Auf uns machten die Hopi damals einen mürrischen Eindruck. Ich beneidete sie dafür, wie sie Ham standhielten. Jetzt fühle ich mich nicht mürrisch. Ich fühle mich auch weder komisch, noch ist mir zum Lachen zumute, und ich glaube, den Weißen um mich herum käme es mürrisch vor, und wenn sie versuchen würden, mich aufzuheitern, würde ich ihnen noch mürrischer erscheinen, obwohl ich doch dieselbe bin. Ihre Bemühungen blieben erfolglos. Fehler. Widerstand. Ich würde sie scheitern lassen. Während ich das geschrieben habe, habe ich ein bißchen gelächelt. Es ist alles so albern. Ich lächle dich an, um dich dazu zu bringen, zurückzulächeln, damit ich mich gut fühle.
»Das nennen sie Leben!«, kam mir dann in den Sinn, in genau demselben Ton, den ich vor ein paar Jahren bei einem Hopi hörte. Es war Sommer, und ich war mit Barbara Bauer nach Second Mesa gegangen, um einige meiner Hopi-Freunde zu sehen. Es sollte dort ein Tanz stattfinden, einen Hopi-Tanz. Nach der Tanzzeremonie schien sich so etwas wie eine Comedy-Veranstaltung anzuschließen, in der man sich über die Weißen lustigmachte. Einer der Hopi-Männer wählte aus den Zuschauern eine Hopi-Frau aus, mit der er dann zusammen die Standarttänze der Weißen durch den Kakao zog. Die Botschaft war klar. Ich dachte, sie könnte nicht mißverstanden werden. Aber der Hopi ging auf Nummer sicher. Er drehte den Kopf und rief über seine Schulter hinweg: »Das nennen sie tanzen!«
All die indianischen Bräuche sind nichts für mich. Die ganze Gestalttherapie ist nichts für mich. Was mich interessiert, sind die Orte, an denen sich beide begegnen.
Gerade bin ich aufgestanden und zur Toilette gegangen. Dabei habe ich gesungen. Mein Singen geschah, und ich hatte Freude daran. Der Klang, die Schwingung in meiner Brust, in meinem Nacken, und vor allem in meinem Kopf, obwohl sie irgendwie auch in meinen Zehenspitzen zu spüren waren. Agito ergo sum. Jetzt machen meine Schultern eine schwingende, pendelnde Bewegung. ... Mein Rumpf schwingt mit – ein weiteres, raumgreifenderes Schwingen – jetzt eine rollende Bewegung, wie eine dieser kleinen Zelluloid-Puppen, die einen beschwerten, halbrunden Fuß haben und immer hin und herpendeln, wenn man sie anstößt.
Jetzt sitze ich, aber mein Sitz ist anders – locker, frei, leicht. Meine Wirbelsäule fühlt sich an, als ob sie wachsen würde, so wie es sich häufig angefühlt hat, wenn ich mit Fritz »gearbeitet« habe. (Wir beide wünschten, wir hätten ein besseres Wort für »arbeiten«.)
Ich bin immerhin 67 Jahre alt und nicht gerade in einem guten gesundheitlichen Zustand. Wo ist bei all dem Regen und Nebel – die Regentropfen benetzen die Stromleitungen – meine Steifheit, mein Rheuma geblieben (die Schmerzen sind selten und klein, aber scharf)? Ich fühle mich so warm – als ob ich alles um mich herum aufwärmen könnte. (Bei den Menschen bin ich mir nicht so sicher!)
Durch die Gestalttherapie habe ich etwas verstanden; ich habe eine neue Erfahrung gemacht. Früher war ich mit einigen Leuten manchmal ego-los – wenn sie es auch waren. ... Ich bin aufgestanden, um eine Tasse Tee zu machen und habe etwas anderes verstanden. Unglaublich! – nach all den Jahren verstehe ich etwas über mich. Jetzt weiß ich nicht, was ich zuerst schreiben soll, also mache ich Tee und sehe, was passiert.
Der Regen tropft vom Dach. Das Ofenrohr macht Geräusche: Ping-ping. Ich mag die Pausen – und das Geräusch. Am offenen Fenster bläht sich der Vorhang ein wenig auf. Rauch steigt von einer Zigarette im Aschenbecher nach oben und wirbelt um die Schreibmaschine herum. Die Leiter am Dock sieht aus, als hätte sie jemand dahingestellt, damit einer oder etwas aus dem Wasser steigen kann. Wer? Was? Jeder soll sich seinen eigenen Jemand vorstellen. Meiner ist freundlich. Er geht über ins Unfreundliche. Ich drehe ihn zurück. Unecht. Es ist weder ein wer, noch ein was, eher ein ›etwas von‹. Ein kleiner Schlepper, mit schwarzem Rumpf und weißem Aufbau. Er zieht kleine Wellen hinter sich her und spritzt weißes Wasser entlang der Trosse in Richtung des Auslegers, den der Schlepper hinter sich herzieht und auf dem massenhaft Baumstämme liegen. Was, wenn der Ausleger den Schlepper rückwärts ziehen würde, gegen seine eigentliche Fahrtrichtung? Ich stelle mir das vor; es sieht komisch aus, vorwärts zu wollen und rückwärts gezogen zu werden. Mir scheint, daß die meisten von uns ein ähnliches Leben führen. Ich habe zu oft und zu lange so gelebt. Projektion? Introjektion? Retroflektion? Egal? Manchmal habe ich den Eindruck, daß ich introjiziere, das Introjekt projiziere und sowohl das Introjekt als auch die Projektion retroflektiere. Ob das einen Sinn ergibt oder nicht, ist mir egal. Mir gefällt, wie es klingt. Das alles ist ja ohnehin nicht real, sondern nur eine bestimmte Betrachtungsweise, und mit solchen Konzepten kann ich nichts anfangen, weil ich sie nicht mag. Andere können viel damit anfangen, weil sie solche Konzepte mögen, und wieder andere vermehren den Unsinn unter den Menschen, indem sie einerseits zwar nicht wissen, wie sie sie anwenden sollen, es andererseits aber trotzdem tun.
Eine Sozialarbeiterin in Harry Rands Seminaren äußerte sich in aller Ausführlichkeit (unter dem Vorwand einer Frage) über Objekt-Beziehungen und einige andere Dinge, von denen ich nichts verstehe. Für mich waren es einfach nur viele Worte. Als sie fertig war, nahm Harry seine Zigarre aus dem Mund und meinte: »Das klingt mir nach vielen Worten. Sag mir, was du meinst.« Aber das konnte sie nicht.
Harry stammte aus Boston und ist (war?) Psychiater und Psychoanalytiker, aber was er sagte, erschien mir sehr sinnvoll, und manchmal hatte er Ähnlichkeit mit Fritz. Ein Student berichtete über einen Patienten in der Klinik und überflutete uns mit einem Schwall von Fachwörtern. Harry hörte bis zum Schluß zu (anders als Fritz) und meinte dann: »Du meinst, der Mann hat Angst.«
Harry hatte einen Patienten, der hereinkam und kein Wort sagte. Er konnte ihn nicht bewegen, irgend etwas von sich zu geben. Plötzlich sah Harry sich selbst, wie er als Zehnjähriger zum Direktor mußte, und der Direktor kam ihm vor wie ein Riese, so daß Harry einfach keinen Ton herausbrachte. (Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Fritz’ Arbeitsweise.) Harry erzählte dem Mann, was in ihm vorging (das hat viel Ähnlichkeit mit Fritz, obwohl es auch noch Unterschiede gibt), und daß er den Patienten als jemanden wahrnahm, dem er (Harry) wie ein Riese vorkam. Da fing der Mann an zu reden.
––––•––––
Ich weiß nicht mehr, was ich vorhin erzählen wollte. Versuch nicht, es zu fassen: Laß es wiederkommen. Es kommt wieder.
Eines abends bat Fritz hier zwei Männer, Co-Therapeuten zu sein, d. h. eigentlich fragte er sie nicht, und er bat sie auch nicht wirklich. Es war eine Mischung aus beidem, oder etwas dazwischen. Er sagte (das trifft es), sie sollten sich einen von uns als Patienten aussuchen. Die beiden saßen in zwei benachbarten Ecken des Raumes, und ich saß auf der anderen Seite, genau gegenüber. Ich sah, wie ihre Augen sich bewegten, bei jemandem stehenblieben, dann zum nächsten wanderten und so weiter. Die Blicke der beiden trafen sich bei mir, und beide bekamen leuchtende Augen. Ich stellte mich zur Verfügung und hatte das Gefühl, als ob zwei Monster, vor denen ich keine Angst hatte, sich auf mich gestürzt hätten. Ich setzte mich auf den heißen Stuhl. Don und David setzten sich auf die Couch neben mir – sie hielten einen gewissen Abstand zwischen sich. In dieser Situation waren sie nicht wirklich freundlich.
Ich weigere mich, weiterzuerzählen. Ich will nicht weitererzählen. Der Grund dafür ist, daß ich darüber nachdenke, daß ich versuche, mich daran zu erinnern, was wann passierte, und auszusortieren, was wichtig ist und was weggelassen werden kann. Auf diese Art komme ich in Schwierigkeiten (in mir selbst – und dann auch mit anderen, und manchmal mit diesem oder jenem, oder ich lasse etwas fallen oder verbrenne mir die Finger oder so, oder mir passiert etwas ganz Unmögliches, z. B. daß ich einen Brief wegwerfe, den ich eigentlich unbedingt behalten wollte, oder ich zerreiße ein paar Seiten eines Manuskripts, das ich gar nicht gelesen habe und von dem ich nicht weiß, was drin steht). Also gehe ich ein wenig im Regen spazieren, vergesse die Dinge und sehe, was kommt.
Die Reihenfolge spielt keine Rolle! Diese Einleitung zu dem, was passiert ist, ist nur eine Skizze, für die irgendein beliebiger Teil völlig ausreicht. (Als mir das klar wurde, war ich nicht mal bis zur Tür gekommen.)
Vorhin dachte ich, ich müsse Erklärungen abgeben, damit keiner sagen kann: »So läuft das also im Gestalt-Institut-Kanada.« »Das ist also Gestalttherapie.«
Diesmal war es das, in dieser Situation und mit diesen drei Leuten – und mit Fritz.
Don und David sprachen über mich. Ab und zu machte Fritz eine Bemerkung, vielleicht auch nur einmal. In der Gestalttherapie liegt die Betonung darauf, mit dem anderen zu sprechen anstatt über ihn. Ich schimpfte mit Don und David, weil sie tratschten. Das machte mir Spaß. Dann bemerkte ich, daß ich stärker zitterte als sonst. Es kommt gelegentlich vor, daß ich zittere (der medizinische Ausdruck ist Tremor), aber diesmal war mein Zittern intensiver als sonst. Das sagte ich ihnen, und dann sagte ich: »Und ich habe keine Angst.« Ich hatte keine Angst. Ich hatte angefangen zu spüren, wie Ordnungen und Gegenordnungen in mir aufeinandertrafen und das Zittern auslösten. Ich spürte in mich hinein und merkte, daß mein Körper von dem Stuhl aufstehen wollte und daß ich ihn darauf festhielt. Ich stand auf, ging ein paar Schritte und drehte mich um. David sagte: »Ich erlebe dich so, daß du dich von mir wegbewegst«, als sei das der Grund für meine Bewegung. Ich spürte meinen Körper und merkte wie ich zögerte, auf David zuzugehen, allerdings war das ein Zögern, das ich leicht hätte übergehen können. Ich überging es – leicht. Dann spürte ich wieder ein Zögern – ich wurde zu einem Zögern, und zwar voll und ganz. Nicht: »ich zögere«, sondern »Ich bin Zögern.« Selbst dieses »ich bin« ist eigentlich schon zuviel gesagt. Als nächstes nahm ich Don wahr, die Beine an den Körper gezogen, den Rücken an der Wand – als hätte er Angst vor mir. Ich machte Don gegenüber eine Bemerkung in der Art. Fritz meinte: »Ja, das stimmt. Er sieht aus wie ein Affe vor seiner Höhle.«
Don meinte: »Eben hatte ich einen Flash (diesen Ausdruck gebrauchte er häufiger), daß ich gerne mit dir spazierengehen würde.«
Ich: »Möchtest du jetzt mit mir spazierengehen?«
Don sagte ja und stand auf . Arm in Arm gingen wir durch den Raum.
Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt es war, aber irgendwann hatte ich kein Ego mehr. Es gab nur noch Gewahrsein.
Nachdem wir einmal durch den Raum gegangen waren, sagte Don, daß er sich von mir angetrieben fühlte. Ich sagte: »Nach den ersten drei Schritten.«
Don stimmte zu. »Am Anfang sind wir zusammen gegangen.« Er sagte noch etwas, aber ich weiß nicht mehr was. Ich sagte: »Erklärung.« Er meinte: »Du willst eine Erklärung von mir?« Ich: »Nein. Du hast mir eine Erklärung gegeben. Dasselbe hast du eben schon einmal gesagt« (ich deutete mit dem Kopf auf das andere Ende des Raumes).
Wir sahen uns an. Seine rechte Hand hielt meine linke. Ich streckte ihm meine rechte Hand entgegen und sagte: »Würdest du diese Hand auch halten?« Er legte seine linke Hand in meine rechte.
Während all das geschah, hatte ich keine Gedanken, keine Phantasien, keine Anweisungen, nichts. Ich war einfach nur da. Was immer ich wahrnahm, wurde einfach wahrgenommen – ohne Absicht, ohne Ziel und ohne Meinung. An diesem Punkt nahm ich meinen Körper wahr und drückte aus, was ich wahrnahm. »Bis hierher bin ich gekommen. Weiter komme ich nicht.« Kein Denken, nur Ausdruck der Wahrnehmung dessen, was mein Körper tat. Ich spürte, daß ich wie angewurzelt dastand. Ich blieb wo ich war.
Don sagte: »Genau so möchte ich es haben.«
Wie in der Gestalttherapie, gibt es nicht nur eine Möglichkeit, etwas zu sagen, sondern immer nur viele verschiedene Möglichkeiten. Als ich mich hinsetzte, kamen mir die Bilder von dem Ochsen und dem Mann in einem von Suzukis Zen-Büchern in den Sinn. Das letzte Bild ist ein leerer Kreis. Es trägt den Titel »Der Ochse und der Mann sind verschwunden.«
Patient und Therapeut waren verschwunden. Keiner von beiden war mehr da. Mann und Frau waren verschwunden. Ich war mir Dons und meiner selbst bewußt – sehr viel genauer – und gleichzeitig waren Don und ich auch »verschwunden«. Ich war verschwunden. Es gab nur noch Ereignisse, Geschehnisse, und jedes Ereignis war – ebenso wie jeder Augenblick – einfach da, und dann nicht mehr. Es war nirgendwo. Nur dieser Augenblick – jetzt. Und doch war alles aufgezeichnet und mir zugänglich.
Vollkommene Ruhe, und keine Fehler. Das ist Vollkommenheit. Das »Streben nach Vollkommenheit und Perfektion« erscheint mir sinnlos; es sei denn, man versteht darunter ein so hartes Bemühen und Feststecken, daß es zu einer Explosion kommt. Ich (Ego-Ich) bin in Stücke gerissen, und der Organismus, der ich ist, übernimmt das Ruder. Das ist eine ziemlich anstrengende Vorgehensweise.
Während ich das schreibe, habe ich Abendessen gemacht. Süße Backkartoffeln mit Möhren. Gleich kommt das Steak in die Pfanne, und dann bleibe ich dabei und höre auf zu schreiben. Ganz leicht gehe ich hin und her, während ich das, was ich gerade nicht »tue«, weder vergesse noch mich daran erinnere.
Als Kay abreiste und niemand sich anbot, um Fritz das Frühstück zu machen, sagte Fritz: »Ich werde lernen, mir selbst Frühstück zu machen.« Eines Tages erzählte er mir ganz fröhlich – in aller Bescheidenheit und mit einem Hauch von Ehrfurcht – daß er an diesem Morgen die Eier perfekt hinbekommen hatte, ohne Uhr.
Ich weiß noch, wie ich als junge Frau immer ohne Uhr gekocht habe. Selbst wenn ich in ein Buch vertieft war, nahm ich Gerüche wahr und wußte, wann es »Zeit« war, etwas zu tun. ... Plötzlich ist mein Kopf voll mit all den Uhren und Zeitmessern und anderen Geräten, die wir nicht brauchen. Was für ein Wahnsinn. Wieviel Mühe die Menschen sich machen, um sie herzustellen; und wieviel Mühe die Leute sich machen, um Geld zu verdienen und sie kaufen zu können. Die ganze Verschwendung von natürlichen Rohstoffen. All die Abhängigkeit. Man hält die Wirtschaft in Gang, man hält die Menschen in Gang, um die Wirtschaft in Gang zu halten, um die Menschen in Gang zu halten. ...
Als Alan Watts über das garantierte Einkommen für jeden sprach (und nicht diesen Unfug über negatives Einkommen, wo man Plus oder Minus angeben muß) sagte er, die Leute wollten wissen, woher das Geld kommen soll. »Es kommt nirgendwo her. Das hat es noch nie getan.« Er erklärte, daß Geld lediglich eine Maßeinheit sei, wie Zentimeter. Während der Depression von 1929 verloren sehr viele Menschen plötzlich ihre Arbeit. Das ganze Wissen, die Fähigkeiten, das Material war noch da, nur das Geld fehlte. Er sagte, das sei dasselbe, wie wenn ein Mann ganz normal zur Arbeit ginge und der Chef ihn wegschicken und sagen würde: »Tut mir leid. Es gibt keine Arbeit. Wir haben keine Zentimeter mehr.« Das ganze Wissen, die Fähigkeiten, das Material ist noch da, nur die Zentimeter fehlen.
Das ist mein Gefühl in bezug auf unsere »Wirtschaft«. Ganz abgesehen davon, daß es sich um eine »Wirtschaft« handelt, die auf Abfall basiert.
Ich mag Knappheit – nicht Entbehrung. Aber Knappheit ist ganz gut.
Die Erleuchtung, die mir vor ein paar Seiten kam, war folgende: Mein Leben lang haben mir die Leute erzählt, ich könnte (und sollte deshalb) bessere Jobs annehmen. Ich wollte nicht. Mir gefiel die Arbeit in irgendwelchen Hinterzimmern, bei denen ich niemandem etwas vorspielen mußte. Einmal machte ich einen Bürojob, bei dem ich innerhalb von drei Jahren im Vorzimmer landete, mit feinen Gardinen an den Fenstern und einem Vorgarten. Ich hatte keine Wahl und hätte es einfach so hinnehmen können, aber ich entschied mich, mir eine schöne Lampe und einen Holzschnitt von zu Hause mitzubringen. Allerdings gab es auch Zeiten, in denen der Chef hereinkam und auf seine Schuhe starrte, weil ich einen dreckigen Kittel trug und meine Haare völlig durcheinander waren, weil ich mich in irgend etwas hineinvertieft und mir dabei die Haare gerauft hatte.
Etwas an der Frage, warum ich keine besseren Jobs annehmen wollte, verstand ich jedoch nicht. Ich wußte nur, daß sie mich nicht interessierten. Ich wollte keine Chefin sein. Daran gibt es keinen Zweifel. Wilfred Pelletier bezeichnet das System der Weißen als »vertikale Organisation«, und dieses System gefällt mir nicht. Er schreibt darüber in seinem Artikel »Einige Gedanken zum Thema Organisation und Führung« – ein Aufsatz, den er 1969 für die Mani tobia Indian Brotherhood schrieb.
Vor etwa einem Monat fuhr ich zu einer einwöchigen interkulturellen Konferenz in Saskatchewan. »Durchgeführt« wurde diese Konferenz von Wilfred, aber eigentlich ließ er sie einfach nur laufen und hatte selbst keine andere Funktion, als daran teilzunehmen. Es gab kein Programm, keinen Zeitplan und nur einen einzigen Vortragenden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geplant war, aber dieser Vortragende sprach immer weiter und weiter und weiter. Ich ging raus, holte etwas Obst, kam wieder herein und ließ die braunen Papiertüten herumgehen. Wie immer verstand ich nicht, wie die Indianer einfach dasitzen und so freundlich dreinschauen konnten, während vorne ein Weißer eine langweilige Rede hielt. Später fand ich heraus, daß sie in Gedanken fischen oder jagen gehen. Wilfred erzählte mir, wie »der Bär – FLATSCH! – ins Wasser sprang und das Wasser zu allen Seiten wegspritzte.« Mit seinen langen Armen machte er eine weite, ausladende Geste. Gott, wie er das genoß!
Fritz sagt: »Wenn du dich langweilst, dann zieh dich an einen Ort zurück, an dem du dich wohler fühlst.«





























