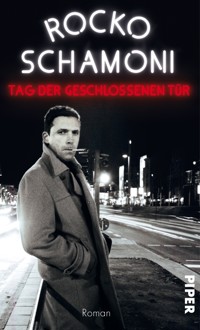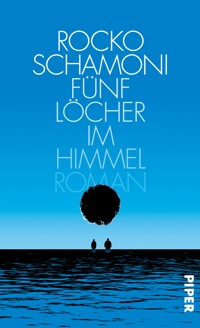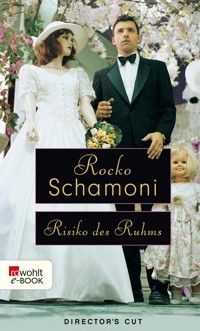9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Entschuldigung, es ging nicht anders Hatte die taz recht, als sie schrieb, Rocko Schamoni sei «lustiger als hierzulande erlaubt, und ernster als hierzulande gewünscht»? Natürlich, dieses Buch ist der Beweis. Es ist die Erinnerung an eine Jugend, wie sie viele hatten. Kühe, Mofas, Bier, Konfirmanendenunterricht, Schulstress, Liebeskummer und die tödliche Langeweile auf dem flachen Land, die Windstille am Ende der schlimmen Siebziger. Doch dann kam PUNK, und PUNK kam auch nach Schmalenstedt in Schleswig-Holstein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Rocko Schamoni
Dorfpunks
Roman
SH-Punk
Schmalenstedt, schöner sterbender Schwan
Erste Amtshandlung: Reinkommen in die Dorfszene
Respekt schaffen durch moderne Waffen
Der Magier
Im Bauch einer Pyramide der Jugend
Dinge wechseln den Besitzer
Äquatortaufe im Ozean des Alkohols
Celine, Prinzessin der Liebe
Der große, gefährliche Motor Langeweile
Die Königin des Discoplaneten
Große Passion Gestaltenbeschleuniger
Isi Brandt und das Glas von John Lennon
Zum letzten Mal Hardrock
Schneid dir die Haare, bevor du verpennst
Der Discoplanet
Eine neue Familie gründet sich
Weiß
Musik wird unser Leben verändern
Hölle im Land der Engel
Warhead
Gewalt ist unser Geld, und wir wollen gerne zahlen
Der Hypnotiseur
Sexualität ist eher unangenehm
Die Lederkarawane
Gen Italien
Schwaster Rühmann
Wald-, Höhlen- und Strandpunks
Berlin, alte Hure mit Herz
Die Amigos
Das nächste große Muss
Kleine Freiheit
Neue Namen, neue Wunden, neue Drogen
Der Sachsenstein
Freiwillige Isolationshaft
Stars
Die Menschen mit den hohen Stimmen
Les Misérables
Wildern
Mutterkorn
Noch mehr Ton: Mehrton
Das erotische Netz des Doktor Sexus
Die ganze Welt ist eine Attrappe
Kontakt nach ganz oben
Zwei Provinzler fallen über eine Großstadt her
Der Hafen der Liebe
Die Prüfung
Epilog
Dank
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
SH-Punk
Ich war Roddy Dangerblood. Bis ich 19 war.
Dann wurde ich zu Rocko Schamoni.
Vor alldem hatte ich einen ganz normalen bürgerlichen Namen. Das ist schon so lange her, dass er mir fast entfallen ist. Nur wenn der Staat mich in Form irgendeiner Behörde herbeizitiert und nicht begreift, dass ich einen neuen, cooleren Namen habe, muss ich mir diese abgestoßene Haut wieder überziehen. Seltsam, von Fremden mit einem Namen angesprochen zu werden, mit dem mich meine Eltern das letzte Mal riefen, als ich noch Teenager war. Ich bin dann jedes Mal um mein Erwachsensein beraubt, um einen Großteil meiner Geschichte, sitze auf dem Amt als alter Jugendlicher. Das sind Wurmlöcher durch die Zeit. Gegraben von nichts ahnenden Beamten. Aber ich verrate ihnen nichts davon, sie sollen keine Macht über mich haben.
Ich komme von der Ostsee, ich war SH-Punk. SH steht für Schleswig-Holstein. Dies ist eine Geschichte von Ufern. An die Wellen schlugen. Sie kamen aus England, breiteten sich dort sehr schnell aus, sprangen aufs Festland über, setzten die Großstädte unter Wasser und flossen von dort aus weiter, um später in der Provinz zu verebben. Jahre später. 1975 in England ausgebrochen, 1981 bei uns verebbt. In uns. Ein Jugendtsunami.
Und es ist eine Geschichte von verschiedenen Wegen, erwachsen zu werden. Von Wegen, die die Zeit für uns bereithielt. Ich konnte es mir gar nicht anders aussuchen. Das Schicksal hatte bestimmt, dass ich Punk werden sollte. Niemand Geringeres als das Schicksal.
Ganz grob gesehen besteht mein Leben aus zwei Teilen.
Aus meiner Kindheit und dem Rest.
Der Rest begann, als ich circa zwölf Jahre alt war.
Davor war meiner Erinnerung nach alles in Ordnung, irgendwie alles normal. Ich war ganz in der Welt, ich sah mich nicht getrennt, reflektierte nicht über sie, nahm sie, wie sie war, freute mich über das meiste, benutzte zur Kommunikation die Sprache, mit der ich aufgewachsen war, die man mir beigebracht hatte. Eine ziemlich ideale Welt. Eine Zen-Welt. Eine Welt in Watte.
Dann aß ich vom Baum der Erkenntnis und wurde aus dem Paradies vertrieben.
Schmalenstedt, schöner sterbender Schwan
1976 in Norddeutschland, genauer gesagt: Schmalenstedt an der Ostsee. Fünftausend Einwohner, CDU-regiert, nächste größere Stadt: Kiel. Viel Wald, Bäche, Seen, Hügel, eine Endmoränenlandschaft, geformt in der Eiszeit. Man nennt es die Holsteinische Schweiz, idyllisch, relativ unberührte Natur, das meiste Land in Adelshand. Und totaler Totentanz.
Es gab eine Kooperative Gesamtschule mit 1600Schülern. Ein großes Einkaufszentrum, ein paar Kneipen, Restaurants und eine Disco: Meier’s. Ansonsten war Schmalenstedt eine sterbende Stadt.
Meine Eltern hatten sich für relativ wenig Geld ein altes Bauernhaus in einem Vorort Schmalenstedts gekauft, einem Dorf mit vielleicht dreihundert Einwohnern. Kleine Häuser, Vorgärten, Deutschlandfahnen (heute gepaart mit Ferrari-Motiven), Garagen, niedrige Hecken. Und sieben aktive Bauernhöfe.
Das Haus war schön, groß und alt, von 1877, ziemlich renovierungsbedürftig, umgeben von einem 2000Quadratmeter großen Grundstück mit Obstbäumen, das total verwildert vor sich hin wucherte. Es lag an einem Hang mit Aussicht auf das Dosautal, eines der letzten Urstromtäler Norddeutschlands, in der Mitte ein kleiner Fluss, die Dosau eben. Auf der anderen Talseite ein säumender Wald, den ich später als den Geisterwald kennen lernen sollte.
Am Anfang war es wunderbar für mich und meinen Bruder, das alte Haus zu erforschen, Dachböden und Abseiten zu entdecken, Verstecke, Dinge, die der Vormieter vergessen oder verloren hatte. Es roch nach Staub und alten, tragischen Geschichten, Geschichten vom Verlust des Eigenheims. Immer wieder eingemauerte Rechnungen. Wenn mein Vater eine Wand einriss, fand sich oft eine eingemauerte Rechnung darin. Darüber mussten wir dann jedes Mal wieder lachen. Gute Idee, Rechnungen einzumauern, wenn man kein Geld hat. Fanden wir.
Mein Bruder und ich bekamen gegenüberliegende Zimmer im oberen Stockwerk des Hauses, nah genug, um in einem ständig schwelenden Kriegszustand zu verweilen, der meistens so aussah, dass er als der Jüngere mir damit drohte, von mir begangene Untaten bei meinen Eltern zu verpetzen. Dafür drohte ich damit, ihm seine Lieblingsgegenstände zu klauen. Ich entwickelte ein geradezu mafioses geheimes Drohsystem, indem ich im Fall einer bevorstehenden Verpetzung einfach nur ganz kurz meine Hand hob und ihm eine bestimmte Anzahl von Fingern zeigte. Diese Anzahl bezog sich auf die – meiner Meinung nach – angemessene Anzahl der Dinge, die ich ihm klauen würde, wenn er zu reden wagte.
Treppengepolter, vier Füße in rasendem Lauf Richtung Wohnzimmer, Türenknallen, meine Mutter fährt erschreckt herum, ihr langes Haar fliegt in der Luft.
Mein Bruder: Mama, Mama, der (auf mich zeigend) war in deinem Arbeitszimmer und hat die Farben geklaut.
Mama: Waas?
Ich: Ich war da nicht drin, das war schon… (Finsterer Blick auf meinen Bruder, dann die Aufmerksamkeit meiner Mutter auf etwas anderes lenkend:) Mama, was ist das da für ein Buch (aufs Regal zeigend)?
Mutter blickt verwirrt zum Regal. In der Zeit hebe ich die Hand ein wenig und spreize drei Finger in Richtung meines Bruders, der erbleicht.
Mama: Was ist denn hier –
Mein Bruder: Mama, er hat mir drei Finger gezeigt!
Mama: Na und? Was ist denn hier –
Mein Bruder: Das heißt, dass er mir drei Sachen klauen will.
Mama: Ja, aber warum denn, du (zu mir), stimmt das?
Ich: Nein, warum denn, ich hab doch gar nichts gesagt.
Mama: Ja, dann lasst mich jetzt in Ruhe, ich habe keine Lust auf eure Streitereien.
Ich: Okay.
Mein Bruder: Aber…
In einem unbemerkten Moment ging ich dann nach oben und klaute ihm die Gegenstände, die er am schmerzlichsten vermissen würde. Er konnte es mir nie nachweisen.
Heiligabend schenkte ich ihm alles wieder, und er hasste mich dafür. Ich Schwein. Aber er spielte die Rolle des Jüngeren so geschickt aus, dass ich mich nicht anders zu wehren wusste. Hätt ich’s anders machen können, hätt ich’s auch anders gemacht. Sage ich zu meiner Verteidigung.
Erste Amtshandlung: Reinkommen in die Dorfszene
Wir waren fremd im Dorf, und wir mussten da erst mal reinkommen. Das dauerte lange. Zuerst hielten mein Bruder und ich an unseren alten Freundschaften fest und fuhren, sooft wir konnten, nach Schmalenstedt in die Nähe unserer ehemaligen Wohnung. Das war auf Dauer allerdings zu anstrengend. Außerdem lockte das Dorf mit eigenen Reizen, wie ich bald entdecken sollte. Das Dorf riecht.
Irgendwann erschien ein Junge auf unserem Grundstück, der sich uns als Achim Dose vorstellte. Achim war blond, sportlich, neugierig, mutig, forsch, ein richtiger Dorfrotzbengel, und er wollte sehen, was für Leute hier eingezogen waren, in das große, alte, leer stehende Haus am Hang.
Der Rest des Dorfs verhielt sich desinteressiert bis abweisend. So schnell wird man nicht in eine norddeutsche Dorfgemeinschaft aufgenommen. Dafür bedarf es oft eines jahrelangen Abgleichens politischer und kultureller Werte. Dafür muss man gemeinsam viel Alkohol trinken. Dafür muss man im Schützenverein, in der Feuerwehr und im Fußballverein sein, sonst läuft da erst mal gar nichts. Anders sein war nicht angesagt. Aber all das kam für meine Eltern nicht in Frage. Sie waren Lehrer. Also standen wir draußen. Die ganze Familie. Obwohl ich bereit gewesen wäre, den ganzen Schnickschnack mitzumachen. Ich wollte dabei sein.
Achim hatte keine Berührungsprobleme, er nahm mich mit ins Niederdorf. Unser Dorf liegt auf zwei Ebenen, und im unteren Teil des Dorfes wohnte ein Großteil der Dorfjugend, auch Achim mitsamt seinen Eltern und seinen acht Geschwistern. Er war genauso alt wie ich.
Es dauerte lange, bis mich die anderen Dorfjungs akzeptierten, ich musste durch ein Spalier der Demütigungen und mich körperlichen Herausforderungen stellen. Ohne mindestens eine Prügelei mit einem von ihnen hätten sie mich nie akzeptiert. Die Aufnahmezeremonien unter Jungs haben immer mit Gewalt zu tun. Gewalt erzeugt Respekt, ohne Gewalt brauchst du gar nicht erst wiederzukommen. Beim nächsten Mal: Bring Gewalt mit.
Und du weißt als Junge: Anders geht’s nicht, ich muss mich dem stellen, das ist die Welt, in der ich leben muss. Das ist ein beschissenes Gefühl.
Ich prügelte mich mit Bolle, einem kräftigen Typen, der am lautstärksten dafür gewesen war, mich sofort aus dem Dorf zu schmeißen. Er stand auf dem erhöhten Grundstück der Scharnbecks und schrie mich über die niedrige Hecke an. Es war Sommer, das Bild strahlt in mir in leuchtenden Farben. Er schrie, dass wir uns verpissen sollten, wir hätten hier nichts zu sagen, wir gehörten nicht dazu. Die Menschen auf der sommerlichen Dorfstraße schauten uns interessiert zu. Ein kleines gesellschaftliches Ereignis. Mal sehen, ob der Neue was zu bieten hat, nach unseren Regeln. Viele Leute waren da. In mir schäumten Verzweiflung und Wut, ich wusste, dass ich nicht kneifen konnte. Er sprang mich an. Wir prügelten uns ohne Fäuste, rissen an den Klamotten des anderen, wälzten uns am Boden, scheuerten uns auf, spuckten Sand. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Obwohl ich betonen möchte, dass ich damals schon sehr stark war. Deshalb vermute ich, dass ich gewonnen habe. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein: Ich war der Sieger.
Erst nach diesem bestandenen Kampf gab es so etwas wie ein Bleiberecht für uns.
Respekt schaffen durch moderne Waffen
Ich konnte meinen erkämpften Platz relativ gut behaupten, da ich ein großer Waffenliebhaber war. Ich besaß eine stattliche Anzahl an Messern, eine Machete, Pfeil und Bogen, eine selbst gebaute Armbrust, und mein Trumpf war ein Morgenstern, bestehend aus einem dicken Ast, einer Kette und einer Metallkugel am Ende. Als mein Bruder eines Tages nach Hause kam und mir erzählte, dass die Scharnbeck-Brüder ihn mit Pfeilen beschossen hätten, brauchte ich nur die Mitte der Dorfstraße herunterzugehen und den Morgenstern hinter mir lasziv auf dem Pflaster schlorren zu lassen. Die Situation war ohne Einsatz der Waffe sofort bereinigt, ich hatte waffenmäßig gepeakt. Fett.
Während meine Eltern tagsüber arbeiteten und ihre gesamte Freizeit der Renovierung des Hauses widmeten, streunte ich mit den Jungs durch die Wälder und Kieskuhlen. Wir verbrachten einen großen Teil der Nachmittage damit, Krieg zu spielen, entweder Cowboy gegen Cowboy (Indianer waren verpönt, weil sie angeblich keine Feuerwaffen besaßen) oder richtigen Soldatenkrieg.
Angeheizt wurde unsere Phantasie durch die Manöverübungen, die amerikanische Soldaten bei uns im Dorf und auf den umliegenden Feldern abhielten. Sie gruben sich dort tagelang ein und schossen auf Bekannte gleicher Nationalität mit andersfarbigen Armbinden.
Sie waren genau wie wir drauf. Bloß schon erwachsen.
Manchmal klaute ich meiner Mutter Geld, um Mars oder Raider einzukaufen und damit zu den Soldaten zu gehen. Sie lagen unter Tarnnetzen verdeckt, halb eingegraben bei Bauer Schopp unterm Knick, und spielten Krieg, aber wenn wir mit unserem Süßkram kamen, hörte der Krieg sofort auf. Im Gegenzug bekamen wir von ihnen Patronenhülsen und manchmal sogar ganze leer geschossene Patronengurte.
Wer so einen Patronengurt besaß, der hatte es geschafft. Sie waren der Gipfel der Echtheit, rochen nach Krieg, sahen unglaublich martialisch aus. Wie in den Filmen, die wir heimlich sahen. Vor meiner Mutter musste ich all das sorgfältig verstecken. Sie verachtete meinen Hang zum Militarismus und zur Gewalt. Mit so einem Patronengurt, einem gefundenen Helm und den üblichen Spielzeugwaffen im Knick zu liegen und vorbeifahrende Autofahrer abzuknallen war etwas Wunderbares, Erfüllendes. Natürlich hätten wir so etwas nie wirklich gemacht, das ist ja wohl klar.
Ich musste mir in meiner Jugend bestimmt acht Paar Chakus bauen, die ich aus Besenstielen bastelte, überzogen mit Metallabflussrohren und verbunden mit Ketten oder Seilstücken. Wenn ich diese Prachtstücke irgendwo nach meinen stundenlangen Bruce-Lee-Übungen (unter den Armen durch, über Kreuz über den Rücken, mit ausgestrecktem Arm wirbeln usw.) bei uns im Haus liegen ließ, waren sie am nächsten Morgen auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Meine Mutter leugnete jedes Mal diesen pazifistischen Diebstahl. Ich war sehr wütend, konnte ihr aber nichts nachweisen.
Also entwickelte ich immer bessere Verstecke, vor allem, als meine Waffen langsam wertvoller wurden. Damit meine ich Wurfmesser, Luftpistolen und selbst gemischtes Schwarzpulver (ein Pfund Unkraut-Ex, ein Pfund Zucker und ein Teelöffel Schwefel – gut verrühren, fertig ist der Sprengstoff). Denn wenn ich unvorsichtig war, klaute meine Mutter alles, und ich musste mir wiederum Geld von ihr klauen, um nachzurüsten. Da biss sich bei uns die Katze in den Schwanz, es war ein Teufelskreis.
Dieser Hang zur Gewalt sollte später übrigens zur idealen Grundausstattung für die Punkwerdung gehören.
Als wir unsere ersten Luftfeuerwaffen besaßen, war unserer Brutalität keine Grenze mehr gesetzt. Wir zogen in kleinen Gruppen durch die Gegend und schossen auf alles, was nicht bewaffnet war. Also quasi auf alles. Bis auf Menschen.
Es gab hinter dem Dorf einen kleinen versteckten Teich, an dem Checker, Dule, Achim und ich uns eines Sommernachmittags trafen. Checker war einer der coolsten Typen im Dorf, er war der Sohn des Elektromeisters, trug weite, schwarze Glockenjeans und war schon früh im Stimmbruch. Er strahlte eine große Souveränität aus, und man war stolz, wenn er seine Zeit mit einem verbrachte.
Am Teich war ein Anhänger als Jäger- oder Anglerunterkunft abgestellt. Mit einem Messer ritzten wir menschliche Umrisse in das lackierte Blech und exekutierten diese Gestalt anschließend hundertfach mit Diabolos, das waren so kleine eierbecherförmige Bleigeschosse. Checker hatte eine neue Luftpistole mit Drehmagazin, die man nicht nachladen musste, sie machte bestimmt hundert Schuss am Stück. Ich besaß eine Milbro G2, die billigste Luftpistole, die es damals zu kaufen gab, sie kostete 18Mark 50 inklusive 500Diabolos und fünf Reinigungspfeilen.
Als uns das Schießen auf den Anhänger zu langweilig wurde, sahen wir uns nach anderen Zielen um. Wir wurden auf ein paar in der Nähe weidende Kühe aufmerksam, und uns fiel auf, wie ideal die weißen Flecken als Schussziele taugen würden. Aber um unsere Treffer nachweisen zu können, mussten wir die Reinigungspfeile verwenden, denn sie hatten bunte Federn am Ende und würden nicht im Fleisch verschwinden, sondern gut sichtbar draußen stecken bleiben. Ich suchte mir eine Kuh aus, deren weißer Fleck entfernt einem menschlichen Umriss ähnelte. Langsam trottete der weiße Felltyp auf der Kuh über die Wiese. Ich versuchte, ihn am Kopf zu treffen, der gleichzeitig der Hintern der Kuh war. Ich erwischte ihn voll, und die Kuh machte einen Riesensatz, direkt in den Strom führenden Weidezaun. Das sah lustig aus. Leider konnten wir nicht alle Pfeile verschießen, denn im Affentempo kam ein Ford Granada den Feldweg zum See runtergeheizt. In ihm saß der Besitzer der Kühe, Bauer Erich Stolpe.
(Welches ist der schwulste Name der Welt: Erich – vorne er und hinten ich… ham wir gelacht.) Obwohl er uns eindeutig erkannt hatte, flüchteten wir durch sein Kornfeld, trampelten die Ähren um und versteckten uns stundenlang irgendwo im Wald. Unsere Schießübungen wurden nie geahndet, was einzig und allein damit zusammenhängen konnte, dass Bauer Erich ein okayer Typ war und in seiner Jugend wohl ähnliche Sünden begangen hatte.
Das Schwarzpulver hatte ich mit Joachim Becker, Sohn eines Chemikers und selbst auch Chemiegenie, hergestellt. Wirfüllten es in kleine Briefchen zu fünf Gramm ab und verkauften es nach der Schule an der Bushaltestelle. Wenn man es anzündete, verbrannte es sprühend und erzeugte stinkenden Qualm. Die Fahrer fluchten, wenn wir das Zeug vor ihren Bussen losließen. Die Haltestelle sah oft aus wie ein Kriegsschauplatz, dunkle Wolken stiegen auf. Man konnte das Pulver aber auch in Zeitungspapier einrollen und daraus Dynamitstangen basteln. Schon am dritten Tag – unser Handel war schwunghaft angelaufen – wurde ich mit circa zehn Briefchen erwischt und unserem Direx vorgeführt. Er hielt mir eine zwanzigminütige Standpauke über die Gefährlichkeit unserer Knallerei und drohte mir mit Schulausschluss, falls ich mich nochmals erwischen lassen sollte. Mein Vater, der an der Schule unterrichtete, bekam nichts mit. Zum Glück.
Wir stellten die Produktion ein, und die Freundschaft zwischen Joachim und mir, die stark von unserem geschäftlichen Verhältnis abhängig gewesen war, verdorrte.
Mein Waffenfetischismus muss etwas mit meinem Wunsch nach Härte zu tun gehabt haben. Ich wollte hart sein, hart wie Rocker oder Berg-und-Tal-Bahn-Kassierer (die, die immer aufsprangen und mitfuhren, um die Chips zu kassieren), oder wie Disco-Acer mit dünnem Oberlippenbart, Röhrenjeans und Mittelscheitel.
Alle Dorfjungs wollten gerne hart sein. Wer nicht als hart galt, konnte nicht mitreden. Jede Verletzung kam einem Orden gleich; je mehr man aufweisen konnte oder je schlimmer sie waren, desto mehr Ansehen brachten sie einem bei den anderen.
Der Magier
Eines Tages tauchte John Scholl bei uns auf. Er war ein Künstler, den meine Eltern in Guatemala kennen gelernt hatten, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern viele Jahre gelebt und gearbeitet hatte. Ein besessener Maler, der alles, was er berührte, sofort mit einer Schicht Farbe überzog. Er schleppte riesige etymologische Wörterbücher und Dialektatlanten mit sich herum und referierte ständig über die Bedeutung von Wörtern. Er kannte sich mit Sprachen wirklich aus. Wenn ich ihn in seinem Zimmer neben unserer Diele besuchte, erklärte er mir konspirativ, woher das Schlechte in der Welt kam.
Er: DOG-GOD, DOG-GOD. Gott ist ein Hund. Die Familie ist der Urquell alles Schlechten, hier wird das Gute, Freie im Menschen verschüttet, hier wird der Mensch an den Leviathan gefesselt. Lass deinen Hass zu, mein Junge, pflege deinen Hass, er ist nicht nur ein negatives Gefühl, sondern auch ein unendlicher Energiequell. Nutze diese Energie für dich, setze sie konstruktiv ein, dein Hass unterscheidet dich von den anderen.
Ich: Aha, wie meinen Sie das denn?
Er: Du sollst ihnen nicht glauben. Du musst die Bedeutung der Wörter lernen. Ich sehe, dass du anders bist als die anderen, du siehst nicht aus wie sie.
Ich: Ja, ich steh auf AC/DC.
Er: Hä?
Ich: AC/DC und KISS. Das sind die derbsten Hardrockbands. Die spielen die voll geilen Solos. Die sind auch anders als die anderen. Da kriegt man voll den Hass von.
Er: Kenn ich nicht. Du musst jedenfalls auf die Stimmen hören. Keiner darf dich zu irgendwas zwingen. Diese Welt ist bereits kaputt, lass nicht zu, dass sie dich berührt. Flieh aus der Familie, such die Freiheit im Verstand, du musst –
Ich: Okay, mach ich, alles klar, also erst mal denn… also tschüs, nä…
Ich wusste nicht genau, was er von mir wollte. Er kam mir ein wenig überspiritualisiert vor, aber irgendwie imponierte er mir auch. Er strahlte ein sonderbares inneres Glühen aus, und etwas von dem Hunger nach Worten und deren Bedeutung habe ich von ihm übernommen. Später erfuhr ich, dass er viel mit Drogen experimentierte, und ich ärgerte mich, davon nicht früher erfahren zu haben.
Er hatte auch eine Tochter, die er dem Volk der Inka zu Ehren Inka genannt hatte. Auch sie nahm gerne Drogen, und zwar so gerne, dass sie Probleme damit bekam. Nachdem John uns verlassen hatte, bat er meine Eltern eines Tages, Inka für einige Zeit bei uns aufzunehmen, sie wolle freiwillig entziehen und müsse aus diesem Grund unbedingt von der Großstadt fern gehalten werden. Wegen welcher Drogen genau sie entziehen musste, weiß ich nicht mehr, ich glaube aber, dass sie auf allen möglichen Sachen rumgondelte. Auf jeden Fall hatte sie Gelbsucht.
Inka war eine Spitzentype, und mein Bruder und ich verstanden uns blendend mit ihr. Sie war nicht allzu groß, ein bisschen stämmig und hatte leicht indianische Züge, da ihre Mutter aus Guatemala stammte. Sie war sehr lustig, und wir konnten uns vorzüglich gegenseitig nerven. Mit meiner Mutter zusammen bemalte sie Bauernmöbel und Türblätter mit paradiesischen Szenerien. Also eigentlich immer wieder mit demselben Motiv, Adam und Eva vor dem Baum der Erkenntnis. Eva hielt den Apfel in der Hand, und Adam hatte ein grotesk großes Geschlechtsteil. Auf allen Bildern. Auf Bauernmöbeln. Vielleicht war das ja Ausdruck ihrer Einsamkeit und Sehnsucht. Während die Erwachsenen das Motiv als «total natürlich» bezeichneten, fand ich es irgendwie säuisch, was Freunde und Bekannte meiner Eltern aber nicht davon abhielt, ihre Resthöfe ebenfalls mit paradiesischen Schwanzbildern zu versehen.
Natürlich hielt Inka ihren Drogenentzug nur kurz durch, bald dachte sie sich Tricks aus, wie sie die sacklangweilige Zeit auf dem Dorf besser bewältigen konnte. Sie bekam regelmäßig Post aus Hamburg von ihren Hippiefreunden. Irgendwann kam sie auf die Idee, sich einfach auf diesem Weg mit Trips versorgen zu lassen, und von da an kamen mit jedem Brief einige kleine Blättchen Löschpapier, die mit Lysergsäurediäthylamid getränkt waren, unbemerkt zu uns in Haus geflattert. Abends ging Inka auf große Reise. Wir bekamen davon nichts mit, dabei war ihr manchmal jäh erwachendes geierhaftes Interesse an Süßigkeiten ein deutliches Zeichen, aber davon wussten ich und mein Bruder nichts. Wir versorgten sie mit Mars und Raider, für uns ebenfalls braunes Gold. Dann hing sie in ihrem Zimmer stundenlang mit schrägen Augen auf dem Bett rum und hörte Kraftwerk. Das mochte sie gerne. Sie behauptete, zur Kraftwerk-Clique zu gehören und sogar bei denen gewohnt zu haben. Ständig spielte sie mir deren Platten vor. Eines Nachts kam Inka nach Einnahme ihres Löschpapiers auf einen Horrortrip. Meine Eltern waren nicht da, sie waren ausgegangen. Inka verwandelte sich in verschiedene Tiere. Die ganze Nacht krabbelte sie auf allen vieren durch das riesige Bauernhaus, miaute und bellte und muhte. Sie hatte vergessen, wer sie war, und durchwanderte nun die verschiedensten Tierformen auf der Suche nach sich selbst. Niemand konnte ihr helfen, denn außer uns war niemand da. Um neun gehen bei uns im Dorf die Lichter aus, da ist dann nix mehr von wegen: «Hilfe, wer bin ich? Bin ich eine Katze oder eine Kuh? Können Sie mir helfen, mich zu finden?» Und was sollten mein Bruder und ich von einer meckernden Ziege halten, die sich ins Badezimmer verirrt hatte? Inka brauchte viele Stunden, erst im Morgengrauen fand sie zu sich selbst zurück und kroch erschöpft ins Bett.
Mein Vater bekam ihre Abflüge irgendwann mit, und eines Tages stellte er sie in ihrem schielenden Zustand zur Rede. Daraufhin rückte sie freiwillig ihre Reserven raus, und er schmiss sie ins Klo. Das tat ihr sehr weh. Nach einem Jahr verließ uns Inka, sehr zu unserem Bedauern, um wieder nach Guatemala zu gehen.
Im Bauch einer Pyramide der Jugend
Achim hatte sich einen Job bei Bauer Nold geangelt und half dort jeden Tag. Er durfte Trecker fahren, die Kühe ausmisten, die Schweine treiben, und er bekam seinen Lohn in qualmender Währung ausgezahlt: HBs (Hitlers Beste, wie unter vorgehaltener Hand gefeixt wurde). Manchmal auch fünf Mark. Er war der zugelaufene Wunschsohn der Familie, denn der Bauer hatte nur eine Tochter.
Ich beneidete ihn. Ich fand das so cool: richtig arbeiten, mit echten Tieren umgehen, Maschinen führen, rauchen. Achim bot mir an, auch für mich eine Stelle zu besorgen. Bauer Nold sagte nur zögernd zu, er traute der Lehrerbrut nicht.
Ich kam jeden Tag, schuftete für zwei und tat alles, um bäuerlich anerkannt zu werden. Ich mistete den Kuhstall aus, häckselte die Rüben für die Kühe, wendete die Silage, packte Strohkloppen, trieb die Schweine und Hühner.
Irgendwann durfte ich das erste Mal den Mister fahren, einen schmalen kleinen Trecker mit Hydraulikschaufel, der in die engen Gänge der Kuhställe passte. Ich war unglaublich stolz, die verantwortungsvolle Millimeterarbeit des Mistrauskarrens ausführen zu dürfen. Achim brachte mir alles bei. Ich war ein guter Mister.
Wenn der Bauer Mittagsstunde machte, verzogen wir uns in Höhlen, die wir im gigantischen Heuboden gebaut hatten. Zu denen führten enge Gänge durch das Heu, durch die man auf allen vieren kriechen musste und die nur wir kannten. Kein Erwachsener kam je dorthin, niemand wusste davon. Es waren geheime Kammern in der Pyramide der Jugend. Sicherer konnte man auf der Welt nicht sein, als wenn man durch die spärlich beleuchteten Fellgänge gekrochen war und in die weiche Grabkammer gelangte. Es roch muffig nach Heu, und in den Sonnenstrahlen, die durch die kleine Dachluke einfielen, konnten wir die Millionen Staubpartikel sehen, die wir einatmen mussten. Alle Jungs, die auf dem Hof arbeiteten, kannten diese Geheimzone und kamen ab und zu mit. Aber Achim und ich waren die Pharaonen. Wir hockten in der Kammer, redeten und rauchten. Mittendrin im trockenen Heu. Es ist nie was passiert, komischerweise.
Bauer Nold hatte einen Vater, der die graue Eminenz des Hofes war. Wir nannten ihn nur den «Alten». Er konnte es nicht lassen, sich in alles einzumischen und in allem Recht zu haben. Wie ein alter, dicker Napoleon stolzierte er über den Hof und gab Befehle. Wenn er auftauchte, hieß es schleunigst abtauchen, um nicht sofort verdienstet zu werden. Zum Steinesammeln tuckerte der Alte mit mir und Achim auf einem alten Fahrtrecker auf den Acker. Wir saßen hinten auf dem Hänger. Am Ziel angekommen, fuhr er den Trecker langsam über die morastige Erde und zeigte mit seinem Krückstock auf die Brocken und Findlinge, die wir zum Hänger schleppen sollten. «Hoch die Nuss», pflegte er zu sagen. Er schliff uns, bis uns die Zunge aus dem Hals hing. Das mochte er gerne. Wenn der Hänger voll war, ging’s zurück zum Hof. Einmal schnappte sich Achim während der Rückfahrt heimlich den Stock des Alten, den dieser hinter den Fahrerstuhl geklemmt hatte. Vorsichtig schob Achim den Stock von hinten unter dem dicken Schenkel des Alten und dessen rechtem Fuß bis zum Gaspedal und drückte dies unvermittelt voll durch. Das schepprige Gefährt machte einen Satz und röhrte dann mit qualmenden vierzig Stundenkilometern ins Dorf hinein. Der Alte fing an, panisch zu werden, und schrie sinnlose Befehle in die Gegend, die in diesem Fall keiner ausführen konnte. Der Schweiß rann ihm den dicken Nacken runter, er strampelte und versuchte, das vermeintlich verklemmte Gaspedal zu lösen. Achims Trick durchschaute er nicht, denn wie bei vielen alten Traktoren war der Auspuff auf der Motorhaube angebracht, und so saß der Alte in einer Fahne aus Qualm, den die geschundene Maschine ausstieß. Mit wedelnden Bewegungen versuchte er, sich Sicht zu verschaffen und die Fußgänger, die ihn verwundert anstarrten, von der Straße zu treiben. Was war denn in den gefahren? Kurz vor der scharfen Kurve der Einfahrt geriet er vollends in Panik und schrie uns zu, wir sollten abspringen. Im letzten Moment nahm Achim den Stock vom Gas, und das schwerfällige Vehikel schrammte mit knapper Not an der Mauer der Einfahrt vorbei. Der Alte spuckte Rotz und Wasser vor Wut auf den untreuen Trecker und ließ uns als unerwartete Reaktion in einem ersten Befehlshagel das gesamte Gefährt durchölen. Wir bezahlten den Preis murrend, erfreuten uns dafür aber später der schönen Erinnerung an die wilde Fahrt.
An den Kühen konnten wir unsere Naturliebe genauso abreagieren wie unsere Gewaltphantasien. Wir fanden es sehr interessant, die Bullen von hinten mit der Forke in die Eier zu piken. Sie waren angekettet und konnten nicht weg. Sie brüllten und zogen an den Ketten, während wir in Loslaufstellung verharrten. Die Hühner schlugen wir mit den Mistforken um, dass sie ohnmächtig wurden und minutenlang nur noch torkeln konnten. Aber eigentlich liebten wir die Tiere. Es waren Tests. Lebenstests. Wer so was nicht brachte, war nicht cool in der Dorfjungsszene. Dafür einen Orden der Gewalt.
Wir rotzten den ganzen Tag, und ab und zu rauchten wir HBs hinter Beckmanns Kuhstall. Beckmann war der zweite Bauer am Hof, es war ein Zwillingsgehöft, bei dem sich die Bauernhäuser gegenüberstanden. In der Mitte war ein großer Platz.
Wer gut rotzen konnte, war angesagt, weil Rotzen Härte signalisierte. Rotzen und Rauchen waren Türen in die Erwachsenenwelt. Obwohl Erwachsene gar nicht rotzen, zumindest die wenigsten. Heutzutage ist Rotzen eh so gut wie out.
Auf jeden Fall lag in alldem bereits ein stärker werdender selbstzerstörerischer Zug. Das fing auf einmal an, im Sommer 78, und war von da an nicht mehr zu stoppen. Der blutige Morgen der Jugend erhob sein wirres Haupt.
Uns fehlte die Initiation, die Knaben in Naturvölkern durch die Gemeinschaft der erwachsenen Männer erfahren. Kontrollierte rituelle Verletzungen, Drogen oder Beschneidungen. All das gab es bei uns nicht, und keinen Mann, keinen Vater, der gemeinsam mit uns durch die Tür ins Mannsein gegangen wäre, geahnt hätte, was uns fehlte und wie er uns das hätte geben können. Nur die bescheuerte Bundeswehr, deren Mannwerdungsriten für mich ganz klar das Letzte waren. Also mussten wir uns diese Rituale selbst ausdenken, unbewusst, aber zielstrebig. Blutige, kriegerische Rituale. Nicht enden wollende Rituale des Übergangs.
Dinge wechseln den Besitzer
Wir klauten wie die Raben. Sobald wir in der Schule Freistunden hatten, gingen Bernd Lose, Sonny Sommer (meine besten Schulfreunde) und ich zum Toom Markt, dem örtlichen Riesensupermarkt in Schmalenstedt, ganz in der Nähe der Schule. Er hatte in wenigen Jahren alle kleinen Nachbarschaftsläden aufgefressen. Wir liebten den Toom Markt, ich liebe ihn noch heute. Seitdem die Leute in Schmalenstedt nicht mehr in die Kirche gingen, trafen sie sich im Toom Markt. Es war der wichtigste Kommunikationsort der Stadt.
Hier gab es viele Dinge, die wir gut gebrauchen konnten, vor allem Zigaretten und Schallplatten. Wie ein Rudel Wölfe umringten wir das Plattenregal. Wir waren so hungrig auf Hardrock und wir konnten die Platten nicht haben, weil sie zu teuer waren. Vor allem der AC/DC- und der KISS-Stapel hatten es uns angetan (abgesehen von Motörhead, Rory Gallagher, Ted Nugent, Saxon, Whitesnake, Rocky Horror Picture Show…). Hardrock war der ideale Soundtrack zur Mannwerdung. So hart wie der Sound und wie die breitbeinigen Mattenhengste auf den Covers, so hart wollten wir gerne werden.
Es gab einen Oberdetektiv im Toom Markt, er hieß Herr Stichling und hatte uns bald als seine natürlichen Feinde erkannt. Er versuchte alles, um uns beim Klauen zu erwischen. Meist drückte er sich in seinem weißen Kittel wie zufällig hinter irgendwelchen Regalen herum und schielte dabei sackdumm zu uns rüber. Außerdem versuchte er es mit Spiegelsystemen. Sein größter Coup war allerdings das Bohren von kleinen Löchern in eine gegenüberliegende Holzverkleidung, hinter der er verschwinden konnte. Von hier aus war es ihm möglich, uns aus einer Distanz von zwei Metern auf die Finger zu schauen, und er selbst blieb dabei völlig unsichtbar. Bis auf seine einfältigen Pupillen hinter den Löchern. Jedes Mal wenn er zu unserer Freude hinter der Ecke in seinen Winkel verschwand, drängten wir uns ganz besonders diebisch vor dem Plattenregal, bis schließlich einer von uns zu den Gucklöchern hinsprang und hineinbrüllte. Beim ersten Mal kippte Stichling um, man konnte es gut hören, und wir grölten vor Vergnügen. Wir wussten, dass er nichts machen konnte, weil sein Versteck ja geheim war und er sich nie die Blöße geben würde, vor unseren Augen herauszuhumpeln. Erst wenn er sich gedemütigt verdrückt hatte, sahnten wir ab. Alle unsere Platten waren geklaut. Jeder von uns hatte bestimmt sieben oder acht Stück, da ging was, rocktechnisch.
Mit dem Hardrock lichtete sich der Nebel über dem Ozean, und der Kontinent der Erwachsenen wurde am Horizont sichtbar.
Äquatortaufe im Ozean des Alkohols
Mein erstes Besäufnis hatte ich, glaube ich, mit zwölf.