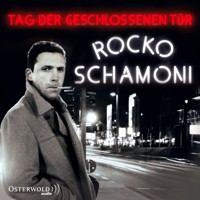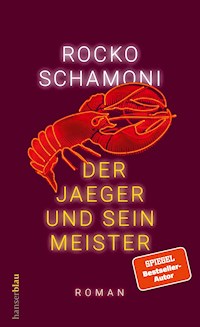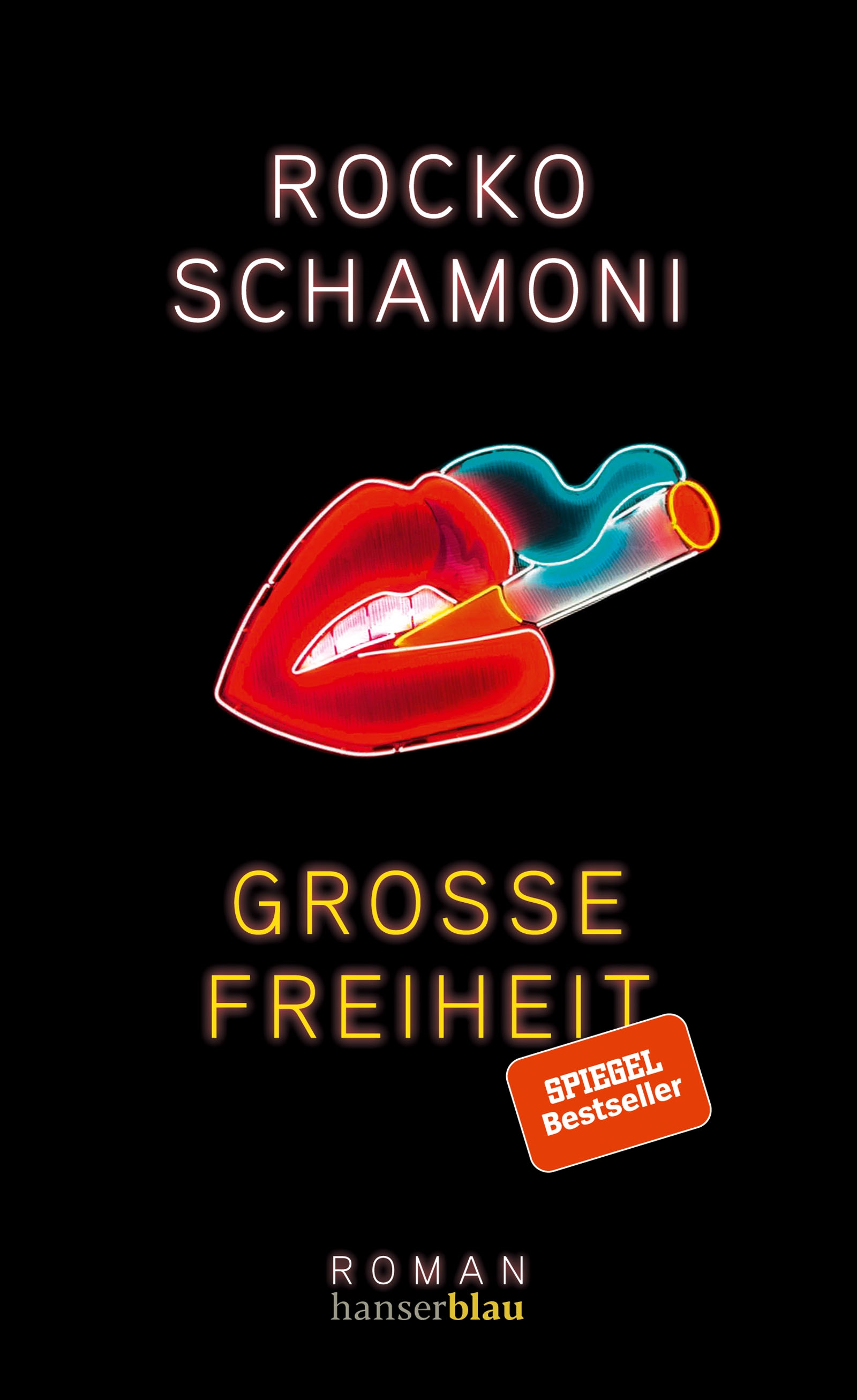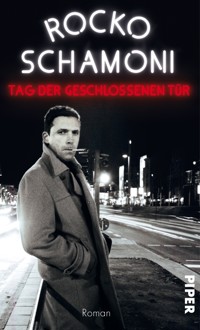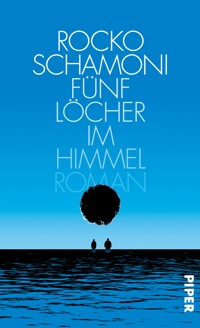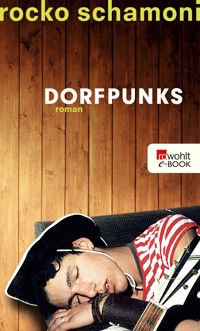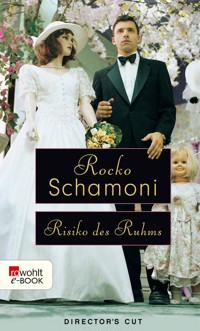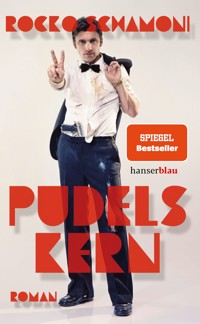
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Dorfpunks kommen in die Stadt: Rocko Schamoni kehrt zurück zu seinen persönlichen Wurzeln Sommer 86, ein junger Mann fährt nach Hamburg, um dabei zu sein. Er ist 19 und will Musik machen, die Jugend feiern, Künstler sein. Es zieht ihn nach Sankt Pauli, auf den Fixstern der Verrückten. Er will hinein in den Abgrund, „wo Feuchtigkeit und dunkle Wärme merkwürdige Organismen zum Tanzen bringen“. Er trifft die Zitronen, die Ärzte, die Hosen, die Neubauten – und sucht seinen eigenen Platz in dieser Welt. Als Erstes braucht er einen neuen Namen: Rocko Schamoni. „Pudels Kern“ reißt uns zurück in die Jahre des Punk, in die Kellernächte, den kaputten Tourbus und bis zum großen Plattenvertrag. Zu den Hoffnungen und Abstürzen. Es ist das glühende Porträt des Künstlers als junger Mann: „Nichts hat mehr Bedeutung, alles fließt, wir sind Quallen der Liebe.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Sommer 86, ein junger Mann fährt nach Hamburg, um dabei zu sein. Er ist 19 und will Musik machen, die Jugend feiern, Künstler sein. Es zieht ihn nach Sankt Pauli, auf den Fixstern der Verrückten. Er will hinein in den Abgrund, »wo Feuchtigkeit und dunkle Wärme merkwürdige Organismen zum Tanzen bringen«. Er trifft die Zitronen, die Ärzte, die Hosen, die Neubauten — und sucht seinen eigenen Platz in dieser Welt. Als Erstes braucht er einen neuen Namen: Rocko Schamoni.»Pudels Kern« reißt uns zurück in die Jahre des Punk, in die Kellernächte, den kaputten Tourbus und bis zum großen Plattenvertrag. Zu den Hoffnungen und Abstürzen. Er ist das glühende Porträt des Künstlers als junger Mann: »Nichts hat mehr Bedeutung, alles fließt, wir sind Quallen der Liebe.«
Rocko Schamoni
Pudels Kern
Roman
hanserblau
Dieses Buch ist als Memorial unserer Freundschaft allen gewidmet, die darin auftauchen, vor allem denjenigen, die schon gehen mussten:
Wölli, Faust, Bollock, Sigurd Müller, Tobias Gruben, Nils Koppruch, Wiener Norbert, Mikel Stratz, Subito Olaf, Andreas Banaski, Almut Klotz, Cäpt’n Suurbier, Xaõ Seffcheque, Zappo, Olifr M. Guz, Peter Marxen, Françoise Cactus, Cay Stele und meinen Eltern.
Alles, was wir an Großem kennen, ist von Nervösen geschaffen. Sie und keine anderen haben Religionen begründet und Meisterwerke hervorgebracht. Niemals wird die Welt genügend wissen, was sie ihnen verdankt, noch vor allem, was sie gelitten haben, um es ihr zu schenken. Wir genießen kunstvolle Musik, schöne Bilder, tausend erlesene Köstlichkeiten, aber wir wissen nicht, was sie ihre Schöpfer an Schlaflosigkeit, an Tränen, an krampfhaftem Lachen, an Nesselfieber, Asthma, Epilepsie gekostet haben, oder an Todesangst.
Marcel Proust
Anmerkung des Autors
Ich muss vorausschicken, dass alle erzählten Ereignisse in diesem Buch meiner subjektiven Erinnerung und meinen Aufzeichnungen aus Kalendern und Tagebüchern entspringen. Gut möglich, dass sich beschriebene Personen anders und sogar genauer an diese Ereignisse erinnern als ich selbst. Ich freue mich also über nachträgliche Richtigstellungen, so sie denn konstruktiv vorgetragen sind. Ich zumindest habe versucht, dieses Buch mit dem entdeckerischen und aufgeregten Geist der späten Jugend zu schreiben, mit dem ich diese Zeit auch erlebt habe.
Prolog
5.11.85
Ich bin einer von jener naiven Sorte, die immer erst alles anfassen müssen, bevor sie es glauben. Ich bin ein furchtbar verwirrter Jugendlicher, aber ein paar Sachen weiß ich: Ich will männlich sein. Ich will nie erwachsen werden. Ich will Leidenschaft, ich will erschaffen, etwas vor mir haben, mein Werk, meine Kunst.
Ich habe in einem Schrank meine alten Tagebücher und Kalender wiedergefunden. Die Kalender reichen von 1985, also meinem 19. Lebensjahr, bis 2012. Das meiste, was ich zu der Zeit tun musste und erlebt habe, ist dort verzeichnet. Und in den Tagebüchern fand ich persönliche Bemerkungen dazu. Allerdings nur in den ersten Jahren, die Tagebucheinträge hören zur Jahrtausendwende auf.
Ich wusste immer, dass die Kalender und Aufzeichnungen dort in dem Schrank liegen, aber ich habe sie nie angerührt, weil es mir schlichtweg zu langweilig erschien, das Erlebte noch mal nachzulesen. Ich fand es sogar ein wenig lächerlich, dass ich die Bücher überhaupt geschrieben habe, mir erschien diese Art von Selbstbeschäftigung eitel, selbstbezogen, unreif und ich dachte schon lange darüber nach, das ganze Zeugs wegzuschmeißen. Aber jetzt, Jahre später, auf der Suche nach dem dunklen Stern meines Lebens, nach dem Kern meines Dramas, bin ich dankbar dafür, dass es die kleine Bibliothek noch gibt, weil die Erinnerungen so konkret sind. Genauer als die Bilder in meinem Kopf. Ich verstehe die Sprache, erkenne sie wieder, jedes Gefühl und alle Handlungen erscheinen mir vertraut und fremd zugleich. Denn ich bin ein anderer geworden. Ich bin gewachsen, habe mich verformt, bin erblüht und verkrustet, habe Überflüssiges verloren und Notwendiges gewonnen. Und nun bin ich alt. Zwar nicht richtig alt, aber schon ganz schön alt. So alt, wie ich nie zu werden geglaubt hätte. So alt, wie es bei mir und meinen Jugendfreunden früher verpönt gewesen war. Wir planten, jung zu bleiben oder zumindest jung zu sterben. Es kommt mir vor, als wäre all das nur einen Wimpernschlag entfernt.
Ich will nicht älter werden, als ich jetzt bin. Ich stelle es mir schrecklich vor, so alt zu werden, wie meine Alten sind. Alles an ihnen ist festgefahren, ihre Freiheit ist verpufft. Wofür leben sie, für ihre Arbeit? Fünf Tage die Woche die Kinder von Fremden erziehen und am Wochenende Hefte korrigieren. Was ist ihr Ziel?
Die Tagebücher regen meine Erinnerungen an, Spalten und Ritzen tun sich zwischen den Synapsen auf und längst Verschollenes erscheint staubig im Licht der Gegenwart. Ich bin wirklich erstaunt darüber, was dort alles herumliegt, vor allem die Kleinigkeiten, Details, Dinge, Szenen, Begebenheiten, die mir völlig wertlos erschienen waren und dennoch von einer Instanz in mir, einem niederen namenlosen Beamten meines Bewusstseins, abgelegt wurden in den tiefsten Nischen meines gigantischen grauen Massespeichers. Vielleicht sind gerade diese kleinen Dinge einer genaueren Betrachtung wert.
Ganze Szenen ploppen auf, ich kann die Erinnerungen abspulen wie alte VHS-Tapes, manchmal klemmt das Band ein wenig, manchmal gibts Schlieren oder das Tracking funktioniert nicht wirklich, aber meistens sehe ich klare Bilder und höre deutliche Stimmen in meinem Kopf. Ein überraschender Effekt: Je älter ich werde, desto klarer werden die Bilder und die Stimmen. Den Effekt hatte mir meine Großmutter genauso beschrieben, als ich jung war, im Wohnzimmer meiner Eltern, sie muss schon über siebzig gewesen sein, und wir sprachen über das Leben, die Jugend und über den Prozess der Erinnerung.
Ich kann mich sehr gut an meine Kindheit und Jugend erinnern, die Bilder werden immer klarer, von Jahr zu Jahr.
Und was ist mit der Zeit nach deiner Jugend, so zwischen dreißig und jetzt?
Das ist alles verschwunden. Da war ja alles immer gleich, der Bauernhof, die Tiere, der Tagesablauf, die Arbeit, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber den Anfang erinnere ich gut, da war alles neu.
Jetzt bin ich fast da, wo sie damals gewesen ist. Je mehr ich mich vom Urknall entferne, also von meiner Kindheit und Jugend, desto besser kann ich das, was hinter mir liegt, erkennen und verstehen. Weil ich die notwendige Distanz habe, um die ganze Szene aus der Vogelperspektive zu überblicken.
Ich lege die Tagebücher beiseite und frage mich, ob ich mittlerweile das bin, was man einen Hasbeen nennt? Einer, der gewesen ist. Der das Beste hinter sich hat. Bei dem der Lack ab ist. Der von der schönsten Zeit seines Lebens träumt, die irgendwann in seiner Jugend lag. Opa erzählt vom Krieg.
Ich gehe ins Bad, schaue mich im Spiegel an und sehe immer noch den, der ich mal war. Sehe die vertrauten Konturen, die Ebenheit der Züge, kaum Falten um die Augen, die hohe Stirn, das nervige lockige Haar, das jeden Morgen wie ein schlecht aufgeschlagenes Daunenkissen auf meinem Kopf sitzt. Aber ich sehe auch den, der ich bald sein werde. Der Bart ist grau geworden, die Haut hat an Straffheit verloren, die Augen brauchen eine Brille. Ich stecke zwischen den Zeiten fest wie in einem Gletscher, der sich langsam talwärts bewegt. Und ich kann mich nicht an dem festhalten, der ich mal war, ich muss zu dem Etwas verwachsen, das ich werden soll, denn der Strom der Zeit fließt nur in eine Richtung — vorwärts. Oder besser: abwärts.
Wenn ich an meine Jugend denke, schlaglichthaft, dann erscheint sie mir in einem etwas verklärten, weichen, goldenen Licht. Wie ein Polaroid aus den Siebzigerjahren. Wenn ich aber in den Tagebüchern lese, wenn ich genauer nachdenke, mich tiefer auf die Erinnerungen einlasse, dann fällt mir all der Druck und Zwang, die Unsicherheit, die Unklarheit, die Verzweiflung, das Nichtwissen, die Vergeblichkeit, die Brutalität, mit einem Wort — die Qual meiner Jugend wieder ein.
Ich habe alles, aber auch alles an Selbstachtung verloren. Ich halte mich für mehr oder weniger nicht lebensberechtigt. Das Dumme ist, das ist keine Laune, sondern eine Einsicht und ein Zustand. Ein ohnmächtiger Zustand der Erkenntnis und nur ein letzter Funken Hoffnung, dass ich vielleicht doch nicht so bin, wie ich bin. Ich kann starke Kräfte entwickeln, aber nur so kurz, dass es für nichts Veränderndes reicht.
Und immer, immer, manchmal unterschwellig, manchmal dominierend: der Tod im Kopf. Ganz nüchtern, ohne Sentimentalität, nur als möglicher dritter Weg.
Don’t forget — Einsamkeit ist das Wichtigste.
Gott, bin ich froh, so nicht mehr sein zu müssen. So nie wieder sein zu müssen, zumindest in diesem Leben. Denn nun kenne ich mein Wesen und meine Fähigkeiten, ich kenne die Menschenwelt und ahne zumindest, wie das Leben funktioniert. Je näher ich dem Tod komme, desto besser weiß ich, was ich will und worum es mir eigentlich geht. Und ich weiß, wie ich das verwirklichen kann. Früher habe ich mich — weil ich nicht wusste, wer ich war — chamäleonhaft ständig neu erfunden, habe Persönlichkeiten, Charakteristika, Styles ausprobiert, was von außen spannend ausgesehen haben mag, sich innen aber unsicher und hohl anfühlte. Mein Wesen war unfertig und der Tornister meiner Persönlichkeit nur zur Hälfte gefüllt, ständig dieses leere Schwappen in dem zu großen Raum. Die Gefahr bei Glycerin ist, dass es beim Transport explodiert.
Jetzt scheint alles anders. Ich bin nach wie vor neugierig, erfindungsreich, energiegeladen und an guten Morgenden, wenn ich aufwache und die Augen noch geschlossen halte, fühle ich mich wie ein alters- und körperloser Geist, der voller Lust und Freude über die Welt gleitet und sich all die Wunder anschaut, die irgendjemand namens Gott mit unglaublicher Akribie vorbereitet hat. Und ich weiß: Es gibt nichts Schlechtes auf der Welt. Wenn, dann nur in der Welt der Menschen.
Vor mir auf dem Tisch liegen die Tagebücher und meine rote Wollmütze. Ich besitze sie, seitdem ich vier Jahre alt bin. Mutter hat sie mir gestrickt und die Wolle ist so dehnbar und dennoch fest, dass ich sie immer noch tragen kann. Ich starre eine kleine Ewigkeit die Mütze an, ich versinke in den Strickrillen und tauche ganz ein in das dunkle Gespinst aus Haaren. Dann beginne ich zu schreiben.
1986
Das Glimmen am Horizont
Am Tag, nachdem ich meine Lehre als Keramiker — genauer gesagt als »Scheibentöpfer« — bestanden habe, also gestern, fange ich an, meine Sachen zu packen, um das Haus meiner Eltern in dem kleinen Dorf an der Ostsee für immer zu verlassen. Ich bin neunzehn Jahre alt und die Welt steht mir offen. Das Leben liegt vor mir und wirkt wie ein schier unendlicher Berg noch zu öffnender Geschenke. Gleichzeitig bin ich ein Geschenk an die Welt, das sie die Freude hat, öffnen zu dürfen, das kann man auch erwähnen. Meine Mutter wuselt die ganze Zeit aufgeregt um mich herum, denn mit der Freiheit, die mir von nun an zusteht, wird sie auch ihre wiedererlangen. Sie hat sich die Haare kürzer geschnitten und scheint sich sehr bewusst auf diesen Lebensabschnittswandel vorzubereiten. Aber entscheidender als die Freiheit wiegt die Leere, die ich im Haus hinterlassen werde. Mein Bruder ist schon ausgeflogen und wenn sich die Tür hinter mir schließt, wird statt meiner eine raumgreifende Ruhe in das große alte Bauernhaus unter den beiden riesigen Blutbuchen einziehen, ich weiß, dass meine Mutter Angst davor hat. All die brüderlichen Streitereien, der Lärm um nichts, der rumpelnde Krach aus dem Proberaum, die Mädchenstimmen aus meinem Zimmer, die Fehlfarben-Riffs (Es geht voran), die durch die dicken Mauern des alten Bauernhauses dumpf ins Wohnzimmer sickerten — all die Alltagsprobleme und Scherereien, aus denen unser Leben bestand —, werden verschwunden sein, stattdessen: Freiheit und Stille. Eine Zäsur: Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist die Hauptaufgabe erledigt, die Staffel des Lebens ist übergeben, nun beginnt das Afterlife, die Bonuszeit, pure Quality Time, der Luxus des langsamen Verglimmens. Und gleichzeitig fängt für die Eltern jetzt das eigentliche Leben an, denn es gibt keine biologischen Verpflichtungen mehr, der Mensch kann sich ganz sich selber zuwenden, dem Sein, der Kunst oder den Göttern.
Darüber hinaus befürchtet Mutter, dass ihr verrückter Sohn an der Welt zerschellen könnte, dass er, wenn er nicht mehr unter dem Schirm ihres persönlichen Protektorats steht, vom Abgrund seiner eigenen Wildheit verschlungen werden könnte. Eine berechtigte Befürchtung, denn ich habe nicht vor, meine Zukunft mit Plan, Maß und Ziel anzugehen. Ganz im Gegenteil, ich werde mit vollem Anlauf einen Sprung ins Nichts wagen, wild und frei sein, untergehen in einem Ozean der Freude. Ich habe bereits so lange von der fernen Welt geträumt, von den großen Städten, in denen andere wilde, freie Menschen leben, die mich nicht verurteilen für meine Unfähigkeit, mich anzupassen, mein Nicht-funktionieren-Können, das man an meinem zerrissenen Äußeren ablesen kann. Hier auf dem Dorf spüre ich, wie die bösen Blicke hinter den Gartenzäunen Löcher in meine zerfransten Haare brennen, sie verachten mich zutiefst, und aus einer Ligusterhecke zischte mir kürzlich ein Grauhaariger zu: »Bei Hitler hätten sie dich längst vergast!« Eine zweifelsohne zutreffende Bemerkung. Ich habe bereits seit Jahren das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Wer hat eigentlich mit dem Streit angefangen — ich oder das Dorf? Ich bin dem Dorf entwachsen, ohne zu wissen, wie und warum. Es müssen die Platten gewesen sein, die ich höre (Pistols, Siouxsie & the Banshees, Damned, Buzzcocks, Blondie, Stranglers, Abwärts, Hans-A-Plast, Freiwillige Selbstkontrolle, Slime, Swell Maps, Crass, Slits, Der Plan, ZK, Grauzone), die Zeitungen, die ich inhaliere (Spex, Sounds, diverse Fanzines und Comics wie Cobra oder Mad), die Filme, die ich sehe (Blade Runner, Repo Man, Stranger than Paradise, Pankow 95), die Bücher, die ich lese (Bukowski, Brecht, Kazantzakis, Science-Fiction-Dystopien von Stanislav Lem und Isaac Asimov, Biografien über James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, Zeichnungsbücher von Robert Gernhardt und F. K. Waechter). Vielleicht sind wir auch einfach beide Schuld, das Dorf und ich. Ich finde, das Dorf hätte sich ruhig etwas mehr bemühen können. Wenn es geduldiger gewesen wäre, das Dorf, etwas liebevoller und offener, wer weiß, vielleicht würde ich nicht fliehen, vielleicht würde ich irgendwann meinen Platz hier finden, zum Beispiel als der Dorftöpfer (als wenn es sowas noch geben würde). Ich bin froh, dass dieser sprichwörtliche Krug an mir vorüberzieht.
Auf jeden Fall gibt es am Horizont dieses mächtige Glimmen, das mich lockt, ich sehe es nachts und spüre es tagsüber, die Anziehungskraft einer großen fernen Macht — und ich kenne ihren Namen: Hamburg. Speziell: Sankt Pauli — Fixstern der Verrückten. Das ist mein Ziel, meine Hoffnung, meine imaginierte Zukunft. Ich verfolge seit Jahren aufmerksam, was dort passiert, schnappe jede Meldung auf und sortiere sie ein in mein inneres Karteikartensystem der Jugendimpulse. Läden wie das unaussprechbare Bissörsss, die Schlachterei, das Schlaflose Nächte, das Onkel Pö, die Marktstuben, der wichtigste Punkclub Hamburgs — das Totenschiff (auch genannt Krawall 2000), das Versuchsfeld, die Altonaer Fabrik und vor allem die legendäre Markthalle. Bands und Musikerinnen wie Abwärts, Kastrierte Philosophen, Palais Schaumburg, Slime, Geisterfahrer, Andreas Dorau & die Marinas, Ede & die Zimmermänner, Andy Giorbino, Saal 2, überhaupt die ganzen Zickzack-Bands von Alfred Hilsberg — für mich purer und verheißungsvoller Magnetismus, zu mir getragen durch die bereits genannten Zeitungen und »Musik für junge Leute« auf NDR1. Das ist der Szene-Liveticker, die aktuellsten Tagesmeldungen werden von Paul Baskerville und Ruth Rockenschaub überliefert. Dazu der Ruf des Verruchten, den Sankt Pauli verströmt und dessen brackige Note bis zu uns in die Provinz wabert: Kneipen und Kaschemmen, Rotlicht, Kleinkriminalität, Drogen, Verwahrlosung — der ideale Nährboden für einen zukünftig Verkommenen. Denn ich will alles andere sein als sauber, erfolgreich, zukunftsorientiert, eloquent, planbar und planend, zielstrebig und aufwärtsstrebend. Ich will wie Paul Verlaine und Arthur Rimbaud den verdammten Bodensatz schmecken, mich so weit wie möglich hinein und hinunterbewegen, ins Zwielichte, in den Ranz, dorthin, wo Feuchtigkeit und dunkle Wärme merkwürdige Organismen zum Tanzen bringen. Genau wie all die anderen Helden der Musik und Kunstwelt, die ich verehre. Die Kunst wächst nicht auf sauberem Boden, denke ich mir. Du musst dich dem Dreck, den Stürmen, den Gefahren des Seins aussetzen, um etwas vom Leben zu begreifen, um etwas erzählen zu können. Du musst Narben sammeln, bevor du wirklich berichten kannst. Denke ich mir. Und das tu ich auch, mein Körper ist übersät mit Narben und jedes Wochenende kommen neue hinzu. Orden der Wildheit. In »Alexis Sorbas« hab ich gelesen, dass Sorbas selbst die Brust voller Narben trug, sein Rücken aber glatt wie Babyhaut war. Das beweist, dass er nie flüchtete, sondern sich jedem Kampf stellte. Diese Szene hat mich ungemein beeindruckt. So wie Sorbas will ich werden, wenn ich alt bin. Wenn ich überhaupt alt werde. Denn ich will ja eigentlich gar nicht älter als dreißig werden. Allein der Gedanke erscheint mir als frevelhafter Verrat an den Idealen von Punkrock.
Meine Eltern haben mir das alles nicht eingetrichtert, im Gegenteil, sie versuchten mich so gerade und formvollendet wie möglich in die Welt zu entlassen. Allein — es gelang ihnen nicht, zum Glück, denn ich suche die Unvollkommenheit und die Verwegenheit, sie gehören zum guten Ton unserer jungen, heißen Zukunft.
Beim Zusammenpacken versucht Vater Mutter immer wieder zu beruhigen, hält sich selber jovial zurück, trägt meine wenigen Umzugskartons schweigend und stoisch zu dem grünen Volvo auf dem Hof. Er hat auf seine ruhige Weise beschlossen, mich und meinen Bruder gehen zu lassen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine riesige Erleichterung, dass wir endlich verschwinden. Dass er sich endlich wieder den Dingen zuwenden kann, die ihn eigentlich interessieren, nach diesem 20-jährigen Umweg, zu dem ihn Mutter gezwungen hat. Denn er ist gegen seinen Willen Lehrer geworden, hat diesen anstrengenden Beruf ausgehalten, weil er die Familie ernähren musste. Weil er uns Blagen durchbringen musste. Eigentlich hatte er andere Pläne für sein Leben. Eigentlich wollte er ein künstlerisches Leben. Vielleicht wird dieses Leben ja nun doch noch beginnen. Vielleicht kann er endlich anfangen zu schreiben und zu komponieren. Und die Fotografie wiederaufnehmen. Und die Holzarbeiten. Ich wünsche es ihm. Ich jedenfalls werde seine Fehler nicht wiederholen. Ich werde mich nicht zum Untergebenen machen lassen, weder zum Sklaven der Familie noch irgendeiner Firma, Religion oder Staatsstruktur, das schwöre ich hiermit feierlich!
Ich durchsuche das Haus noch einmal nach den Relikten meiner Jugend. Was muss ich mitnehmen? Wichtig sind mir sowieso nur die paar Platten, Kassetten, Bücher und selbstgeschneiderten Klamotten, sonst besitze ich ja nichts. Und Mutters rote Wollmütze, ich stecke sie in meinen Rucksack.
Als ich schließlich fertig gepackt habe, fahren die beiden mit mir nach Hamburg, um mich dem Abgrund zu übergeben, den Mutter dort imaginiert. Sie redet die ganze Fahrt über von der Gewalt auf Sankt Pauli. Von den Kiezmorden, die seit Monaten die Geschichten über diesen Stadtteil dominieren. Dass ich aufpassen soll, mich von dort fernhalten soll. Ja, ja, mach ich, keine Sorge, ich setze keinen Fuß nach Sankt Pauli rein, niemals, klar, sicher, ist abgemacht. Jetzt muss auch sie lachen. Für Mutter muss diese Fahrt ein Grauen sein, der Abschluss des Hauptkapitels ihres Lebens, ihr Wunsch nach einer eigenen glücklichen Familie ist ausgelebt und verblasst nun. Ich bin eines ihrer zwei Meisterstücke, in mir kommt ihr ganzes Sein, Können und Wollen zum Tragen. Ich bin ihre Fortsetzung und ihre Zukunft, sie hat mich — ganz Mutter Frankenstein — in unendlicher Fleißarbeit ersonnen, erbastelt und zusammengesetzt und nun soll sie mich — ihr filigranes Lebenswerk — einfach in jener großen, wüsten, zerstörerischen Stadt an einer Straßenecke abstellen? Völlig irrer Gedanke, nach nur einer Nacht werde ich vermutlich zertrampelt und zerstört sein, denkt sie. Nicht zu unrecht.
Ankunft im Paradies
Ich hab es in Hamburg zusammen mit Uta — einer guten Freundin vom Land — geschafft, eine Wohnung zu ergattern, im Schanzenviertel, einem heruntergekommenen, kleinbürgerlichen Viertel neben Sankt Pauli, in dem viele Arbeiter aus dem Schlachtgewerbe, ausländische Mitbürger und weniger wohlhabende Menschen leben. Einzig im Schulterblatt gibt es ein paar billige Restaurants und Kneipen und am Pferdemarkt zwei Diskotheken.
Unsere Wohnung ist ein Loch in der Kampstraße, einer kleinen Zubringerstraße des Schlachthofes, im vierten Stock mit drei kleinen Zimmern, einer winzigen Küche und einem schachtartigen Bad mit Badewanne, über der ein riesiger alter gusseiserner Elektroboiler hängt, der aussieht, als könnte er uns jederzeit beim Baden erschlagen. Wie ein fettes, klumpiges Damoklesschwert hängt er da, wie eine Bombe, bereit, diese Wohnung und dieses Sein sofort zu zerfetzen, Little Fat Man, festgefroren in einer Zeitschlaufe direkt über der Wanne, eine Sekunde vor der Detonation.
Der Boden ist mit dreckigen Plastikteppichen verklebt, die Fenster und Türen schließen nicht richtig, es gibt kein Warmwasser und die ganze Wohnung stinkt nach diffusem Zerfall. Sie kostet einhundert Mark pro Monat. Für uns ist dieser Platz das Paradies, wir sind so glücklich, endlich unsere eigene Plattform in der Welt gefunden zu haben.
Tagelang renovieren wir, reißen die alten Tapeten und Teppiche raus, streichen die ganze Wohnung neu und richten sie spärlich ein mit dem wenigen, das wir besitzen. Unser Soundtrack dazu sind die Buzzcocks, Uta — kluge, junge Intellektuelle mit Wildheit und Stil — hat die strenge Regel ausgegeben, dass in dieser Wohnung bis auf Weiteres nur diese eine englische Punkband gehört werden darf, und ich denke nicht daran, ihr zu widersprechen. Immer und immer wieder »Everybody’s happy nowadays«, offene Fenster, der süßliche Duft aus der gegenüberliegenden Hermann Laue Ketchup-Fabrik in der sommerlich warmen Luft, Farbe auf den Wänden, dem Quast und meiner nackten Haut.
Meine Geliebte Frenchy lebt bereits seit einiger Zeit in Hamburg. Sie ist vor mir vom Dorf hergezogen, wollte die Enge und Beschränktheit der Provinz hinter sich lassen, in Hamburg russische Literatur studieren, in die Kunstwelt eintauchen, sich selber in der Stadt neu entdecken. Neben dem Studium arbeitet sie in Nachtkulturinstitutionen wie der »Großen Freiheit 36«. Sie ist mein Ankerpunkt, mein Ruhepol, und ich bin sehr froh, sie in Hamburg zu wissen, ich selbst habe ja keine Ahnung vom Leben in der Großstadt. Dennoch erscheint es mir wichtig, eine eigene Wohnung als Startpunkt für die Eroberung der Welt zu bewohnen, und die Kampstraße ist der ideale Platz dafür, genau im Zentrum der Stadt gelegen, im Schlagschatten des Fernsehturmes, auf den ich jede Nacht von meinem Bett aus starre. Auch hier wieder ein verheißungsvolles Symbol: der Turm vor dem schwarzen Himmel, groß, alles überragend, strahlend, blinkend und vor allem die ganze Zeit sendend — Funkturm will ich werden, überlege ich mir, ein menschlicher Sender, der alle Menschen erreicht.
Ständig schneien Leute bei uns herein, all unsere alten Freunde vom Dorf, die bereits in die Großstadt vorausgeeilt sind, machen ihre Aufwartung, ihre Antrittsbesuche, um zu schauen, wie wir leben, einige beneiden uns für den Glückstreffer, den wir mit unserem Schrottloch gelandet haben. Ich habe den Flur mit Marvel Comics ausgeklebt, der Silver Surfer ist meine Galionsfigur, so einsam wie er will ich vom Mond auf die Erde hinunter starren, um hin und wieder hinab zu surfen und den Menschen zu helfen. Mit Punkrock und Liebe. Das eine darf vom anderen nichts wissen, aber ich arbeite mit beiden.
Nachts erforsche ich unser weiteres Lebensumfeld, lasse mich durch die Kneipen des Viertels treiben, wandere über den Pferdemarkt hinein nach Sankt Pauli, den Nukleus der Wildheit, Mutters »Gefahrengebiet«. Diese Stadt, oder besser ihr Zentrum ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Etwas Warmes, Versöhnliches liegt in der Kaputtheit, etwas, das zu mir sagt: Hier kannst du genauso sein, wie du bist, du musst dich nicht verstellen, niemand beobachtet dich, beurteilt dich, lauert in Ligusterhecken auf dich, um dich zu verfluchen. Im Gegenteil, du bist den Leuten egal, einer von vielen Spinnern. Aber wenn du Freunde suchst, findest du sie an jeder Straßenecke! Denn all die anderen hoffnungslosen Versager und Nichtfunktionierer aus all den anderen spießigen Dörfern werden ebenfalls an dieser Küste angespült, der Goldküste der Idioten. Sankt Pauli ist das schwarze Loch, das uns verschluckt und in dem wir uns verstecken, der Treibsand, in dem wir abtauchen, hier verlieren sich unsere Spuren aus der Welt der Bürgerlichkeit im Diffusen. Ich will schlichtweg nicht mehr feststellbar sein von der Welt meiner Eltern, von den Erwachsenen, den Behörden, der Polizei, dem Staat. Ich will nicht heranziehbar sein für Ideen, Dienste und Aufgaben, die nicht meiner Lebensvision entsprechen. Ich wechsele mein Aussehen, meinen Namen und meinen Beruf, ich verpuppe mich und werde zu einem eisernen Schmetterling! Ich will verschollen sein. So verschollen wie Rimbaud, als er mit 19 Jahren die Pfade der bekannten Welt verließ und im Nebel der Geschichte verschwand. Lasst mich verschollen sein!
In den ersten Wochen habe ich wenig Geld, ich lebe von den spärlichen Almosen, die Mutter mir hinterlassen hat. Ich mache mir keine Sorgen, ich brauche nicht viel. Als mein Geld aufgebraucht ist, ernähre ich mich tagelang von Kabapulver, das ich trocken und löffelweise aus der Packung esse, das reicht mir. Außerdem steht der Zivildienst in Aussicht und ich weiß, dass ich dort schon bald mehr Geld verdienen werde, als ich je besessen habe, über tausend Mark jeden Monat, ich bin ein gemachter Mann! Ich habe mich beim HSV beworben, also beim »Hamburger Spastiker Verein« und man hat mir eine Stelle in Finkenwerder, südlich der Elbe, in Aussicht gestellt.
Aber eines nach dem anderen, zuerst geht es darum, die Stadt kennenzulernen, sich vorzustellen, die wichtigsten Läden — die ich aus »Musik für junge Leute« kenne — zu checken, zu verstehen, wen man treffen muss, um irgendwann zur In-Crowd zu gehören, dem erlesenen Klüngel von Leuten, die der Stadt ihren mystischen Glanz verleihen. Es gibt verschiedene Szenen in der Stadt, in die ich eintauchen kann, so viel hab ich schon begriffen. Zum einen gibt es die alte Welt des Hamburger Punkrock, die ihre Hauptspielorte in der Hafenstraße, im Totenschiff, in den Marktstuben, der Fabrik und der Markthalle haben. Zum anderen die neue Welt der Zickzack Bands und Experimentalmusiker/innen, die sich zwischen Noise und Kunst ein eigenes Universum erschaffen, eher beheimatet im Subito/ehemals Schlaflose Nächte, im Versuchsfeld oder im Bisörsss. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Szene der Profimucker, die für ein paar Jahre verunsichert in die zweite Reihe zurücktreten mussten, als die Musikexplosion der frühen Achtziger alles Alte hinwegfegte. Die aber nun zurückkehren und den Revolutionär/innen nachhaltig zeigen, wo der Barthel den Most holt. Mit anderen Worten: Die »Neue Deutsche Welle« ist nichts anderes als der Gestus der Frühachtziger-Experimental-Bands mit dem Können der erfahrenen Profimucker. Daraus ergibt sich ein hochspackiger Sound auf gleichzeitig professionellem Hifi-Niveau — wenn Sie (meine bereits älteren Leser in der fernen Zukunft) wissen, was ich meine.
Ich gehe meistens ins Totenschiff, eine Eckkneipe in der Nähe des Fischmarktes, die als Punkladen umfunktioniert worden ist. Dort treffe ich auf die Mitglieder meiner Lieblingsband — »Die goldenen Zitronen«, in meinen Augen die spannendste Band des Augenblicks. Schorsch, den blondgefärbten Sänger, der am liebsten in Schlafanzügen rumläuft, habe ich über meinen Maler-Freund Daniel in Lütjenburg kennengelernt. Er gehörte zu den Timmendorfer Punks, mit denen wir Lütjenburger uns als »OH Subs« (Ost Holstein Subversives, abgeleitet von UK Subs) verbrüdert fühlen. Schorsch ist einer dieser Typen, denen man sofort ihre naturgegebene Souveränität anmerkt, er steht irgendwie drüber. Schorsch kennt sich mit neuer Musik aus, hat politische Haltung, benimmt sich cool und ist mit einem äußerst speziellen trockenen und schnellen Humor gesegnet. Ted, der Zitronen-Gitarrist, ist ebenfalls blitzgescheit, im Vergleich zu Schorsch allerdings scharfzüngiger und anarchistischer, und wenn er jemanden mag, sich für einen Menschen begeistert, fühlt sich diese Person dadurch angehoben und energieerfüllt. Die beiden haben sich in den letzten Wochen meiner angenommen, ab und an übernachte ich in der Wohnung des Ted in der Buttstraße, gleich neben dem Totenschiff. Wenn wir abends in die Kneipe rübergehen, treffen wir einige der wichtigsten Musiker meines Lebens, zu denen ich bisher nur in ehrfürchtiger Verehrung aus der dörflichen Ferne aufgeschaut habe. Speziell Abwärts und Slime waren die deutschen Punkbands, die ich in der Provinz am häufigsten gehört habe und die meine Gedanken und Gefühle — ähnlich wie die Fehlfarben — auf den Punkt brachten. Und nun stehe ich auf einmal zwischen den legendären Sängern dieser Bands und diversen anderen Szenegrößen und alle trinken billiges norddeutsches Bier mit mir und behandeln mich aus unerfindlichen Gründen wie ihresgleichen. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Vor einigen Monaten hab ich mir zu Hause auf dem Land noch ausgemalt, wie diese Menschen wohl sind. Habe ihre Fotos auf den Plattencovern studiert und sie mir als strenge, erhabene, überlebensgroße Matadore vorgestellt, als steinharte Lederpunks und Politkämpfer, eine Art RAF der Musikszene, unbestechlich und unansprechbar stolz. Niemals konnte ich sie mir als normale Menschen vorstellen, mit denen man reden und lachen kann, die vielleicht sogar kritisierbar sind.
Das ist das Gute am Punkrock — man findet in jeder Stadt Gleichgesinnte, die einen vorurteilsfrei aufnehmen, es gibt keine Hierarchien, keine Helden und Idole, alle tun zumindest so, als ob sie gleich seien.
Häufig ziehe ich vom Totenschiff aus zu Fuß über den Kiez nach Hause in die Schanze, so auch vor kurzem, in einer Sommernacht dieses Jahres. Freund Fliegevogel ist vom Dorf gekommen, um mich zu besuchen, und gemeinsam haben wir ein paar Stunden im Totenschiff verbracht. Eine Punk Lady namens »Trümmer-Martha«, die in ihren zerrissenen Nachkriegsklamotten ziemlich verwegen aussieht, begleitet uns zurück in die Schanze. Auf dem Marsch fragt sie uns beiläufig, ob wir schon mal »blank gezogen hätten«? Ob wir schon mal einen »exhibitionistischen Einsatz« vollführt hätten? Auf unser Unverständnis hin erklärt sie uns, dass sie unter ihrem langen Ledermantel häufig einfach nichts trägt, dass das erfrischend und bisweilen auch erregend sei, und zum Beweis öffnet sie ihren Mantel und ist darunter nackt. Fliegevogel und ich sind spontan begeistert und beschließen, es ihr gleichzutun. In meiner Wohnung fliegen alle Klamotten bis auf Strümpfe und Schuhe in die Ecke und ich kleide uns mit langen Mänteln ein. So ziehen wir zu dritt durchs nächtliche Viertel, stellen uns in Kneipen, ordern Drinks, und im geeigneten Moment, auf das Zeichen Trümmer-Marthas hin — werden die Mäntel geöffnet. Als Männer hätten wir uns das niemals erlauben können, aber in Begleitung und unter Marthas Schutz ist das etwas anderes, man starrt uns ungläubig und auch belustigt an und einige Beobachter sind so angetan, dass sie sofort nachziehen. So taumelt schließlich eine kleine Traube Halbnackter durch das Viertel, um ständig und zu jedem Anlass die Mäntel zu öffnen, der Effekt hat einen hohen Ansteckungsfaktor.
Wenn ich nicht unterwegs bin oder mich anschließend von einem mehr oder weniger schweren Kater erhole, sitze ich zu Hause, um zu »arbeiten«. Was man so »arbeiten« nennt. Zwar erscheint das Wort »Arbeit« unpassend, aber das Komponieren von abwegiger Musik, das Erschaffen von Texten für diese Stücke ist ja auch »Arbeit«, selbst wenn mir das Wort genauso unsympathisch erscheint wie das Wort »Hobby«. Diese Tätigkeiten sind einfach ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Alles ist selbstgewählt und selbsterschaffen, wir sind reine DIY-Wesen, wir bestehen aus selbstproduzierter Kleidung, Phantasienamen und aus unserer eigenen Kunst, nichts ist vorgefertigt oder kommt von der Stange, das haben uns Malcom McLaren und Vivienne Westwood sorgfältig eingebläut.
SEI, WAS DU TUST.TU NICHTS, WAS DU NICHT SEIN WILLST.
Ich sitze häufig in meinem Zimmer auf dem himmelblau lackierten Fußboden und suche nach guten Akkorden und Melodien auf meiner Akustikgitarre. Ich würde ein Himmelreich für einen Mehrspurrekorder geben, aber so ein Konstrukt ist schlicht unbezahlbar, kostet mehrere Hundert Mark und meine Rücklagen tendieren schlichtweg gen Null.
Um in Punkkreisen nicht einfach der nächste Shouter zu sein, der gegen Gesellschaft und Staat anbrüllt, hab ich mir ein eigenes Showkonzept überlegt: Ich möchte als eine Art junger Kollege von Elvis Presley aus Las Vegas angeliefert worden sein, mit glamourösem Showanzug und strassbesetztem Sombrero, um mit englischem Slang selbstgeschriebene deutsche Schlager zu singen. Dazu muss ich sagen, dass ich persönlich überhaupt gar keinen Schlager höre, er interessiert mich auch nicht, höchstens wegen seiner Klischees, wegen seiner Glattheit und Verlogenheit, das trifft einen Nerv meines Humors. Ich schreibe also Schlagersongs, nicht weil ich sie liebe, sondern weil ich es kann, diese Art von Formeln bilden sich ganz von selbst in mir und tauchen auf wie die Gärblasen an der Oberfläche eines Güllesees.
Abendrot — ohoho
Manuela ist schon lange tot — ohoho
Eine Träne findet ihren Weg
Grüß Manuela von mir — grüß sie von mir
Zumindest in Punkkreisen ist die Kontroverse gesetzt — was soll das? Darf der das? Verstößt das nicht gegen alle Regeln des schlechten Geschmacks? Man muss dazu sagen, dass die Punkregeln noch strenger sind als die Spießerregeln: Kleider und Sprachcodes, Benimmformen, Hierarchien, alles eins zu eins gespiegelt — in Müll. Und wegen der eigenen Punk-Spießigkeit hat sich ein Satellit vom Mutterplanet Punk gelöst: Funpunk. Die Bands dieser neuen Form empfinden sich zwar auch als antibürgerlich und politisch, aber auch als hedonistisch, es geht darum, die verrosteten Fesseln des Hardcore und der Political Correctness zu sprengen und so etwas wie Freude in die Anarchie zurückzutragen. Da ich selbst ein schlechter Punksänger bin, versuche ich, den Nimbus des Funpunk mit dem Glam amerikanischer Showstars und dem in Punkkreisen provozierenden Gestus des deutschen Schlagers zu koppeln. Ab und zu drängen mich meine Freunde von den Zitronen dazu, in den Punkläden in der Hafenstraße nachts auf den Tisch zu springen und einen meiner Songs zum Besten zu geben, was ich auch tue. Eine Hälfte der Anwesenden johlt mir begeistert zu, während die andere sich genervt abwendet oder darüber debattiert, ob man mich nicht einfach von der Bühne prügeln kann. Ich singe, dass man sich »Liebe nicht kaufen kann« und die Hardcore Punks im Hintergrund skandieren »Aufhörn!«, »Holt das Schlagerschwein da runter!«, »chauvinistische Spießersau!« Die Aufregung ist groß — in diesen Jahren ist alles politisch und wird debattiert, ein falsches Wort bringt dich auf unterschiedlichste Abschusslisten und ich habe anfangs keine Ahnung vom Sprachkanon und den Benimmregeln dieser strengen Welt. Die Zitronen allerdings und mein Malerfreund Daniel sprechen mir zu, vielleicht auch, weil sie sich insgeheim und klammheimlich über den Ärger freuten, den mein planloser Auftritt verursachen wird. Nach einem meiner Auftritte gibt es eine Debatte, in der sich Politleute über das angeblich reaktionäre Weltbild meiner Texte aufregen.
Die Zitronen haben mir versprochen, mich als »Vorband« mit auf Tournee zu nehmen. Man will mich sogar mit dem Chef des sogenannten Weserlabels, auf dem die Zitronen ihre Platten veröffentlichen, bekannt machen. Fabsi, ehemaliger Drummer von ZK, der Band, aus der die Toten Hosen hervorgegangen sind, wird bald nach Hamburg kommen. Zu diesem Anlass will man ein Treffen zwischen ihm und mir arrangieren. Das sind unglaubliche Versprechungen für mich, schließlich sind die Zitronen gerade DIE Shooting Stars am deutschen Funpunkhimmel. Mit ihnen touren zu dürfen, wäre mehr als nur eine Auszeichnung. Aber darüber hinaus auch noch den Ex-Drummer von ZK kennenlernen zu können, dem Vernehmen nach mittlerweile ein mächtiger Plattenboss, und womöglich bei ihm eine Platte herausbringen zu können — völlig undenkbar!
Kurze Zeit später kommt Fabsi tatsächlich nach Hamburg und wir treffen uns nachts mit den Zitronen im Totenschiff. Fabsi ist deutlich älter als wir, vielleicht schon Mitte dreißig, aber gekleidet nach modernster Funpunk-Manier: Schlafanzughose, Rüschenhemd, zerfetzter Mantel, blau gefärbte Haare und er spricht einen schweren Düsseldorfer Dialekt. Er bittet mich in seinen roten VW-Bus vor der Tür und dort spiele ich ihm ein paar meiner Songs vom Tape vor. Fabsi ist begeistert, erkennt mein angeblich brachliegendes Talent, seine Aufregung ist ihm durch einen sehr eigentümlichen Tick anzumerken, alle paar Sekunden fährt er sich mit der rechten Hand zum Mund und bläst einen imaginären Kugelschreiber in seinen Fingern an.
Hömma Jung, dat is ja der Knaller, hömma, disch bring wa ganz groß raus, dat wird der Hit, hömma! — Fffffft.
Es wird beschlossen, dass ich eine Single aufnehme, demnächst, hier in einem Studio in Hamburg, Fabsi will sie auf seinem Weserlabel veröffentlichen und promoten und dann wird eine unglaubliche Karriere beginnen, ich werde schon sehen:
Dat wird der Knaller — Fffffft, hömma du Schellenprinz! Jetzt musse bloß noch überlegen, welscher Name uff dem Plakat steht. Roddy Dangerblood find isch nid so prall, dat is doch kein Showname von einem, der us Las Vegas kommt, hömma — Fffffft!
Ich spüre intuitiv, dass er recht hat.
Freiheit oder Sicherheit, das ist hier die Frage
An einem kühlen Frühsommertag des Jahres ’86 beginne ich meinen Zivildienst in Finkenwerder. Ich fahre am frühen Morgen, bekleidet mit einem alten, dicken Salz-und-Pfeffer-Mantel meines Vaters und der roten Strickmütze von Mutter, auf der Fähre über die bleigraue und müde schlingernde Elbe in den südlich des Flusses gelegenen Stadtteil. Rentnerghetto. Drumherum Obstplantagen und Flugzeugbauer, über viele Kilometer nichts als Apfelbäume, Zigtausende, in Reih und Glied, ein gigantisches Apfelbaumheer, bereit, ganz Nordeuropa zu unterjochen. Nichts für Punks aus der Großstadt. Auch nicht für Dorfpunks. Nichts für junge Leute. Eigentlich hätte ich gerne eine Stellung in einer der innenstädtischen Einrichtungen des HSV, also des »Hamburger Spastiker Vereins«, angetreten, dort lebt man nach Freundesaussagen ein fürstliches Leben, kurze Arbeitswege, einfache Aufgaben, die Insassen sind pflegeleicht und brauchen kaum Unterstützung, extraordinäre Versorgung ist garantiert, da die Kassen gut gefüllt sind und man die Einkäufe selber bestimmen darf, also werden im »Nobel-Spar« am Großen Burstah nur die feinsten Waren vom Wursttresen geholt: Lachsschinken, Krabbensalat, italienische Salami. In Finkenwerder ist das alles anders, der Bau, an dem ich morgens um acht klingele, ist ein grober, schmuckloser Fünfziger-Jahre-Klotz mit breiter Rollstuhlrampe. In dem Komplex sind auf zwei Etagen Schwerstbehinderte untergebracht. Ein alter Mann in grauem Anzug und mit starrem Gesicht, den ich nach dem Weg zur Einrichtung fragte, meckerte in breitem Missingsch:
De Behinderten? Dor vörn in den Idiotenbunker sind de.
Seine Frau, des Hochdeutschen mächtig, setzte hinzu:
Den gesamten genetischen Ballast von Hamburg hebt se hierher verklappt! Dafür sind se sich in der Stadt zu fein, nich?
Ich lande auf der oberen Etage in einer kleinen Betreuergruppe, wir haben sechs Pflegefälle mit unterschiedlich schwersten Behinderungen zu umsorgen. Peter zum Beispiel hat Gehirnschwund, bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr konnte er nahezu normal und selbstbestimmt leben, dann aber begann sein Gehirn sich durch eine seltene Krankheit aufzulösen. Von seiner Persönlichkeit ist kaum noch etwas zu spüren, meist sitzt er müde in seinem Sessel und stiert auf den Boden, bis es etwas zu essen gibt. Das Einzige, was er noch sagen kann, ist »Den Mist!« Sobald man aber eine Heinz-Erhardt-Kassette einlegt, erwacht Peter zum Leben, sein Körper strafft sich, er richtet sich auf, die Augen beginnen zu glänzen und er fängt an — genau an den richtigen und besten Stellen —, herzhaft und laut zu lachen. Er prustet und wiederholt die Pointen und wir Betreuer fallen mit ins Lachen ein, bis wir alle zusammen Tränen in den Augen haben. Wenn der Witz vorbei ist, sackt Peter wieder in sich zusammen und wir mit ihm. Den Mist! Sein innerster Wesenskern, den die Krankheit noch nicht zerstören konnte, ist sein Humor. Wenn der Witz doch bloß nie aufhören würde!
Es befindet sich ein weiterer, bereits etwas älterer Punk in der Betreuergruppe, er hat mich unter seine zerfledderten Fittiche genommen und mir alles Notwendige beigebracht, vor allem erklärt er mir die Charaktere der Pflegefälle, ihre Nöte und Vorlieben, die Abläufe und Strukturen der Einrichtung. Immer wieder wird unser Gespräch unterbrochen von den gutturalen Schreien der Insassen, ich komme mir vor wie bei »Einer flog über das Kuckucksnest«. Als erster Dienst wurde mir von meinem Punklehrer aufgetragen, die Scheiße von den Wänden des Autistenzimmers zu waschen, eine würdige und passende Aufgabe.
Als ich am Abend nach dem anstrengenden ersten Tag mit der Fähre nach Hause fahre, begreife ich, dass meine so heiß ersehnte Freiheit nach den neun vergurkten Schuljahren und den drei einsamen Jahren Töpferlehre in Plön schon wieder vorbei ist. Auf nichts habe ich mich mehr gefreut, als endlich selber über meinen Tag und mein Handeln bestimmen zu können, nie wieder wollte ich etwas tun müssen, was sich andere für mich ausgedacht haben, ich wollte als freier Mann in einer freien Stadt leben, aber genau das soll mir jetzt erneut versagt bleiben. Wer hat das Recht, mich dazu zu zwingen? Wer hat die Macht, mich derart zu demütigen? Nur einer ist stark genug dafür — Vater Staat. Der mich noch lieber in die Armee gesteckt hätte. Wenigstens bezahlt er mich gut. Zum ersten Mal werde ich einen ernstzunehmenden Lohn nach Hause tragen, das Vierfache meines jämmerlichen Töpferlohns, mich erwarten monatlich 1100 Mark. Die Zeit der Schnorrerei ist vorbei, keine verächtlich herablassenden Blicke von Freunden mehr, wenn ich am Tresen schon zu Beginn des Abends blank bin. Ich werde mir Bier leisten können, Brot und Nudeln und sogar eigene Zigaretten. Ich werde ein eigenes Bankkonto besitzen, auf dem wie von Zauberhand neues Geld eintrifft, fast schon ein Tim-Thaler-Leben. Willkommen in der Erwachsenenwelt. Freiheit oder Sicherheit sind die Ufer, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Beides zusammen gibt es angeblich nicht.