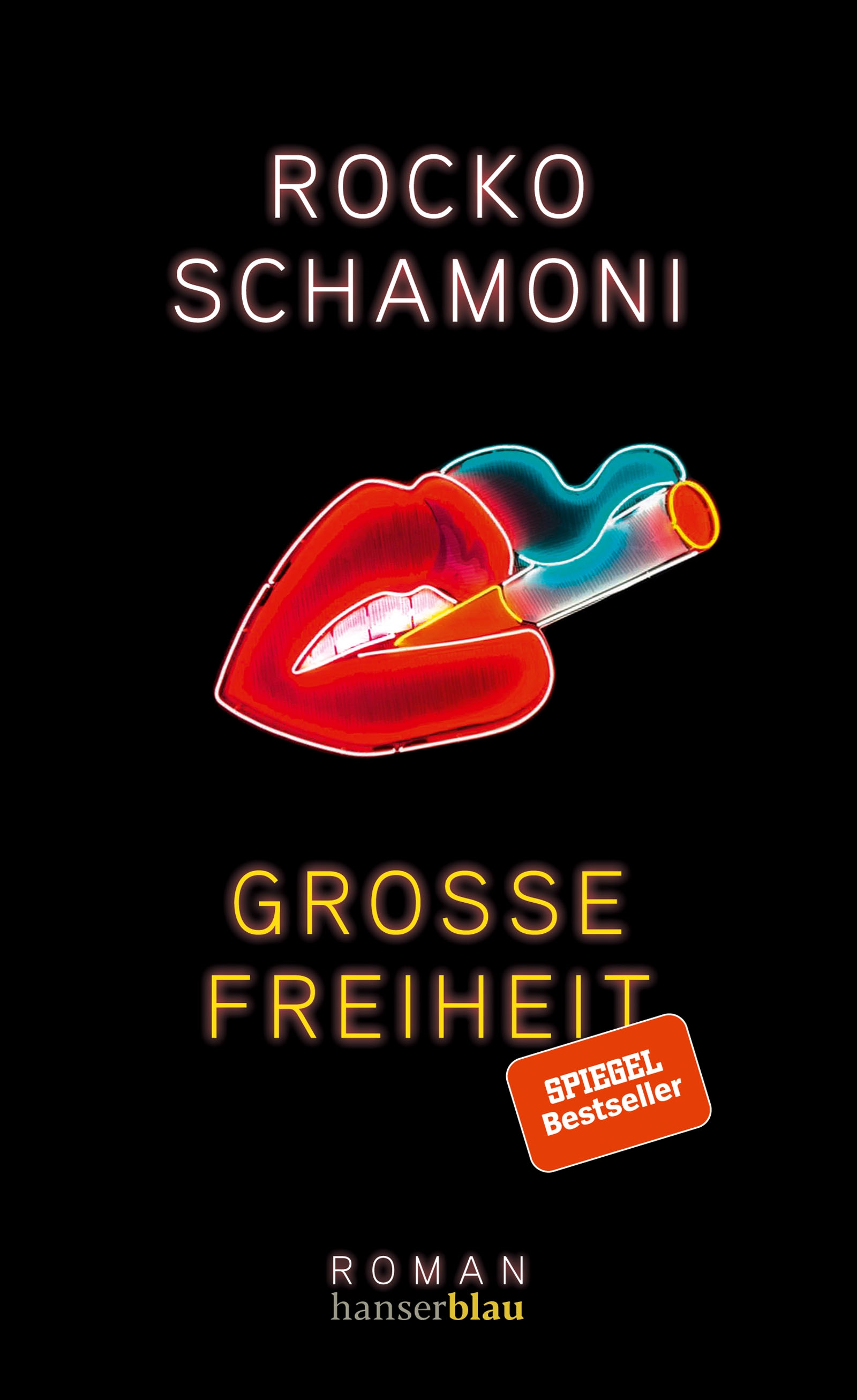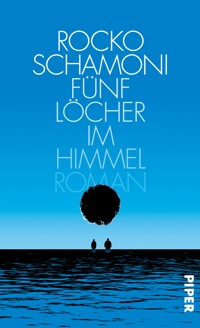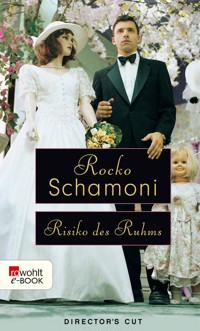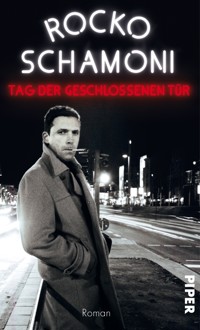
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unbeirrt treibt Michael Sonntag durch seine Tage, sein Körper zeigt erste Gebrauchsspuren, und die großen Gedanken machen gewöhnlich einen Bogen um ihn. Entgegen der Erwartungen, die seine Umwelt an ihn stellt, verweigert Sonntag gern jede daseinserhaltende Tätigkeit. Nur seinem Freund Novak gelingt es hin und wieder, ihn mit hirnrissigen Geschäftsideen aus der Reserve zu locken. Und natürlich Marion Vossreuther, der Servicekraft aus dem Handy-Laden, die einen ganz eigenen Reiz auf ihn ausübt. Entschlossen geht Rocko Schamonis Held Michael Sonntag den Erfordernissen des Lebens aus dem Weg. Und dabei fordert der Irrsinn unserer Existenz seine Unerschrockenheit und seinen Witz öfter heraus, als ihm lieb sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für alle schmutzigen Heiligen
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-05421-8
© Piper Verlag GmbH, München 2011
Umschlaggestaltung: Felix Schlüter, typeholics.de
Umschlagfotografie: Dorle Bahlburg
Ein weites steinernes Feld
Inmitten der Stadt liegt ein weites steinernes Feld. Der Boden ist geteert, an anderen Stellen gepflastert, Gullis und Laternen unterbrechen die ebene Fläche. Ein paar Autos parken dort und ein Laster. Eine Plastiktüte wird vom warmen Sommerwind über den Platz getrieben. Der Himmel leuchtet in einem milden Mittagsblau, die wenigen Wolken können die Sonnenstrahlen nicht aufhalten, sie treffen mich, während ich langsam über den Platz wandere, und laden mich auf mit Energie, mit Wärme und Mut. Ich atme tief durch und spüre, wie sich die Elemente des Lebens in mir vereinen. Luft und Licht. Ich erreiche die Mitte des Platzes, und da ich kein Ziel habe, bleibe ich unvermittelt stehen und schaue mich um. Weit reicht mein Blick, Hunderte von Metern vor mir begrenzen Bäume, Hecken und Straßen das Heiligengeistfeld. Ich drehe mich langsam um die eigene Achse, und auf einmal löst sich eine leere Blase in mir, ein Vakuum breitet sich aus, und jeglicher Bewegungsimpuls kommt mir abhanden. Wohin soll ich gehen, wenn ich doch überall hingehen könnte? Alle Ziele könnte ich ansteuern, Freunde, Läden, Orte, die mir etwas bedeuten oder meiner Bewegung eine Ordnung verleihen könnten, allein ich kann mich nicht entscheiden, jedes dieser Ziele wäre gleich gut, aber keines hebt sich unter den anderen hervor. Dieses Gefühl ist sehr unangenehm. Ratlos lasse ich mich auf den Boden sinken und warte. Gesichter von Freunden und Namen von Orten laufen durch meinen Geist, aber nichts tut sich, keiner meiner Gedanken nimmt eine klare Form an oder erscheint mir von großer Priorität. Mein Zustand nimmt eine zwanghafte Form an, ich will hier nicht sitzen bleiben, aber je mehr ich mich zu einer Entscheidung dränge, desto unmöglicher scheint sie mir. Sollte ich aufstehen und einfach aufs Geratewohl losmarschieren? Sollte ich der Tüte folgen, die in einigen Metern Entfernung kullernd an mir vorbeigetrieben wird? Diese Idee erscheint mir Anlass genug, ich raffe mich auf und folge der Tüte langsam mit etwas Abstand, damit anderen Menschen, die mich eventuell beobachten könnten, nicht auffällt, was ich hier treibe. Nach ein paar Metern bleibt die Tüte liegen, also bleibe ich ebenfalls stehen und schaue mich verschämt um. Wie kann man nur so planlos sein? Schuld baut sich in mir auf. Schuld wegen meiner Antriebslosigkeit, meiner Unentschlossenheit, meiner Ausgeliefertheit. Schuld wegen meiner Schwäche. Die Tüte treibt weiter, überschlägt sich, ändert die Richtung und bewegt sich nun in die entgegengesetzte Richtung voran. Ich drehe mich um und laufe wie zufällig vor ihr her. Sie biegt nach links ab, also bleibe ich stehen und trotte ihr schließlich hinterher. Der laue Sommerwind ändert immer wieder seine Richtung, und weder die Tüte noch ich kommen einer Seite des Platzes auch nur ein Stück näher. Vor mir lehnt eine zusammengesackte Gestalt an einem Altglascontainer und mustert mich reglos. Meine Scham wird größer. Alles, was ich tun könnte, wäre, zurück zur Platzmitte zu gehen und mich wieder zu setzen. Das ist allerdings noch schwächer, als der Tüte zu folgen, also setzt sich unser Tanz fort. Ein Stadtreinigungsfahrzeug kommt zäh mahlend und bürstend über den Platz gefahren. Ich bleibe stehen und schaue auf die Uhr. Der Fahrer kehrt alte Dosen, Plastikfetzen und Müll auf. Schließlich trifft er auf meine Tüte und wischt sie mit seinen Bürsten in den Bauch des Fahrzeugs. Der Fahrer beäugt mich im Vorbeifahren. Ich schaue verlegen auf meine Uhr, als gäbe es dort einen Halt. Was soll ich tun? Da die Tüte jetzt in dem Fahrzeug ist, könnte ich ihm ja folgen. Aber ich muss mich dazu entschließen, bevor es wegfährt. Langsam bewegt es sich zur Ausfahrt des Platzes, von wo ich gekommen bin. Ich folge dem Fahrzeug, und je näher ich dem Rand des Platzes komme, desto mehr Mut und Elan ergreifen mich. An der Ausfahrt löse ich mich von dem Fahrzeug und der Tüte darin und lasse mich erschöpft auf einen Poller sinken. Ich spüre: Ich bin befreit, der Bann ist gebrochen, jetzt kann ich mich wieder normal bewegen. Ich darf diesen verdammten Platz nie wieder betreten! Dieser Platz ist eine Falle. Dabei ist es doch ein so schöner Platz, ein so großer und freier Platz. Die Scham hält mich lange fest, jeder andere Mensch hätte diesen Platz mit einem gelösten Gefühl überqueren können, nur mir ist das nicht vergönnt. Ich spiele mit dem Gedanken, es doch noch mal zu versuchen, spüre aber, dass ich zu schwach bin, und beschließe, lieber den Bürgersteig an der Straße zu benutzen. Was sind das nur für Kräfte, denen ich da ausgesetzt bin? Was sind das für Aufgaben, die mir da gestellt werden, und vor allem: Wer stellt sie mir? Wieso stehen andere vor der gloriosen Aufgabe, den Mount Everest zu besteigen oder die Erde allein in einem Segelboot zu umrunden, und mir wird die kleinste aller Aufgaben zugeschanzt: Überquere einen großen Platz in deiner Stadt – und scheitere daran! Was für eine Diskrepanz. Es gibt Menschen, die so frei sind, dass sie überall hingehen und alles tun können, was sie wollen. Was für ein wundervoller Ort muss die Welt für diese Menschen sein, denn sie können ihn ganz erfahren und begreifen. Ich hingegen kann ihn nur ersehen oder erlesen, denn die meisten Orte werden mir für immer verwehrt bleiben.
Ich gehe langsam den Bürgersteig entlang, hinein ins Viertel, in dem ich wohne, und lasse meinen Blick über die Häuserfassaden streichen, entlang der Fenster, der Eingänge und der Läden, die ihre Waren an den Bürgersteigen ausbreiten. Ich gehe diese Wege seit vielen Jahren. Langsam, aber sicher verändert sich hier alles. Wo sind der Schmutz, die Schäbigkeit geblieben, wo die Schmierereien, der abgeblätterte Putz und die Plakate? All das scheint es nicht mehr zu geben, es ist entfernt worden, herausradiert aus dieser Stadt. Das heilige Schmutzige und die schmutzige Heilige sind verschwunden. Noch vor ein paar Jahren gab es hier leer stehende Häuser und verwilderte Hinterhöfe, in denen Unkraut, Müll und Ratten das Regiment übernommen hatten. Ein altes, löchriges, schönes Gebiss. Aber all die faulen Zähne sind gezogen worden. Die Lücken zwischen den Häusern wurden gefüllt, die maroden abgerissen oder renoviert. Langsam weichen die türkischen Gemüsehändler und die Freaks mit ihren Gerümpelläden und werden ersetzt durch Streetwareshops und Tapasbars.
Ich verfolge all das mit einer stillen Beklommenheit. Denn ich will nicht sagen, dass immer nur das Alte das Bessere wäre, trotzdem verfolgt mich dieser Gedanke im Angesicht der Welt, die da vor mir entsteht, während eine andere versinkt. Ich vermisse das Unnütze hier in diesem Viertel und in der ganzen Stadt immer mehr. Ich liebe das Unnütze, denn schließlich bin ich ein Teil davon. Ich schaffe es einfach nicht, nützlich zu sein, ich habe eine Nützlichkeitsallergie, immer wenn ich etwas tue, an dem ich den Verdacht einer Nützlichkeit wittere, verwelkt in mir der Handlungsimpuls. Ich kann nur die Dinge zu Ende bringen, die keinem direkten Nutzen dienen. Also kann ich auch nicht der Gemeinschaft dienen, sie hat keinen Nutzen an mir. Und ewig höre ich die Worte meiner Mutter in mir nachklingen: Junge, was hat das denn für einen Nutzen? Was bringt dir das denn für einen Nutzen? Welchen Nutzen hat denn das Leben, das du führst? Was nützt das alles? Junge, was nützt das?
Mutter, von deinem Kind soll nie wieder ein Nutzen ausgehen.
Seit über fünfzehn Jahren wohne ich nun in diesem Viertel. Und während ich langsam zu verfallen beginne, während mein Körper erste Abnutzungserscheinungen zeigt, am Gebiss, im Gedärm, an den Gelenken, im Gesicht und natürlich im Gehirn, verjüngen sich das Viertel und seine Bewohner, eine meiner eigenen Entwicklung entgegengesetzte Bewegung. In meinen Enddreißigerjahren bin ich fast doppelt so alt wie die jüngsten Zuzöglinge. Vielleicht sollte ich demnächst von hier wegziehen, in eine Gegend, die meinem Zustand eher entspricht? Irgendwo an den Rand der Stadt, wo alterslose Menschen in gesichtslosen Behausungen wohnen. Wo mein Verfall und meine Nutzlosigkeit in der Gleichförmigkeit untergehen. Ich habe meine Chance gehabt. Jung und nutzlos zu sein ergibt eine sinnige Paarung, aber wenn man älter wird, muss man sich irgendwann für eine Funktion entschieden haben. Du musst dich entschieden haben, für das, was du sein willst in der Gesellschaft der Menschen. Du musst dich entscheiden!
Das habe ich immer noch nicht getan. Man sieht es mir langsam an. Man sieht es mir langsam nicht mehr nach. Es ist nicht so, dass ich mich nicht schon mal festgelegt hätte. Auch für größere Zeiträume. In einem Plattenladen habe ich gearbeitet, für zwei Jahre. Kinovorführer war ich für acht Monate. In Kneipen und Bars habe ich hinter dem Tresen gestanden und Kuchen und Kaffee und Bier und Wein ausgeschenkt. Kolumnen für Zeitungen schreibe ich, und Karten bei Konzerten habe ich abgerissen.
Aber das sind ja alles keine Lebensperspektiven. Wie könnte ich meinen Enkeln erzählen, dass ich ein erfülltes Leben als Kartenabreißer hatte? Lieber kriege ich keine Enkel, als ihnen das berichten zu müssen.
Mit der kleinen Erbschaft, die Großmutter mir vor Kurzem gemacht hat, kann ich auch nur das Gröbste auffangen. Das selbst auferlegte Elend für ein Weilchen aufschieben. Jeden Monat bekomme ich eine magere Pension, ausreichend für meinen Vorruhestand, um noch ein Weilchen in den Sümpfen der Untätigkeit verweilen zu dürfen. Aufschub, um mein wahres Talent zu entdecken. Wenn ich das nicht bald geschafft habe, muss ich mich selber ins Heim einliefern lassen. Erben ist wie sterben, bloß ohne st.
Die Wunderwelt der Entfremdung
Ich finde mich vor einem Supermarkt wieder und spüre, dass ich ihn betreten muss. Immer wenn ich nervös werde, wenn ich mich innerlich unklar oder zerrissen fühle, schaue ich mir Produkte an. Tauche ich ein in die Welt der von Maschinen erzeugten Wunder. In die Wunderwelt der Entfremdung. In die rückverzauberte Welt der Neuzeit. Früher schien die Welt an sich, der Kosmos und das Leben, unerklärlich. Heute sind sie erklärt. Entzaubert. Aber die Produkte, die wir selber herstellen, werfen neue Fragen auf. Nach dem schockierenden Erlebnis auf dem Heiligengeistfeld muss ich mich erden. Ich schlendere sehr langsam an den Regalen vorbei und lasse meinen Gedanken freien Lauf, warte auf ein Produkt, das mich einfängt. Stichwort Margarine. Vitaquell Omega 3. Ich nähere mich dem Stapel und nehme eine Packung in die Hand. Sie gefällt mir gut, klein, rechteckig, formschön, mit weißgelber Plastikhülle und rot-grüner Schrift darauf. Woher mag diese Margarine kommen? Wer hat sie erfunden und warum? Gab es nicht vorher schon genug Margarinen? Und wer war an ihrer Produktion beteiligt, also an dieser konkreten Packung hier in meiner Hand? Aus welchen Materialien ist die Verpackung hergestellt? Und die Farben für den Aufdruck? Wer hat die Aufdruckmaschinen hergestellt und wer die Stanzform für die Margarineverpackung und mit was für Maschinen? Und mit welchen Maschinen wurden wiederum diese Maschinen hergestellt? Eine unendliche Reihe von Maschinen, die wiederum andere Maschinen herstellen. Maschinen, die Arbeiten verrichten, die früher Menschen verrichtet haben. Auf der Verpackung werden die Inhaltsstoffe der Margarine aufgeführt. Rapsöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Palmöl, Palmkernfett, Meeresalgen, Farbstoff, Zitronensaft und Meersalz. Wer hat das Rezept dafür erfunden, und wie konnte er wissen, dass gerade dieses Rezept das richtige ist? Gibt es Forschungszentren, in denen herausgefunden wird, wie gut eine neue Margarine auf den menschlichen Körper wirkt und wie gut sie schmeckt? Wer liefert all die einzelnen Ingredienzen für die Margarine und woher kommen sie? Durch wie viele Hände ging diese Packung Margarine? Kennen diese Menschen sich? Und wie kamen sie auf die Idee, ein Teil des Räderwerks in der Produktion fettarmer Margarine zu werden? Sind das glückliche Menschen? Stellen sie sich die gleichen Fragen wie ich? Werden sie ihren Enkeln erzählen, dass sie ein glückliches, erfülltes Leben in der Margarineproduktion hatten?
Ich könnte Stunden vor diesem Regal mit der Margarine in der Hand verbringen. Und einen Schritt nach rechts setzt sich das Wunder fort. Kakaomilch in Plastikflaschen. Ein rätselhafter Traum. Der Supermarkt ist für mich ein Ort ähnlich dem Deutschen Museum, mit dem Unterschied, dass nichts erklärt wird, sondern nur Fragen aufkommen und Mutmaßungen angestellt werden. Aber das ist ja gerade das Schöne. Die Antworten interessieren mich wie immer viel weniger als die Fragen.
Zurück in meiner Wohnung setze ich mich glücklich vor meinen kleinen Stapel von Einkaufsgütern und versinke in ein ruhiges Betrachten. Andere Leute sitzen zu Hause vor dem Fernseher, ich sitze häufig vor solchen Stapeln und sehe mir die Gegenstände aus der Produktpalette der globalisierten Warenketten an. Die Möglichkeit, für wenig Geld jeden Tag die unterschiedlichsten Nahrungsmittel nach Hause tragen zu dürfen, nicht hungern zu müssen, sich auch noch gut unterhalten zu fühlen. Ich bin dankbar, das muss ich sagen. Ich weiß gar nicht genau, wem eigentlich. Ich beschließe, der Menschheit als Ganzes dankbar zu sein, das scheint mir am gerechtesten. Ist dies etwa nicht das Paradies, nach dem wir so lange gesucht haben? Der Zustand der Vollversorgung – satt am Busen der Gesellschaft.
Ein lebenslanger Vertrag
Deine grünen Augen. Leuchtend grün. Wassergrün. Lichtwassergrün. Feine gelbe Muskelfasern zeichnen sich durch die Iris und versinken mittig in der Schwärze der Pupille. Groß sind sie, diese Augen. Du benutzt nur wenig Schminke. Du brauchst keine Schminke. Glatt ist die Haut, schmal und lang Deine Nase. Die schwarzen Haare hast Du stramm nach hinten gekämmt, ein Zopf hält die Frisur auf Spannung. Du trägst einen dunklen Lippenstift, der Deinen Lippen eine scharfe Kontur verleiht. Dein Gesicht ist perfekt proportioniert. Ich wüsste nicht, wie es ausgewogener sein könnte. Fast schon ein wenig langweilig. Du bist groß. Du trägst einen eleganten schwarzen Hosenanzug, eng anliegend, Du siehst darin sehr sportlich und agil aus, lebendig, hart, trainiert. Marion. Du bist Marion Vossreuther aus dem O2-Handyladen in der Innenstadt. Du trägst ein Schild auf der Brust, auf dem Dein Name steht. Deine sportliche Haltung und die strenge Frisur verleihen Dir eine arrogante Ausstrahlung. Kühl, aufgeräumt und überlegen scheinst Du wirken zu wollen. Du gliederst Dich perfekt ein in die Reihe der glänzenden Objekte Deiner Auslagen. Alles ist hier so glatt und funktional und aseptisch, wie Du es selber auch bist. Meistens stehst Du am Ende des Schachtes, der Dein Geschäft ist, und berätst Kunden, versuchst ihnen Handyverträge zu verkaufen.
Ich habe schon oft hier gestanden und in die Auslagen gestarrt, um immer wieder einen kurzen Blick auf Dich werfen zu können. Ich weiß nicht, ob Du mich schon bemerkt hast. Auch als ich Dir nahe war, als ich Dich um den Prospekt der aktuellen Handys bat und Du ihn mir freundlich in die Hand drücktest. Da entdeckte ich zwischen Deinen Augen auf dem pfenniggroßen Stück Deiner Nasenwurzel noch etwas anderes. Etwas Unmaskiertes, Tieferes, das mich anzog. Eine Sorgenfalte. Ich überlege mir ernsthaft, mir wegen Dir ein Handy zuzulegen. Nur um mit Dir Kontakt zu haben. Das Problem ist, dass dieser Kontakt auf den Moment des Kaufs beschränkt wäre und nicht über die Restlaufzeit des Vertrags, wie ich es mir eigentlich wünschte. Marion. Ich möchte ein Handy kaufen, das nur eine Nummer im Speicher hat – Deine. Weil ich Dich liebe. So wie Du bist. In Deiner ganzen Perfektion und Tristesse. Gib zu, dass sich sonst keiner an Dich heranwagt. Keiner aus Deinem Handyladen, keiner der Kollegen Eurer Company, die Du nach Feierabend triffst, keiner in Deinem Fitnesscenter, höchstens mal einer der Trottel aus dem After-Work-Club. Sie bleiben alle weit hinter Deinen Erwartungen zurück, und das macht Dich einsam. Aber hier hinter der Scheibe stehe ich. Ein großer, starker, dunkelhaariger, freier Mann. Ein Mann mit Geschmack und Anstand, mit Wissen und Kultur. Ein Mann mit Humor und Eigenart. Ein künstlerisch veranlagter Mann, der schon alles Mögliche ausprobiert hat. Ein Mann, der Dich verwöhnen würde und den Du versorgen könntest. Ein Mann, der sich ganz zum Spielball Deiner Liebe machen könnte, solange Du keine Kinder von ihm wolltest. Ein sensibler und zurückhaltender Mann, der Dir den Vortritt lässt beim Herstellen des Erstkontakts. Marion. Es muss von Dir kommen. Ein bisschen was musst Du auch leisten, wenn Du schon so einen Mann willst.
Ich betrete das Geschäft und schreite langsam die Glasregale mit den Telefonen ab. Du hast mein Kommen noch nicht bemerkt und bist mit Deinem Computer beschäftigt. Als ich Dir schon relativ nahe bin, begegnen sich unsere Blicke. Ich lächle Dich kurz an, und Du erwiderst das Lächeln. Zwar ist es ein professionelles Lächeln, eines, das Du fünfhundertmal am Tage austauschen musst, und dennoch wirkt es nicht falsch, sondern – so unterstelle ich – kommt von ganzem Herzen. Jetzt wäre eigentlich der Moment, in dem Du mich ansprechen solltest. Ein Kunde betritt den Verkaufsraum, geht direkt auf Dich zu und beendet unsere zarten Anbandelungen. Zeit für mich zu gehen. Du hast Dich vorerst für einen anderen entschieden. Einen, der stupider und direkter zur Sache kommt. Einen, der sich gar nicht wirklich für Dich interessiert. Aber ich werde wiederkommen, weil ich weiß, dass Du mit ihm nicht glücklich wirst. Er will nur Deine Produkte. Er will nur Deine Telefone, Deine Ladestationen, Deine Bluetoothlösungen und Navigationszusatzgeräte. Marion. Ich, im Gegensatz zu ihm, ich will Dich.
Kann ich diesen Brief so abschicken? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du darauf reagieren wirst. Bin ich zu direkt? Bin ich zu forsch? Dass auch du einsam bist, darüber besteht für mich kein Zweifel. Aber ob du ausgerechnet einen wie mich willst, das bleibt festzustellen. Ich werde die richtigen Worte finden. Marion.
Lawinen der Schuld
Ich wohne bereits sehr lange in dieser Wohnung. Schon über fünfzehn Jahre. Zwar war ich zwischendurch ein paar Jahre verzogen, untergebracht bei einer Frau und ihren Kindern, aber ich bin zurückgekommen, als sie mich nicht mehr wollte. Irgendwann stellte sie fest, dass es egal ist, ob ich da bin oder nicht. Dass es teurer ist, wenn ich da bin. Und trotzdem nicht aufregender oder abgerundeter oder schöner. An diesem Tag, nach etwa vier gemeinsamen Jahren, teilte sie mir emotionslos mit, dass es jetzt für mich Zeit sei, dahin zurückzugehen, wo ich hergekommen sei. In das Land des Pfeffers.
Das verstand ich und ging.
Ab und zu sitze ich vor meiner Fotokiste und sehe mir Bilder aus unserer gemeinsamen Zeit an. Ihre Kinder nicht sehen zu können gibt mir einen Stich ins Herz. Ich fühle mich schuldig dafür, dass ich nicht für sie da sein kann. Dass ich einfach weg bin. Dass ich ihnen genommen wurde. Dass ich mich ihnen genommen habe. Dass sie traurig sind, weil ich nicht da bin. Dass sie sich fragen, warum ich gegangen bin. Dass sie ohne mich aufwachsen werden. Dass ich die erste große Enttäuschung in ihrem Leben gewesen sein werde. Dass sie später mit ihren Psychologen über mein Verhalten und mein Verschwinden reden werden müssen. Dass sie mir später die Schuld werden zuweisen müssen, für die Verlustängste, die sie haben. Hätte ich diese Lawine aus Schuld erahnt, ich wäre an dem Abend, an dem ich ihre Mutter kennengelernt habe, nicht ausgegangen. Leute wie ich dürfen mit den Grundmechanismen des Lebens, mit der Reproduktion, mit Familiengründung, mit der Versorgung eines Stammes, mit der Verantwortung und dem ganzen Rattenschwanz nichts zu tun bekommen, da bleiben sonst nur Leid und Elend zurück. Leute wie ich, die an ihrem eigenen Leben zweifeln, die am Leben überhaupt zweifeln, dürfen nicht auf das Leben anderer losgelassen werden, ihre Pflugscharen des Zweifels hinterlassen ungerade Brüche und nässende Wunden.
Nach dieser Erfahrung habe ich beschlossen, mich nie wieder in familiäre Verhältnisse einzumischen oder gar hineinzubegeben, meine desaströse Veranlagung würde nur Unheil anrichten. Meine amourösen Begegnungen müssen idealerweise zeitlich beschränkt und von unverbindlicher Natur sein, damit weder ich noch irgendjemand anderes durch mein Verhalten ins Trudeln gerät. Das ist mein Verständnis von Seriosität. Kurze, beglückende, erotische Intermezzi und ein klares Ende vor den unendlichen Umschlingungen, Verknotungen, Zerfaserungen, Durchwühlungen, Verzerrungen, Durchdringungen, Zerfetzungen und Erdrosselungen der Liebe. Feigheit? Wie mir Frauen immer wieder vorwerfen, um mich zu provozieren, um mich unter Druck zu setzen und mich an die Kandare zu legen. Auf keinen Fall. Eher Aufgeräumtheit. Ich warne zu Recht vor mir. Auch ich sehne mich nach Verbindlichkeit, nach Wärme und Geborgenheit. Aber sobald der Alltag sein graues Medusenhaupt erhebt, erstarre ich vor Schreck und lasse alle Sehnsüchte fahren. In diesem Zustand tue ich niemandem gut, in diesem Zustand sitze ich am besten zu Hause vor einem kleinen Produktstapel, und die Zeit und die Welt ziehen blind an mir vorbei, ohne mich zu bemerken.
Lasst mich abwesend sein, dann verschone ich auch euch.
Leben auf Pump
Am Montag hole ich Geld von der Bank. Neues Geld, Monatsanfangsgeld. Dispo endlich auf null. Andere haben Angst davor, eine glatte Null auf dem Konto zu haben, ich bin glücklich darüber. Weil ich ja sonst immer nur im Minus bin. Auf null zu sein heißt für mich, wohlhabend zu sein. Ein Leben auf Pump. Danach fühle ich mich, als wäre ich wieder aufgeladen. Als hätte ich neue Batterien im Rücken. Ich fahre mit der S-Bahn in die Innenstadt und gehe eine große, prächtige Einkaufsstraße entlang. Ich tue so, als könnte ich mir irgendwas von dem dort Angebotenen leisten. Könnte ich ja auch, nur danach wäre ich direkt wieder abgebrannt. Ich kaufe mir ein Eis und beobachte die Menschen beim Flanieren. Männer klüngeln in Haufen vor einem Uhrenladen herum. Ich schaue mir die Omega-Uhren an. Ein Paar stellt sich neben mich.
»Du, die Seamaster hab ich ja schon, aber mit dem schwarzen Ziffernblatt sieht die auch megageil aus.«
»Find ich auch, so was steht dir doch immer.«
»Kostet aber zweifünf.«
»Hol sie dir doch, die andere trägst du doch sowieso nicht mehr.«
»Geiles Teil, megageil! Die geht in tausend Jahren nur eine Sekunde falsch!«
»Unglaublich. Echt?«
»Ja logisch, das ist ’ne Omega, check das mal.«
»Und wer will das nachprüfen? Solange lebst du doch gar nicht …«
Die beiden werfen sich einen unglaublich hohlen Blick zu, ihrer ist fragend, seiner genervt, dann bemerken sie, dass ich neben ihnen stehe. Abrupt beendet er das Gespräch und drängt sie weiter.
Auch ich schreite voran. Frauen kleben an Scheiben von Schuhläden. Ist das das Innerste, worauf man uns reduzieren kann in diesen Zeiten? Männer auf Technik und Frauen auf Schmuckwerk? Die Konsumenten sind sehr beschäftigt mit dem Beobachten der Waren, die Möglichkeit des Besitzens lässt sie in einen Rausch verfallen, sie horchen ganz tief in sich selbst hinein, achten auf die innere Stimme, die ihnen sagt, was ihnen noch fehlt, was zu ihnen gehören könnte. Psychologischer Fachterminus: shoppen. Ein wirklich hässliches Wort. Ich war heut shoppen. Eine Zustandsbeschreibung wie eine Krankheit.
Mir fällt auf, dass die Frauen in der Innenstadt beim Verlassen von Geschäften besonders rücksichtslos sind. Sobald sie ihre Gelüste und Bedürfnisse befriedigt haben und auf den Bürgersteig treten, achten sie auf nichts und niemanden mehr. Sie scheinen wie betäubt, haben eine sinnvolle Verwaltung des öffentlichen Raums gänzlich aufgegeben und erwarten von den anderen Konsumenten Rücksicht. Mit Tüten und Objekten beladen, wanken sie zu ihren kleinen, schicken Autos, um diese zu füllen und die Beute in ihre teuren Höhlen zu transportieren. Absicherungsmethoden. Gier als Lebensprinzip kennt nach oben keine Grenzen, es gibt nie genug, man kann sich nie endgültig abgesichert fühlen. Mehr fühlt sich immer gut an. Mit mehr machst du nie was falsch. Herr, lass es mehr werden.
Ich komme zum O2-Laden. Marion Vossreuther steht wie immer hinter dem Tresen und starrt auf den Flatscreen vor sich. Den ganzen Tag steht sie vor diesem Flatscreen und hat den Blick wie eine Angel in die Leere des Netzes getaucht. Ein Kunde steht vor ihr und wartet geduldig. Schließlich findet sie, wonach sie sucht, und preist es ihm mit einem Lächeln an. Wie schön dieses kleine professionelle Lächeln ist. Ich wünschte, sie würde mich die ganze Zeit professionell anlächeln.
Jeden Tag würde ich einen neuen Vertrag bei Dir abschließen, nur um dieses antrainierte Lächeln zu bekommen. Marion, willst Du nicht mich gegen O2 eintauschen? Was bietet Dir O2, was ich Dir nicht bieten könnte? Geht es um Absicherung und Versorgung? Ich gebe zu, darin ist O2 besser als ich. Aber auch nur so lange, wie sie Dich brauchen, danach lassen sie Dich fallen. Redet O2 mit Dir über Kunst und Politik? Betrinkt sich O2 mit Dir und klaut Lebensmittel? Kann Dich O2 sexuell zufriedenstellen? Ist O2 zärtlich zu Dir, küsst und massiert Dich, befriedigt Dich, bis Du nicht mehr magst? Nein, nein, nein. O2 kann sich in allen wichtigen Bereichen des Lebens nicht mit mir messen. Bedenke das, Marion, wenn Du Dich endgültig entscheidest.
Ich gehe weiter. Neben einer Telefonzelle sitzt auf dem Boden ein Hütchenspieler, ein Südländer, vor ihm hocken zwei ebenfalls südländisch wirkende Männer, sie reden aufgeregt aufeinander ein, einer weist wiederholt mit dem Finger auf die Streichholzschachtel vor ihnen, sie ist ganz leicht angehoben, und man sieht darunter die Kugel, um die es geht. Einer der beiden Wettenden zeigt nun entschlossen auf die Schachtel und sagt laut: »Disser! Disser da!« Der Hütchenspieler hebt die Schachtel, schaut etwas dumpf und gibt dann dem Wettenden einige Geldscheine. Der Gewinner schaut mich triumphierend an. Erneut beginnt der Spieler, die Kugel unter den Schachteln wandern zu lassen, immer weiter schiebt er sie, und jedes Mal kann man genau sehen, wo sie landet. Schließlich bleibt sie unter einer Schachtel liegen, und wieder ist der Deckel leicht angehoben. Der Gewinner von eben schaut mich aufmunternd an, als wollte er sagen: »Bitte, bedien dich, so leicht ist das!«
Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Ich ziehe einen Zehner aus meiner Hosentasche und weise mit dem Finger auf die Schachtel. Der Spieler nimmt mir den Zehner aus der Hand und hebt den Deckel. Die Kugel ist weg. Wo ist sie geblieben? Eben hab ich sie noch gesehen. Der Spieler hebt eine andere Schachtel, und darunter liegt die Kugel. Der vormalige Gewinner und sein Freund entfernen sich leidenschaftslos. Sie haben ihren Job als Koberer gemacht. Ich wanke etwas verschämt rückwärts, muss dann aber anfangen zu grinsen, und schließlich lache ich lauthals. Wie konnte ich auf so etwas Billiges hereinfallen? Respekt! Ich beschließe auf der Stelle, ebenfalls in das Hütchenspielermetier einzutreten. In einem Zigarettenladen kaufe ich mir ein paar Streichholzschachteln und eine Packung Kaugummis. Aus dem Silberpapier eines Kaugummis rolle ich eine Kugel. Etwa hundert Meter von dem Spieler entfernt, der mich eben abgezogen hat, lasse ich mich auf dem Boden nieder. Ich freue mich wahnsinnig auf meinen neuen Beruf. Die beiden Südländer, die eben noch gewonnen haben, sind gerade auf dem Weg zurück zu ihrem Kompagnon und kommen schlendernd bei mir vorbei. Der eine erkennt mich und bleibt verdutzt stehen. Ich beginne die Kugel unter den Schachteln wandern zu lassen, ungelenk natürlich, aber mit einem selbstbewussten Gesichtsausdruck. Die beiden mustern mich ein wenig ratlos, sie verstehen den Trick nicht, sie versuchen zu ergründen, wie meine Technik funktioniert. Wie kann ich, der ich eben noch bei ihnen verloren habe, jetzt eine eigene Kugel wandern lassen? Als einer von beiden davon überzeugt ist, dass ich blutiger Anfänger sein muss, setzt er auf eine der Schachteln. Ich hebe die, auf die er mit dem Finger zeigt, an und – die Kugel ist darunter. Ich muss ihm einen Zehner zahlen. Fassungslos nimmt er ihn entgegen. Wo ist verdammt noch mal der Trick? Wieder lasse ich die Kugel wandern, und wieder setzt er nach einiger Zeit. Ich zahle ihm etwas genervt einen weiteren Zehner. Ein paar Leute sind stehen geblieben. Hier scheint ein Hütchenspieler sein Geschäft nicht zu verstehen. Oder ist das Ganze ein riesiger Schwindel? Oder war die Hütchenspielerei immer schon ein ehrliches Handwerk, und all die Male, die man andere hat verlieren sehen, nur reiner Zufall? Ein älterer Mann versucht jetzt sein Glück und weist, noch bevor der Südländer zum dritten Mal zuschlagen kann, auf eine Schachtel. Auch er gewinnt, und ich zahle ihm anstandslos, aber griesgrämig den Zehner. Die Menschentraube um mich herum wird größer. Nachdem ich ein Mädchen, das mit seiner Mutter vor mir steht und gewettet hat, habe gewinnen lassen müssen, weil ich es wirklich nicht besser kann, hebe ich enttäuscht die Schachteln hoch und stelle fest: »Das verdammte Spiel muss kaputt sein, irgendetwas stimmt hier nicht.« Man schaut mich ratlos an. Ich untersuche die Schachteln genau, schüttele sie und rolle die Kugel vor mir her. Dann beginne ich ein weiteres Spiel. Diesmal gewinnt wieder der Südländer. Da ich letztlich nie gewinne, wird mir die Sache nach einer Weile fade. Ich beschließe, das Spiel zu beenden. Ein letztes Mal untersuche ich die Schachteln, dann springe ich auf, zertrampele sie wütend und gehe fluchend meiner Wege. Das verdammte Spiel ist kaputt! Scheiße! Das spiel ich nie wieder, so ein Scheißspiel! Ratlose Menschen schauen mir nach. Die Südländer lachen verächtlich.
Ich habe ’ne ganze Menge Geld verloren, aber ich bin trotzdem irgendwie glücklich. Warum mich so eine Aktion glücklicher macht, als wenn ich selber Geld bei einem Hütchenspieler gewonnen hätte, weiß ich nicht. Vielleicht weil ich, obwohl ich die ganze Zeit verloren habe, trotzdem Herr der Situation war. Fakt ist: Ich bin nicht ausgenommen worden, ich habe mich ausnehmen lassen.
Ein leeres Blatt Papier
Ich habe heute Morgen nach dem Aufwachen etwas Sonderbares erlebt. Nachdem ich mich gewaschen und eine Tasse Kaffee zu mir genommen habe, setze ich mich an meinen Schreibtisch vor dem Fenster zum Park. Ich lege meine Hände auf die Tasten der Schreibmaschine, so wie ich es fast jeden Tag tue. Ich warte, bis sich ein Energiebündel in mir formt, wie eine Fontäne heranwächst, bemerke, wie elektrische Impulse durch meine Synapsen und Nerven zu den Muskeln meiner Hände und Finger jagen und sie veranlassen, bestimmte Tastenkombinationen zu tippen. Es entstehen Worte auf dem Papier, Worte, die mir fremd sind und die ich erst lese, nachdem ich die Seite zu Ende geschrieben habe. Ich versuche festzustellen, ob ich diese Worte und Sätze kenne oder ob sie mir geschenkt wurden. Ecriture automatique:Humunlaqualil wird genüsslich das schwarze Pech zieren. Die Fleißbomben zerplatzen wie Kot in deinem Gewinde, und abgeflachstes Stronzium brät auf silbernen Geiern über die Welt. Meine Damen und Herren, das Hulakarken-Obitionilium übernimmt die gesamte Verantwortung!
Es geht rein um den Klang und den Fluss. Manchmal gelingen mir ganz außergewöhnliche Buchstabenkompositionen. Häufig entstehen Namen in mir. Ich habe eine stattliche Liste von Namen, die mir wie aus dem Nichts zufliegen. Vielleicht sind es die Namen von Toten? Vielleicht sind es die Namen von Menschen aus einer Parallelwelt? Vielleicht sind es die Namen derjenigen, die kommen werden?
Heute Morgen aber bleibt es still in mir. Ich warte, horche in mich hinein, aber dort ist gar nichts, meine Finger bleiben absolut ruhig. Irgendwann nehme ich die Hände von der Maschine, lege sie auf den Tisch, spiele mit einem Kugelschreiber, hebe ihn mit der rechten Hand neben den Stuhl. Ich lasse ihn los. Er schwebt in der Luft, etwa einen Meter über dem Boden. Er schwankt, dreht sich langsam wie eine ausschwingende Kompassnadel, bleibt dann stehen und hängt fast unbeweglich in der Luft. Ich stehe auf und umrunde ihn vorsichtig, ich bücke mich und schaue von unten auf den Kuli. Er wird von nichts gehalten und schwebt ganz ruhig weiter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fühle mich weder ängstlich noch unsicher, nur ein wenig ratlos. Schließlich setze ich mich wieder und warte, schaue auf den Kuli. Nach einer Weile wird mir langweilig. Ich nehme ihn und lege ihn zurück zu den anderen Stiften. Ich werde heute nicht schreiben.
Keine Sympathien für Vitamine!
Ich sammle gerne. Als Kind habe ich tatsächlich Briefmarken gesammelt. Später Platten und Bücher. Auch Eintrittskarten von Konzerten, Lesungen und Ausstellungen. Erinnerungen. Spuren durch ein Leben. Beweise dafür, gewesen zu sein. All das habe ich irgendwann aufgegeben, denn diese Sammlungen gerieten bei mir zu Sackbahnhöfen, Erinnerungsstauräumen, die gesammelten Objekte wurden zu unbenutzten, toten Gegenständen, die ich nur hatte, um sie zu haben, und die ich aus diesem Grund irgendwann alle wieder loswerden musste. Nun sammle ich Lebendiges. Feinstoffliches. Organisches. Ich sammle Krankheiten, Krankheiten faszinieren mich. Der Mensch ist kein abgeschlossenes Individuum, er ist ein Mischwesen, ein Superorganismus, der über zweitausend verschiedene Bakteriensorten in sich trägt, die, laut der American Society for Cell Biology, wenn man sie herausnehmen und wiegen könnte, über zwei Kilogramm Gewicht ergeben würden und ohne die der Mensch überhaupt nicht lebensfähig wäre. Das Erbgut meiner Besiedler ist hundertmal so groß wie meines, quantitativ gesehen. Ich bin zweitausend Lebensformen. Mein Leben funktioniert nur, weil wir alle in mir leben. Ich bin ein Bakterientransporter, ein Fahrzeug für Kleinstlebewesen, ein Virenflugzeugträger. Sonntag 2000 XL.
Ich sammle Krankheiten, seit ich volljährig bin. Als Kind war ich selten krank, aber in meiner Adoleszenzphase entdeckte ich, dass eine plötzliche Krankheit wunderbar als Ausrede herhalten kann, um zumindest für kurze Momente nicht funktionieren zu müssen. Und seit dem Moment, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, um in die Großstadt zu ziehen und ein eigenes Leben zu beginnen, arbeite ich mit Krankheiten. Sie sind sozusagen der Job meines Lebens. Wenn ich krank bin, muss ich nicht funktionieren. Mindestens einmal die Woche bin ich krank. Was bei mir dazu führt, dass ich oft nicht länger als ein halbes Jahr in einem Job verweile, weil mir dann wegen Unzuverlässigkeit gekündigt wird. Da ich eigentlich einen gesunden und widerstandsfähigen Körper habe, ist es nicht so einfach, glaubhaft krank zu werden. Und das muss ich ja sein, um einen gelben Schein vom Arzt zu bekommen. Ich habe mir viele Methoden ausgedacht, um krank zu werden. Das Vortäuschen ist auf Dauer nicht glaubhaft. Am Ende meiner Zeit bei der Post musste ich mich sogar einmal von einem Amtsarzt untersuchen lassen, da man mir meine ständige Grippe nicht mehr abnahm. Der Arzt kam zu dem Schluss, dass ich kerngesund sei und über ein extrem gut funktionierendes Abwehrsystem verfüge. Diese Einschätzung bot Anlass zur sofortigen Kündigung.
Die einfachste Methode, krank zu werden, ist, sich in der Nähe von kranken Menschen rumzutreiben. Ich streife oft in meiner Freizeit in der Nähe von kranken Menschen herum. Ich habe ihnen gegenüber keine Berührungsängste, im Gegenteil, ich begrüße und umarme auch diejenigen, die ich zum ersten Mal anspreche. Die Zeiten der Grippeepidemien sind meine Lieblingsjahreszeiten. Ich fahre dann sehr viel U-Bahn, natürlich immer die stark frequentierten Linien, und stelle mich an die Türen, wo das meiste Gedrängel herrscht. Oder ich halte mich in Arztpraxen und Krankenhäusern auf. Denn die Orte der Genesung sind die zuverlässigsten Herde für Krankheitserreger aus aller Herren Länder, sozusagen Virenbörsen, Tauschmärkte für extraordinäre Infektionen. Denken Sie nur an das Tropeninstitut in Hamburg-St. Pauli. Dort trifft man an guten Tagen auf eine größere Bakterienpalette als in den tiefsten Ebolaspalten des Dschungels. Um dem Vorwurf der Koketterie vorzubeugen, möchte ich auch warnen vor diesen fremdländischen und teilweise unidentifizierten Erregern, es sind einige dabei, deren Effekte äußerst unangenehm sein können. Deshalb hole ich mir meine Krankheiten lieber auf der Straße ab, eine herkömmliche U-Bahn-Grippe ist jederzeit zu verschmerzen, verschafft einem aber eine garantierte Auszeit von etwa einer Woche.
Ende der Leseprobe