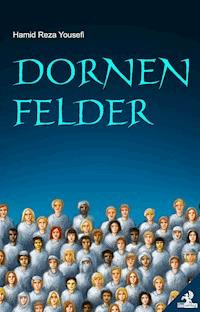
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lau Verlag & Handel KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dieser biografischen Skizze zeichnet der Philosoph Hamid Reza Yousefi sein bewegtes und bewegendes Leben nach. Er erzählt von seiner ersten Heimat Iran, seiner Kindheit, von den Umständen, die ihn zum Verlassen seines Landes bewegten und seinem Migrantenschicksal in Deutschland. Besonders würdigt er den Fundamentaltheologen Adolf Kolping (1909-1997), der Yousefi nicht nur die grundlegenden Kenntnisse zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung vermittelt, sondern seinem Leben einen neuen Sinn verliehen hat. Yousefi, der sich als ein >Insider und Outsider< zugleich bezeichnet, bringt uns seine interkulturellen Erlebnisse und Erkenntnisse aus der erfrischenden Perspektive eines Menschen nahe, der die Welt nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern in vielerlei Schattierungen wahrnimmt. Er führt die Bedeutung eines offenen Dialogs über Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor Augen, "eine dialogische Form, das Andere zu sehen und mit ihm eine Verständigung zu suchen." Damit öffnet er Türen, durch die es sich zu gehen lohnt: intellektuell, emotional, liebevoll und mit unendlich viel Verständnis. So schafft er ein neues Genre: die Brückenliteratur. Yousefi ist es gelungen, was vielen Menschen verwehrt bleibt: er hat Deutschland zu seinem zweiten ›Zuhause‹ gemacht: "Einem Land", schreibt er, "das meine zweite Heimat geworden ist, einer Kultur, die ich schätze und einer Sprache, die ich gerne spreche." Er erzählt gelernt zu haben, "Nachteile als Gelegenheiten zur weiteren Entfaltung" seiner "Ideen zu nutzen. Schließlich ist kein Nachteil so groß, dass sich hieraus nicht auch ein Vorteil ergäbe." … Integration ist eine besondere Art, sich und die Anderen wahrzunehmen und zu erleben. Sie hat viele Facetten und benötigt viele Brücken. Dialogisches Denken und tolerantes Verhalten bilden das Wesen der Integration, dies interkulturell in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hamid Reza Yousefi
DORNENFELDER
1. Auflage September 2011
Copyright © 2011 by Lau-Verlag & Handel KG, ReinbekAlle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Steffen Faust, BerlinISBN 978-3-95768-159-1
www.lau-verlag.de
INHALT
PROLOG
TEIL 1
Steinige Wege
TEIL 2
Prägende Begegnung
TEIL 3
Zweite Heimat
TEIL 4
Stille Wunder
EPILOG
»Wenn man mich fragen würde, welche Persönlichkeit in meinem bisherigen Leben, neben meiner Mutter Zahra, meiner Frau Ina und meinem Freund Peter den tiefsten Eindruck auf mich gemacht hat, dann würde ich erwidern: es war Adolf Kolping (1909-1997). Er war es, der mir ein so differenziertes Deutsch beigebracht hat, wie es keine Sprachschule vermocht hätte, er war es, der mir die grundlegenden Kenntnisse zu meiner wissenschaftlichen Ausbildung vermittelt hat. Mich faszinierten seine menschliche Güte, sein Scharfsinn und seine aufrichtige Natürlichkeit.«
Dieses Buch ist Adolf Kolping gewidmet.
PROLOG
Es war im September 1990, als ich nach einer langen Odyssee Deutschland erreichte; ein Land, das sich in einer epochalen Veränderung befand. Über Nacht stürzte im November 1990 in der ehemaligen DDR zusammen, was seit 1949 Bestand gehabt hatte. Mich erinnerte diese Zeit an die Zustände der Islamischen Revolution von 1979. Die Menschen konnten in der Tat glücklich sein, dass eine friedlich verlaufene politische Umwälzung ihnen die von vielen lang ersehnte Öffnung der Grenzen bescherte.
Deutschland hatte ich als Ziel gewählt, weil uns im Iran ein positives Bild von diesem Land vermittelt worden war, das für demokratische Strukturen, Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit steht. Im Iran wird Deutschland nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern auch in der Schule als das Land der Dichter und Denker dargestellt. Das Deutschlandbild im Iran ist ferner deshalb gut, weil das Verhältnis zwischen den beiden Ländern über lange Zeiten freundschaftlich gewesen ist. Nach intensiver Lektüre des mehrbändigen Werkes ›Kulturgeschichte der Menschheit‹ des berühmten Historikers Will Durant in persischer Übersetzung hatte ich ein unbändiges Bedürfnis, den europäischen Geist in all seinen Facetten kennen zu lernen: die klassische Musik, die Kunst, die Philosophie und das Funktionieren der Gesellschaft, Goethes West-östlicher Diwan, Schillers ›Ästhetische Erziehung des Menschen‹, Beethovens überzeitliche Symphonien und Jaspers’ Weltphilosophie.
Inzwischen bin ich seit mehr als einundzwanzig Jahren in Deutschland, meiner zweiten Heimat. Mein Lebensweg verläuft zwischen zwei großen Kulturen. Zahlreiche Begebenheiten setzen sich wie ein Mosaik zu einem Bild zusammen und führen vor Augen, wie ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin.
Henrik Ibsen stellte einmal fest: ›Schreiben heißt, über sich selbst zu Gericht sitzen.‹ Ich möchte weder über mich selbst noch über andere zu Gericht sitzen, ich will weder beurteilen noch verurteilen, sondern dem Leser meine Erkenntnisse und Erfahrungen anvertrauen, wie ich sie erlebt habe. Diese begleiten mich überall – beim Lesen, Schreiben, auf der Straße, im universitären Leben, in der Familie. Darüber möchte ich berichten; über meine Freude und Trauer, Ängste und Hoffnungen; über mein Leben in der Schwebe.
Ich möchte einigen Freunden herzlich danken, die mir während der Durchsicht des Textes viele Impulse gegeben haben. Manche Freunde charakterisieren ihn als eine Autobiographie, einige andere bezeichnen ihn als Bildungs- und Schmerzgeschichte zugleich, andere wiederum halten ihn für ein gelungenes Jugendbuch oder ein Musterbeispiel der Integration.
Mein Text trägt alle diese Komponenten in sich. Er will, Goethe ehrend, Brückenliteratur sein, eine dialogische Form, das Andere zu sehen und mit ihm eine Verständigung zu suchen.
Hamid Reza YousefiTrier, im September 2011
Teil 1
Steinige Wege
Ankunft in einer Parallelgesellschaft
Meine erste Station in Deutschland war die Main-Metropole Frankfurt. Im Iran dauert es in der Regel sehr lange, bis ein Visum ausgestellt werden kann, dies ist auch mit tausenden von Eventualitäten verbunden. Weil ich nicht warten wollte, entschied ich mich, es über die Türkei zu versuchen. So fuhr ich zunächst mit einigen Freunden in einem Bus nach Istanbul. Nachdem wir die iranische Grenze passiert hatten, kauften sich einige Passagiere Whiskey und türkisches Bier, da im Iran kein Alkohol konsumiert werden darf. Vom Atatürk-Flughafen aus wollte ich eine Maschine nach Frankfurt am Main nehmen. Im Bus entwickelten sich einige Bekanntschaften unter Iranern, die ebenfalls nach Deutschland reisen wollten, und wir schlossen uns zusammen, um mit einem Dolmush, einem Omnibus, den Flughafen zu erreichen.
Im Kreise von Landsleuten, debattierenden Männern und lachenden Frauen, mit denen ich lustige Worte wechselte, ging ich an Bord einer Maschine nach Deutschland. Nach unserer Ankunft wünschten sie mir alles Gute. Wir verabschiedeten uns herzlich bei der Passkontrolle, bevor sie verschwanden und ich mutterseelenallein in der Halle eines mir fremden Flughafens stand. Die Gespräche der Vorbeieilenden verstand ich nicht.
In diesen Wochen des ungewissen Unterwegsseins bewegte ich mich zwischen drei unterschiedlichen Kulturformen, dem Iran als einem Land, in dem Frauen Kopftücher trugen, der Türkei, in der die Haare der Frauen zu bewundern waren und Deutschland, wo die Mädchen bekleidet waren wie zur Schahzeit im Iran, mit Miniröcken und Hemdchen mit Spaghettiträgern. Zum ersten Mal wurden mir drei unterschiedliche Transformationen der Kulturen bewusst. In kürzester Zeit schlüpfte ich, wie ein Fisch, von einem kulturellen Kontext in den nächsten.
In Frankfurt wandte ich mich an Bijan, einen Bekannten aus meiner Teheraner Heimatstadt. Bevor er neun Jahre vor mir den Iran wegen des Iran-Irak-Krieges verließ, hatte er mit seiner Familie unweit von uns gelebt, so dass sich oft unsere Wege kreuzten. Als ich den Plan fasste, nach Deutschland zu kommen, wollte ich mich zuerst an ihn als meine erste Anlaufstelle wenden. Seine Eltern stellten mir seine Adresse und Telefonnummer zur Verfügung.
Als ich nach einigen Telefonaten, die ich aus der Türkei mit Bijan geführt hatte, plötzlich in Deutschland vor ihm stand, schauten wir uns lange an. Es war ein denkwürdiger Augenblick, dass sich zwei ehemalige Nachbarskinder, die sich kaum mehr erkannten, aus einem weit entfernten Teil der Welt hier begegneten: erhebend und gruselig, ein seltenes Gefühl des Aufgehobenseins und der Verlassenheit zugleich. Mir gingen in diesem Moment viele Geschichten unserer Jugend durch den Kopf. Plötzlich sagte Bijan: »Hamid, to-i?«, ›bist du es?‹
»Are manam«, ›ja, ich bin’s‹, erwiderte ich, glücklich ein Wort in meiner Muttersprache zu hören.
»Willkommen zu Hause«, begrüßte er mich und wir umarmten uns fest. Bijan sagte mir: »Du bleibst hier, und ich werde mich um deine Angelegenheiten kümmern. Ich kenne mich hier sehr gut aus und habe auch bisweilen als Dolmetscher gearbeitet.« Mir fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen.
Bijan war sechsundzwanzig Jahre alt und etwas mollig, so dass seine Freunde ihn ›Tschaqalu‹, Moppelchen, nannten. Er beherrschte zwar sehr gut die deutsche Sprache, bewegte sich aber in einer ghettoartigen Parallelgesellschaft. Seine Gutmütigkeit machte ihn beliebt; mir schien er auf eine sympathische Art unordentlich. Er hatte immer eine Schar iranischer und anderer ausländischer Freunde um sich, seine deutschen Nachbarn aber schien er kaum zu kennen. Dies war mir ungewohnt, weil die Nachbarn im Iran in der Regel wie zur Familie gehörig behandelt werden. Weil bei Bijan fast immer laute Musik lief, fragte ich ihn, ob sich die Nachbarn nicht auf die Dauer gestört fühlten:
»Nein nein, sie reden mit uns nicht, selbst dann nicht, wenn wir richtig auf die Pauke hauen. Sie wollen, dass es uns nicht gibt«, zwinkerte er mir, halb belustigt, halb ernst, zu.
Bijan lebte in den Tag hinein und sprach, meinem Empfinden nach, zu sehr dem Alkohol zu. Am Abend suchten ihn seine Freunde mit Bier, Asbach-Flaschen und Kartoffelchips auf, man trank und starrte gebannt auf die Mattscheibe, wo die gerade auf Sendung gegangene Stripshow ›Tutti Frutti‹ lief. Man verkündete lautstark, wie gerne man mit dem Moderator Hugo Egon Balder tauschen würde und bewunderte die mit Blümchen beklebten Busen der spärlich bekleideten Damen. Das war der Höhepunkt ihres nächtlichen Vergnügens. Diese Art der Unterhaltung und der Euphorie ihrer Zuschauer, ein ausschweifendes Leben ohne Perspektive, fand ich nicht gerade nachahmenswert.
Mich machte nachdenklich, dass Bijan und seine Freunde überhaupt nicht bemüht waren, die Angebote der Gesellschaft zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Es war mir ein hoffnungsvoller Gedanke, hier ein sinnvolles Leben zu gestalten und mich soweit wie möglich einzugliedern. Mir war es urplötzlich ein Bedürfnis, ein Gespräch mit meinem Gastgeber zu suchen. Dies ließ nicht lange auf sich warten.
Einige Tage später bat ich Bijan darum, mich nach Bad Schwalbach zu fahren, wo ich mich als Asylsuchender melden konnte. Als wir uns voneinander verabschiedeten, sprach ich an, was mir seit unserem Wiedersehen auf dem Herzen brannte:
»Du sprichst sehr gut Deutsch und bist ein aufgeschlossener Mensch, warum trinkst du eigentlich so viel und führst dieses Leben? Ist es dir gleich, was mit dir geschieht? Ist dir die Zukunft egal oder tust du nur so?«
Er war sichtlich ergriffen.
»Hamid«, setzte er schließlich an, »du wirst wahrscheinlich das Gleiche erfahren oder dir wird vielleicht das Gleiche widerfahren. Es ist nicht einfach, in dieser Gesellschaft zu bestehen, egal, was du machst. Ob du lieb oder böse bist. Du läufst so nebenher.« Unvermittelt brach Bijan in Tränen aus: »Ich bin seit 1981 in Deutschland, wegen des Iran-Irak Krieges. Zum Militär wollte ich nicht, meine Eltern wollten das auch nicht, und da sie einigermaßen wohlhabend sind, ermöglichten sie mir die Ausreise.« Er erzählte, dass auch er über die Türkei seinen Weg nach Deutschland gefunden hatte, und fuhr fort: »Dabei dachten wir, ich lande nun im Paradies. Mittlerweile sehe ich aber keinen Unterschied zwischen beiden Ländern. Hier tragen die Leute eine Krawatte, dort einen Stehkragen, hier werden Menschen belogen, dort auch; hier kannst du bis zum Abwinken saufen, dich in der Öffentlichkeit mit Mädels verlustieren; das Gleiche machst du im Iran, aber eben zu Hause. Alles ist letzten Endes gleich; nur Formen und Methoden sind unterschiedlich. Was aber dazukommt, so bist du hier letzten Endes der ungeliebte Ausländer, den man nicht ernst zu nehmen braucht. Das ist alles.«
Manche Leute hielten ihm immer wieder vor, dass Ausländer nicht nur Deutschland auf der Tasche liegen, sondern auch die deutsche Kultur missachteten, indem sie ihre eigenen Spielchen auf deutschem Boden austrugen. »Keiner interessiert sich, warum du hier bist, dass Du ein Mensch bist, der anders ist«, fügte er hinzu.
Ich spürte das Dramatische an seiner Situation, war aber voller Optimismus und sagte: »Einfach alles gleichzusetzen ist nicht richtig. In Deutschland wie im Iran gibt es viele gute Dinge, aber auch sehr viele Schwierigkeiten. Man muss doch wenigstens versuchen, mit dieser Gesellschaft klarzukommen! Nein, Bijan, erst, wenn das nicht funktioniert, kannst du ja wieder in den Iran zurückgehen. Kulturen können schlecht sein, aber du musst auch daran arbeiten, um sie besser zu machen.«
»Na, du wirst schon sehen, vielleicht schaffst du es ja besser als ich, hier zu recht zu kommen«, schloss er das Gespräch.
Von Heim zu Heim …
Das Durchgangswohnheim in Bad Schwalbach war ein Riesenkomplex mit Einzelgebäuden, in denen sich zahlreiche Räumlichkeiten befanden. Es sah wie eine verkommene und gottverlassene Kaserne aus, die jenseits von Gut und Böse ist, und war völlig verschmutzt. Wegen der permanenten Ankunft und Abreise zahlreicher Menschen herrschte eine unbeschreibliche Dauerhektik. Das Procedere war einfach: es gab ein Anmeldezentrum mit mehreren Büros. Jeder Sachbearbeiter hatte einen Übersetzer bei sich und war, in alphabetischer Reihenfolge, für die Ankommenden zuständig.
Zunächst sprach Bijan für mich, die weiteren Befragungen aber mussten mit einem eigenen Übersetzer der Behörde erfolgen. Die erste Vorsprache entsetzte mich, weil man mich, wie einen Kriminellen, von allen Seiten fotografierte und mir die Abdrücke von allen zehn Fingern genommen wurden.
Nach dieser Anmeldung brauchten die Beamten einige Zeit, um uns auf die umliegenden Wohnheime aufzuteilen. Alle mussten stets ganz Ohr sein, weil man immer über Lautsprecheranlagen ausgerufen wurde und zu gewissen Uhrzeiten bei bestimmten Personen Vorsprache halten musste. An diesem Ort trennten sich stündlich die Schicksale wie am Fließband. Häufig rannten weinende Frauen oder Jugendliche hinter den Beamten her und baten, sie doch mit einem anderen Bus, in dem Verwandte, Bekannte oder Schicksalsgenossen saßen, mitfahren zu lassen. Menschen suchen immer den Schulterschluss, wenn sie sich in einer unsicheren Situation befinden.
Glücklicherweise waren die Beamten recht freundlich und versuchten, den Menschen ihre Wünsche soweit wie möglich zu erfüllen. Dies ging wegen der Sprachbarrieren und aus sonstigen Sachzwängen heraus nicht immer, aber durch das internationale Kopfnicken und sonstige allgemeinverständliche Gebärden funktionierte die Verständigung dennoch einigermaßen. Uns wurde in Folie eingeschweißtes ›Essen auf Rädern‹ serviert, das scheußlich schmeckte, aber nach dem Motto ›Der Hunger treibt es herunter‹ blieb uns keine andere Möglichkeit, als es zu vertilgen.
Etwa eine Woche später schickte mich die Behörde mit dem Bus in ein Wohnheim in das Dörfchen Selters, wo ich glücklicherweise bessere Zustände vorfand. Dort wohnte ich etwa vier Monate zusammen mit Afrikanern, Pakistani, Indern, Bulgaren und Tschechen.
Mit einem tschechischen jungen Mann teilte ich auch das Zimmer. Er hieß Lubor. Zwischen uns entstand rasch eine enge Freundschaft. Abends machten wir geruhsame Spaziergänge durch die ländliche Umgebung, immer darauf bedacht, nicht gesehen und als Ausländer erkannt zu werden.
Lubor war in Deutschland, weil er, wie Bijan, nicht zum Militär wollte. Er sprach bereits gut Deutsch und war ein schöner und allen Dingen des Lebens gegenüber aufgeschlossener junger Mann. Nur den indischen Mitbewohnern gegenüber hatte er Vorbehalte, weil sie viel Alkohol tranken. Aber keiner wollte dem anderen Schmerz zufügen, weil wir wussten, im Ernstfall würden wir aufeinander angewiesen sein.
Im Heim lernte Lubor ein bulgarisches Mädchen kennen, und kurze Zeit später kündigte sich bei den beiden Nachwuchs an. Diese an sich so erfreuliche Situation gestaltete sich schwierig, da unsere Zukunft zu diesem Zeitpunkt noch völlig ungewiss war.
… und weiter nach Bad Nauheim
Auf ein Telefonat der Behörden hin hatte ich erneut den Aufenthaltsort zu wechseln und musste mich mit dem nächsten Bus nach Bad Nauheim aufmachen. Nie konnte ich verstehen, warum sie uns hin- und herschickten, obgleich durchaus die Möglichkeit bestanden hätte, so lange an einem Ort zu bleiben, bis unsere Anträge bearbeitet waren. Letzten Endes werden die Beamten gewusst haben, warum sie so handelten.
Im Vergleich zu meiner Unterkunft in Selters war dieses Wohnheim wieder sehr ungepflegt, und da es in der Nähe des Bahnhofs lag, musste man jeden Tag das Vorbeifahren unzähliger Züge ertragen. Dort hatte ich mein Zimmer mit zwei recht freundlichen Jungen aus Aserbaidschan zu teilen.
Unsere Aufgabe war, selbst zu kochen, wobei jedem Stockwerk eine Küche zur Verfügung gestellt war, die stark an die Kochgelegenheiten von heruntergekommenen Wohngemeinschaften erinnerte. Manche Jugendliche hatten noch nie eine Küche benutzt, und die Speisen, die von überall her kamen, waren nicht nur bunt gemischt, sondern manchmal qualitativ fraglich. Ein Junge, der nicht kochen konnte, ernährte sich fast ausschließlich von hartgekochten Eiern, weshalb er wegen Leberversagens ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Dennoch grenzte es an ein Wunder, was im Schmutz dieser kleinen Küchen alles an Essbarem entstand. Den Afrikanern und Asiaten fühlte ich mich besonders verbunden, weil sie ihre Gerichte mit Reis zubereiteten. Reis ist im Iran Grundnahrungsmittel, wie die Kartoffel in Deutschland. Noch interessanter fand ich die Esskulturen; manche aßen am Tisch oder auf dem Boden den Reis mit Stäbchen, einige mit den Fingern und manche, wie ich, mit dem Löffel. Später ersetzte ich meinen Löffel durch die deutsche Gabel.
Mohammad und seine Frau Atonga, ein schwarzafrikanisches Ehepaar aus Nigeria mit einem aristokratischen Aussehen, das schon länger in diesem Wohnheim war, interessierte sich für meine Belange. Wir spielten manchmal zusammen Karten mit meinen Mitbewohnern. Leider konnten wir uns kaum verständigen, da die Verkehrssprache des Ehepaars das Französische war, während ich, neben meinem spärlichen Deutsch, versuchte, mich in englischer Sprache durchzuschlagen. Als wir uns später trennen mussten, gestand mir Mohammad traurig, wir seien die einzigen Schiiten, deshalb fühlten sich beide mit mir verbunden. Er hatte gesehen, dass ich in meinem Geldbeutel ein Bild des Heiligen Imam Ali, des vierten Kalifen des Islam und der Schiiten, mit mir führte.
Meine Heimat Iran ist vorwiegend schiitisch geprägt, dort leben aber auch Sunniten, Angehörige der zweiten großen Konfession des Islam. Zwischen Schiiten und Sunniten gibt es keine religiösen Unterschiede. Ihre Basis ist der Koran und die Sunna, die Lebensweise des Propheten. Die Angehörigen beider Konfessionen ehren die vier Kalifen Abu Bakr, Omar, Osman und Ali, die Schiiten heben aber Ali als Schwiegersohn des Propheten hervor. Daraus ergeben sich politische Unterschiede. Der schiitische Islam bildet zwar die Minderheit in der islamischen Welt, wird aber auch in Afghanistan, Pakistan, Indien, dem Libanon, Syrien und einigen afrikanischen Ländern praktiziert. Mit Mohammad und Atonga habe ich hautnah erfahren, dass religiöse Gefühle keine Grenzen kennen und unausgesprochen Gemeinschaft und ein Wir-Gefühl stiften.
In Bad Nauheim war für die Kurgäste ein wunderschöner Kurpark mit einem großen Teich angelegt. Jeden Tag ging ich hin, fütterte die Vögel, beobachtete die Passanten und genoss die geruhsame Atmosphäre in vollen Zügen.
Mich schmerzte manchmal zu sehen, wie sorgenfrei die Kinder vorhüpften und in ihrer Welt glücklich waren. Ihre Unbeschwertheit war ihnen anzusehen, weil sie lachten und sich mit Wasserpistolen beschossen.
In solchen Momenten kamen mir meine Kriegserlebnisse wie Einblendungen vor Augen. Mich ergriff eine Erinnerung, in der ich mit meiner Gruppe voll bewaffnet abkommandiert worden war, um binnen fünf Minuten eine zum Lazarett umfunktionierte Sporthalle zu bewachen. Der Anblick der Halle, in der ich Wochen zuvor noch mit den Kameraden Fußball gespielt hatte, brachte mich völlig aus dem Gleichgewicht. Nun lagen hier mehr als dreihundert Verletzte eng nebeneinander. Manche schrieen um Hilfe, andere halluzinierten, überall sah man Verbundene und es roch nach Blut. Ärzte und Schwestern huschten eilig hin und her und kümmerten sich unermüdlich um die Verletzten. Ich legte instinktiv Waffe und Ausrüstung auf den Boden nieder, ging zu einem Verwundeten und fragte:
»Bruder, Bruder, was kann ich für Euch tun? Der Iran ist stolz auf Euch. Wir wollen unser Land retten. Wir werden siegen!«, aber sofort wurde ich von meinem Vorgesetzten dazu aufgefordert, hinauszugehen und wieder meine Stellung zu beziehen, was ich auch unverzüglich tat. –
Ich bemerkte nicht, dass ich auf der Parkbank saß und weinte. Bis dahin war mir nicht bewusst gewesen, wie erschöpft ich war. Ein älterer Herr klopfte mir auf die Schulter und fragte, ob es mir nicht gut gehe. Ich war nicht dazu imstande, ihm zu antworten, stand auf und ging langsam weg. Die Welt, die ich doch eigentlich hatte kennen lernen wollen, erschien mir greifbar nah, aber ich konnte mich nicht auf sie einlassen, und sie blieb mir noch sehr fern.
Eine Jugend im Krieg
Der Iran-Irak-Krieg hat meiner Heimat sehr viel Leid zugefügt. Wir fragten uns immer, warum die USA und ihre Verbündeten unser Land durch den Irak in die Knie zwingen wollten. Der Krieg war, neben der Islamischen Revolution, die zweite große Erschütterung in meinem Leben.
Schlimm waren die Kampfbomber, aber sie hatten die Angriffe der iranischen Luftabwehr zu fürchten und warfen häufig ziellos ihre Fracht ab. Nie aber werde ich die sowjetischen Scud-Raketen vergessen, mit denen die irakische Armee Teile der iranischen Hauptstadt verwüstete.
Wenn Kampfflugzeuge oder Raketen in das iranische Hoheitsgebiet eindrangen, wurden wir mit Sirenen und über Radio gewarnt. Angriffe wurden als ›rot‹ bezeichnet, die Entwarnung war ›weiß‹. Nie werde ich das Heulen der Sirenen und die Aufrufe aus den Ohren bekommen: »Achtung, Achtung – das Signal, das Sie hören, ist rot. Bitte verlassen Sie Wohnungen und Arbeitsplätze und begeben Sie sich in Sicherheit.«
Kurz darauf waren Detonationen zu hören und vor allem zu spüren, denn die heftigen Luftdruckschwankungen pflanzten sich bis in die weitesten Teile der Stadt fort. Die abgeworfenen Bomben verwandelten die Hauptstadt in ein brennendes Inferno. Nach etwa zwanzig Minuten kam die Entwarnung: »Achtung, Achtung – das Signal, das Sie hören, ist weiß.«
Einmal war ich mit dem Taxi auf dem Weg zur Arbeit, als Alarm ausgelöst wurde. Direkt darauf hörten wir ein lautes Rauschen, wie von einem überdimensionalen Flammenwerfer. Ich spürte den Sog und den Luftdruck des herannahenden Geschosses, und kurz darauf sah ich über mir eine Riesenrakete. Wenige Sekunden später schlug sie mit voller Wucht ein. Der Taxifahrer schrie: »Ej Khoda! – Gott bewahre uns!« Wir stiegen aus und liefen instinktiv an die Stelle des Einschlages, der auf dem Karimkhan-Boulevard einen Krater von mindestens fünfzig Metern aufgerissen hatte. Die Rakete hatte einige Autos demoliert und einen Großteil der Straße verwüstet. Die umliegenden Häuser blieben weitestgehend unbeschädigt bis auf die Fenster, die der Druckwelle der Detonation nicht standhielten. Die Rakete hatte zehn Menschen mit in den Tod gerissen, die später als vermisst gemeldet wurden.
Wir lebten in der Nordstadt, einem Viertel außerhalb des Zentrums, das weniger ein Ziel der Bomben war. Zunächst benutzten wir bei Alarm einige Male unseren Keller als Refugium, aber dort fühlte man sich wie gefangen und bekam Platzangst, da nicht sichtbar war, von woher die Gefahr nahte.
Meine Familie und die Nachbarn, wie viele Menschen aus der Nordstadt, machten aus der schmerzhaften Not des Bombenalarms eine Tugend. Im Sommer verließen alle häufig kurz nach der Abenddämmerung die Hauptstadt und trafen sich etwa zehn Kilometer entfernt in den Hügeln des Garjrud, um die Nacht dort in relativer Sicherheit zu verbringen. Man hatte Thermoskannen mitgebracht, und Kerzen beleuchteten dieses nächtliche Picknick am Berg. Bei Bombenalarm löschten alle das Licht, kauerten sich zusammen und es herrschte eine gespenstische Stille. Nach der Entwarnung flammte eine Kerze nach der anderen wieder auf, der Garjrud verwandelte sich wieder in ein Lichtermeer. Die Menschen bewegten sich, begannen, miteinander zu reden und so die ausgestandene Angst zu verarbeiten.
Zu Beginn des Krieges kam Majid, der einzige Sohn meiner Tante Gohar, der älteren Schwester meines Vaters, als Soldat ums Leben. Sie wohnten in der Nähe der irakischen Grenze, deshalb setzte man Majid direkt zu Kriegsbeginn dort als Soldat ein. Er wurde eines der ersten Opfer. Seine Eltern betrauerten den Verlust ihres Sohnes, er war nicht verschmerzbar. Tante Gohar träumte Tag und Nacht von ihm, bei jedem Anruf sagte sie: »Lass’ mich rangehen, das muss Majid sein.« Klingelte jemand an der Tür, so meinte sie ebenfalls: »Das ist bestimmt Majid.« Ich habe meine Tante kein einziges Mal mehr lächelnd erlebt. Zeit ihres Lebens war sie unglücklich; sie taumelte mehr als das sie sich aufrecht hielt.
Durch diesen traurigen Fall in der Familie bestärkt, war mir klar, dass ich – wie viele meiner Landsleute – gegebenenfalls auch unter Einsatz meines Lebens, handeln musste. Dieser Entschluss beschleunigte sich, da eine Rakete unmittelbar in unserer Nachbarschaft einschlug und drei meiner Freunde ums Leben kamen, mit denen ich freitags immer zusammen Fußball gespielt hatte. Zu dieser Zeit war ich fast achtzehn Jahre alt und hatte gerade meine Schule beendet.
Das iranische Schulsystem ist dem in Frankreich ziemlich ähnlich. Es gibt eine einjährige Vorschule, eine fünfjährige Grundschule und ein dreijähriges Kolleg, dem sich die gymnasiale Oberstufe anschließt. Auch die Benotung richtet sich, wie in Frankreich, nach einer Skala von eins bis zwanzig. Ich hatte mich für eine allgemeinbildende Schule entschieden und mir wäre nun, mit meiner Hochschulreife, jede Studienmöglichkeit offen gewesen.
Aber bei diesem Ausnahmezustand war die gesamte Bevölkerung in Aufruhr und jeder reagierte, wie es ihm seine Mittel erlaubten. Wenige hatten die Möglichkeit, den Iran zu verlassen oder wenigstens ihre Kinder ins sichere Ausland zu schicken, wie die Familie Bijans. Mir war es zwar verständlich, dass viele das eigene Leben oder das ihrer Kinder retten wollten, aber dennoch fand ich es schmerzhaft zu erleben, wie manche Bürger in diesen schwierigen Zeiten dem Land den Rücken kehrten.
In einer solchen Grenzsituation wird einem bewusst, dass sich die Frage nach dem Alter eines Menschen nicht mehr stellt, wenn Jüngere wie Ältere die gleiche Erfahrung machen und denselben Gefahren ausgesetzt sind. Hier wird alles urplötzlich zweitrangig; alle leben in gegenseitiger Verantwortung.
Viele Männer und auch Frauen meldeten sich als ›Basidji‹, als Freiwillige zum Kriegsdienst, um das Land zu verteidigen. Für mich stand fest, dass ich nicht den Iran verlassen würde, auch wenn ich die Bedenken meiner Eltern, die nicht von meiner Idee begeistert waren, verstehen konnte. Mir war nicht nur wichtig, meinen regulären Militärdienst zu absolvieren, sondern auch einen Beitrag zur Verteidigung des Iran zu leisten. Ich war ein ganzes Jahr, mit Unterbrechungen, im Einsatz.
Durch ein Losverfahren wurden wir in einer Kaserne zur Marine, zu den Bodentruppen, zur Luftwaffe oder zu den ›Sepah-e-Pasdaran‹, einer der regulären Armeen des Landes, die nach der Revolution von 1979 entstanden war, eingeteilt und dementsprechend ausgebildet. In der hoch organisierten Kriegsakademie von Sepah wurden alle Kategorien des Militärs zusammengefasst. Mein Los brachte mich zu den ›Pasdar-wasife‹, den Pasdar-Soldaten. Wir hatten zunächst im kriegsakademischen Zentrum von Sepah-e-Pasdaran eine dreimonatige Intensivausbildung durchzumachen und mussten mit sämtlichen Waffen- und Panzertypen umgehen lernen. Hierzu gehörte auch das Legen und Entschärfen von Minen, die auf beiden Seiten eingesetzt wurden.
Über die Grundausbildung hinaus spezialisierte man sich auf einen militärischen Bereich wie Artillerie oder Infanterie, man war Funker, Sanitäter oder Grenadier.
Ich war in einer elfköpfigen Einheit, die die Grenzen kontrollierte. Oft ist einer unserer Kameraden entweder wegen Minen oder aus sonstigen Gründen ums Leben gekommen. Diesen Verlust hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu beklagen gehabt, wenn wir zu dieser Zeit mit Nachtsichtgeräten ausgestattet gewesen wären.
Alle Kräfte wurden zur ›defa-e moqaddas‹, der heiligen Verteidigung des Landes aufgewendet. Weil Saddam Hussein, der damalige Präsident des Irak, von seinen Verbündeten, der Sowjetunion und den USA, von Anfang an mit modernen Waffen versorgt worden war, bedeutete dieser Krieg für uns Iraner eine gerechtfertigte Verteidigung unseres angegriffenen Landes.
Entscheidung für das Ausland
Der zwanzigste August 1988 ist für die Iraner ein unvergesslicher Tag, es ist der Tag, an dem der unheilvolle Krieg acht Jahre nach seinem Ausbruch mit einem Waffenstillstand endlich ein Ende nahm. Es gab kaum eine Familie, die nicht einen Verlust zu beklagen gehabt hätte. Im Lande herrschte eine erschöpfte Ruhe; jeder war auf seine Art froh, dass diese bedrohliche Zeit nun ein Ende gefunden hatte. Alle Menschen kamen aus ihren Häusern auf die Straßen und spontan wurde ein Volksfest gefeiert. Wir waren froh, als die Nachricht durch die Medien kursierte, der Irak sei durch eine UN-Resolution verurteilt worden, weil er den Iran ohne jegliche Kriegserklärung über Nacht angegriffen hatte.
Das Ende des Krieges erweckte im Lande wieder die anfänglichen Hoffnungen der Revolutionszeit auf Wohlstand und ein besseres Leben. Die Freude des Volkes hing damit zusammen, weil endlich mit dem Aufbau des Landes begonnen werden konnte. Man sprach in dieser Zeit von einer Wiedergeburt. Der künftige Iran musste ein moderner, unabhängiger Staat sein.
Kurz darauf nahm der Tod dem greisen Staatsoberhaupt Imam Khomeini die Führung aus der Hand, und viele seiner Ideale wurden mit ihm buchstäblich zu Grabe getragen. Über den eigentlichen Aufbau des Iran, der nun beginnen sollte, gab es auf politischer Ebene starke Verwerfungen. Die Stimmung war aufgeheizt, und das Land befand sich in einer Lage zwischen Macht und Ohnmacht. Wir durchlebten eine politische Aufbruchssituation, in der sich die unterschiedlichen Richtungen neu formierten. Die politischen Flügel bekämpften sich gegenseitig mit großer Härte. Zu schaffen machten dem Land zusätzlich die wirtschaftlichen Sanktionen, die bereits 1979 von den USA verhängt wurden und die bis heute fortdauern.
Eine solche Situation, gepaart mit den vorangegangenen kulturellen Erschütterungen, machte es jungen Erwachsenen schwer, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Zu dieser Kriegsgeneration gehörte auch ich. Mit einigen politischen Entwicklungen im Lande war ich nicht einverstanden, und viele persönliche Pläne waren in den Wirren der Zeit nicht realisierbar. Schon seit einiger Zeit hatte ich wegen dieser Umstände mit dem Gedanken gespielt, den Iran zu verlassen, um mir in einer stabileren Umgebung eine Zukunft aufzubauen.





























