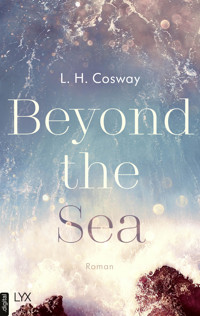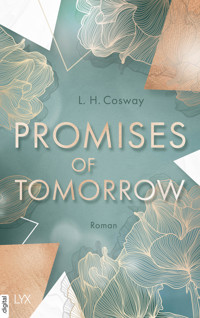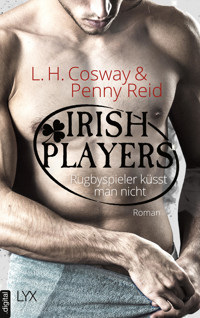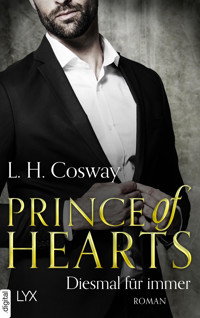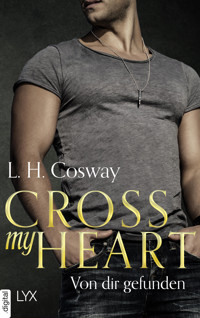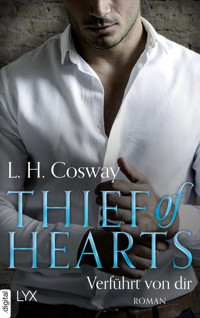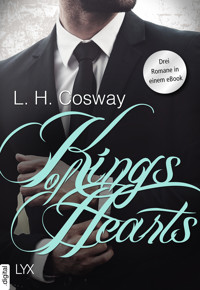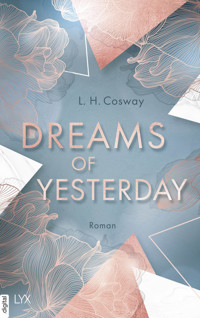
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cracks Duet
- Sprache: Deutsch
Am klarsten sehe ich meine Träume, wenn ich in deine Augen blicke
Als Evelyn den geheimnisvollen Dylan kennenlernt, scheint sie ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Der attraktivste Junge der Schule und sie möchten nicht nur beide weg aus Dublin, sie haben auch einen gemeinsamen Traum: Eines Tages wollen sie ihr eigenes Unternehmen in New York gründen! Doch während Dylan alles dafür tut, ihren Plan in die Tat umzusetzen, fehlt Evelyn der Mut, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber als ein tragischer Unfall geschieht muss sie sich entscheiden: für ihre Familie oder ihre Zukunft mit Dylan in New York.
"Brillant und unglaublich poetisch erzählt!" THE GOOD THE BAD AND THE UNREAD
Band 1 der CRACKS-Reihe von Bestseller-Autorin L. H. Cosway
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Liebe Leser*innen
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Die Autorin
Die Romane von L. H. Cosway bei LYX
Leseprobe
Triggerwarnung
Impressum
L. H. Cosway
DREAMS OF YESTERDAY
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maike Hallmann
ZU DIESEM BUCH
Als Evelyn Flynn den geheimnisvollen Dylan O’Dea kennenlernt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Nicht nur hat sich der attraktivste Junge der Schule in sie verliebt, in ihm scheint sie auch ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Aufgewachsen im selben Außenbezirk von Dublin, haben sie beide schon früh gelernt, dass das Leben alles andere als fair ist und man sein Glück selbst in die Hand nehmen muss. Doch erst mit Dylan hat sie das Gefühl, dass es auch so viel Schönes auf der Welt gibt. Mit ihm kann sie sich plötzlich alles vorstellen, sogar ihren großen Traum zu verwirklichen: eines Tages ein eigenes Unternehmen in New York zu gründen! Doch je konkreter ihre Zukunftspläne werden, desto deutlicher merken sie, dass sie sich doch nicht so ähnlich sind, wie sie dachten. Denn während Dylan alles dafür tut, ihren gemeinsamen Traum zu verwirklichen und seinem alten Leben zu entkommen, merkt Evelyn, dass ihr der Mut fehlt, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber als ein schrecklicher Unfall geschieht, muss sie sich entscheiden: für ihre Familie oder ihre Zukunft mit Dylan in New York …
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr auf der letzten Seite eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
»Ich will deinen Geist befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein.«
Morpheus, The Matrix
1. KAPITEL
Innenstadt von Dublin, Irland 2006
Nichts tat ich lieber, als einer Blütenknospe dabei zuzusehen, wie sie sich öffnete. Ganz zu Anfang glich sie einer Pistazie. Am nächsten Tag regten sich die Blütenblätter. Am folgenden Tag spreizten sie sich. Am Tag darauf noch ein wenig mehr, und dann stand die Blume endlich in voller Pracht. Ich wartete darauf, dass sich die Blüten meines rosafarbenen Hibiskus öffneten, aber es würde noch ein paar Tage dauern. Aus einer Plastikflasche goss ich etwas Wasser in den Topf, dann schraubte ich den Deckel wieder zu. Gerade wollte ich sie wieder ins Regal zurückstellen, da hämmerte jemand an meine Tür. Es klang panisch, ein Klopfen, das nach Beachtung schrie. In dieser Gegend war es nicht immer eine gute Idee, bei einem solchen Klopfen die Tür aufzumachen. Ich lugte durch den Spion und sah draußen jemanden aus meiner Schule stehen. Dylan O’Dea hieß er – oder war es O’Toole? Wie auch immer, jedenfalls war ich ziemlich sicher, dass er ein oder zwei Stockwerke unter mir wohnte, ebenfalls hier in St. Mary’s Villas. Von wegen Villas: Darauf darf man nichts geben. Nichts hier hatte mit einer Villa auch nur die allergeringste Ähnlichkeit. St.Mary’sKriegsbunker wäre ein passenderer Name gewesen. Alles war grau. Durch die Fenster fiel kaum Licht, und sämtliche Wohnungen rochen irgendwie schimmlig, ganz egal, wie gründlich man putzte und lüftete.
Dylan sah verschwitzt und verzweifelt aus, und irgendwas in seinem panischen Blick bewegte mich dazu, die Tür zu entriegeln. Ehe ich ein Wort sagen konnte, schoss er auch schon hindurch und knallte sie hinter sich zu.
»Mann, was soll denn das!«, rief ich und bereute meine Entscheidung schon jetzt. Ich wohnte bei meiner Tante Yvonne, aber sie war arbeiten und würde erst in einigen Stunden nach Hause kommen.
Dylan starrte mich eindringlich an, seine Brust hob und senkte sich unter schweren Atemzügen. Er hob einen Finger an den Mund, was überall dasselbe bedeutete: Sei still.
Ich gab keinen Mucks von mir, und im nächsten Augenblick ertönte draußen Lärm. Irgendwer hämmerte an die Türen, so wie Dylan eben an meine gehämmert hatte. Wieder sahen wir uns an. Er musste wohl gespürt haben, dass ich etwas sagen wollte, denn im nächsten Augenblick war er bei mir, drückte mich rücklings gegen die Wand und legte mir die Hand über den Mund. Er überragte mich ein ganzes Stück. Ich wehrte mich, aber da flüsterte er mir ins Ohr: »Bitte sei still. Da sind ein paar Typen hinter mir her. Ich muss mich nur kurz hier verstecken, dann hau ich wieder ab. Versprochen.«
Ich starrte ihn an. Dann hob ich einen Fuß und trat ihm gegen den Knöchel. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus, ließ mich aber nicht los.
»Leck mich«, presste ich gedämpft unter seinen Fingern hervor. »Verzieh dich!« Es klang mehr wie: »Lep mif. Verfie dif.«
»Bitte, Evelyn. Ich brauche deine Hilfe.«
Mein Herz raste. Er kannte meinen Namen. Wobei das so seltsam auch wieder nicht war, hier wusste eigentlich jeder, wie die anderen Leute im Haus hießen. Es war nur irgendwie eigenartig, dass er mich so persönlich anredete, weil wir noch nie zuvor miteinander gesprochen hatten.
Unter dem ernsten Blick seiner dunkelblauen Augen hörte ich auf, gegen seinen Griff anzukämpfen. Für einen langen Augenblick starrten wir einander an, und ich bekam eine Gänsehaut. Seine Brust war breit und kräftig, und er roch nach Nelken.
»Versprichst du, nicht zu schreien, wenn ich meine Hand wegnehme?«, fragte er ganz leise.
Ich nickte langsam, und er nahm die Hand von meinem Mund. »Wer ist hinter dir her?«, flüsterte ich und hatte Angst, dass er mir Ärger an die Tür gebracht hatte.
»Ein paar Typen von der McCarthy-Bande. Sie wollten mich rekrutieren. Ich habe Tommy McCarthy gesagt, er soll sich verpissen, und jetzt wollen sie mir eine Abreibung verpassen.«
»Ach du Kacke«, hauchte ich.
Der Lärm draußen kam näher. Wer auch immer da war, donnerte jetzt mit den Fäusten an die Tür der Nachbarwohnung. Ich hielt ganz still, atmete kaum. Mein Blick wanderte über Dylans angespanntes Gesicht, seine umwerfenden Augen, das markante Kinn. Er trug eine graue Jeans, schwarze Stiefel und eine marineblaue Steppjacke. Sein Haar war irgendwas zwischen blond und braun und ganz leicht gelockt. Allerdings war es so kurz geschnitten, dass die Locken nicht viel Gelegenheit hatten, sich zu … locken. Er war sehr attraktiv, aber das änderte nichts daran, dass er praktisch bei mir eingebrochen war. Während mein Nachbar drüben die Tür öffnete und mit den Typen redete, die Dylan suchten, flüsterte ich: »Warum versteckst du dich ausgerechnet hier?«
Er runzelte die Stirn, es ließ ihn aussehen wie einen mürrischen Bären. »Was?«
»Du hättest genauso gut woanders klopfen können. Warum bei mir?«
Einen Herzschlag lang herrschte Schweigen, dann antwortete er endlich, ebenfalls flüsternd: »Weil du hier im Haus die Einzige bist, die mich nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen würde.«
Ich zog eine Braue hoch. »Woher willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht.«
Ehe er antworten konnte, ging das Gehämmere wieder los, diesmal an meiner Tür. Vor Angst stockte mir der Atem, mein Brustkorb krampfte sich zusammen, denn ich kannte die Sorte Burschen, die dort draußen waren. Arm. Hartgesotten. Brutal.
Im gleichen Augenblick drängte Dylan mich wieder gegen die Wand und presste mir die Hand auf den Mund, ich konnte mich nicht rühren. Diesmal wehrte ich mich nicht, sondern hielt still und gab keinen Mucks von mir. Seine Nähe jagte mir ein Kribbeln durchs Rückgrat. So nah kamen mir praktisch Fremde nur selten.
»Mach die verdammte Tür auf«, brüllte draußen eine Männerstimme, »sonst trete ich sie ein.«
»Vielleicht sollte ich aufmachen und ihnen sagen, dass du nicht hier bist«, flüsterte ich unter Dylans Hand.
Er sah zu mir herunter, vermutlich spürte er die Bewegung meiner Lippen an seiner Haut. Legte den Kopf schief, als fände er das Gefühl irgendwie interessant, dann sagte er: »Nein, dann kommen sie rein und schlagen hier alles kurz und klein.«
Angespannt stieß ich die Luft aus. Er hatte recht. Und das konnte ich Yvonne nicht antun. Ich durfte nicht zulassen, dass sie nach ihrer Schicht in der Bar eine völlig demolierte Wohnung vorfand.
Wieder hämmerte jemand gegen die Tür. Als am Fenster ein Gesicht auftauchte, zuckte ich zusammen, aber zum Glück verbargen uns Yvonnes Gardinen. »Da drinnen ist er nicht«, sagte jemand. »Wahrscheinlich ist er zu den Willows rübergerannt.«
Die Willows waren ein abbruchreifer Wohnblock, ungefähr fünf Minuten entfernt. Wer sich besaufen oder Drogen einwerfen wollte, ging dorthin. Wer obdachlos war, fand dort einen Schlafplatz.
»Na los«, sagte die erste Stimme, und der Typ, der durchs Fenster hereinsah, verschwand.
Dylan ließ mich los, durchquerte mit drei Schritten das Zimmer und spähte zwischen den Vorhängen hindurch nach draußen. »Sie sind weg«, sagte er und atmete auf, vor Erleichterung sanken seine Schultern herab.
»Na, dann solltest du jetzt auch besser gehen«, sagte ich, plötzlich wieder auf der Hut. Es machte mich nervös, dass ein fremder Junge, mit dem ich noch nie zuvor ein Wort gewechselt hatte, mitten in unserer Wohnung stand. Wobei Junge nicht ganz das richtige Wort war. Dylan war vermutlich etwa ein Jahr älter als ich, ungefähr achtzehn, hatte aber die Statur eines erwachsenen Mannes. Schon bald würden seine Schultern sogar noch breiter werden, das Gesicht markanter. Er würde ein echter Hingucker werden, da war ich sicher.
Er drehte sich wieder zu mir um und starrte mich an, eine Braue hochgezogen. Eine ganze Weile rührte er sich nicht, dann ließ er den Blick durchs Wohnzimmer schweifen. Seine Anspannung wich so etwas wie Freundlichkeit oder vielleicht auch Belustigung. »Großer New-York-Fan, hm?«, fragte er trocken angesichts all der Poster und Souvenirs.
Ich räusperte mich. »Ich nicht, aber meine Tante Yvonne. Seit sie Harry und Sally gesehen hat, ist sie von der Stadt ganz besessen. Sie spart darauf, in ein paar Jahren nach New York umzuziehen.«
Dylans Mund verzog sich nachdenklich. Es stand ihm. »Und was ist mit dir?«
»Was soll mit mir sein?«
»Gehst du dann mit?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Meine Grandma wohnt in diesem Seniorenwohnheim drüben in Broadstone. Wir sind alles, was sie noch hat. Ich könnte sie nicht einfach alleinlassen.«
Dylan dachte eine Weile darüber nach. Der Blick seiner dunklen Augen wurde sanfter. Dann ging er auf die Tür zu. »Danke, dass ich mich hier verstecken durfte.« Er warf einen raschen Blick hinaus, um zu sehen, ob die Luft rein war.
»Na klar«, sagte ich, weil mir nicht einfiel, was ich sonst sagen sollte.
Er warf mir einen letzten Blick zu. »Ich schulde dir was. Man sieht sich, Evelyn.« Und im nächsten Moment war er fort.
»Tut mir ja leid, aber für eine Nacht mit Jared würde ich meine eigene Mutter verkaufen, das steht mal fest«, sagte Sam am Montag auf dem Weg zur Englischstunde.
»Meinst du 30 Seconds to Mars-Jared-Leto oder Jordan-Catalano-Jared?«, fragte ich. »Das sind nämlich zwei total unterschiedliche Hausnummern.«
»30 Seconds natürlich. Du weißt doch, einem Mann mit Eyeliner kann ich nicht widerstehen.« Er zwinkerte mir zu. Wir erreichten gerade unsere Spinde, da tauchte ein sandbrauner Schopf in der Menge auf. Dylan. Er musste meinen Blick gespürt haben, denn er sah mich an. Bei seinem Anblick rang ich nach Luft. Unter einem Auge hatte er eine dunkelviolette Prellung, und sein Gesicht war mit Platzwunden und Schrammen übersät. Lieber Gott.
Sam war meinem Blick gefolgt und kommentierte taktlos: »Sieht ganz so aus, als ob Dylan O’Dea auf die harte Tour abfährt.«
O’Dea also. »Ich würde mal drauf tippen, dass er sich die Prügel eher auf der Straße eingefangen hat als bei einem Mädchen«, sagte ich und kaute betroffen auf meiner Unterlippe herum. Diese McCarthy-Typen mussten ihn gestern doch noch erwischt haben.
»Was du nicht sagst.« Sam lachte leise in sich hinein, aber ich fand es nicht so witzig wie er. Vor Besorgnis verspürte ich einen Stich mitten in der Brust, und ehe ich wusste, was ich tat, hatte ich mich auch schon in Bewegung gesetzt und ließ Sam bei seinem Spind stehen.
Dylan sah mich näher kommen und blieb wie angewurzelt stehen. Warf sich die Tasche über die Schulter und stieß die Luft aus. »Was?«, fragte er.
»Sie haben dich erwischt, oder?«
Er verlagerte das Gewicht aufs andere Bein, meine Sorge schien ihm unangenehm zu sein. »Nee, bin gegen eine Mauer gerannt.«
»Sei nicht albern.«
Wieder ein Seufzer. »Ja, Blondie. Sie haben mich erwischt. War wohl eh besser, es hinter mich zu bringen. Jetzt lassen sie mich vielleicht in Ruhe.«
Ich nickte langsam und wusste nicht, wie ich auf den Kosenamen reagieren sollte. Besonders originell war er zwar nicht, aber trotzdem kribbelte es auf einmal in meinem ganzen Brustkorb. »Meinst du?«
»Ich hoffe es, aber wer weiß das schon?«
»Wollten deine Lehrer wissen, woher du deine Verletzungen hast?«
Er sah mich ungläubig an. »Was meinst du denn, wo wir hier sind? Das interessiert niemanden auch nur einen Scheißdreck.«
Es fuchste mich, dass er damit leider recht hatte. Die Lehrer an dieser Schule waren entweder zu fies oder zu fertig, um sich groß darum zu scheren, wie es den Schülern zu Hause erging. Irgendwie konnte ich es ihnen nicht mal übel nehmen. Sogar die netten Lehrer hatten irgendwann die Schnauze so voll davon, schikaniert und beleidigt zu werden, dass sie emotional einfach dichtmachten. Das hier war keine freundliche Ecke, um aufzuwachsen, aber ich dachte gern über mich selbst, dass ich trotzdem noch ein Herz hatte. Ehe ich über meine nächsten Worte nachdenken konnte, waren sie schon über meine Lippen: »Aber mich kümmert es nicht nur einen Scheißdreck.«
Misstrauisch kniff er die Augen zusammen. »Warum?«
»Weil ich kein gefühlloser Klotz bin, deshalb.«
Dylan richtete den Blick über meinen Kopf hinweg in die Ferne und schob die Hände in die Taschen. »Wäre aber wahrscheinlich besser für dich«, sagte er, und dann marschierte er an mir vorbei und verschwand im Gewühl.
Uff.
»Oh Blondie, schaff mal deinen Hintern hier rüber«, rief Sam, und ich wandte mich zu meinem Freund um.
»Was denn?«, fragte ich.
»Ich wusste ja gar nicht, dass ihr euch kennt, du und Dylan O’Dea.«
Ich runzelte die Stirn. »Tun wir auch nicht. Nicht so richtig.«
Er verschränkte die Arme vor der Brust und schürzte die Lippen. »Klang aber ganz danach.«
»Da waren gestern so ein paar Typen hinter ihm her und wollten ihn zusammenschlagen, und er hat sich bei mir in der Wohnung vor ihnen versteckt. Das ist alles.«
»Oh, krasse Geschichte. Hat er sich vielleicht ganz zufällig in deinem Schlafzimmer versteckt? Und habt ihr noch ein bisschen rumgemacht, als die Luft rein war? Wie hat er sich denn bei dir bedankt?«
Wenn es darum ging, den Alltag zu einer abenteuerlichen Seifenoper umzudichten, war auf Sam Verlass. Aber bei der Erinnerung daran, wie Dylan mir den Mund zugehalten hatte, kribbelte es mit einem Mal tatsächlich in meinem Bauch. »Er hat nur gesagt, dass er mir was schuldet.« Ich zuckte mit den Schultern.
Sams Augen funkelten. »Das heißt, er schuldet dir, dich mal ordentlich durchzuvögeln.«
»Sam!«
»Was denn?«
»Sei nicht so widerlich.«
»An Sex mit so einem Kerl ist überhaupt nichts widerlich, Ev. Außerdem wird es Zeit, dass du die Blüte deiner Jungfräulichkeit mal loswirst, ehe sie schrumpelt und dahinwelkt.«
»Bitte sag nicht Blüte dazu. Und außerdem bin ich hier nicht die Einzige, die die loswerden müsste, also tu nicht so, als wüsstest du total Bescheid.«
Er sah mich frech an. »Wenn ich so hetero und so hübsch wäre wie du, dann wäre ich schon vor Jahren so weit gewesen. Aber hier in der Gegend ist es nicht gerade ein Kinderspiel, andere Schwule aufzutreiben.«
»Andere Schwule, die sich schon geoutet haben, willst du wohl sagen. Warte einfach, bis dir der nächste Typ irgendeinen homophoben Mist an den Kopf knallt – die Chancen stehen gut, dass er auch vom anderen Ufer ist.«
»Hmmm, Shane Huntley umgibt manchmal so eine Aura aggressiver Sexualität. Vielleicht liegst du da gar nicht ganz falsch.«
Wenn man vom Teufel sprach … im nächsten Augenblick kam Shane auf uns zu, mit gerümpfter Nase und seinem üblichen Arschgeigengefolge. Ich fragte mich, weshalb die ätzendsten Leute anscheinend immer die meisten Freunde hatten. Ich selbst hatte nicht die allerleiseste fiese Ader in mir, und der einzige richtige Freund, den ich hatte, war Sam.
Shane marschierte an uns vorbei und beachtete uns nicht weiter, vom Naserümpfen mal abgesehen, und ich drehte mich um und räumte in meinem Spind herum. »Ich habe in Yvonnes Büchersammlung eins von Freud gefunden. Er hatte da diese Theorie, dass wir Sachen, die wir an uns selbst nicht leiden können, an anderen regelrecht hassen.«
»Hmmm«, machte Sam. »Könnte was dran sein. Aber wie auch immer, zurück zum sinnlichen Mr O’Dea … wann willst du denn deinen Schuldschein bei ihm einlösen?«
Ich lachte leise. »Weiß ich noch nicht. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich Hilfe beim Möbelschleppen brauche. Der Kerl hat ganz schön breite Schultern.«
»Sehr gut geeignet, um dich ein bisschen durchs Schlafzimmer zu werfen.«
Ich warf ihm einen verärgerten Blick zu. »Du hast wohl nicht vor, das Thema bald mal gut sein zu lassen, richtig?«
Er zwinkerte mir zu und machte ein boshaftes Gesicht. »Jedenfalls nicht in diesem Leben, Blondie.«
2. KAPITEL
»Es ist Freitagabend, und wir haben mal wieder überhaupt nichts vor«, erklärte Sam, stieß ein gelangweiltes Seufzen aus und ließ sich aufs Sofa plumpsen.
»Gibt es denn keine Teeny-Discos, wo ihr beide hingehen könntet?«, fragte Yvonne, die sich gerade für ihre Schicht in der Bar fertig machte, und fasste ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen.
»Jede Menge«, antwortete Sam. »Aber deine Nichte hält sich für zu cool für solchen Unfug.«
»Ich halte mich nicht zu cool dafür, ich habe nur keinen Spaß daran. Dann sitzen wir ja doch nur in einer schummrigen Ecke rum und warten darauf, dass irgendwelche Typen uns bemerken. Wir tanzen nicht mal. Wozu soll das gut sein?«
»Ich verspreche dir, dass ich heute tanze, wenn du mitkommst«, bettelte Sam, rutschte vom Sofa und ging vor mir auf die Knie.
Ich zog eine Braue hoch. »Du lügst doch. Wenn wir wirklich gehen, heißt es nur wieder, ach, warum setzen wir uns nicht erst mal eine Weile, und ehe wir uns versehen, ist auch schon wieder alles vorbei, ohne dass wir auch nur das kleinste bisschen getanzt haben.«
Yvonne betrachtete Sam verwundert. »Aber du tanzt doch so wahnsinnig gern.«
»Ich tanze wahnsinnig gern zu Hause, wenn niemand zusieht«, korrigierte er. »Aber nicht in der Öffentlichkeit, wo irgendwelche Pestbeulen losgackern und sich über mich lustig machen.«
Betrübt stieß Yvonne die Luft aus. »Manchmal vergesse ich ganz, wie gemein Teenager sind. Anwesende ausgenommen.«
»Du bist erst siebenundzwanzig. Ist noch nicht so lange her, dass du selbst einer warst«, erinnerte ich sie.
Yvonne kicherte. »Danke für das Kompliment, aber manchmal kommt es mir vor, als wäre ich nie ein richtiger Teenager gewesen.«
Das war nicht gelogen. Yvonne hatte sehr viel früher als die meisten anderen die Aufgaben einer Erwachsenen übernommen und sich um meine Grandma gekümmert, als sie an MS erkrankt war, und dann auch um mich, als meine Mutter abhaute.
Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder Sam zu. »Mal im Ernst, du solltest dir von diesen Typen nichts madig machen lassen, was du liebst. Wenn dich irgendwer auch nur schief ansieht, kümmere ich mich um ihn.«
Sam tat, als würde er jeden Augenblick in Ohnmacht fallen. »Meine Heldin. Erklär mir doch noch mal, warum du nicht mit einem Penis geboren wurdest? Wir würden das perfekte Paar abgeben.«
»Damit beweist Gott mal wieder, was für einen kranken Humor er hat – macht uns zu Seelengefährten, aber gibt uns die falsche Ausstattung«, neckte ich ihn.
»Ihr zwei seid so bescheuert.« Yvonne schüttelte den Kopf. »Was auch immer ihr heute Abend anstellt, passt auf euch auf, ja? Ich komme heute spät.«
»Machen wir. Bis morgen früh.«
»Bis dann, Liebes«, sagte sie, gab erst mir zum Abschied einen Kuss auf die Schläfe und dann Sam. Ich schwöre es, sie war uns sehr viel mehr eine Mutter als unsere biologischen Eltern. Ich lebte seit meinem dreizehnten Lebensjahr bei Yvonne – seit meine Mutter beschlossen hatte, ihr Leben nicht länger damit zu verschwenden, sich um ein Kind zu kümmern. Sie hatte mich bei ihrer viel netteren, verantwortungsvolleren jüngeren Schwester gelassen und war nach London gezogen, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Anscheinend ging es bei ihrem Lebenstraum darum, in einer Klamottenboutique zu arbeiten, ihren ganzen Lohn für Alkohol auf den Kopf zu hauen und ihr Herz an ständig wechselnde, aber immer gleich lieblose Männer zu verschenken. Jedes Mal, wenn sie anrief, schien sie irgendeinen neuen Freund am Start zu haben, aber man konnte mit ihr über nichts richtig reden. Um ehrlich zu sein, war es mir lieber so. Mein Leben bei Yvonne war so viel geordneter als früher bei Mom.
Ich sah Sam an. »Ich würde mal sagen, wenn wir das wirklich durchziehen, sollte ich mich wohl besser noch umziehen.«
»Ach was, Schlafanzughosen und fleckige T-Shirts sind gerade total angesagt«, antwortete er sarkastisch.
Ich warf ein Kissen nach ihm, stand auf und schlurfte in mein Zimmer. Am Ende entschied ich mich für ein enges schwarzes Minikleid, Spitzenstrumpfhose, Stiefeletten und eine Jeansjacke. Sam trug bereits Jeans und T-Shirt, musste sich also nicht mehr umziehen. Manchmal beneidete ich Jungs darum, wie wenig Aufwand es sie kostete, gut auszusehen. Ein bisschen Haargel, ein Spritzer Deo, und sie waren fertig.
Unterwegs hakte ich mich bei ihm ein. Wir nahmen die Treppe auf der Rückseite des Gebäudes – wenn wir vorne rausgingen, rannten wir so gut wie sicher irgendwelchen Arschlöchern über den Weg, die auf Ärger aus waren, hinten hingegen war normalerweise niemand. Heute sah ich auf den beiden untersten Stufen allerdings ein paar Leute sitzen. Beim Näherkommen erkannte ich Dylan und seine Freunde Amy und Conor. Sie passten optisch überhaupt nicht zueinander – Amy, die sich alle Mühe gab, auszusehen wie Robert Smith von TheCure, und Conor mit seinen dicken Brillengläsern und dem lockigen Haarschopf. Er war außerdem der einzige Teenager im gesamten Wohnblock mit einer weißen Mutter und einem schwarzen Vater. Er hatte es hier nicht gerade leicht. Und dann war da noch Dylan, gut aussehend und clever genug, um sich anzufreunden, mit wem er wollte. Stattdessen hatte er sich ausgerechnet diese beiden als beste Kumpel ausgesucht. Vielleicht gerade, weil er schlau war. Vielleicht sah er etwas in ihnen, das wir anderen nicht bemerkten. Jedenfalls gehörte das zu den Dingen, die ich an ihm bewunderte. Er passte sich nicht an, lief nicht mit der Herde mit.
Normalerweise wären Sam und ich grußlos an den dreien vorbeigelaufen, aber weil ich Dylan ja jetzt quasi irgendwie kannte, blieben wir stehen. »Hey Dylan«, sagte Sam. »Du siehst schon ein bisschen besser aus. Verheilt gut.«
Ich schloss die Augen und verzog das Gesicht. Mal im Ernst … ich hatte Sam sehr lieb und so, aber wenn irgendwo ein unsichtbarer Elefant im Raum stand, schlug er niemals einen Bogen um ihn, sondern packte ihn geradewegs bei den Stoßzähnen.
»Was geht das dich denn an?«, fragte Amy abweisend. Von allen Mädchen hier im Block war sie eindeutig die größte Kratzbürste. Andererseits zog ihr Kleidungsstil eine Menge negative Aufmerksamkeit auf sich, also hatte sie vielleicht keine andere Wahl, als kratzbürstig sein. Ich hatte mich schon oft gefragt, was sie hier in St. Mary’s Villas wollte, immerhin war es nicht gerade so, dass man Goths – oder sonst jemanden, der irgendwie anders war – hier besonders herzlich willkommen hieß. Und sie schleppte ständig diese kleine Videokamera mit sich herum und nahm den ganzen Tag irgendwelches Zeug auf. Vielleicht war sie vom Film besessen und wollte, was weiß ich, Regisseurin oder so etwas werden. Aber es machte die Leute irre, wenn sie merkten, dass sie gefilmt wurden. Es nötigte mir Respekt ab, dass sie sich trotz aller Widerstände treu blieb.
»Ich frag ja nur«, antwortete Sam. »Musst mir nicht gleich den Kopf abreißen.«
Amy starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an und trank einen Schluck aus ihrer Bierdose. Neben Dylan stand ein Sixpack, und ich schloss daraus, dass sie vorhatten, den Abend hier zu verbringen. Jedenfalls wollten sie eindeutig nicht tanzen gehen.
Dylan musterte mich, beginnend bei den Stiefeletten, dann wanderte sein Blick langsam meinen Körper hinauf. Unter seinem Blick fing es in meinem Magen an zu kribbeln, als flatterte darin eine ganz besondere und seltene Sorte Schmetterlinge herum. Dylan-O’Dea-Schmetterlinge gehörten zu jenen Prachtexemplaren, die Leute gern einfingen und eingerahmt an die Wand hängten. Es war echt schräg, wie überdeutlich ich ihn auf einmal wahrnahm, denn bis vor Kurzem hatte ich ihn gar nicht weiter beachtet, höchstens am Rande bemerkt, dass er attraktiv war und in der Schule die üblichen Cliquen mied. Vielleicht wäre es gut, wenn häufiger mal fremde Jungs ungebeten in meine Wohnung platzten.
»Wo wollt ihr denn hin?«, fragte er mit seiner tiefen Stimme.
»Tanzen, drüben im Sweeney’s«, antwortete ich und wickelte mich fester in meine Jacke.
Er sah mir unverwandt in die Augen. »Warum?«
Ich runzelte die Stirn. »Was meinst du mit warum?«
»Ev tanzt wahnsinnig gern«, mischte sich Sam ein. »Darum gehen wir dorthin.«
Amy stieß ein leises, spöttisches Schnauben aus, und ich ärgerte mich, sagte aber nichts. Conor sah schüchtern zu Boden, und Dylan ließ mich immer noch nicht aus den Augen. Ich hob eine Hand und sagte: »Schuldig im Sinne der Anklage.«
Mann, warum hatte ich das gesagt? Aber ehe es mir so richtig peinlich werden konnte, griff Dylan nach meiner immer noch erhobenen Hand und zog mich neben sich auf die Stufen. Bei der vertraulichen Berührung holte ich tief Luft. »Bleibt hier und trinkt was mit. Betrachte das als den Gefallen, den ich dir noch schulde.«
»Und was soll daran ein Gefallen sein?«, erkundigte ich mich.
»Weil es dich davor bewahrt, zu Pop aus den Neunzigern zu tanzen und von besoffenen Fünfzehnjährigen angebaggert zu werden.
»Ha! Da hat er nicht ganz unrecht«, flötete Sam und setzte sich neben Amy, trotz ihrer abweisenden Miene. Typisch Sam. So leicht ließ er sich nicht abschrecken – finstere Blicke erwiderte er einfach mit einem strahlenden Lächeln.
Ich rang noch mit mir, ob ich lieber hierbleiben und mit Dylan abhängen wollte, statt ins Sweeney’s zu gehen, da kamen Shane Huntley und Anhang um die Ecke und steuerten aufs Gebäude zu. Shane hatte sich den Kopf geschoren und trug seine Alltagsuniform aus Jeans, Ben-Sherman-Shirt und makellos weißen Adidas-Turnschuhen. So lief er immer rum, wenn er nicht gerade die Schuluniform trug – was er immer auf seine eigene Weise tat. Manchmal knotete er sich die Krawatte um den Kopf – in Rambo-Manier. An anderen Tagen trug er das Hemd, aber keinen Pullover dazu, oder den Pullover ohne das Hemd. Entweder kriegte er es mit der Wäsche schlecht auf die Reihe, oder er weigerte sich einfach, sich an die Bekleidungsregeln zu halten.
Rasch musterte er unser kleines Grüppchen, wobei sein Blick am längsten an Sam hängen blieb. Ein seltsamer, fast gequälter Ausdruck huschte über sein Gesicht, ehe er es mit einem Schnauben überspielte. Normalerweise neigte ich nicht dazu, Leute zu verabscheuen, aber Shane hasste ich dafür, wie er Sam behandelte. »Wie geht’s denn so, Jungs?«, fragte Shane, zog eine Zigarette hinter seinem Ohr hervor und zündete sie an.
»Ich glaube, hier sind auch ein paar Mädchen anwesend«, bemerkte Amy spitz.
Shane sah von Amy zu mir. »Ich sehe keine.«
Oh, Superspruch. Innerlich verdrehte ich die Augen. Seine Freunde kicherten, und ich spürte, wie sich Dylan neben mir versteifte. Shane taxierte ihn kurz und konzentrierte sich wieder auf Sam. Sam war eins von Shanes Lieblingszielen. Nur selten verging ein Schultag, ohne dass er ihn mit der einen oder anderen homophoben Beleidigung bedachte, aber wie es aussah, war es heute anders.
»Was treibst du denn hier, Sammy? Solltest du nicht eigentlich unten beim George sein und dich in den Toiletten durchnehmen lassen?«
The George war eine weithin bekannte Schwulenkneipe. Ich biss die Zähne zusammen und wollte gerade etwas Bissiges erwidern, da kam mir Sam zuvor. »Wieso? Macht dich der Gedanke etwa an?«
Von einem Augenblick zum anderen wurde die Belustigung in Shanes Gesicht zu Wut. »Was hast du da gerade gesagt?«
Da stand Dylan auf und trat einen Schritt auf Shane zu. Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte ihm geradewegs ins Gesicht. »Du verziehst dich jetzt besser.«
»Vor dir habe ich keine Angst, O’Dea. Hab gehört, die McCarthy-Jungs hätten dich gestern fast totgeprügelt, und wie ich jetzt sehe, stimmt das wohl.«
In aller Ruhe hob Dylan seine Bierdose zum Mund, leerte sie und warf sie weg. »Das Gerücht, dass ich dir das dumme Maul gestopft habe, wird ebenfalls stimmen.«
Mit zusammengekniffenen Augen starrte Shane ihn an und überlegte offenbar, ob er es riskieren sollte. »Da muss schon ein anderer kommen als du, um mir das Maul zu stopfen«, sagte er schließlich und drehte sich zu seinen Kumpels um. »Hauen wir ab. Hier stinkt’s nach Schwuchteln.«
Einer seiner Freunde musterte Conor mit verschlagenem Blick und murmelte etwas Abstoßendes, ehe sie weitergingen. Amy hatte es ebenfalls verstanden, sie richtete sich auf und stellte sich vor Wut schäumend neben Dylan. »Wow, ein homophobes Arschloch und ein Rassist. Ihr habt euch echt verdient.«
Einige von ihnen zeigten ihr den Mittelfinger und riefen noch ein paar Beleidigungen. Sie ballte die Fäuste, und Conor streckte die Hand nach ihr aus und sagte, das sei es nicht wert. Als die Typen weg waren, setzte sich Dylan wieder hin, aber sein kerzengerades Rückgrat verriet mir, dass er immer noch vor Wut kochte. Ich kannte ihn ja fast gar nicht, aber es bedeutete mir viel, dass er sich so für Sam einsetzte. Er kannte uns schließlich ebenfalls kaum, und trotzdem verteidigte er uns. Am liebsten hätte ich mich bei ihm bedankt, aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Hat irgendwer gehört, dass er was gegen das mit dem dummen Maul gesagt hat?«, fragte Conor, als wollte er die Stimmung auflockern.
Ich lächelte ihm zu. »Ich würde mal drauf tippen, dass dumm zu sein unter denen als cool gilt.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Und diese Leute pflanzen sich fort wie die Karnickel. Ehe wir uns versehen, sieht es auf der Welt aus wie in diesem Film. Ihr wisst schon, Idiocracy.«
»Und dann ist Shane Präsident«, sagte ich erschauernd.
»Ach, aber wir könnten dann ja die Rebellion ins Leben rufen«, erwiderte er. »Wir nennen uns die Anti-Huntleys.«
»Tja, ihr beiden könnt dann ja der Brad und die Angelina der Rebellion sein«, trompetete Sam und zwinkerte mir zu. Himmel, seit Brads Scheidung von Jennifer Aniston letztes Jahr war Sam wie besessen von seiner neuen Beziehung zu Angelina Jolie. Ständig brachte er es fertig, die beiden irgendwie ins Gespräch einzubauen. Und mir war klar, dass er mit seinem Zwinkern andeuten wollte, dass ich mit Conor flirtete, was überhaupt nicht stimmte.
Conor errötete und wandte den Blick ab, und Dylan öffnete ein neues Bier. Schweigend reichte er es mir, dann gab er Sam auch eins. Stammelnd brachte ich ein leises »Danke« heraus und nippte daran.
»Conor interessiert sich nicht für Evelyn, er mag ältere Frauen«, teilte uns Amy mit, und Conor bedachte sie mit einem mörderischen Blick.
»Halt bloß deine verdammte Klappe, Amy«, zischte er.
»Was soll das denn jetzt heißen?«, erkundigte sich Sam kühn.
»Er steht auf deine Tante«, sagte Amy, ohne sich daran zu stören, dass Conor sie mit Blicken zu erdolchen versuchte.
Ich drehte mich zu ihm um und glotzte ihn an. »Du magst Yvonne?«
Verlegen zuckte er mit den Schultern. »Sie ist nett zu mir.«
Yvonne war zu jedem nett. Ihr Herz war so groß wie die weite Welt, und Conor lebte nur ein paar Türen von uns entfernt. Bestimmt lief er ihr ab und zu über den Weg. Allerdings war ich ziemlich sicher, dass er Yvonne nicht auf diese Art aufgefallen war. Nicht bei ihrem Altersunterschied.
»Wie alt bist du?«
»Achtzehn«, antwortete er abwehrend.
»Meine Tante ist siebenundzwanzig. Das sind neun Jahre Unterschied.«
»Wenn es andersrum wäre, würde sich keiner was dabei denken«, warf Dylan ein.
Beim Klang seiner Stimme ging ein Kribbeln durch meinen ganzen Körper. Seit Shanes Abgang hatte er kein Wort mehr gesagt. Ich warf ihm einen raschen Blick zu und stellte fest, dass er mein Profil betrachtet hatte. Ich wandte den Blick wieder ab.
»Ganz genau«, bemerkte Amy. »So ein Altersunterschied ist doch nichts Schlimmes, solange beide volljährig sind und die Beziehung wollen.«
»Hab ich ja auch gar nicht gesagt. Nur bin ich ziemlich sicher, dass meine Tante das anders sehen würde. Bisher waren alle ihre Freunde älter als sie.«
»Hat doch nichts zu sagen«, wandte Sam ein. »Ich finde, du solltest ihr sagen, was du empfindest, Conor. Denk dir irgendeine große romantische Geste aus und leg ihr dein Herz zu Füßen.«
Conor verzog das Gesicht. Ich versetzte Sam einen leichten Klaps. »Sei kein Arsch.«
Wenn Conor das täte, würde er sich nur blamieren, und das war Sam völlig klar. Er wollte einfach nur ein bisschen Unheil stiften. Ich betrachtete den schlaksigen Conor mit seiner unordentlichen Lockenfrisur und den dicken Brillengläsern. Eigentlich war er gar nicht unattraktiv, er hatte ein freundliches, recht hübsches Gesicht, aber er war so durch und durch Teenager, dass es fast wehtat. Er wirkte wie fünfzehn, allerhöchstens sechzehn. Yvonne sah in ihm vermutlich nichts weiter als irgendein beliebiges Kind, das zufällig im selben Haus wohnte.
»Warte vielleicht noch ein oder zwei Jahre«, riet ich ihm freundlich. »Dann bist du zwanzig, und es spielt keine so große Rolle mehr.«
Er stieß einen gequälten Seufzer aus. »Mann, es ist ja nicht so, dass ich unsterblich in sie verliebt wäre oder was weiß ich. Ich finde sie nur hübsch. Und sie trägt immer High Heels.«
»Oh, darauf stehst du wohl, was?«, fragte Sam und zwinkerte ihm zu.
»Tun doch die meisten Männer«, sagte Dylan leise.
Die Art, wie er es sagte, jagte mir ein Kribbeln übers Rückgrat.
»Ich bevorzuge eine nette Levis mit engem Schritt«, erwiderte Sam, und Dylans Lippen zuckten fast unmerklich.
»Ach ja?«
»Jepp. Du solltest dir mal eine anschaffen. Ich bin sicher, Ev hätte nichts dagegen.«
Oh Sam, jetzt halte doch bitte mal die Klappe.
Dylan stupste mich leicht gegen die Schulter. »Stimmt das?«
»Hör ihm gar nicht zu«, murmelte ich und lief knallrot an. Ich würde mir Sam nachher so was von vorknöpfen.
»Shane Huntley trägt Levis«, sagte Amy und musterte Sam schräg von der Seite. »Kommt deine Vorliebe vielleicht daher?«
Ich war ihr sehr dankbar dafür, dass sie die allgemeine Aufmerksamkeit von mir ablenkte und stattdessen Sam in den Mittelpunkt rückte. Der kleine Scheißer hatte es nicht anders verdient.
Aber natürlich wich er mal wieder elegant aus, so wie immer. »Wo wir gerade von Shane reden, Ev hat da eine Theorie. Sie glaubt, sein ätzendes Verhalten kommt daher, dass er seine eigene Homosexualität unterdrückt. Das ist wohl so was Freudianisches.«
Es überraschte mich, dass er anscheinend wirklich zugehört hatte. »Ich habe das nur mal irgendwo gelesen. Kann sein, dass es gar nicht stimmt.«
»Nee, du hast schon recht«, sagte Dylan, und Freude durchrieselte mich. »Ich habe da mal einen Artikel gelesen – sie haben eine Gruppe Männer untersucht, und diejenigen mit den homophobsten Ansichten wiesen bei der Betrachtung von Bildern, auf denen Männer miteinander intim waren, im Schnitt eine messbar höhere genitale Vaskularität auf.«
Sam starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an, ehe er sich an Dylan wandte. »Ich habe noch nie gehört, wie jemand in guter Gesellschaft die Worte ›genitale Vaskularität‹ gebraucht hat.«
Ich kicherte. »Aber in schlechter Gesellschaft schon?«
Er winkte ab. »Du weißt schon, was ich meine.«
»Du hast zu viele von Yvonnes historischen Liebesromanen gelesen.«
»Yvonne liest Liebesromane?«, sprang Conor sofort auf das kleine Informationsbröckchen an.
Ich warf ihm einen Blick zu, »Ja, macht sie. Das tun viele Frauen.«
Er senkte den Blick. »Ist es die, äh, sexy Sorte?«
»Oh Mann, dich hat’s ja echt schlimm erwischt. Das sag ich dir ganz sicher nicht. Mir gefällt die Vorstellung gar nicht, dass du irgendwelchen Fantasien über meine Tante nachhängst.«
»Schon längst zu spät.« Dylan kicherte, dann nahm er einen ordentlichen Schluck Lager.
Ich musterte ihn. Er war wirklich ein eigenartiger Typ. Von einem Teenager aus St. Mary’s hätte ich jedenfalls nicht erwartet, dass er Studien über Vorurteile und menschliche Sexualität las. Ich selbst kam mit so etwas ja auch nur in Berührung, weil Yvonne bei Büchern ein so breit gefächertes Interesse hatte. Zu ihrem Bedauern hatte sie nie genug Geld fürs College gehabt, deshalb bildete sie sich in ihrer Freizeit selbst fort. Und weil sie ständig mit mir über ihre Ideen und Gedanken sprach, hatte ich im Lauf der Zeit einiges an Secondhand-Wissen absorbiert.
»Klappe«, flüsterte Conor peinlich berührt.
»Nichts, wofür du dich schämen müsstest«, sagte Sam. »Yvonne ist echt eine heiße Mommy. Wenn ich hetero wäre, würde ich auch von ihr fantasieren.«
»Aber stattdessen fantasierst du von Shane«, konterte Amy.
»Oh Gott, hörst du jetzt mal auf? Was auch immer Ev und Dylan sich da so hochtrabend zusammenreimen, er ist nicht schwul. Er ist einfach nur ein Schläger.«
»Ja, ein sexy Schläger, von dem du gern mit offenen Augen träumst«, stichelte sie weiter.
Ich beschloss, meinem Freund zu Hilfe zu kommen, obwohl er es nicht verdiente. »Nee, dafür ist Sam viel zu beschäftigt damit, von Jared Leto zu träumen. Für einen anderen ist da kein Platz mehr.«
Amys Augenbrauen schossen nach oben, und sie starrte Sam an. »Wow, also gibt es doch etwas, wo du guten Geschmack beweist.«
»Pfoten weg von Mr Leto«, erwiderte Sam, jetzt wieder ganz vergnügt. »Er gehört mir allein.«
»Habt ihr das hier eigentlich schon gesehen?«, unterbrach Conor und startete ein Video auf seinem Handy – das übrigens ganz schön teuer aussah. Er wäre gut beraten, es in den Villas nicht so offen herumzuzeigen, sonst wurde es ihm noch geklaut. Im Video war ein asiatischer Typ zu sehen, der von diversen Dächern, Geländern und Wänden sprang.
»Besser er als ich«, sagte Sam. »Aber auf jeden Fall ganz schön beeindruckend.«
»Ich weiß. Im Netz gehen gerade alle voll drauf ab«, sagte Conor. »Echt heftiger Party-Trick.«
»Das nennt man Free Running«, sagte Dylan. »Und es ist ein Sport, kein Party-Trick.«
»Du bist ein Party-Trick-Snob«, sagte Amy. »Nur weil du glaubst, dein eigener wäre am besten.«
»Was kannst du denn Besonderes?«, fragte ich.
»Er kann jeden beliebigen Geruch erraten«, erklärte Conor, als wäre es das Aufregendste, was man sich nur vorstellen konnte.
»Euch kann man ja echt leicht beeindrucken«, befand Sam trocken. »Ich bin ziemlich sicher, dass das die meisten Leute draufhaben.«
»Nein, du hast das falsch verstanden. Dylan riecht an irgendwas, ganz egal, ob Pastasauce oder Duftkerze, und zählt dir dann sämtliche Zutaten auf«, wandte Conor ein. »Es ist völlig irre.«