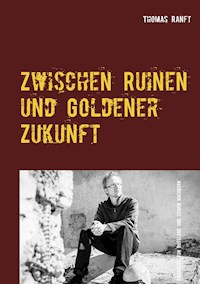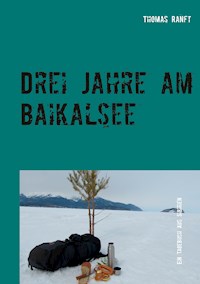
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie lebt es sich siebentausend Kilometer weiter im Osten? Der Autor erzählt vom überraschenden Lehralltag an einer sibirischen Universität, der auf den ersten Blick ähnlichen und doch mitunter ganz anderen Mentalität der Menschen in Russland und spannenden Begegnungen auf endlosen Zugfahrten mit der transsibirischen Eisenbahn. Und natürlich geht es um das Leben am Baikalsee, dem Herzen Sibiriens, wo im Sommer die Taigawälder brennen und im Winter bei minus fünfunddreißig Grad Autos über eine anderthalb Meter dicke Eisdecke fahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Abschied
Berlin – Moskau
Moskau
Moskau – Ulan-Ude
In einer
Chruschtschowka
Treffpunkt Panzer
Auf dem Markt
Treffpunkt Theater
Schlafende Verkäuferin, schwankendes Briefporto
Mein erstes Wochenende am Baikal
Treffpunkt Leninkopf
Jukari und Wakana
Kamelhaar, Kaffee, kleiner Ausflug
Kollegen, Konto und Kleidung
Die russische Mongolei
Kontraste
Gremjatschinsk
Unterricht
Bürokratie
Kultur
Verabredungen auf russische Art
Transsib
Küche statt Krim
Essen
Pädagogik
Sibirien von oben
Wahrheitssuche zwischen Russland und dem Westen
Zwei Celli
Müll
Alltag, Amerikaner und Adolf
Beratung
Lenin und Buddha
Maksimicha
Bildung
Ulan-Ude und Chabarowsk
Etwas Kulturwissenschaft: Hofstede und Hall
Ulan-Ude – Wladiwostok
Wladiwostok
Wladiwostok – Ulan-Ude
Die Entdeckung der Langsamkeit
Kulturschock und Rock
Christstollen in Sibirien
Ust-Bargusin
Minus vierunddreißig
Prüfungszeit
Heimaturlaub
Zwischen den Reisen
Ulan-Bator
Mongolei
Sanitätskontrolle und Pferdekopfgeige
Wo das neue Jahr im Februar beginnt
Kein Problem, egal und möglicherweise
Auf dem Weg in die kälteste Großstadt der Welt
Jakutsk
Auf der Lena
Frühlingsgefühle
Wintergefühle, oder: Eisangeln auf dem Baikal
Eindrücke aus dem Unterrichtsalltag
Auf der Heiligen Nase
Musik und Menschen
Casting
Schein und Sein
Kurumkan
Mir gefällt, dass unsere Deutschkurs ist ungewöhnlich
Niso
Menschliches Moskau
Moskau: Metro und GULAG-Museum
Schulbesuch auf dem Land
Tomsk
Zeitzonen in Russland
Kommunikation in Russland
Auf Besuch bei den Altgläubigen
Waldbrände und Thermalquellen
Ende des Studienjahres
Straßenmusik!
Besuch aus Deutschland
Gästeprogramm
Baikal, Bliný, Bibliotheken
Transsib, Taiga, tote Tiere
Mit Musik durch Moskau
Isaak und Gera
Am Südrand des Sowjet-Imperiums
Armenien
Siebzehn Jahrhunderte Christentum
Jerevan
Wort und Wirklichkeit
Herbst
Von Grenzen und Wahlen
Meine zehn Minuten im russischen Staatsfernsehen
Thomas from Germany. Englisch auf der Dorfschule
Herbstliche Botanik am „Schlafenden Löwen“
Burjatische Volksmusik
Macht und Geld
Rechnen auf russisch
Zirkus
Eine Nacht im Frauenkloster
Posolsk. Eine Nacht im Männerkloster
Eine Nacht in Tschita
Russenmafia
Frust
Straßenverkehr in Ulan-Ude
Der Krim-Krimi
Pjervomajskoje
Sevastopol
Jalta
Alúpka
Simferopol
Eisige Wunderwelt Olchon
Quer über den Baikal
Plusgrade
Uni-Episoden
Erster Klasse nach Krasnojarsk
Abakan
Munku-Sardyk, 3491 m
Form und Freiheit
Militärparade und Unsterbliches Regiment
Leben in der Steppe
Reisemüde
Sowjet-Nostalgie
Bildung und Medizin
Ich kann gerade nicht sprechen
Glinka
Chamar-Daban
Die Geheimnisse Putins und Deutschlands
Heil Hitler und willkommen in Tadschikistan
Die Macht des Dolmetschers
Im buddhistischen Kloster Ivolginsk
Heimat
Russland, China und der Amur
Der Geruch des Ostens
Unliebsame Tiere und unvermeidbare Visa
Die Schreibmaschine
Ein Wintermärchen
Pelz und Politik
Väterchen Frost und der Weihnachtsmann
Bishkek – ein Reisebericht aus Kirgistan
Auf dem Pamir-Trakt durch die asiatische Schweiz
Osh
Warum ich ein Stipendium bekommen möchte
WAZ 2115 (Lada Samara)
Die unsichtbare Schlange
WWP-2018
Misstrauen und Hilfsbereitschaft
Familienleben
Glaube und Gesetz
Am Ende der Welt
Von schneller Hilfe und schneller Post
Akzente
Nach Norden
Russische Wege
Im schönsten Land der Erde: Tadschikistan II
Ferien und Fahrschule
An den Rändern der Zivilisation
Vier Enden
Axt und Auge
Willkommen in Russland
Russland extrem
Literaturempfehlungen zu Russland und Sibirien
Landkarte der Region
Ortsregister
Vorwort
Die erste Bekanntschaft mit Russland machte ich in meiner Jugend. Gierig verschlang ich die Romane Turgenjews und Erzählungen Tolstojs aus der väterlichen Bibliothek und hörte Sinfonien von Tschaikowskij und Schostakowitsch. Als in der siebten Klasse die Wahl der zweiten Fremdsprache getroffen werden musste, entschied ich mich für Französisch statt Russisch: zu mühsam erschien es mir, ein neues Alphabet zu erlernen; ohnehin galt mein Interesse nicht den Sprachen, sondern eher den Naturwissenschaften.
Nach dem Ende von Schule und Zivildienst in meiner Heimatstadt Leipzig entdeckte ich die Freude am Reisen und Sprachenlernen. Zunächst verschlug es mich für ein Jahr nach Norwegen, dann für einige Monate nach Israel. Das Studium der Biologie an der Uni Kiel brach ich nach drei Semestern frustriert ab und absolvierte stattdessen eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner im benachbarten Botanischen Garten. Hier lernte ich einen Praktikanten aus der Ostukraine kennen, bei dem ich versuchte, meine ersten Brocken Russisch anzuwenden: Anna Karenina einmal im Original zu verstehen war jetzt mein erklärtes Ziel. Die Gespräche fand ich viel spannender als das Gärtnern, und so reifte mein Entschluss zum Studium der russischen Sprache und des Faches Deutsch als Fremdsprache in Potsdam.
Nach einem einjährigen Aufenthalt als Deutschlehrer in der fernöstlichen russischen Stadt Chabarowsk unterrichtete ich Migranten an der Potsdamer Volkshochschule und besuchte im Auftrag eines Berliner Vereins, der Praktikantenaustauschprogramme mit Osteuropa organisiert, zahlreiche Städte im europäischen Teil Russlands. Im Sommer 2015 trat ich meine längste Reise mit unbekanntem Rückkehrdatum an: an den Baikalsee sollte es gehen, in eine Welt, in der sich europäische und asiatische Kulturen, Steppe und Taigawald treffen und wo mich an einer Universität in der burjatischen Hauptstadt Ulan-Ude eine Stelle als Lehrkraft für deutsche Sprache und Landeskunde erwartete.
Fünf Jahre sollten es insgesamt werden, die ich am Baikalsee zugebracht habe. Von den ersten drei Jahren erzählt dieses Buch, die Erlebnisse der nachfolgenden Zeit sind in meinem zweiten Buch „Zwischen Ruinen und Goldener Zukunft“ beschrieben.
Abschied
10.08.15: Nach neun Jahren werde ich mich morgen von Potsdam verabschieden und einen Zug nach Russland besteigen: die nächsten Jahre meines Lebens möchte ich in Sibirien verbringen, um an der Staatlichen Burjatischen Universität in der Stadt Ulan-Ude die deutsche Sprache und Landeskunde zu unterrichten. Mit zwei Hundert-Liter-Koffern und einem großen Rucksack, insgesamt etwa fünfundsiebzig Kilo, besteige ich in Berlin-Hauptbahnhof den Zug nach Moskau.
Berlin – Moskau
11.08.: Seit einiger Zeit verkehrt der durchgehende Zug Berlin-Moskau nicht mehr täglich, sondern nur noch zweimal wöchentlich, und mit neuen Waggons, die mit geräumigen Vierer-Coupés statt den bisherigen Dreier-Abteilen ausgestattet sind. In einigen der Coupés werden statt vier nur zwei Plätze verkauft, die dafür teurer sind - eine solche Fahrkarte hatte ich vor einem Monat erstanden, zweihundertdreißig Euro, teurer als das Flugzeug.
Mein Mitreisender im Abteil saß schon seit Paris im Zug. Ein älterer Herr wohl um die sechzig, in Frankreich zweisprachig russisch-französisch aufgewachsen; sein Vater war nach dem ersten Weltkrieg, wie viele andere Russen auch, vor den Kommunisten geflohen, da er als „weißer" Offizier im russischen Bürgerkrieg auf der Seite der Verlierer gekämpft hatte, und in die französische Hauptstadt emigriert. Ein überaus angenehmer, interessanter Gesprächspartner, der sein Leben lang Theater- und Musikergruppen auf Gastspielen begleitet hatte, den Cellisten Mstislav Rostropowitsch persönlich kannte und das Spiel der siebensaitigen Gitarre erlernt hatte. Nach einer Weile stellte sich heraus, dass Jean-Pierre – in Russland Pjotr – nicht sechzig, sondern dreiundachzig Jahre alt war. Wie hat er das wohl geschafft? Kein Kristallzucker und völliger Verzicht auf Internet und Mobiltelefon, war seine Erklärung...vielleicht liegt hier das Geheimnis langen, gesunden Lebens?
Statt des traditionellen Kessels mit heißem Wasser im Gang konnten die Passagiere ins Abteil der Zugbegleiterin gehen und sich dort mit dem Wasserkocher kostenlos den mitgebrachten Tee aufbrühen. Insgesamt war ich von vormittags halb elf bis mittags halb eins des Folgetages im Zug, unterwegs war die Uhr eine Stunde vorzustellen - macht fünfundzwanzig Stunden Reisezeit. Da es in Russland keine Sommerzeit gibt, schrumpft der Zeitunterschied von Berlin zu Moskau im Sommer von zwei auf eine Stunde.
Spät abends überquerten wir die EU-Außengrenze von Polen nach Weißrussland und hielten in Brest. Eine junge, sehr strenge und sehr motivierte Zollbeamte kam in unser Abteil und begann mich auszufragen. Wohin fahren Sie? – Nach Moskau. – Was haben Sie alles im Rucksack? – Klamotten, ein Notebook... – Und wessen Koffer sind das da unten? – Auch meine. – So viel Gepäck? Das müssen wir mal wiegen. Sie wissen, dass maximal fünfzig Kilo erlaubt sind? – Ich bekam einen Schweißausbruch. Wenige Minuten später kam ein Kollege ins Abteil und hängte meine Gepäckstücke nacheinander an seine Waage. Einundsiebzig. Also einundzwanzig Kilo Übergewicht!
Ich begann schon fieberhaft zu überlegen, ob ich jetzt ein knappes Drittel meiner Sachen wegschmeißen oder nach Berlin zurückfahren muss, doch zum Glück gab es eine Lösung: jedes Kilo zuviel kostet vier Euro Strafe. Die Zollbeamte stieg mit mir aus dem Zug, half mir beim Ausfüllen der Zolldeklaration, ging mit mir zur Bank und tätigte meine Bareinzahlung der Strafgebühr, in Euro. Als Wechselgeld bekam ich Euro zurück, sowie knapp neuntausend belarussische Rubel in Scheinen. Ein stolzer Scheinestapel, frisch aus der Geldpresse. Bei einem Umtauschkurs von eins zu siebzehntausend allerdings nicht mal ein einziger Euro, und ich konnte mir gerade so einen Tee im Bahnhofscafé davon kaufen. Während sich die ambitionierte Zollbeamte um mich kümmerte, fuhr der Zug in eine Werkhalle ein, wo die Räder auf russische Breitspur umgestellt wurden, ein Vorgang, bei dem die Passagiere normalerweise sitzenbleiben.
In Moskau holte mich ein Bekannter vom Bahnhof ab und wir fuhren mit der Metro ans Südostende der Stadt zu seiner Wohnung in einem Hochhaus im Mikrorajon Njekrasovka.
Moskau
14.08.: Heute Mittag werde ich im Kazaner Bahnhof den Zug 082IA, Wagen 16P besteigen, der mich in drei Tagen, siebzehn Stunden und vier Minuten nach Ulan-Ude bringt. Wie üblich habe ich einen oberen seitlichen Schlafplatz in einem Plazkart genannten offenen Großraumwagen gebucht und diesmal auch den Fahrplan mit allen Zwischenstationen ausgedruckt, um bei längeren Halten das Aussteigen und Sich-die-Beine-vertreten auf dem Bahnsteig nicht zu vergessen: fünfzehn Minuten in Kazan, fünfzig Minuten in Jekaterinburg, vierundfünfzig in Novosibirsk, vierzig in Irkutsk… Zwischenhalte gibt es etwa aller zwei Stunden, die aber oft nur wenige Minuten dauern.
Ich besuche immer wieder gern den Zwölf-Millionen-Moloch Moskau – und bin immer wieder froh, wenn ich nach ein paar Tagen abreisen kann. Auf Dauer wären die Fahrten in der höllisch laut kreischenden Metro, die sich durch die Gänge der Metrostationen wälzenden Menschenmassen und überhaupt die Zeit, die man in den oft proppenvollen Verkehrsmitteln verbringt, um von A nach B zu gelangen, nichts für mich. Für meine Bekannte Mascha, in Ulan-Ude geborene Geigerin, ist es hingegen genau das Richtige: ihre überschüssige Energie wird sie wunderbar los, indem sie von einem Ende der Stadt zum anderen hastet, meint sie. Wir gingen auf dem Bulvarnoje koltso spazieren, einen den Stadtkern umspannenden Straßenring mit breitem Grünstreifen in der Mitte und zahlreichen Denkmälern, so dass ein aufmerksamer Rundgang zugleich eine Reise durch die russische Musik- und Literaturgeschichte wird. Nationaldichter Puschkin thront dort, der durch ein einziges Drama berühmt gewordene Gribojedov, Scholochov kauert in einem Boot, und Rachmaninov reckt dem Betrachter seine pianistischen Finger entgegen.
Eine Stunde dauert die Fahrt vom Zentrum zu meinen Bekannten nach Njekrasovskoje, wo ich zu Gast bin in ihrer nagelneuen, hellen Wohnung in einem siebzehngeschossigen Hochhaus, umgeben von einem Meer an bis zu fünfundzwanzigetagigen Neubaublocks, wo vor wenigen Jahren noch blankes Feld war. Moskau dehnt sich mit großer Geschwindigkeit ins Umland aus, bei jedem Besuch studiere ich den Metroplan und staune über die sich nach außen verlängernden Linien mit neuen Stationen. Vor wenigen Jahren wurde der Stadt im Südwesten ein riesiges, bis dahin zum Moskauer Umland gehörendes Territorium einverleibt, das sogenannte „Neu-Moskau“. Nun sieht die Umrisskarte der Hauptstadt ganz eigenartig aus – ein Kreis mit einem großen, dicken Anhang links unten.
Moskau – Ulan-Ude
18.08.: Hinter mir liegt eine Zugfahrt von genau 5641 Kilometern Länge quer durch das russische Riesenreich mit Gesprächen und Schwarztee, schönen Landschaftseindrücken, drei Schachspielen und der quälend langweiligen, uninteressanten Lektüre von Bulgakovs „Meister und Margarita“ – eindeutig nicht mein Buch.
Meine zwei Koffer und den Rucksack packte ich nach dem Einsteigen an verschiedenen Stellen auf die oberste Ablage, im Zug ist genug Platz und niemand fragt nach dem Gewicht. Am ersten Tag machte ich Bekanntschaft mit meinen auf der anderen Seite des Ganges sitzenden Nachbarn. Es stellte sich heraus, dass das ältere Paar auch nach Ulan-Ude fuhr und der Mann kurz nach der Wende drei Jahre in Jüterbog als russischer Offizier gedient hatte. Sie meinten, ich solle mich auf einen trockenen und extrem kalten Winter einstellen, erzählten von den ungewöhnlich vielen Waldbränden im Sommer und beklagten das schlechte Obst und Gemüse aus China in ihrer Region. In Jekaterinburg stieg eine nicht zu überhörende deutsche Reisegruppe in den Nachbarwagen, unauffällig überquerten wir die Grenze zwischen Europa und Asien, nur durch ein paar unscheinbare Hügel gab sich das Uralgebirge zu erkennen.
Seit meiner ersten Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn im Jahre 2009 hat sich einiges verändert. Die meisten Waggons sind moderner mit „Bio-Toiletten“, die dank geschlossenem Kreislauf auch während der Standzeiten benutzt werden können, und man kann kein Fenster mehr öffnen und sich fotografierend hinauslehnen. Es gibt viel weniger Babuschkas, die an den Bahnsteigen Beeren, Piroggen und Tücher verkaufen - auf den meisten Bahnhöfen wurde ihr wilder Handel verboten, statt dessen gibt es Kioske, wo ich Doschirak-Aufbrühnudeln und Kefir bekam, um meine Essensvorräte aufzufrischen. Nicht verändert hat sich das Reisetempo: ohne Standzeiten legte der Zug die 5641km in 77 Stunden zurück, was im Durchschnitt 73 km/h entspricht.
Am Abend des dritten Reisetages stieg eine Gruppe burjatischer Studenten mit ihrer Gruppenleiterin ein, die in der Nähe von Tomsk bei einem Festival burjatische Volkstänze aufgeführt hatten. Letztere fing an zu lachen, als ich von meinem Aufenthalt in Moskau erzählte: die Menschen dort würden sich wie Roboter benehmen, mechanisch laufend mit Blick nach unten, und von anderen Völkern in ihrem Land hätten sie keine Ahnung – Burjaten werden ihres Äußeren wegen oft für Chinesen gehalten und dann gefragt, woher sie so gut Russisch können… Der junge Mann aus Ulan-Ude, mit dem ich Schach spielte, warnte mich vor den Studenten an der Burjatischen Staatlichen Universität, wo ich unterrichten werde: sie seien faul und undiszipliniert, und ich solle gleich zu Anfang auf Respekt und Disziplin achten.
Am Morgen des vierten Reisetages wachte ich auf, als der Zug gerade in Sljudjanka hielt, blickte aus dem Fenster, und da war er - der Baikal, größter Süßwasserspeicher der Erde, sich geheimnisvoll öffnender Spalt in der Mitte Asiens, dessen Ufer sich jedes Jahr um einige Zentimeter voneinander weg bewegen, das vielbesungene Herz Sibiriens!
Abends wurde es immer schon gegen zwanzig Uhr dunkel und morgens um drei Uhr hell – sich geradewegs nach Osten bewegend, fuhr der Zug „in den Tag hinein“ und verkürzte diesen damit um mehr als eine Stunde täglich. Das Ergebnis sind fünf Stunden Zeitunterschied zu Moskau hier in der Baikalregion. Am Bahnhof wurde ich von meinem künftigen Kollegen Anatoli abgeholt und in die für mich bereitgehaltene Wohnung gefahren.
In einer Chruschtschowka
19.08.: Es herrscht sonniges, warmes Wetter in Ulan-Ude, ein angenehmer frischer Wind weht, und von einigen erhöhten Stellen in der Stadt gibt es einen tollen Ausblick auf die Steppenumgebung, was ein Gefühl von Großzügigkeit und Weite vermittelt.
Ich wohne in einer fünfstöckigen Chruschtschowka, einem Ziegelbau aus der sowjetischen Chruschtschow-Ära, in der ersten Etage in einer Zweizimmerwohnung in der Frunse-Straße, fünfzehn Gehminuten vom Zentrum und meinem künftigen Arbeitsplatz entfernt. Die Wohnung ist neu gestrichen und komplett ausgestattet: Waschmaschine, Kühlschrank, Möbel – alles da, was ich zum Leben brauche, sogar Bügeleisen und -brett, eine Grundausstattung an Geschirr und ein Internetzugang. Statt meines geliebten Potsdamer Gasherdes muss ich nun leider mit einem E-Herd vorlieb nehmen. Es gibt ein Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer mit Küchenecke, zwischen dieser und meinem Schreibtisch führt eine Tür auf den verglasten und überdachten Balkon, von dem aus ich durch einige Bäume hindurch auf die Frunse-Straße blicke. Heißes Wasser für Bad und Spüle kommt aus Fernwärme-Rohren, die Heizkörper an den Wänden werden im Herbst aktiviert, wenn – stadtweit und zentral gesteuert – die Heizsaison beginnt. Das Leitungswasser ist problemlos trinkbar. Als erstes habe ich das Wohnzimmer personalisiert: den Fernseher in den Schrank verbannt und zwei Landkarten vom Baikalsee aufgehängt.
Die Architektur hier in unmittelbarer Nähe des Zentrums ist eine Mischung aus Chruschtschowkas der 60er Jahre, außerdem großen, hohen Gebäuden aus der Stalin-Ära und einigen Holzbauten aus der Zarenzeit, zwischendurch immer wieder ganz moderne Häuser mit viel Stahl und Glas.
Wie russlandweit üblich, ist die Haustür mit einem Magnetschloss gesichert, dass sich durch das Anhalten eines Chips mit einem Piepton kurz deaktiviert, wonach die Tür aufgedrückt werden kann. Die Wohnung hat eine Innen- und eine Außentür, letztere durch einen langen Sicherheitsschlüssel zu öffnen, der viermal mit schwerem Klicken umgedreht wird. Das Treppenhaus ist eher heruntergekommen und dreckig, was allen wohl egal ist, da man sich dort nie länger als eine Minute aufhält. Die Briefkästen sind verlottert und nicht abschließbar. Der Hauseingang befindet sich auf der rückwärtigen, der Straße abgewandten Hausseite. Hier ist auch ein großer Hinterhof, schön mit Blumen bepflanzt und mit Bänken versehen, wo sich Abends das nachbarschaftliche Leben abspielt und viele Kinder herumrennen.
Heute Abend liegt ein leichter Nebel über der Stadt, die Sonne ist rot, obwohl sie noch hoch am Himmel steht, und es riecht leicht verbrannt: in diesem Jahr sind die Waldbrände in der Baikalregion so heftig wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Treffpunkt Panzer
22.08.: Als ich vor einigen Tagen in die Wohnung zog, fand ich auf der Spüle eine große Packung Lebensmittel-Soda, genau dort, wo normalerweise das Geschirrspülmittel steht. Ich studierte die Packung und stellte fest, dass es sich um eine Art Auflockerungsmittel zum Backen handelt. Inzwischen habe ich erfahren, dass die Leute hier auch ihr Geschirr damit waschen. Ich traue der Wirkung nicht ganz und habe es durch eine Flasche herkömmliche Chemie ersetzt, hergestellt von „Henkel Russland“.
Fünf Gehminuten von meinem Haus entfernt am Prospekt Pobedy (Sieges-Prospekt) steht auf einem großen Steinklotz ein Panzer, etwas darunter ist ein ewiges Feuer – das Sieges-Denkmal, obligatorisch auch in russischen Städten, die nie Frontgebiet waren. „Die Heldentat der sowjetischen Kämpfer und der Arbeiter des Hinterlandes wird für immer im Gedächtnis des Volkes bleiben“, steht geschrieben. Lass uns am Panzer treffen, schlage ich vor, wenn ich mich mit jemandem in der Stadt verabreden möchte.
Vorgestern Abend habe ich mich dort mit Bulat getroffen. Bulat ist der Bruder meiner Bekannten Mascha, unverkennbar burjatischen Aussehens, obwohl er kein Burjatisch spricht, und hat gerade den einjährigen Wehrdienst absolviert. Einen anderthalbjährigen Zivildienst gibt es in Russland auch und er wurde bei der Musterung darauf hingewiesen, wollte aber lieber zur Armee. Gibt es eigentlich noch die berüchtigte dedowschtschina, wollte ich wissen, das rituelle Quälen neuer Soldaten durch Ältere? Nein, meinte Bulat, und wer gewalttätig wird, würde hart bestraft. Zum Studieren hat er keine Lust und arbeitet jetzt in der Druck-Abteilung einer Reklameagentur. Vor zwei Jahren hatte er mich mit Mascha in Potsdam besucht, der Deutschlandaufenthalt hat ihn sehr beeindruckt. Inzwischen kann er auch Fahrrad fahren (für Russland keine Selbstverständlichkeit), was ich damals vergeblich versucht hatte ihm beizubringen.
Gestern Abend war der Panzer mein Treffpunkt mit Irina. Den Kontakt zu ihr hatte ich über eine gemeinsame Potsdamer Bekannte, die wie Irina in der örtlichen Bahaj-Gemeinde aktiv ist. Irina ist auf einem Dorf östlich von Ulan-Ude aufgewachsen und spricht neben Russisch auch Burjatisch, was keineswegs alle Burjaten tun – und außerdem auch Englisch, was sie in dem gleichen Institut studiert hat, in dem auch ich unterrichten werde. Jetzt arbeitet sie im Büro, auch einer Reklameagentur – das gibt mehr Geld und ist weniger Stress als der Lehrerberuf, für den sie eigentlich qualifiziert ist.
Anschließend lud mich Irina ein, mit ihr und zwei Freundinnen ins CheGuevara zu gehen, eine Art Restaurant-Disco. Nach kurzem Kampf meiner Neugierde mit dem üblichen Drang, früh ins Bett zu gehen, überwog erstere. An den Tischen und auf der Tanzfläche drängten sich hübsch zurechtgemachte Frauen – aufgrund der asiatischen Gesichtszüge noch schöner als ohnehin in Russland; Männer waren offensichtlich Mangelware. Es gibt einfach nicht genug, meinte meine Begleiterin lakonisch. Warum nicht, wollte ich wissen. Irina zuckte die Achseln: Alkohol, Armee, schwere Arbeit… In einer Vitrine lagen Rosen aus, die man für hundert Rubel erwerben konnte. Der Eintrittspreis von dreihundert Rubeln erschien mir recht hoch, aber das ist bei Russen ohnehin ein Rätsel: die Leute sind gut gekleidet, amüsieren sich und gehen shoppen, dürften aber – bei den oft ziemlich westeuropäischen Preisen und ihrem viel geringeren Einkommen – eigentlich kaum Geld haben. Der Umtauschkurs liegt zurzeit bei für Westeuropäer sehr günstigen eins zu siebzig – noch vor zwei Jahren war es eins zu fünfundvierzig.
Deutsche oder Deutsch-Muttersprachler, die dauerhaft hier wohnen, gibt es kaum: außer mir noch meine inzwischen mit einem russischen Mann verheiratete Amtsvorgängerin, die schon seit zwölf Jahren in der Region lebt, außerdem wohl noch einen Anstreicher und eine baptistische Schweizer Familie.
Auf dem Markt
24.08.: Die meisten Menschen hier verdienen vielleicht ein Fünftel eines deutschen Durchschnittslohnes, ohne dass das Leben entsprechend billiger wäre. Zigaretten, Benzin, Verkehrsmittel (eine Fahrt mit der Straßenbahn für zwanzig Cent) und Dienstleistungen (Schlüssel nachmachen lassen für zwei Euro) kosten deutlich weniger, Lebensmittel, Technik und Kleidung sind oft nicht wesentlich günstiger als bei uns. Arbeitslosigkeit ist kein Thema, gering bezahlte Jobs gibt es ohne Ende, das ganze öffentliche Leben ist sehr personalintensiv strukturiert: pro Straßenbahnwagen ist ein Kontrolleur unterwegs, in Geschäften und Museen gibt es oft mehr Aufpasser als Kunden oder Besucher. Für die meisten entfällt der Ausgabenpunkt „Miete“; man lebt mit Verwandten zusammen in Wohnraum, der nach dem Ende der Sowjetunion in Privateigentum übergegangen ist und weitervererbt wurde. Wenn kein Geld da ist, droht deshalb auch nicht gleich die Obdachlosigkeit, man kommt vielleicht bei der Cousine unter und der Gemüsegarten der Datsche hilft über die größten Versorgungsengpässe hinweg. Auf der Liste des Bruttoinlandsproduktes der russischen Regionen nimmt Burjatien Platz sechzig von fünfundachtzig ein.
Gestern war ich auf dem zentralen Markt und kaufte Leckereien aus der Region: burjatischen Buchweizenhonig, frische Milch und Butter, geröstete Pinienkerne und Baumharz-Kaugummis, dazu Gewürze aus Usbekistan, die einzeln in kleine dreieckige Papiertütchen verpackt werden. Außerdem fand ich an einem Stand Päckchen mit Machorka, dem Aussehen nach an kleingehäckselte Rinde erinnernder Bauerntabak noch originalverpackt aus Sowjetzeiten mit dem Preisaufdruck „15 Kopeken“. Machorka wurde von russischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg geraucht, sein Verkauf ist aufgrund des hohen Nikotingehaltes in Europa verboten.
Treffpunkt Theater
24.08.: Mein Lieblingsplatz in der Innenstadt ist der Springbrunnen vor dem Opern- und Ballettheater. Hier tönt aus Lautsprechern klassische Musik, die Leute sitzen eisessend und schwatzend auf Bänken in der Sonne und Hochzeitspaare lassen sich vor dem Hintergrund des schicken Säulenganges fotografieren. Auf dem Weg zum Institut mache ich gern einen Schlenker hier vorbei, um ein paar Takte aus Vivaldis „Jahreszeiten“ oder Prokofjevs „Romeo und Julia“ mit auf den Weg zu nehmen. Die Beschallung öffentlicher Plätze mit Lautsprechern ist überhaupt ein russisches Phänomen – oft lästig, in diesem Falle erfreulich.
Gestern Abend habe ich mich hier mit Irina und zwei ihrer Freundinnen, Olga und Oyuna, getroffen, um Posy essen zu gehen. Posy ist ein burjatisches Nationalgericht, man kann sie sich vorstellen wie große, saftige Pelmeni: ein Stück Fleisch in eine Teigtasche gehüllt. Sie werden mit der Hand gegessen: zuerst muss man vorsichtig ein Stück abbeißen und dann den Saft heraussaugen, wenn man mit einem kräftigen Biss beginnt, riskiert man einen satten Spritzer über den ganzen Tisch. Bald wirst Du keine Zeit mehr haben, meinte Ira, Deine Studenten werden Dich hierhin und dorthin einladen, Du wirst sehen. Hoffentlich interessieren sie sich auch für meinen Unterricht, gab ich zurück, was kann ich denn machen, um ihre Motivation zu fördern? Ach, meinte Oynua, wenn ein Ausländer unterrichtet, ist das immer spannend, mach Dir keine Sorgen. Einige, die keine Lust haben und nichts machen, gibt es immer, pinat‘ baldú sagt man dazu auf Russisch.
Auch wenn es keinen Park Sanssouci hier gibt und mein Jogging-Partner Ingo weit weg ist, mit dem ich mich in Potsdam oft verabredet hatte, macht mir das Rennen Spaß und ersetzt mir das Erkunden der Stadt mit dem in Ulan-Ude als Verkehrsmittel fast nicht existenten Fahrrad.
Schlafende Verkäuferin, schwankendes Briefporto
26.08.: Tagsüber ist es schwül und etwas staubig hier, heute Abend gab es zum ersten Mal einen kurzen, heftigen Regenschauer und ein Gewitter.
Nach dem Aufstehen um kurz nach sechs Uhr stellte ich fest, dass ich keinen Appetit auf meinen üblichen morgendlichen Schwarztee hatte. Kurzerhand ging ich in das vierundzwanzig Stunden geöffnete Lebensmittelgeschäft zwei Häuser weiter, um ein Glas löslichen Kaffee zu kaufen. Die Tür war verschlossen, aber es war Licht, ein Fenster geöffnet und ich sah die junge Verkäuferin mit dem Kopf auf der Theke liegend schlafen. Durch mein Klopfen wachte sie auf, reichte mir die gewünschte Ware heraus und legte sich danach wieder hin.
Eine Straße weiter befindet sich eine kleine Postfiliale, der ich einen Besuch abstattete, um Briefmarken für Post nach Deutschland zu kaufen. Zu meinem Erstaunen bekam ich Fünfzig-Rubel-Marken, wenige Tage zuvor hatte ich in der Hauptpost mit vierunddreißig Rubeln frankierte Umschläge zum Absenden in meine Heimat erworben. „Ich gebe Ihnen lieber etwas mehr“, meinte die Postmitarbeiterin, „die Tarife ändern sich manchmal, und dann wird der Brief nicht angenommen und kommt zurück.“ Diesem Argument wollte ich mich nicht verschließen, und deshalb bekommen jetzt einige Leute von mir Briefe, die mit vierunddreißig Rubeln frankiert sind und andere solche mit fünfzig Rubeln.
Meine im Moment fast täglichen Joggingrunden führten mich ans Ufer des Flusses Udá, wo ich an einer von vielen schönen sandigen Stellen im erfrischend kalten, sauberen Wasser badete. Außerdem kam ich an einem weiteren Denkmal mit Panzer vorbei – diesmal zum Andenken an die Gefallenen der Kriege in Afghanistan und im Kaukasus – und entdeckte das Tschaikowski-College für Kunst, eine Art Berufsschule für Musiker und Maler, wohin ich mich auf der Suche nach einem Cello sicher bald einmal wenden werde.
Zum Kennenlernen der Stadt setze ich mich manchmal in die erstbeste Straßenbahn und fahre bis zur Endhaltestelle. Es gibt genau fünf Linien, die im Wesentlichen einen großen Kreis beschreiben mit einigen Abzweigungen. Jede Straßenbahn hat einen Wagen, ein fahrkartenverkaufender Schaffner fährt immer mit (vierzehn Rubel), vom Band werden deutlich die Stationen angesagt – und die Stimme erzählt darüber hinaus zu jeder Station noch etwas zu der Einrichtung oder dem Platz, wonach sie benannt ist. „Städtisches Krankenhaus Nummer eins, gegründet dann und dann, benannt nach dem und dem dann und dann, heute berühmt für das und das. Sehr geehrte Damen und Herren, vergessen Sie beim Aussteigen Ihre Sachen nicht.“ Einiges davon geht natürlich im Rattern und Quietschen der Räder unter. „Nächste Station: Dramatheater, gegründet dann und dann. Ulan-Ude – eine Stadt guter Traditionen! Achtung, Türen schließen…“ Wie oft muss man die Strecke fahren, bis man alle Jahreszahlen auswendig kann? zwanzig mal, hundert mal? Ich werde es nicht erleben – mein täglicher Arbeitsweg ist zu Fuß.
Ulan-Ude hat eine riesige flächenmäßige Ausdehnung – ein Großteil davon zählt zum Tschastnyj sektor, dem „Privatsektor“ mit meist kleineren Holzhäusern mit Garten dahinter und Garage daneben. Eigentlich träume ich ja von einem Häuschen mit eigenem Gemüsegarten, aber die hohen Holzzäune und die bellenden Hunde scheinen auf den ersten Blick wenig sympathisch. Außerdem gibt es dort kein fließendes warmes Wasser, im Winter müsste ich mit Holz heizen und jedes Mal, wenn ich ein paar Tage weg bin, würde die Bude bis auf unter null auskühlen.
Inzwischen habe ich auch mein Büro an der Uni einigermaßen eingerichtet. Dass ich überhaupt eins bekommen habe, ist nicht selbstverständlich und ein schönes Zeichen, dass dem Lehrstuhl meine Anwesenheit etwas bedeutet. Mein Blick aus dem Fenster fällt genau auf das Hauptpostamt, schräg daneben und nicht sichtbar – der Leninkopf, bizarres Wahrzeichen der Stadt. Eines von zwei Bücherregalen ist leider nicht benutzbar und fällt jeden Moment wieder aus der Wand heraus, weshalb die Hälfte meiner Bibliothek in Bananenkisten gestapelt neben der Tür liegt – aber das Studienjahr hat ja noch nicht einmal angefangen. Noch herrscht seltsame Stille in den hohen Gängen des ehrwürdigen, vorrevolutionären Institutsgebäudes. Am nächsten Dienstag wird sich das schlagartig ändern.
Ich wohne in Wohnung Nummer sechsundvierzig. Aus vergangenen Monaten haben sich für diese Wohnung Nebenkostenschulden in Höhe von 2194 Rubeln angehäuft. Mein Nachbar in Wohnung siebenundvierzig, der Schlingel, schuldet der Stadt sogar 9015 Rubel. Und in Wohnung achtundvierzig haust einer, fast schon ein Bandit!, der sage und schreibe mit 43949 Rubeln für Strom und Wasser im Rückstand ist! Sonst weiß ich zwar nichts über meine Nachbarn, nicht mal, wie sie aussehen, aber das wenigstens ist jetzt klar: An der Hauswand außen hängt seit vorgestern ein gelber Zettel mit einer Nebenkosten-Schuldenliste. Gleich mit einer Gerichtsdrohung, wenn bis Monatsende nicht bezahlt wird.
Mein erstes Wochenende am Baikal
31.08.: Am letzten Wochenende fand ich mich am Ufer des Baikalsees wieder, Fußball spielend mit dem sechsjährigen Wanja, als Tramper im Toyota der etwa fünfundfünfzigjährigen Ljudmila und frühstückend bei der neunundachzigjährigen Urgroßmutter Anja.
Am Samstagmorgen setzte ich mich in die Elektritschka, den Vorortzug, der gemächlich und oft haltend von Ulan-Ude nach Westen zuckelt, und fuhr bis zur nach etwa einer Stunde erreichten Endstation Tataurovo. Bei der Fahrkartenkontrolle schaute die Schaffnerin erst das Ticket an, dann mich, dann noch einmal verwundert das Ticket und fragte schließlich, was ich denn in Tataurovo wolle, da gäbe es nur das Dorf und sonst nichts, das Ende der Welt sozusagen. Anscheinend fiel ich auf unter den vielen Omas und Opas, die ihre Datschen entlang der Bahnstrecke besuchen und die den Passagierbestand im Wesentlichen ausmachen. Ach, Sie wollen weiter zum Baikal? Na, da haben Sie sich ja was vorgenommen. Warum nehmen Sie keine Marschrutka, die fährt direkt hin... Der Zug fuhr entlang des Flusses Selengá, man hat einen wunderschönen Blick auf den Fluss, die nicht allzu hohen Berge dahinter und die sich in der Flussaue aneinanderdrängenden Datschengrundstücke. In Tataurovo stieg ich aus, lief eine Weile durch das wie ausgestorbene, stille Dorf, fotografierte das einzige fröhlich glänzende Gebäude – die kleine Holzkirche, die sich wie eine Perle in der Dorfmitte hervortat – und begab mich dann auf der staubigen Landstraße M55, der zentralen West-Ost-Lebensader Sibiriens, Richtung Norden, erwartungsvoll den Arm ausstreckend, wenn Autos vorbeifuhren.
Nach etwa zwanzig Minuten hielt ein kleiner Toyota, mit der jungen Großmutter Ljudmila am Steuer und dem kleinen Enkel Wanja auf der Rückbank. Was denn mein Ziel wäre? Die Siedlung Babuschkin? Wartet da jemand auf Sie? Nein? Na, dann können Sie eigentlich auch mit uns mitkommen. Wir fahren nach Oimur. Das liegt auch am Baikalsee, das ist für Sie doch genauso interessant, und uns ist nicht so langweilig. Wir haben dort ein Häuschen, da übernachten Sie mit uns, und morgen fahren wir zurück. Einverstanden?
Und so ergab es sich, dass ich nicht wie geplant westlich, sondern östlich der Mündung des Selenga-Flusses mein Wochenende verbrachte, im Häuschen von Ljudmila und dem dahinterliegenden Garten, wo ungefähr das gleiche wächst wie bei meiner Mutter hinterm Haus, nur nicht ganz so üppig und ein bisschen später reif – ich kam gerade richtig zur Himbeerernte, die in Leipzig schon vor einem Monat abgeschlossen war. Das 2000-Seelen-Dorf Oimur liegt an einer für den Baikalsee eher untypischen Stelle, an den Sandstrand schließen sich weite grüne Wiesen an, Berge sind nicht sichtbar und das Wasser ist extrem flach – man läuft hundert Meter in den See und das Wasser geht immer noch nur bis zur Hüfte. Auf den Wiesen grasen Kühe und Pferde, gelegentlich springen einige Ziegen herum. Die Häuser haben kein fließendes Wasser, die meisten Leute haben eine Art Brunnen im Garten – ein gebohrtes tiefes Loch mit einer Pumpe drin und einem Schlauch. Im Zentrum steht eine schöne Kirche, an der ich einen fotografierenden Franzosen traf, der mit seinem Campingmobil seit einem halben Jahr Asien durchquert, und das, ohne eine einzige Fremdsprache zu sprechen. Ich badete mit dem kleinen Wanja, las ihm Märchen vor und bolzte auf der Wiese, die künftig mal ein Kartoffelacker werden soll.
Früh am Sonntag fand ich das Dorf in eine Mischung aus Morgennebel und Waldbranddunst gehüllt. Ich machte mich auf den Weg, um einmal zum Dorfende zu laufen. Weit kam ich nicht. „Junger Mann“, sprach mich ein runzliges Mütterchen mit grellrotem Kopftuch und grüner Strickjacke an, „können Sie mir kurz etwas helfen? Kommen Sie mal herein zu mir.“ Das Mütterchen wollte Baba Anja genannt werden (Baba heißt Großmutter, wie sich dann herausstellen sollte, war sie längst Urgroßmutter) und brauchte kurz jemanden zum Anpacken beim Umstellen eines Tisches. Anschließend sollte ich noch „zum Tee“ bleiben, das heißt, zu einem üppigen zweiten Frühstück, und sie erzählte mir ihre Geschichte – Mann vor fünfzig Jahren angetrunken mit dem Boot alleine ausgefahren und ertrunken, einziger Sohn wohnt bei Kaliningrad ("das ist doch gleich da bei Ihnen in der Nähe"), wo sie nicht hinziehen will, lieber auf heimatlicher Erde sterben. Alten Menschen zu begegnen, die noch ganz klar im Kopf sind, finde ich besonders schön und wertvoll.
Nachmittags fuhren wir auf der wunderbar frisch asphaltierten Straße M55 zurück nach Ulan-Ude, unterwegs hielten wir noch an einer für Anhänger des Schamanenkultes heiligen Städte mit Holzstelen und in die Bäume geknoteten Tüchern. Ich kam gerade noch rechtzeitig, um meine Wohnung aufzuräumen, bevor mein allererster Besuch hier vor der Tür stand.
Treffpunkt Leninkopf
02.09.: Seit ich meinen Couchsurfing-Account von Potsdam auf Ulan-Ude umgestellt habe, bekomme ich regelmäßig Anfragen von Reisenden, die hier Station machen. Bärtige Moskauer Tramper, Transsibirische-Eisenbahn-verrückte Slowenier oder eurasiendurchquerende Japanerinnen melden sich und fragen, ob sie ein paar Mal übernachten können oder ich ihnen wenigstens die Stadt zeigen kann, getreu dem Couchsurfing-Prinzip „Lieber bei Einheimischen unterkommen als in Hostels“ – aus der Perspektive Russland-unerfahrener Durchreisender gehöre ich wohl fast schon zu den ‚locals‘. Ulan-Ude ist keineswegs das Ende der Welt, sondern ein Verkehrsknotenpunkt: wer von der Mongolei nach Norden oder nach Europa fährt, landet hier, und Transsib-Touristen legen gern einen Aufenthalt ein, bevor sie entweder weiterfahren oder einen Abstecher an den Baikalsee machen.
Wenn jemand die Stadt gar nicht kennt und weder weiß, wo der Panzer, noch, wo das Theater ist, dann ist es am besten, sich am pamjatnik Leninu, dem Lenindenkmal in Gestalt eines gigantomanischen Kopfes, zu verabreden. Das Denkmal steht auf dem zentralen Sowjet-Platz, ist mit Sockel vierzehn Meter hoch – wovon allein acht Meter auf den Kopf entfallen – und wurde 1970 anlässlich des hundertjährigen Geburtstages von Lenin aufgestellt.
Meine erste Couchsurfing-Gäste waren Sezgin und Ebru, ein junges türkisches Ehepaar, die mit Isomatten und Schlafsäcken ankamen, mich in meiner eigenen Wohnung wunderbar vegetarisch bekochten und voller Begeisterung meinen sowjetischen Machorka-Tabak proberauchten. Es gibt also tatsächlich auch ganz andere Türken als türkendeutsch sprechende Dönerverkäufer...
Gestern gab ich meinen ersten Unterricht an der Uni. Die erste Gruppe – Bachelor-Studenten im vierten Studienjahr – studierte Deutsch nur als zweite Fremdsprache und hatte ein eher bescheidenes Niveau, die zweite Gruppe – Masterstudenten – war wesentlich besser. Die Unterrichtsbedingungen hier sind in Ordnung, natürlich kein Vergleich mit der Volkshochschule Potsdam: die Kreidetafeln sind nur mit viel Mühe beschreibbar und mit jedem Schritt quietschen meine Sohlen auf dem hochglanzpolierten Lackfußboden.
Im Erdgeschoss des Institutes gibt es ein großes deutsches Lehrmittelzentrum, ausgestattet mit Bergen an Fachliteratur, Lehrbüchern und Zeitschriften, darunter auch viele überraschend aktuelle Materialien – aber es scheint sich kaum jemand dafür zu interessieren. Die Bücher sind für Studenten unzugänglich hinter verschlossenen Schranktüren, und das Chaos lässt darauf schließen, dass seit zwanzig Jahren niemand mehr aufgeräumt oder aussortiert hat.
Jukari und Wakana
05.09.: Gestern früh habe ich mich am Bahnhof in Ulan-Ude von Jukari und Wakana verabschiedet. Die beiden jungen Japanerinnen sind gerade dabei, Russland von Wladiwostok bis St. Petersburg mit dem Zug zu durchqueren und hatten zwei Tage in Ulan-Ude Station gemacht. Wakana und Jukari waren genau so, wie ich mir Japaner vorstelle: höflich, kultiviert, leise und dabei immer freundlich lächelnd. Trotz ihres zarten Äußeren sind die beiden offensichtlich hart im Nehmen, reisen mit großen Rucksäcken und ohne jede Russischkenntnisse – Respekt!
Wieder wurde ich in meiner eigenen Wohnung bekocht - sicher das Schönste, was einem mit Couchsurfing-Gästen passieren kann - und gemeinsam überlegten wir, wie wohl eine "Lächel-Karte" der Völker der Nordhalbkugel aussehen würde. Japaner und Amerikaner - ständig aus reiner Höflichkeit lächelnd, Westeuropäer - manchmal, Russen – in der Öffentlichkeit praktisch nie...
Am Bahnhof wollten sie selbst das Zugticket kaufen. Jukari reichte einen Zettel mit der Abfahrtszeit und dem Namen der Station durch das Schalterfenster. „Plazkart oder Coupé, oben oder unten, mit oder ohne Bettwäsche? Ihre Reisepässe!“, drang die an der rauen Sowjet-Wirklichkeit gehärtete Stimme der Schalterdame durch die kleinen, außen angebrachten Lautsprecher. Jukari lächelte und versuchte seelenruhig, den Namen des Zielbahnhofes auszusprechen. „Slu-djanka...“ – „Spricht hier auch jemand Russisch?“, bellte die Dame von innen zurück. Ich fühlte mich an meine ersten Russlandaufenthalte erinnert und daran, was für eine stressige Herausforderung der Kauf einer Zugfahrkarte für mich einstmals war. Jukari aber war die Geduld und Höflichkeit in Person. Da der Zug in zwanzig Minuten abfuhr, hielt ich es dann allerdings nicht mehr aus und übernahm den Kaufvorgang, der Fahrkartenfrau in ruppigem Russisch Paroli bietend. Auf einmal erwies sie sich als ganz nett und suchte sogar Plätze auf der Seite des Wagens heraus, auf der die Sicht auf den Baikalsee am besten sein würde.
Nachdem ich die beiden zu ihren Plätzen im Wagen begleitet hatte und selbst ausgestiegen war, hatte ich noch einen interessanten kleinen Dialog mit der Zugbegleiterin.
„Wer ist das, Chinesen oder was?“
„Nein, Japanerinnen.“
„Von überallher drängen die Leute zu uns nach Russland, schrecklich.“
„Es sind Touristen, und hier am Baikalsee bei Ihnen ist die Natur doch so schön, das Wasser, die Berge, die Wälder...“
„Sollen sie es doch bei sich im Land schön machen!“
„Aber die Taiga kann man doch nicht künstlich herstellen...“
„Sollen sie eben weniger abholzen!“
Ungefähr an dieser Stelle des Wortwechsels setzte sich dann der Zug in Bewegung, und ich winkte Jukari und Wakana durchs Fenster zum Abschied.
Meine erste Arbeitswoche im richtigen Uni-Betrieb liegt hinter mir. Viele neue Gesichter, Studenten und Lehrkräfte, ich bin etwas fertig und dringend wochenendreif. Ich unterrichte neun Doppelstunden pro Woche, es stellte sich heraus, dass ich in der Konzeption meiner Kurse völlig frei bin und sie mir inhaltlich selbst ausdenken muss, sowohl die Themenabfolge als auch das Lehrbuch. Meine Studentinnen – bisher sind alle weiblich – wirken auf den ersten Blick motiviert und diszipliniert, artig und schreiben eifrig alles mit, wie russlandweit üblich, in A5-formatige Heftchen. Die Schlösser der Klassenräume am Institut verlangen mir ein hohes Maß an Bewusstsein ab: man kann praktisch jeden der rustikalen und großen Schlüssel in jede Tür hineinstecken und umdrehen, aber wenn es der falsche ist oder man den Schlüssel um hundertachzig Grad verdreht ansetzt, schrottet man das Schloss – was mir mit meiner Bürotür passierte, wo es ohne viel Aufhebens ausgewechselt wurde. Seit Tagen höre ich durch das Fenster am Arbeitsplatz lautstarke Proben verschiedenster Tanz-, Theaterund sonstiger Showaufführungen für die heute stattfindenden Feierlichkeiten zum djen góroda, dem Tag der Stadt – nicht etwa ein rundes Jubiläum, sondern das dreihundertneunundvierzigste Jahr seit der Gründung... was dann wohl nächstes Jahr hier los sein wird, gar nicht auszudenken.
Kamelhaar, Kaffee, kleiner Ausflug
09.09.: Nicht weit von mir entfernt neben den Eisenbahngleisen befindet sich das Gelände eines großen Warenmarktes. In gefühlt tausend kleinen Lädchen verkaufen tausend Verkäufer tausend für den Haushalt nützliche und weniger nützliche Dinge, und zwar überall ungefähr die gleichen. In einem dieser Lädchen erstand ich am Wochenende eine Bettdecke, um nicht mehr – wie bisher – in meinem Schlafsack liegen zu müssen. Eigentlich wollte ich eine dicke Daunendecke kaufen, wie ich sie auch in Deutschland hatte. Aber Daunendecken scheinen hier nicht üblich zu sein, und so wurde eine Kamelhaardecke daraus. Hinterher fiel mir ein, dass mir ein Berliner Allergologe genau Kamelhaar empfohlen hatte, um schnupfenfrei zu schlafen – also passt es gerade.
Wie überall in Russland werden auch Lebensmittel in tausend kleinen Geschäften verkauft, gelegentlich gibt es den einen oder anderen größeren Supermarkt. Im Supermarkt hier um die Ecke finden sich ungefähr zwanzig Sorten Kaffee – aber alles nur löslicher, kein echter. Dabei trinken die Russen durchaus nicht nur Tee. Interessant, warum einem in Deutschland echter Bohnenkaffee kiloweise zu Ramschpreisen um die Ohren geworfen wird, während er sich hier überhaupt nicht durchsetzen konnte. In der Nähe des Siegesdenkmals fand ich ein kleines Spezialgeschäft, das Wein, losen Tee und Kaffee verkauft – Direktanlieferung aus Moskau, hundert Gramm frisch gemahlenen Kaffee ab umgerechnet vier Euro.
Die erste Hausaufgabe, die ich meinen Studentinnen gab, war ein kleiner Aufsatz „Das bin ich“, in dem sie kurz auf Deutsch über sich erzählen sollten. Vieles darin wiederholt sich: „Ich lebe mit meinen Eltern, mein Vater ist beim Militär“, „Ich möchte reisen und die Welt sehen“, „Mein Hobby ist Tanzen“, „Ich mag deutsche Rockmusik“. Manchmal musste ich bei der Lektüre auch schmunzeln. „Mit dreißig Jahren hat man schon praktisch die Hälfte des Lebens vorbei, zumindest für die russischen Verhältnisse“, schreibt eine ältere Studentin, und weiter: „Und wahrscheinlich um die Memoiren zu schreiben, ist es noch zu früh, aber einiges habe ich schon zu erzählen. Erstens, habe ich zwei gute Kinder. Mein Sohn ist elf und meine Tochter acht.“ Nach dem Unterricht fragte mich diese Studentin, wie alt ich bin – ich ließ sie raten und sie schätzte achtundzwanzig. Hier in Russland hält man mich gewöhnlich für fünf bis zehn Jahre jünger, als ich wirklich bin. Für meine Maßstäbe wiederum sehen Russen recht früh oft schon sehr erwachsen aus.
Als im Jahre 1903 der durchgehende Verkehr auf der transsibirischen Eisenbahn eröffnet wurde, fehlte noch ein wichtiges Stück der Bahnstrecke: die südlich am Ufer des Baikalsees verlaufende Strecke war noch nicht fertiggestellt, weil das Gelände sehr schwierig war und viele Tunnel gesprengt werden mussten. Man behalf sich, indem man ganze Eisenbahnzüge im Sommer mit der Fähre und im Winter mit Pferdefuhrwerken über das Eis beförderte. Anlegestelle am Ostufer war der Ort Babuschkin, heute ein eher bedeutungsloses Dorf drei Fahrtstunden von Ulan-Ude entfernt. Hierhin führte mich mein letzter Sonntagsausflug.
Ich entschied mich, mit der Elektritschka zu fahren, dem Vorort-Bummelzug, der vor allem von Rentnern genutzt wird, die sich zu ihren Datschen begeben. Die Elektritschka fährt zunächst auf einer landschaftlich wunderschönen Strecke entlang des Flusses Selenga nach Norden. Nach etwa einer Stunde waren fast alle Rentner ausgestiegen, und ich befand mich für die restlichen zweieinhalb Fahrtstunden so gut wie allein im Zug. Im Dorf Bolschaja Retschka stieg ein alter, gebeugter Mann am Stock zu, humpelte durch den Wagen und machte an meinem Platz halt. Ich schaute gerade aus dem Fenster hinaus auf den Baikalsee, der soeben in Sichtweite geraten war, und studierte die Landkarte.
„Schön, was?“
„Ja, sehr schön hier!“
„Engländer?“
„Nein, Deutscher.“
Der Mann setzte sich neben mich, und so hatte ich einen Gesprächspartner bis zum Ende der Fahrt. Es stellte sich heraus, dass er ebenfalls nach Babuschkin fuhr, um sich dort in der örtlichen Banja zu waschen, da er zuhause kein fließendes Wasser hat (wie auch niemand sonst in seinem Dorf). Ich freute mich über die Begegnung, musste mir nur Mühe geben, nicht auf seine völlig vergammelten Zähne zu achten. Er war dreiundsiebzig Jahre alt, schimpfte über die Beamten, die die schrecklichen Waldbrände in diesem Sommer zugelassen hätten, schüttelte verständnislos den Kopf darüber, dass die Sowjetunion kaputtgemacht wurde und zeigte im Vorbeifahren auf einige Klippen im See, die eigentlich nie sichtbar wären – aufgrund des trockenen Sommers ist auch der Wasserstand des Baikal ungewöhnlich niedrig.
Auf dem Rückweg trafen wir uns wieder in der gleichen Elektritschka. Unterwegs standen wir wegen Stromausfalls eine Stunde auf der Strecke. Irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit kam ich wieder in Ulan-Ude an, gemeinsam mit vielen unterwegs zugestiegenen Senioren mit großen Tüten und Taschen, in denen sie die Ernte von der Datsche transportierten.
Gelegentlich pflücke ich im Vorübergehen das eine oder andere Blatt vom Baum und trockne es dann in einem Buch der sechsunddreißigbändigen „Großen Sowjetischen Enzyklopädie“ von 1972, die meine Vermieterin im Wohnzimmer zurückließ. Im Wesentlichen gibt es in der Stadt Ulmen mit dem typischen asymmetrischen Blattansatz, Eschenblättrigen Ahorn, Pappeln mit ledrigen Blättern und Akazien. Interessant ist, dass die Stämme vieler Bäume weiß gekalkt sind.
Kollegen, Konto und Kleidung
13.09.: Ich arbeite an der Burjatischen Staatlichen Universität am Lehrstuhl für Deutsch und Französisch. Von einer Ausnahme abgesehen, sind meine Kollegen hier alle weiblich. Etwa die Hälfte von ihnen unterrichtet Deutsch, die andere Französisch. Das Lehrstuhl-Zimmer, wo man zur Unterrichtsvorbereitung zusammenkommt oder sich auch nur zum Teetrinken aufhält, liegt direkt neben meinem Büro. Mit den Deutsch-Kolleginnen spreche ich meistens Deutsch, mit den anderen Russisch – mein eingerostetes Französisch reicht nicht mehr für ein Gespräch. Am anderen Ende des Korridors ist der Lehrstuhl für Übersetzungswissenschaften, wo viele Kolleginnen sind, die Englisch unterrichten, mit denen ich aber bisher weniger zu tun hatte.
Die ganze Abteilung nennt sich „Institut für Philologie und Massenkommunikation“. Neben Fremdsprachen kann man hier auch Journalistik, Reklamewissenschaften und natürlich Russische Sprache und Literatur studieren. Die Tür zum Gebäude ist tagsüber immer offen, im Vorraum geht man an einem Wächter vorbei, von denen sich drei oder vier im Schichtdienst abwechseln, die wohl auch dort schlafen. Zum Glück gibt es hier nicht die sinnlosen und umständlichen Drehkreuze und man muss auch keinen Ausweis vorzeigen, wie ich das in vielen Universitäten im Westen Russlands erlebt habe. Ich grüße den Wächter nickend oder mit einem kurzen Handzeichen, manchmal hole ich mir von ihm einen Schlüssel zu einem Lehrraum und nehme mir Zeit für ein kleines Gespräch: ein guter Draht zu ihnen kann in vielen Situationen nützlich sein. Was gibt es Neues in Deutschland, werde ich gefragt, könnt ihr euch vor lauter Flüchtlingen noch retten?
In der letzten Woche war Lehrstuhlsitzung. Ich fühle mich wohl im Kreis der Kollegen, die Atmosphäre ist entspannt und informell. Nach der Sitzung gab es einen kleinen Imbiss, geschätzt wurde der echte Bio-Bohnenkaffee, von mir aus Deutschland mitgebracht. Ich versuchte aus den Gesprächen herauszuhören, was die Kollegen so bewegt, wie die allgemeine Stimmung ist. Der Rückgang der Popularität der deutschen Sprache zugunsten des Englischen ist ein Problem, die Überlastung mit Bürokratie, die geringen Löhne.
Um den Teil meines Gehaltes zu bekommen, den die russische Seite auszahlt, habe ich mir bei der BaikalBank ein Konto einrichten lassen. Es läuft etwas anders als auf einer deutschen Bank: die Geldkarte zum Abheben und Einkaufen konnte ich sofort mitnehmen und musste mir vor Ort eine PIN ausdenken. Jetzt verstehe ich auch, warum sich hier niemand um abschließbare Briefkästen kümmert – wichtige Dinge wie Bankkarten oder PINs werden nie per Post verschickt.
Im Beruf kleiden sich Russen bekanntlich gern etwas formeller als Deutsche, und ich passe mich dem gerne an: meine besten Hemden haben im Reisekoffer Platz gefunden, und kurz vor der Abreise beriet mich Freund Robert beim Kauf eines Edel-Anzuges im Weimarer Schillerkaufhaus. Die Krawatte hängt bisher noch unbenutzt im Schrank. Ihre Zeit ist bald gekommen: demnächst steht ein Treffen mit dem Rektor an.
Über die Hälfte der Studentinnen in meinen Kursen sehen unverkennbar asiatisch aus. Während die Russinnen wie üblich Nastja, Marina, Olga oder Julia heißen, muss ich mich an die burjatischen Namen wie Seseg, Erzhena, Aja oder Tschimita erst gewöhnen.
Die russische Mongolei
13.09.: Gestern hatte ich die Gelegenheit, auf einer sechshundert Kilometer langen Fahrt mit dem Kleinbus die karge Schönheit der burjatischen Steppe, die Weite des Landes und einige besondere, heilige Plätze kennenzulernen.
Burjatien ist die „russische Mongolei“. Die Burjaten, die etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen, sind eng mit den Mongolen verwandt, Burjatisch und Mongolisch sind einander sehr ähnliche Sprachen. Die Republik ist etwa genauso groß wie Deutschland, hat aber nicht achtzig Millionen Einwohner, sondern nur eine einzige Million. Es grenzt im Westen an den Baikal und ist von Gebirgsketten durchzogen: im Westen der Östliche Saian, im Süden das Chamar-Daban-Gebirge, im Norden das Bargusin-Gebirge. Im Norden dominieren endlose Taiga-Wälder, im Süden die kahle, hügelige Steppe.
Seit etwa fünfzehn Jahren ist in Burjatien die Deutsch-Sibirische Gemeinschaft aktiv, die Kinderheimen und medizinischen Einrichtungen dringend notwendige Ausstattungen finanziert. Eine Delegation der Gemeinschaft besuchte am Samstag eine kleine Betreuungseinrichtung im Dorf Ojor in der Steppe unweit der mongolischen Grenze. Zu meiner großen Freude war ich eingeladen, mitzukommen.
Ich saß im Kleinbus vorne und unterhielt mich auf dem dreihundert Kilometer langen Hinweg angeregt mit Gennadi, dem Fahrer. Gennadi fuhr äußerst diszipliniert und legte großen Wert darauf, dass ich mich anschnallte. Gelegentlich übersah er ein Ortsausgangsschild und fuhr dann einfach mit sechzig auf der freien, gut asphaltierten Landstraße weiter. Als er erfuhr, dass ich nicht verheiratet bin, erzählte er von seiner dreiunddreißigjährigen Tochter Anjuta, die leider den Heiratszeitpunkt auch verpasst habe. Sie kann alles, meinte er, von kochen bis renovieren, und ich solle sie mir doch mal auf vkontakte – dem russischen Facebook-Äquivalent – anschauen. Gelegentlich fuhren wir an größeren, in der Steppe verstreuten Kuh- und Schafställen vorbei. „Früher gab es hier viel mehr Landwirtschaft“, meinte Gennadi, „jetzt ist alles tot, die Lebensmittel kommen aus China.“ Auf einem Hügel hielt er plötzlich an, murmelte etwas von „Heiliger Ort“ und stieg aus.
Auf der Anhöhe befanden sich im Kreis aufgestellte Holzstelen und in Sträucher geknotete Tücher. Die Tradition verlangt, entlang der Holzstelen im Uhrzeigersinn im Kreis zu gehen und auf Steinen einige Münzen zu hinterlassen. Ob das eine buddistische oder schamanische Tradition ist, habe ich nicht genau herausgefunden. Etwas später im Auto sah ich, wie Gennadi sich bekreuzigte. Wahrscheinlich vermischen sich die Religionen bei ihm auf eine ganz persönliche Weise. Wenig später hielten wir an einer echt buddhistischen Stupa, eine Art kleines Tempelgebäude mit einer großen, dicken Buddha-Statue darauf. Auch hier hieß es dreimal im Kreis gehen und ein paar Münzen opfern.
In Ojor erlebten wir ein echtes, herzliches und ausführliches Gastfreundschafts-Ritual von Anfang bis Ende. Ein Kosakenchor begrüßte uns mit männlichem, melancholischem und leidenschaftlichem Gesang, die Frauen reichten Brot und Salz dazu, es wurde eine Drei-Liter-Glasflasche selbstgebrannten Wodkas entkorkt und gläschenweise geleert, nach jeweils einem Toast. Die Jugendlichen, die keine Eltern haben und dort wie in eine Art Betreutem Wohnen untergebracht sind, führten einige Sketche auf. Dann wurden wir zu Tisch gebeten, an eine bis zum Platzen gefüllte Festtafel, wo uns ein am Vortag frisch geschlachtetes Schaf in sämtlichen Einzelteilen serviert wurde, von gekochter Zunge und gedünstetem Gehirn bis hin zu mit geronnenem Blut gefüllten Därmen. Ich hielt mich an einige gebratene Bruststückchen. Und wie in Russland nicht selten, wurden die wichtigen Dinge wie nebenbei hier geklärt, in einem Rahmen von Festlichkeit, Herzlichkeit und Emotion, statt in einer sachlichen geschäftlichen Unterredung. Die Einrichtungsleiterin berichtete, was dringend gebraucht würde, um die Arbeit fortzusetzen. Der Leiter der Deutsch-Sibirischen Gemeinschaft, ein korpulenter, herzlicher und humorvoller Mann, nannte eine Summe, die die Gemeinschaft würde spenden können und begründete auch, warum nicht mehr möglich ist – weil nämlich aufgrund der aktuellen politischen Verwerfungen in Deutschland kaum noch jemand das Projekt unterstützt. Auf die Geldzusage wurde angestoßen, mit Liedern des Kosakenchores und noch mehr Essen zeigten die Gastgeber ihre Dankbarkeit – das Leben konnte weitergehen.
Bald zeigte sich, was ich nach der Eröffnung der Drei-Liter-Wodkaflasche schon geahnt hatte: dass diese bis geleert werden muss und nicht etwa angebrochen stehen bleiben darf. Zum Glück waren die älteren deutschen Damen und Herren einigermaßen trinkfest. Ich bin solche Situationen inzwischen schon gewohnt und zog mich freundlich, aber bestimmt mit Hinweisen auf meine labile Gesundheit aus der Affäre. Innerlich aber schüttelte ich den Kopf: diese verdammten Trinkrituale – und ein Viertel aller russischen Männer versumpft im Alkohol und erreicht das fünfundfünfzigste Lebensjahr nicht. Jedenfalls war die Flasche dann tatsächlich irgendwann leer, und wir wurden mit den besten Wünschen entlassen. Es wurde auch Zeit: der Tag neigte sich, und uns standen noch vier Stunden Rückfahrt bevor.
Kontraste
18.09.: In größeren Häusern in der Stadt grüßen unbekannte Nachbarn einander nicht. Das Grüßen nicht näher bekannter Menschen ist überhaupt weniger verbreitet als in Deutschland und bedeutet meistens, dass man gewillt ist, ein Gespräch anzuknüpfen. Man wirft den Gruß also nicht einfach so in den Raum, sondern hat dazu ein Anliegen – oder geht gleich schweigend aneinander vorbei. Priwjet hört man deshalb sehr viel seltener als bei uns Hallo.
Um nicht sofort als Ausländer aufzufallen, habe ich mir das Grüßen in meinem Wohnhaus bisher verkniffen und kenne deshalb leider auch niemanden – außer meinem Nachbarn Sergej Ivanowitsch, den ich einmal an der Tür aufhielt, um mich ihm nett vorzustellen und ihn zu bitten, das Radio um sechs Uhr morgens nicht so laut zu stellen, dass meine Wohnung gleich mit beschallt wird. Ja, natürlich, kein Problem, war die Antwort, und zu meiner Überraschung blieb die Frage aus, wo ich eigentlich herkomme. Einige Tage später kam ich abends nach Hause und fand Sergej Ivanowitsch schlafend im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür liegen. Wahrscheinlich hatte er einen über den Durst getrunken und war nicht mehr imstande gewesen, die Tür zu öffnen. Ich ließ ihn einfach liegen. So etwas kommt im Alltag schon einmal vor.
In dieser Woche habe ich Bekanntschaft mit dem Opernsänger Maxim gemacht. Maxim ist ein stämmiger junger Mann burjatischen Äußeres mit einer tiefen Stimme, der gut Deutsch und Englisch spricht und davon träumt, noch einmal Gesang zu studieren – und zwar in Deutschland. Ich lud ihn an die Uni in mein Büro ein und erzählte ihm etwas von den Aufnahmebedingungen an deutschen Musikhochschulen und von Stipendienprogrammen. Und dann sagte ich ihm, wovon ich im Moment träume: nämlich davon, hier ein Cello zu finden. „Ach, du spielst Cello?“, meinte Maxim. „Willst Du nicht bei uns im Opernorchester anfangen? So mit halber Stelle? Es gibt nur drei oder vier Celli hier, sie finden nicht genug Leute…“ Erstmal brauche ich ein Instrument, erwiderte ich. Mein neuer Bekannter versprach, sich zu kümmern, und nahm mich gleich mit in die Generalprobe von Puccinis „Toska“, wo er im zweiten Akt den Polizeichef singt. Das Operntheater von Ulan-Ude ist von außen und innen ein prächtiges Gebäude, Iskusstvo prinadlezhit narodu, steht in goldenen Lettern unterhalb der Decke im Saal, „Die Kunst gehört dem Volk. Sie soll ihre tiefsten Wurzeln in der breiten Masse der arbeitenden Klasse haben. W.I. Lenin.“
Weniger prächtig ist dagegen leider die Ulan-Ude’er Altstadt. Sie verdient ihren Namen auf eher traurige Weise: viele der Holzhäuser, wohl noch aus Zeiten von vor der kommunistischen Revolution stammend, sind total herutergekommen, die Straßen sind ausgestorben. Zwischendurch erfreut immer einmal ein Schmuckstück mit neu gestrichenen Fensterläden und schönen Schnitzereien den Blick. Hinter der blau-weiß leuchtenden Kirche entdeckte ich in einer Sackgasse ein Denkmal an die Opfer politischer Repressionen – eine gar nicht mal kleine Statue und viele Gedenktafeln an Menschen mit einem Todesdatum in den dreißiger Jahren, der Zeit der Stalinschen Säuberungen.
Als ich gerade um das Denkmal herumlief, kam einen Anruf von der Lehrstuhlleiterin Elena. Es gäbe ein wichtiges Treffen mit dem Dekan, wo meine Anwesenheit sehr nützlich wäre. Kein Problem, meinte ich, wann das Treffen denn stattfände? Es hätte schon vor zehn Minuten begonnen, meinte Elena. Vielleicht könnte ich es ja noch schaffen, dazuzukommen? Ich bin dabei, mich daran zu gewöhnen, dass viele Dinge – auch im offiziellen Uni-Betrieb - keinen Planungsvorlauf haben, sondern von einem Augenblick auf den anderen stattfinden können.
Gremjatschinsk
20.09.: In einer Buchhandlung erregte ein Tisch mit dem Aufsteller „Verbotene Bücher“ meine Aufmerksamkeit. „Diese Bücher sind in der Ukraine verboten“, stand dort; versammelt waren Titel wie „Projekt Neu-Russland“, „Ukraine – Revolution und Chaos“ und „Ende des Projekts Ukraine“. Ob es in ukrainischen Buchläden ähnliche Auslagen mit in Russland verbotenen Büchern gibt?
Mein dritter Baikal-Ausflug führte mich nach Gremjatschinsk. Das Ufer an dem kleinen Dorf einhundertvierzig Kilometer nördlich von Ulan-Ude ist flach und sandig, umrahmt von waldbewachsenen Bergen. Malerische Kiefern stehen nicht weit vom Wasser, und der Blick über den See hinweg fällt auf die Steilküste von Olchon, der berühmtesten und größten Insel des Sees. Die Luft war sauber und das Wasser herrlich klar, von den diesjährigen Waldbränden zeugten nur viele kleine verkohlte Holzstückchen, die die Wellen ans Ufer geworfen haben.
Für die Rückfahrt stellte ich mich an die Straße und hielt den Daumen heraus. Nach einer kleinen Weile stoppte ein schicker, glänzender Jeep. Am Steuer saß ein dicker Mann mit feistem Gesicht. „Fahren Sie nach Ulan-Ude?“ – „Ja, aber ich bin betrunken. Macht das was?“ – Ich schaute etwas hilflos seine Beifahrerin an. „Macht er Spaß?“ Die Frau schaute nur ausdruckslos vor sich hin. „Na, wenn Sie betrunken sind, dann lieber nicht“, meinte ich unsicher, woraufhin der Mann grinste und Gas gab.
Mit dem nächsten Auto hatte ich Glück. Wir fuhren an grünen Kiefernwäldern und gelb-orange glänzenden Laubwäldern vorbei, ich wurde auf schwarze und braune Stellen hingewiesen, an denen der Wald gebrannt hat. In diesem Sommer hat das Feuer wohl 12000 Quadratkilometer erfasst – zwei Drittel der Fläche Sachsens, auch für hiesige Maßstäbe eine Menge.
Der erste Brief aus Deutschland hat mich erreicht – er war drei Wochen unterwegs. In Russland werden Adressen oft genau umgekehrt geschrieben wie bei uns, also beginnend mit der Postleitzahl und endend mit dem Namen. Drei Zahlen in der zweiten Zeile stehen für Hausnummer, Eingangsnummer und Wohnungsnummer. Postboten können inzwischen wohl auch lateinische Buchstaben lesen.
Unterricht
26.09.: Wie überall in Russland sind die Studenten hier während ihres ganzen Studiums in festen Gruppen zusammen. Ich unterrichte vier verschiedene solcher Gruppen, die mit fünfstelligen Zahlen bezeichnet werden. Gruppe 02231 ist im dritten Studienjahr – nicht die Semester, sondern die Studienjahre werden gezählt – und lernt Deutsch als erste Fremdsprache. Von den sechs Leuten, die auf der Liste stehen, kommen meistens drei oder vier: brave, artige, disziplinierte Mädchen, denen ich am Anfang jedes deutsche Wort förmlich aus der Nase ziehen musste. Da ist ein Kommunikations-Sprachkurs keine leichte Aufgabe, zumal der Kurs um acht Uhr morgens stattfindet. Inzwischen sind sie ein wenig aufgetaut und fragen sogar nach der Hausaufgabe, wenn ich vergesse, ihnen eine aufzugeben.
In Gruppe 02121 herrscht mehr Lockerheit. Die acht tatsächlich fast immer alle anwesenden Damen studieren Deutsch nur als zweite Fremdsprache und sind, wie man es oft bei Englisch-Studenten beobachten kann, etwas cooler drauf als ihre überdisziplinierten Kommilitoninnen von der deutschen Abteilung. Hier gelingt es mir gut, Schwung in den Unterricht zu bringen: ich lasse die Studenten im Raum herumlaufen und sich gegenseitig Fragen stellen, spiele ihnen Hör-Geschichten aus dem Lehrbuch vor und wir lesen die Dialoge anschließend mit verteilten Rollen. Wenn sie auf ihrem Smartphone herumtippen, dann benutzen sie tatsächlich meistens ihr elektronisches Wörterbuch – was natürlich erlaubt ist.
Gruppe 18452 ist meine Lieblingsgruppe. Die Master-Studentinnen haben mit Abstand das beste Sprachniveau und unterrichten teilweise schon selbst Deutsch oder Englisch an einer Schule. Wir üben schnelles und kreatives Beschreiben mit dem „Tabu“-Spiel und vergleichen deutsche und russische Sprichwörter: auf Russisch macht man aus einer Fliege einen Elefanten, nicht aus einer Mücke, und man kennt etwas wie seine fünf Finger und nicht wie seine Westentasche. Ich schlug ihnen vor, dass wir uns einmal in einem Café treffen könnten. „Gern“, meinten sie, „aber erst nach dem Stipendium.“ Was in Deutschland das BA-FöG ist, heißt in Russland Stipendium und ist leistungsabhängig: wer nur Fünfen hat – die beste Note – bekommt viertausend Rubel monatlich, wer nur Vieren hat, zweitausend. Bei einer einzigen Drei auf dem Zeugnis gibt es nichts. Zusätzlich gibt es noch ein Sozialstipendium für die, deren Eltern weniger als sechstausend Rubel monatlich verdienen. Das Stipendium gibt es am fünfundzwanzigsten eines Monats – dann ist auch wieder Geld für einen Cafébesuch da.
Meine Lehrveranstaltung in der Gruppe 02221 ist ein Hauslektüre-Kurs und findet nur einmal in vierzehn Tagen statt. Wir besprechen deutsche Literatur, die die Studenten zuhause lesen sollen. Ich habe mich für drei Novellen von Stefan Zweig entschieden – allerdings in einer adaptierten, vereinfachten Fassung. Die „Episode am Genfer See“ passt gut, weil Boris, ein am Genfer See gestrandeter russischer Soldat im ersten Weltkrieg, vom Baikalsee kommt.
Eigentlich sollten neun Studenten in dieser Gruppe sein, tatsächlich kommen fünf. Wahrscheinlich kommen die anderen vier im Dezember mal vorbei, wohl wissend, dass ich ihnen den Kurs als „bestanden“ bescheinigen muss. Der Studienplan lässt es nicht zu, dass ein Kurs wiederholt wird. Damit die Studentenzahlen nicht unter ein Minimum sinken und somit die Arbeitsplätze für das Lehrpersonal gesichert sind, schleift man auch weniger motivierte Leute durch die Studienjahre mit – „durchgefallen“ in einer Lehrveranstaltung gibt es höchst selten.
Bürokratie
26.09.: Mein derzeitiges russisches Visum gilt bis Anfang November und ist ein Einmalvisum. Demnächst wird es um ein Jahr verlängert und in ein Mehrfachvisum umgewandelt – dann steht ein Besuch der Mongolei auf dem Programm, und Anfang Januar auch Heimaturlaub in Deutschland.