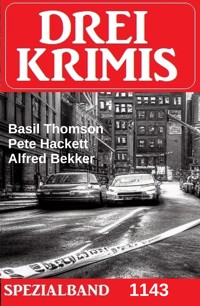
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Trevellian und das Schaf im Wolfspelz (Pete Hackett) Die nackte Mörderin (Alfred Bekker) Richardson und ein arrangierter Mord: Kriminalroman (Basil Thomson) Ein großer Mafia-Deal soll über die Bühne gebracht werden. Es geht um unvorstellbar große Summen - und unvorstellbar dreckige Geschäfte. Ein verdeckter Ermittler wurde eingeschleust und riskiert Kopf und Kragen. Als er auf einer Party des Syndikats-Bosses einem nackten Showgirl gegenübersteht, ahnt er nicht, dass er eine skrupellose Killerin vor sich hat...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Drei Krimis Spezialband 1143
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1143
Copyright
Trevellian und das Schaf im Wolfspelz: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Die nackte Mörderin
Richardson und ein arrangierter Mord: Kriminalroman
Drei Krimis Spezialband 1143
Pete Hackett, Alfred Bekker, Basil Thomson
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und das Schaf im Wolfspelz (Pete Hackett)
Die nackte Mörderin (Alfred Bekker)
Richardson und ein arrangierter Mord: Kriminalroman (Basil Thomson)
Ein großer Mafia-Deal soll über die Bühne gebracht werden. Es geht um unvorstellbar große Summen - und unvorstellbar dreckige Geschäfte. Ein verdeckter Ermittler wurde eingeschleust und riskiert Kopf und Kragen. Als er auf einer Party des Syndikats-Bosses einem nackten Showgirl gegenübersteht, ahnt er nicht, dass er eine skrupellose Killerin vor sich hat...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und das Schaf im Wolfspelz: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Eigentlich sind die FBI-Agenten Trevellian und Tucker mit einem Fall von Industriespionage beauftragt, aber ihr Chef McKee bittet sie, als Begleitpersonen ein Team zum Nordpol zu begleiten und in einer Forschungsstation nach dem Rechten zu sehen. In der Station arbeiten Klimaforscher, die dort die Auswirkungen der Klimaerwärmung erforschen und es scheint mehr ein Ausflug als Arbeit zu sein. Dieser Eindruck ändert sich aber schnell, denn die Ermittler finden nur Leichen in der Station.
1
»Erwarten wir Besuch?«, fragte Ben Hastings und schaute aus dem Fenster des Bürocontainers.
Auch Professor Bill Aldridge hörte das Brummen des Motors. Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht, dass ich wüsste.«
Die Tür zum Nachbarcontainer wurde aufgerissen, eine Frau von etwa dreißig Jahren erschien. »Wir bekommen Besuch. Wer mag sich wohl in diese Ödnis verirrt haben?«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Professor Aldridge. »Aber wir werden es schätzungsweise gleich sehen.«
Er ging zur Tür und verließ den Container. Ein eisiger Wind empfing Professor Aldridge. Etwa hundert Yards entfernt senkte sich der Hubschrauber langsam auf den Boden. Schnee staubte im Luftzug der Rotorblätter. Dann setzte der Heli auf.
Der Tod war gelandet.
Die Luke des Hubschraubers öffnete sich, drei Männer sprangen heraus. Zwei trugen Maschinenpistolen. Der Professor kniff die Augen zusammen. Die drei Ankömmlinge näherten sich. Aus einem Container ein Stück entfernt trat ein Mann. Er war Techniker und hielt die Generatoren in Stand. Er winkte dem Professor zu.
Der Mann, der von den beiden Maschinenpistolenträgern flankiert wurde, trat vor den Professor hin. »Sind wir hier richtig auf der Station Lars O'Connor?« Der Bursche war um die vierzig und hatte fast schwarze Haare, die unter einer Pelzmütze hervorlugten. Sein Gesicht war schmal, die bernsteinfarbenen Augen blickten kalt und durchdringend.
»Ja. Ich bin Professor Bill Aldridge. Ich leite das Team hier. Wer sind Sie und was …«
Der Dunkelhaarige zog eine Pistole unter seinem Mantel hervor und erschoss den Professor. Sofort feuerte einer seiner Begleiter mit der Maschinenpistole auf den Techniker, der für die Generatoren zuständig war. Der Mann bäumte sich auf und brach zusammen.
Die Mörder stürmten in den Container. Die Maschinenpistolen begannen zu rattern. Die drei Kerle zogen eine Blutspur durch die Station. Als sie sie wieder verließen, blieben nur tote Männer zurück.
2
Fred Mercer beendet seinen Dienst und holte sein Auto vom Parkplatz. Es war 17 Uhr. Der Chemiker, der bei Henders & Dexter seine Brötchen verdiente, wollte noch einige Besorgungen machen, ehe er nach Hause fuhr. Er fuhr einen Supermarkt an. Seit er sich von seiner Lebensgefährtin getrennt hatte, musste er seinen Haushalt selbst versorgen und sich darum kümmern, dass er an den Abenden etwas in den Magen bekam. Er kaufte Brot und Wurst und einen Sechserpack Bier, warf alles auf den Rücksitz seines Wagens und klemmte sich wieder hinter das Steuer. Eine halbe Stunde später parkte er den Wagen vor seiner Wohnung. Er wohnte in einer ruhigen Seitenstraße im Osten von Staten Island in einem Zwei-Zimmer-Apartment, das er bezog, nachdem ihn seine Freundin auf die Straße gesetzt hatte. Anfangs war er wütend auf sie gewesen. Sie hatte einen anderen Mann kennengelernt und ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Inzwischen hatte er sich damit abgefunden. Und manchmal empfand er das Leben als Single sogar als angenehm. Er war niemandem mehr Rechenschaft schuldig.
Mercer stieg die Stufen zu seinem Apartment empor und schloss die Tür auf. Gleich darauf betrat er seine Wohnung. Die Luft war ein wenig abgestanden. Er trug seine Einkäufe in die Küche und stellte sie auf den kleinen Tisch, dann ging er ins Wohnzimmer und schob das Fenster in die Höhe. Von hier aus konnte er hinunter auf die Straße blicken. Sie war menschenleer. Das Brummen von Motoren war zu hören. Mercer schaltete den Fernsehapparat ein. Soeben wurden die Nachrichten ausgestrahlt. Der Nachrichtensprecher sagte: »… vier Wissenschaftler der Universität New York tot aufgefunden. Auch die Techniker, die sich mit ihnen auf der Station befanden, wurden ermordet. Die Polizei in Juneau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Motiv für die Bluttat ist noch nicht erkennbar. Im Übrigen hüllt man sich in Polizeikreisen noch in Schweigen. – Bagdad: Wieder hat ein Selbstmordattentäter vor einer Polizeistation eine Bombe gezündet …«
Mercer ging zurück in die Küche, um die Lebensmittel, die er gekauft hatte, im Kühlschrank und im Brotfach zu verstauen. Er nahm eine Dose Bier aus dem Sixpack und öffnete sie, trank einen Schluck und kehrte ins Wohnzimmer zurück.
»… eines Fehlers bei der Zielrakete ist ein Test für den Aufbau des umstrittenen US-Raketenschilds gescheitert«, sagte der Nachrichtensprecher. »Die eigentliche Abfangrakete sei gar nicht erst gestartet, weil das Ziel nicht die geplante Höhe und Entfernung erreicht habe, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Der Test fand über dem Pazifik statt …«
Es läutete. Fred Mercer schaute verblüffte drein. Wer sollte ihn um diese Zeit besuchen? Er ging zur Tür und schob die Klappe vor dem Spion zur Seite. Ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren stand draußen. Der Chemiker kannte ihn nicht. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit. »Ja, bitte?«
Der Mann vor der Tür lächelte. »Ich war schon mal da, aber Sie waren bei der Arbeit. Ich komme von der städtischen Wasserversorgung und muss die Verplombung in Ihrer Wasseruhr überprüfen. Es dauert nur eine Minute. Ich werde also Ihre kostbare Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen.«
Mercer öffnete die Tür vollends. »Kommen Sie herein«, brummte er und grinste. »Stehe ich etwa im Verdacht, die Wasseruhr manipuliert zu haben?«
»Routinekontrolle«, erwiderte der Mann und ging an Mercer vorbei in die Wohnung.
»Die Wasseruhr befindet sich im Badezimmer«, gab Mercer zu verstehen und wies mit einer knappen Geste auf eine der Türen. Gleichzeitig drückte er die Tür zu.
Der Mann verschwand im Badezimmer. Mercer setzte sich in einen Sessel und richtete seinen Blick auf den Bildschirm. Der Nachrichtensprecher verabschiedete sich und wies auf die nächsten Nachrichten in einer Stunde hin. Die Bilder wechselten. Der Mann von der städtischen Wasserversorgung kam wieder ins Wohnzimmer. In seiner rechten Hand lag eine Pistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Einen Augenblick lang war Mercer nicht fähig, einen Gedanken zu fassen. Sein Mund klaffte auf, ein verlöschender Ton entrang sich ihm, in seine Augen trat der Ausdruck von Fassungslosigkeit und Erschrecken. Abwehrend hob er die linke Hand. Er wollte etwas sagen, aber seine Stimme versagte. Dann sah er das Mündungsfeuer und spürte den Einschlag in die Brust. Es war die letzte Wahrnehmung in seinem Leben. Er fiel im Sessel nach hinten. Die Detonation war kaum zu hören gewesen. Pulverdampf zerflatterte. Ohne die Spur einer Gemütsregung starrte der Killer auf sein Opfer. Er sah den blutigen Fleck auf Mercers Hemdbrust und wusste, dass er ihm die Kugel mitten ins Herz geschossen hatte.
Er ließ die Hand mit der Pistole sinken und schraubte den Schalldämpfer ab. Diesen schob er in die Jackentasche, die Pistole verstaute er unter dem Jackenschoß in seinem Hosenbund. Dann nahm er sein Handy, holte eine eingespeicherte Nummer auf das Display und stellte eine Verbindung her. Als sich jemand meldete, sagte er: »Auftrag ausgeführt. Mercer schweigt für immer.«
»Gute Arbeit. Ihren Lohn haben Sie ja erhalten. Sollte ich wieder einen Auftrag für Sie haben, melde ich mich.«
»Es macht Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.« Der Killer drückte die Unterbrechungstaste und schob das Mobiltelefon in die Tasche. Dann versicherte er sich, dass im Treppenhaus die Luft rein war und verließ die Wohnung.
3
»Ihr sollt gleich mal zum Chef kommen!«, sagte Mandy. »Es scheint ziemlich wichtig zu sein.«
»Wir sind schon auf dem Weg«, antwortete ich und legte auf. »Komm, Milo, der AD will uns sehen.«
Wenig später betraten wir Mandys Büro. Die Verbindungstür zum Büro des Chefs war geschlossen. »Geht nur hinein«, forderte uns Mandy auf. »Mr. McKee wartet schon.«
Wir betraten das Büro. Der Assistant Director begrüßte uns per Handschlag, dann wies er auf den kleinen Konferenztisch. »Setzen Sie sich.«
Ich war gespannt, um was es ging.
Mr. McKee setzte sich zu uns. »Es geht um die Station Lars O'Connor im Eismeer nördlich von Alaska. Dort sind vier Wissenschaftler und einige Techniker stationiert. Seit Tagen ist jeder Kontakt zu der Station abgerissen.«
»Wären da nicht die Kollegen in Anchorage zuständig?«, fragte Milo.
Mr. McKee schüttelte den Kopf. »Es handelt sich um einen Auftrag der Universität New York. Die Leute, die auf der Station stationiert sind, stammen allesamt aus New York. Sie arbeiten am North Alaska Ice Core Project. Es geht um die Erforschung des arktischen Eiskerns. Die Forschungen sollen Aufschluss über Klimaänderungen geben.«
Wir musterten Mr. McKee fragend.
Er fuhr fort: »Die Universität New York will einige Leute in die Arktis schicken, damit sie sich ein Bild von den Zuständen in der Station verschaffen können. Man hat mich gebeten, zwei Agents abzuordnen, die das Team begleiten. Ich habe an Sie beide gedacht. Mal ein kleiner Urlaub am Nordpol. Sie werden sicher nichts dagegen einzuwenden haben.«
»Nimmt man an, dass eine Straftat vorliegt – etwas, das in die Zuständigkeit des FBI fallen könnte?«, fragte ich.
Der AD nickte. »In New York sind drei Leute spurlos verschwunden. Professor Dr. Stan Wright, ein namhafter Physiker, der Stadtverordnete Hamilton Wagener und die Pressesprecherin des Gouverneurs, Elizabeth Stamford. Sie gehören zu einer Organisation, die sich für eine saubere Umwelt einsetzt und die Anhänger auf der ganzen Welt hat. Dieser Organisation gehört auch Professor Bill Aldridge an, der das Team in Alaska leitet. Auch drei weitere Wissenschaftler des Teams gehören zu den Fighter for a clean Environment.«
»Hört sich ja ziemlich kämpferisch an«, sagte Milo.
»Die Fighter for a clean Environment haben auch gewissen Kreisen den Krieg erklärt«, erklärte Mr. McKee und führte sofort aus: »Die USA haben seinerzeit das Kyoto-Protokoll zwar unterschrieben, dann aber nicht ratifiziert. Offenbar hatte sich die neue Regierung unter Bush davon überzeugen lassen, der US-Wirtschaft emissionssenkende Investitionen ersparen und ihr dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen zu können. Es geht also gegen eine starke einflussreiche Lobby von Industrie und Regierung und der Schlagabtausch wird ziemlich heftig geführt.«
»Was wollen die Fighter erreichen?«, fragte ich.
»Sie haben eine Kampagne gegen die Erderwärmung gestartet und fordern restriktive Gesetze gegen die Umweltverschmutzung. Die Gruppe findet immer mehr Anhänger. Die Regierung gerät in Zugzwang. Die Industrie, die Milliarden von Dollar investieren müsste, um geforderte Umweltauflagen zu erfüllen, versucht das Problem natürlich zu verharmlosen und spricht davon, dass man mit Kanonen auf Spatzen schießt.«
»Man stellt zwischen dem Verschwinden der drei Leute in New York und der Tatsache, dass der Kontakt zu der Station abgerissen ist, eine Verbindung her«, konstatierte ich.
»So ist es. Es hat Drohungen gegeben. Präsident der Fighter ist Professor Dr. Dennis Hydeman.« Der Chef machte eine kleine Pause. »Es sind ein Geologe, ein Mediziner und eine Toxikologin, die die Universität New York nach Norden schicken möchte. Woran arbeiten Sie gerade?«
»Betriebsspionage.«
»Geben Sie den Fall an die Agents Anderson und O'Leary ab. Setzen Sie sich mit der Universität New York in Verbindung. Ihr Ansprechpartner ist John Russel, der Geologe, der mit Ihnen ins Nordmeer fliegen wird. Wir bleiben in Verbindung, Gentlemen.«
Damit waren wir entlassen.
Wir kehrten in unser Büro zurück. Ich rief bei der Uni New York an und ließ mich mit John Russel verbinden. Nachdem er sich gemeldet hatte, stellte ich mich vor, dann sagte ich: »Mein Kollege Tucker und ich sind abgeordnet, Sie zum Nordpol zu begleiten.«
»Aaah, Agent Trevellian, es freut mich, dass Sie sich gleich bei mir melden. Wir haben keine Ahnung, was uns dort oben erwartet. Aber nach dem spurlosen Verschwinden dreier Mitglieder der Fighter for a clean Environment hier in New York befürchtet man …« Russel brach ab. »Ich weiß selbst nicht so genau, was man befürchtet. Ich nehme an, ein Verbrechen, weil man Polizei dabeihaben möchte.«
»Wie viele Menschen sind auf Lars O'Connor stationiert?«, erkundigte ich mich.
»Neun.«
»Wann fliegen wir?«
Russel nannte mir die Daten; Flugtag, Abflugzeit, Flugnummer. Der Flug würde nach Barrow gehen. Dort sollten wir in eine Twin Otter umsteigen, um zu der Station im Nordmeer zu fliegen.
»Übermorgen also«, knurrte Milo, nachdem ich aufgelegt hatte. »Ob es wirklich ein Urlaub wird, wie der AD meint, das lasse ich besser mal dahingestellt.«
»Lassen wir uns überraschen«, versetzte ich und wiegte skeptisch den Kopf.
4
Wir flogen vom La Guardia Airport ab. Unser erstes Ziel hieß Barrow. Es handelte sich um eine Eskimosiedlung mit knapp dreieinhalbtausend Einwohnern. Etwas nördlich lag die Barrowspitze, das Nordcap Alaskas, der nördlichste Punkt der USA.
John Russel war ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Er war mittelgroß und sehr sympathisch. Trevor Howard, der Arzt, war an die sechzig. Ein wortkarger Mann mit schlohweißen Haaren, der ein hohes Maß an natürlicher Autorität verströmte und eine Koryphäe aufs seinem Gebiet sein sollte. Mary Jane Coulter war um die vierzig und sehr attraktiv. Eine gepflegte Erscheinung, deren Faszination sich kaum ein Mann entziehen konnte.
Die DHC-6 »Twin Otter«, ausgerüstet mit Schneekufen, stand bereit. Sie verfügte über zwei Triebwerke. Wir flogen über das Meer. Eisberge und riesige Eisflächen wurden sichtbar. Dann tauchten die Container der Station inmitten der Eiswüste auf. John Russel klärte uns auf.
»In insgesamt einunddreißig Containern befinden sich die Arbeits-, Generator- und Wohnräume. Diese teilen sich in zwei Blöcke auf. Der eine Containerblock ist der Arbeits- und Wohnbereich der Techniker und Wissenschaftler. Der andere Block, etwa zehn Meter weiter, ist für die Infrastruktur. Getrennt wurde die Station wegen der Brandgefahr. Fast alle Forschungsstationsverluste sind durch Feuer entstanden, da es meist an Löschwasser fehlt. Der eigentliche Stationsblock besteht aus vierzehn Containern. Fünf Schlafcontainer stehen für maximal vierzehn Personen zur Verfügung. Ein Container mit Nasszelle für Dusche, Bad und Klo sowie ein Doppelcontainer, in dem eine Küche und eine Sitzgelegenheit steht.«
Wahrscheinlich stellte Russel fest, dass Milo und ich nur mäßiges Interesse an seinen Ausführungen zeigten, denn er lächelte und sagte: »Warum langweile ich Sie mit solchen Hinweisen? Für Sie wird nur von Interesse sein, ob hier alles seine Ordnung hat.«
Wir landeten. Ein eisiger Wind, der wie ein hungriger Wolf heulte, empfing uns. Wir gingen zu der Station hin. Vor einem der Container stand ein Schneemobil. Und da lag auch ein Mann im Schnee. Er war steifgefroren. Wir drehten ihn auf den Rücken. »Das ist Professor Aldridge«, entrang es sich Mary Jane Coulter. Sie atmete stoßweise. Grenzenloses Entsetzen wob in ihren Augen. Sie presste eine Hand auf den Mund und biss hinein, als wollte sie so verhindern, jeden Moment loszuschreien.
Vor einem der anderen Container lag ebenfalls ein Mann. Tot, erschossen. Seine Brust war von Kugeln zerfetzt. Die Wand des Containers wies ebenfalls Kugellöcher auf. Wir gingen in die Station. Und wir fanden nur tote Männer. Der Tod war wieder einmal unersättlich gewesen in seiner Gier. Die starren Gesichter der Toten spiegelten das letzte Entsetzen ihres Lebens wider. Sie waren mitten bei der Arbeit überrascht worden.
»Großer Gott«, entrang es sich John Russel. »Wir – wir müssen die Polizei verständigen.
»Ich übernehme das«, sagte ich. Dann rief ich das Field Office in Anchorage an, dessen Nummer ich schon in New York in mein Handy gespeichert hatte. Man sagte mir zu, einige Beamte zu schicken.
5
Wes Hadley traute seinen Augen nicht. Der Arbeiter der städtischen Kanalreinigung ließ den Strahl seiner Taschenlampe über den Boden gleiten. Das Grauen erfasste ihn. In dem stillgelegten Schacht lagen drei Leichen. Zwei Männer und eine Frau. Die Verwesung hatte schon eingesetzt. Der Geruch, der dem Arbeiter in die Nase stieg, war unbeschreiblich. Ratten huschten davon. Eine unsichtbare Hand schien Wes Hadley zu würgen. Das Grauen packte ihn und ließ ihn erschauern. Eiskalt rann es ihm über den Rücken hinunter.
Hadley lief zurück zu seinem Team, das neben einer Reihe weiterer Teams die Aufgabe hatte, die Kanalisation des Big Apple zu überwachen und sauberzuhalten, und machte den Teamleiter auf seinen Fund aufmerksam.
Eine Stunde später war die Polizei vor Ort.
6
Clive Caravaggio und Blackfeather befanden sich bei Mr. McKee. Der Assistant Director sagte: »Bei den drei Leichen, die in der Kanalisation gefunden wurden, handelt es sich um Professor Dr. Stan Wright, um den Stadtverordneten Hamilton Wagener und die Pressesprecherin Elizabeth Stamford. Sie gehörten zu den Fighter for a clean Environment, einer Umweltschutzvereinigung, die fast die Bedeutung von Greenpeace erreicht hat.«
»Kann ihr Tod mit ihrer Zugehörigkeit zu dieser Organisation zu tun haben?«, fragte Blacky.
Der Assistant Director zuckte mit den Schultern. »Möglich. In Alaska hat man eine Gruppe von Forschern ermordet, von denen vier ebenfalls der Umweltorganisation angehört haben. Jesse und Milo sind auf dem Rückflug nach New York. Die Ermittlungen vor Ort betreiben die Kollegen des Field Office in Anchorage.«
»Man vermutet also einen Zusammenhang zwischen den Morden am Nordpol und den drei Toten hier in New York«, stellte Clive Caravaggio fest.
Mr. McKee nickte. »Ich habe mir gedacht, dass Sie beide sich des Falles annehmen. Versuchen Sie, die Morde hier in New York aufzuklären. Das Verbrechen entbehrt nicht einer gewissen politischen Brisanz. Die Medien vermuten, dass die Morde auf das Konto einer Lobby gehen, die die Interessen der Industrie vertritt. Eine sehr gewagte These, der man von Seiten der Industrieverbände energisch entgegentritt.«
»Aber sicher nicht von der Hand zu weisen«, gab Clive zu bedenken.
»Womit Sie Recht haben, Clive. Leider handelt es sich nur um Mutmaßungen und von Seiten der Industrieverbände werden diese Angriffe auf das Schärfste verurteilt. – Vielleicht unterhalten Sie sich mal mit Professor Dr. Hydeman. Er ist Präsident der Fighter for a clean Environment und kann Ihnen sicher einige Insiderkenntnisse vermitteln.«
Professor Hydeman wohnte in der 55th Street Nummer 156. Er besaß ein Apartment in der dritten Etage. Blacky legte seinen Daumen auf den Klingelknopf. Natürlich hatten sich die beiden Agents bei dem Professor telefonisch angemeldet. Hydeman selbst öffnete ihnen die Tür. Er schaute ernst drein. Er vermittelte überhaupt einen ausgesprochen distinguierten Eindruck. »Sind Sie die beiden Gentlemen vom FBI?«
»Ja. Ich bin Special Agent in Charge Clive Caravaggio, das ist mein Kollege Special Agent Blackfeather.«
»Bitte, treten Sie ein.« Der Professor vollführte eine einladende Handbewegung.
Als sie saßen, griff sich der Professor an den Kopf. »Ich kann es noch immer nicht glauben. Die Fighter for a clean Environment haben ihren Sitz in New York. Bei den ermordeten Männern und bei Elizabeth Stamford handelt es sich um die einflussreichsten Mitglieder der Organisation. Mir – mir kommt das alles vor wie ein böser Traum. Es übersteigt meinen Verstand.«
»Es gab Drohungen«, sagte Clive.
»Ja. Aber wir haben sie nicht ernst genommen.«
»Hat sich jemand besonders als Gegner der Fighter for a clean Environment in Szene gesetzt?«
»Es hat ziemlich massive Angriffe der Organisation gegen Henders & Dexter gegeben. H & D ist der Umweltverschmutzer Nummer eins hier im Big Apple und wir haben einige Demonstrationen gegen den Konzern ins Leben gerufen.«
»Stahlerzeugung, nicht wahr?«
»Ja, führend auf dem Weltmarkt. Der CO2-Ausstoß des Werkes ist immens. Der Vorstand weigert sich, auch nur einen einzigen Cent in emissionssenkende Maßnahmen zu stecken. Es fehlt an entsprechenden Gesetzen. In Regierungskreisen ist man nicht bereit, daran etwas zu ändern. Wir stehen dem machtlos gegenüber.«
»Wer ist verantwortlich bei Henders & Dexter?«, fragte Blacky.
»Der Vorstandsvorsitzende heißt Miles Shuterland. Er ist arrogant und stellt sich taub, wenn es um Umweltschutz geht. Ihn interessieren nur die Umsatzzahlen des Konzerns – alles andere prallt an ihm ab wie an einer Wand aus Beton.«
»Hat man Ihnen persönlich gedroht?«
»Natürlich. Aber ich lasse mich nicht beirren. Demnächst wird in der Times ein großer Artikel von mir veröffentlicht, in dem ich über das Ausmaß der weltweiten Umweltverschmutzung und ihre Verursacher schreibe. Wenig später wird der Artikel auch in einem namhaften Fachblatt veröffentlicht. In der Publikation werden vor allem unsere Politiker nicht besonders gut wegkommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich nach der Veröffentlichung die Drohungen gegen die Fighter for a clean Environment im Allgemeinen und gegen mich im Besonderen wieder häufen.«
»Nach allem, was geschehen ist, sollten Sie diese Drohungen nicht auf die leichte Schulter nehmen«, bemerkte Clive Caravaggio.
»Das tue ich ganz gewiss nicht nach dem, was geschehen ist.«
Clive und Blacky fuhren anschließend nach Staten Island, wo Henders & Dexter auf einem riesigen Areal Stahl herstellte. Aus den Öffnungen der hohen Kamine quoll dunkler Rauch, ballte sich am Himmel und trieb träge nach Osten ab. Ungefiltert wurden hier Monat für Monat, Jahr für Jahr, zig Tonnen Umweltgift in die Atmosphäre geschleudert.
Der Vorstandvorsitzende wohnte in Manhattan, 74 East 67th Street, war an diesem Tag aber im Betrieb anzutreffen, wo er im Verwaltungsgebäude ein luxuriös eingerichtetes Büro sein eigen nannte. Die Sekretärin meldete Clive und Blacky telefonisch an. Dann wies sie auf die Verbindungstür und sagte: »Bitte, treten Sie ein, Agents. Mister Shuterland erwartet sie.«
Miles Shuterland war Ende vierzig und etwa eins fünfundachtzig groß. Seine dunklen Haare waren glatt zurückgekämmt. Er war ein Mann von Welt und darüber ließ er keinen Zweifel offen. Mit einem breiten Lächeln kam er um seinen Schreibtisch herum und streckte Clive die Hand hin. »Wieso interessiert sich das FBI für unseren Betrieb?«
»Vielleicht können wir das im Sitzen besprechen, Mister Shuterland.«
»Natürlich.« Shuterland begrüßte auch Blacky mit Handschlag. »Nehmen Sie Platz, Agents.« Der Vorstandsvorsitzende wies auf den runden Besuchertisch, um den sechs gepolsterte Stühle gruppiert waren. Clive und Blacky ließen sich nieder, und auch Shuterland setzte sich. Fragend schaute er von einem zum anderen. »Ich kann mir schon denken, was sie zu mir führt.«
»So, was denn?«
»Es geht um den Fall von Betriebsspionage, in dem Ihre Kollegen Trevellian und Tucker ermitteln, nicht wahr? Haben die beiden den Fall an Sie abgegeben?«
»Nein«, antwortete Clive, »das ist nicht der Grund, aus dem wir bei Ihnen sind, Mister Shuterland. Es geht um die Ermordung einiger Mitglieder der Organisation Fighter for a clean Environment. Sie haben sicher in den Medien von der Mordserie gehört.«
»Die Nachrichtensendungen und die Zeitungen sind voll davon«, erwiderte Shuterland und strich sich mit Daumen und Zeigefinger über das Kinn. »Eine schreckliche Sache. Doch nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Sie frage, was Henders & Dexter damit zu tun hat.«
»Henders & Dexter wurde von den Fighter for a clean Environment ziemlich heftig torpediert. Den führenden Köpfen der Organisation wurde anonym gedroht. Und jetzt hat man sieben von ihnen brutal ermordet.«
Shuterland lachte etwas gekünstelt auf. »Denken Sie, dass H & D hinter den Morden steckt?«
»Ich sagte es schon: Die Fighter for a clean Environment haben Ihr Unternehmen ziemlich unter Beschuss genommen. Das wäre doch ein Motiv, finden Sie nicht?«
»Nein, finde ich nicht!«, sagte Shuterland mit Nachdruck im Tonfall.
»Kennen Sie Professor Dr. Dennis Hydeman?«
»Der Mann ist eine bekannte Persönlichkeit.«
»Kennen Sie ihn persönlich?«, fragte Clive.
»Nein.« Shuterland schüttelte einige Male den Kopf. »Ich weiß aber, wie er aussieht. Das Fernsehen …« Der Vorstandsvorsitzende hob beide Hände. Dann fügte er hinzu: »Natürlich sind wir nicht über die Vorstöße dieser selbsternannten Kämpfer für eine saubere Umwelt erfreut. Sie stellen uns sozusagen an den Pranger. Emissionssenkende Investitionen würden allein bei H & D in die Millionen gehen. Das würde gezwungenermaßen den Stahlpreis erhöhen und sich auf den freien Wettbewerb auswirken.«
»Und weil das so ist, denkt man bei H & D nicht daran, in dieser Richtung etwas zu unternehmen, um den Giftausstoß zu reduzieren?«, fragte Blacky und es klang ausgesprochen sarkastisch.
»Es gibt keine Verpflichtung«, antwortete Shuterland ausweichend.
»Keine gesetzliche – aber eine moralische. Die Wissenschaftler der ganzen Welt warnen vor der globalen Klimaerwärmung. Lässt Sie das kalt?«
»Ich vertrete die Interessen von H & D«, versetzte Shuterland kalt. »Und solange es keine gesetzliche Verpflichtung gibt …«
»Was hat es mit der Betriebsspionage auf sich, von der Sie vorhin sprachen?«, fragte Blacky.
»Wir haben eine neue Edelstahllegierung erfunden. Effektiver und effizienter als das bisherige Verfahren. Kurz, bevor wir das neue Produkt auf den Markt bringen konnten, hat ein Unternehmen aus Boston die Legierung auf dem Weltmark vorgestellt und sogar ein Patent hierzu angemeldet. Fast zur selben Zeit wurde ein Chemiker unseres Betriebes ermordet.«
»In dieser Sache ermittelt bereits das FBI?«, versicherte sich Clive noch einmal.
»Ja. Die Agents Trevellian und Tucker.«
Clive und Blacky verabschiedeten sich.
»Was hältst du von Shuterland?«, fragte Blacky, als sie im Auto – einem Buick - saßen und in Richtung Bundesgebäude fuhren.
»Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ein millionenschwerer Wirtschaftsmagnat, der über Leichen gehen würde, um die Firma, die er vertritt, vor Schaden zu bewahren. Der fegt alles zur Seite, was sich ihm in den Weg stellt. Männer wie er haben vor zwei, drei Menschenaltern Amerika erobert; sie sind despotisch, unduldsam, kompromisslos und hart wie – wie …«
»… Stahl.«
»Richtig. Aber machen diese Eigenschaften Shuterland zum Mörder?«
7
Die Boening 737 landete auf dem Edward Lawrence Logan International Airport von Boston. Die Passagiere verließen das Flugzeug. Ein Mann, der keinerlei Gepäck bei sich hatte, verließ sofort das Terminal und mietete einen Wagen, mit dem er zu einer bestimmten Adresse in Boston fuhr. Er erreichte die Wohnung gegen 16 Uhr 30. Sie lag in einem frisch renovierten Haus in einer wahrscheinlich nicht gerade billigen Wohngegend. Die Tür war nur mit einem einfachen Zylinderschloss gesichert. Der Mann läutete. In der Wohnung rührte sich niemand. Er holte ein Etui aus der Jackentasche, in dem sich einige Schlüssel und Dietriche befanden. Es dauerte keine zwei Minuten, dann schwang die Tür nach innen auf. Der Mann betrat die Wohnung und drückte die Tür zu. Dann setzte er sich in einen Sessel und wartete.
Es dauerte fast zwei Stunden, dann hörte er an der Wohnungstür Geräusche. Wenig später betrat Clinton Carter seine Wohnung. Der Eindringling saß so, dass ihn Carter nicht sofort sehen konnte. Die Rückenlehne des Sessels deckte ihn. Er schloss die Tür und zog seine Jacke aus, hängte sie an den Haken neben der Tür und wollte in die Küche gehen, als sich der Eindringling aus dem Sessel erhob. Er hielt eine Pistole auf Carter gerichtet.
Carter erschrak bis ins Mark. Abrupt hielt er an. Ein erstickter Laut brach aus seiner Kehle, er verschluckte sich und hustete. Die Augen quollen ihm aus den Höhlen. Endlich hatte er den Reiz wieder unter Kontrolle. Keuchend und mit Tränen in den Augen fragte er: »Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie kommen Sie hier herein?«
»Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Was ich will! Nun, wir werden, wenn es finster ist, eine kleine Spazierfahrt unternehmen. Bis dahin sollten Sie sich hier auf die Couch setzen und auf keinen Fall versuchen, etwas zu versuchen. Es würde Ihnen schlecht bekommen. Hereingekommen bin ich durch die Tür. Sie sollten sich ein Sicherheitsschloss anschaffen, Carter.«
»Wer schickt Sie?« Seine eigene Stimme kam Clinton Carter fremd vor.
»Können Sie sich das nicht denken? Setzen Sie sich.«
Wie von Schnüren gezogen ging Clinton Carter zur Couch. Die Angst saß tief in ihm und rann wie Fieber durch seine Blutbahnen. Sein Herz pochte wie verrückt. »Was haben Sie vor?«
»Das werden Sie sehen.«
Carter wagte nichts zu unternehmen. Die Zeit schien für ihn plötzlich zu rasen. Draußen wurde es düster. Die Dunkelheit schritt fort. In Boston waren die Lichter angegangen. Sie erhellten den Himmel über der Stadt. Einmal hatte der Eindringling telefoniert. »Ich habe ihn.« Kurze Zeit hatte er gelauscht. »In Ordnung.« Mehr hatte er nicht von sich gegeben. Er saß im Sessel und bedrohte Carter mit der Pistole.
Irgendwann sagte er: »Es ist soweit. Sie werden vor mir gehen, Carter. Denken Sie daran, dass ich durch die Jackentasche auf Sie zielen werde. Wenn Sie also Zicken machen, müssen Sie mit einer Kugel rechnen.«
Sie verließen die Wohnung. Im Treppenhaus war es ruhig. Clinton Carter musste sich ans Steuer des Mietwagens setzen. Der Mann, der ihn entführte, sagte: »Wir fahren zum Meer. Den Weg kennen Sie sicher.«
Carter startete den Motor. Er war nicht stark genug, gegen diesen Strom aus kompromissloser Entschlossenheit, der von dem Fremden ausging, anzuschwimmen. Die Todesangst kam kalt und stürmisch wie ein Schneesturm.
8
Wir waren zurück in New York und hatten Mr. McKee Bericht erstattet. Er hatte schweigend zugehört und jetzt, nachdem ich geendet hatte, sagte er: »Man hat in New York in einem stillgelegten Kanal die Leichen von Professor Wright, des Stadtverordneten Wagener und der Pressesprecherin des Gouverneurs gefunden. Die Agents Caravaggio und Blackfeather ermitteln in dieser Sache. Wie Professor Aldridge und drei weitere der Wissenschaftler, die in der Station Lars O'Connor ermordet wurden, gehörten Wright, Wagener und Stamford zu den Fighter for a clean Environment.«
»Ist das eine Spur?«, fragte ich.
»Setzen Sie sich mit Clive und Blacky auseinander, Gentlemen. Was hat die Spurensicherung auf der Station ergeben?«
»Nicht viel. Wir nehmen an, dass es zwischen drei und fünf Männer waren, die für das Massaker auf der Station sorgten. Sie müssen Maschinenpistolen benutzt haben. Wobei Professor Bill Aldridge wahrscheinlich mit einer Pistole getötet wurde. Er wies nur einen Einschuss in der Brust auf.«
»Das heißt im Klartext, man hat nicht den geringsten Hinweis auf die Mörder.«
»So stellt es sich dar, Sir.«
»Haben die Kollegen in Alaska den Fall übernommen?«
»Das FBI hat ihn abgegeben«, sagte ich. »Die Ermittlungen betriebt das Police Departement in Juneau.«
»Hält man uns auf dem Laufenden?«
»Ja. Man hat es mir jedenfalls versprochen.«
»Na schön. Sollten Sie was Neues erfahren, setzen Sie mich in Kenntnis. Für Morgen ist eine Pressekonferenz wegen der Leichenfunde in der Kanalisation anberaumt. Clive wird mit von der Partie sein. Zwischen den Toten aus der Kanalisation und den Morden im Eismeer scheint ein Zusammenhang zu bestehen. Da Sie zuerst mit der Sache befasst waren, werde ich Ihnen wohl den Fall übertragen. Ich will aber erst Clives Meinung dazu hören.«
Wir suchten unser Büro auf. Ich rief Clive an. Wenig später standen er und Blacky bei uns auf dem Teppich. Wir begrüßten uns.
»Wie war's am Nordpol?«, fragte Blacky grinsend.
»Kalt«, versetzte Milo trocken. »Keine Sonne, kein Strand, keine Mädchen. Eis, Schnee, Wasser und eine Kälte, die dir das Gehirn einfriert.«
»Falls vorhanden«, flachste Blacky.
»Das ist natürlich Voraussetzung«, versetzte Milo. »Mir jedenfalls ist es eingefroren.«
»Hoffentlich ist es wieder aufgetaut.«
»Jetzt weiß ich, warum mir dauernd die Nase läuft«, knurrte Milo.
Dann wurden die Kollegen wieder ernst. Clive berichtete, was er und Blacky bisher herausgefunden hatten. Schließlich wusste ich, was Mr. McKee meinte, als er sagte, dass zwischen den Toten aus der Kanalisation und den Morden im Eismeer ein Zusammenhang zu bestehen schien.
»Wir müssen abwarten, was die Spurensicherung ergibt«, sagte ich. »Wobei ich der Meinung bin, dass die Mörder außer einer Unzahl von Geschossen keine Spuren hinterlassen haben. Ich gebe euch Recht, wenn ihr annehmt, dass die Zugehörigkeit der Ermordeten zu den Fighter for a clean Environment eine tragende Rolle spielt. – Der Chef überträgt den Fall vielleicht wieder Milo und mir. Vorher will er mit dir Rücksprache nehmen, Clive. Milo und ich würden die Sache gerne übernehmen.«
»Ich verstehe«, meinte Clive. »Keine Sorge, Jesse. Ich werde mich nicht allzu sehr an die Sache klammern.«
Clive und Blacky gingen. Wenig später tauchten Sarah Anderson und Josy O'Leary auf. »Wir haben es schon gehört«, sagte Sarah. »Es war für euch alles andere als ein erholsamer Ausflug.«
»Neun tote Männer sind ein Anblick, der dich nicht mehr loslässt«, erwiderte ich. »Sie verfolgen dich bis in deine Träume. Die Skrupellosigkeit, mit der die Täter vorgegangen sind, ist erschreckend.«
»Auch wir waren nicht untätig«, sagte Sarah. »Wir waren in Boston und haben bei der John Lincoln Ltd. ermittelt. Allerdings war unser Einsatz dort nicht von einem besonderen Erfolg gekrönt. Der Manager der Produktionsabteilung – sein Name ist Clinton Carter -, hat sich zwar in einige Widersprüche verstrickt, aber sie reichen nicht aus, um gegen ihn einen Haftbefehl zu erwirken. Die Tatsache, dass bei Henders & Dexter ein Chemiker ermordet wurde, lässt jedoch tief blicken.«
»Ihr tretet also auf der Stelle«, resümierte ich.
»Sozusagen«, antwortete Sarah.
Wir machten an diesem Tag pünktlich Feierabend und gönnten uns eine Pizza im Mezzogiorno. Während Milo ein Glas Wein dazu trank, musste ich mich als Autofahrer mit einem Glas Wasser begnügen. Die Pizza mundete vorzüglich. Anschließend fuhr ich Milo nach Hause und dann suchte ich meine eigene Wohnung auf. Während der vergangenen Tage, in denen ich nicht zuhause war, hatte sich einiges an Post angesammelt. Ich blätterte die Zeitungen durch, die des aktuellen Tages nahm ich mir allerdings ein wenig intensiver vor. Im Lokalteil sprang mir eine Schlagzeile in die Augen: Umweltschutz! Mehr als nur ein Wort. Untertitel: Professor Dennis Hydeman warnt vor den Folgen der Umweltverschmutzung.
Der Name Dennis Hydeman war mir heute zum Begriff geworden. Clive hatte ihn im Zusammenhang mit den Fighter for a clean Environment genannt.
Mit Interesse las ich den Artikel. Er war allgemein gehalten und beinhaltete nicht einen einzigen Hinweis auf den Stahlkonzern Henders & Dexter. Nachdem ich den Bericht gelesen hatte, war ich enttäuscht. Nach allem, was ich von Clive und Blacky wusste, hatte ich massive Angriffe gegen die Industrie erwartet. In Wirklichkeit war es nichts weiter als eine wissenschaftliche Abhandlung über die globale Klimaerwärmung und ihre Folgen für die Natur und natürlich auch den Menschen.
Am folgenden Morgen, wir hatten kaum den Dienst angetreten, rief Mandy an und bat uns, zu Mr. McKee zu kommen. Clive Caravaggio und Blacky waren schon anwesend. Mandy fuhr Kaffee auf. Nachdem wir den Kaffee mit Milch und Zucker aufbereitet hatten, begann der Chef: »Der Artikel, den Professor Hydeman verfasst hat, wurde gestern in der Times veröffentlicht. Heute Morgen hat mich der Professor angerufen. Er hat gestern drei Drohanrufe erhalten. Außerdem lag in seinem Postkasten eine Nachricht, wonach er das Wochenende nicht mehr erleben werde.«
»Der Artikel ist ziemlich allgemein gehalten«, wandte ich ein. »Er bietet keinen Hebel, um dem Professor mit dem Tod zu drohen.«
»Der Name macht's«, versetzte Clive. »Selbst wenn der Professor nur sein Abendgebet veröffentlicht hätte, würden irgendwelche aggressiven Zeitgenossen mit Todesdrohungen reagieren. Wobei ich davon ausgehe, dass neunundneunzig Prozent dieser Drohungen von Trittbrettfahrern stammen.«
»Also bleibt immer noch ein Prozent«, hakte ich ein, »und das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Jesse hat Recht«, ließ Mr. McKee vernehmen. »Und weil das so ist, habe ich beschlossen, den Professor für einige Tage unter Polizeischutz zu stellen. Sie vier werden sich bei seiner Bewachung ablösen. – Sie, Clive, brauche ich heute um 10 Uhr wegen der Pressekonferenz. Es wäre mir also recht, wenn Sie, Jesse und Milo, während des Tages die Überwachung des Professors übernähmen.«
9
Das Büro des Professors befand sich in der Pine Street. Sein Arbeitsplatz befand sich in der Columbia University. In seiner Wohnung in der 55th Street war er telefonisch nicht zu erreichen. Also versuchten wir es an seinem Arbeitsplatz. Fehlanzeige. In seinem Büro erwischten wir ihn endlich.
»Ich weiß nicht, was ich von den Drohungen halten soll«, sagte er. »Wahrscheinlich denkt so mancher Politiker oder Industrieller schon an Mord, wenn er nur meinen Namen liest. Ich habe mit meinem Club für Furore gesorgt, ich bin gefürchtet. – Nein, Agent, ich nehme die Drohung nicht auf die leichte Schulter. Im Gegenteil. Einer der Anrufe schien mir ziemlich authentisch gewesen zu sein. Ja, ich fürchte um mein Leben.«
»Wir werden auf sie aufpassen, Professor«, sagte ich, dann sagte ich ihm zu, innerhalb der nächsten halben Stunde in der Pine Street aufzukreuzen.
Die Pine Street ist eine Parallelstraße zur Wall Street. Wir mussten also nach Süden. Für diesen Einsatz benutzte ich einen Buick aus dem Fuhrpark des FBI. Es war ein sonniger Tag, der Himmel war blau, auf den Straßen und Gehsteigen jedoch lagen die Schatten der Wolkenkratzer und Hochhäuser Südmanhattans. Der Verkehr war chaotisch. Es wimmelte wie in einem Ameisenhaufen. In der Pine Street fand ich einen Parkplatz. Wenig später betraten wir das Gebäude, in dem sich das Büro der Fighter for a clean Environment befand.
Der Professor hatte die Nachricht, die er erhalten hatte, bei sich. Er gab mir das Blatt Papier. Die Nachricht war auf einem Computer geschrieben und ausgedruckt worden. Ich behielt sie, um sie der SRD zuzuleiten, damit diese sie auf Fingerabdrücke überprüfte. Sorgfältig legte ich das Blatt Papier zusammen und steckte es in die Innentasche meiner Jacke.
»Ich habe in Ihrem Artikel eigentlich erwartet, dass sie scharf auf H & D schießen«, sagte Milo.
Der Professor lächelte gequält. »H & D weiß genau, wen ich mit meiner Publikation ansprach. Mit jeder Zeile, die ich über den Umweltschutz und die Umweltverschmutzung schreibe, zerstöre ich etwas von der Reputation der Übeltäter, die sich dank politischer Unfähigkeit mit einer weißen Weste präsentieren dürfen. Es ist nicht notwendig, Namen zu erwähnen. Diejenigen, die ich ansprechen will, erreiche ich immer.«
Milo und ich setzten uns still in eine Ecke. Der Professor diktierte seiner Schreibkraft einige Briefe, führte einige Telefongespräche, unterschrieb einige Schriftstücke, die ihm seine Sekretärin in einer Unterschriftenmappe hingelegt hatte, dann schaute er Milo an, sein Blick wanderte zu mir, er sagte: »Und nun, Gentlemen, muss ich zur Uni. Wie machen wir es. Fahren Sie mich hin oder soll ich meinen eigenen Wagen nehmen und Sie folgen mir.«
»Ich fahre Sie hin, Professor«, sagte ich. »Mein Kollege Tucker folgt uns in Ihrem Wagen. Wie lange wird Ihr Aufenthalt in der Uni dauern?«
»Ich muss zwei Stunden Vorlesung halten.«
Wir verließen das Büro. Der Professor nahm auf dem Beifahrersitz des Chevy Platz. Er hatte Milo gezeigt, wo sein Auto – ein Mercury – stand und meinem Kollegen die Wagenschlüssel gegeben. Milo fuhr wenig später heran, ich kurbelte den Buick aus der Parklücke und fuhr zum Broadway, auf dem wir uns nach Norden wandten. Im Rückspiegel konnte ich Milo sehen.
Es ging nur sehr zögerlich voran. Hinter Milo hatte sich ein Toyota in den fließenden Verkehr eingeordnet. Wir folgten dem Broadway bis zur Chambers Street und bogen auf ihr nach Westen ab, um die West Street zu erreichen und von ihr aus auf die Eleventh Avenue zu gelangen, auf der wir direkt zur Columbia Universität kommen würden.
Der Toyota klebte nach wie vor an Milo dran. Wir rollten auf der rechten Fahrspur dahin. Bei der Einmündung der Canal Street stand die Ampel auf Rot und ich war ungefähr das zehnte Auto in der Schlange, die wegen der Rotschaltung anhalten musste. Der Toyota wechselte auf die linke Fahrspur und rollte langsam an dem Mercury, in dem Milo saß, vorbei. Ich konnte ihn im Seitenspiegel sehen. Und plötzlich sah ich Mündungsfeuer. Die Windschutzscheibe des Toyotas reflektierte es. Im nächsten Moment schoss der Toyota davon, an mir vorbei und raste in Richtung Canal Street. Jetzt sah ich, dass auch auf dem Rücksitz zwei Männer saßen.
Ich sprang aus dem Chevy, riss die SIG heraus und feuerte hinter dem Toyota her. Aus dem linken hinteren Reifen entwich die Luft. Der Wagen kam für einen Augenblick ins Schleudern, wurde aber abgefangen. Die Ampel schaltete auf Gelb. Der Toyota fuhr, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln, auf die Kreuzung. Ein Ford, der aus der Canal Street kam, krachte ihm in die Seite. Es schepperte und klirrte. Der Fahrer und die beiden Kerle im Fond des Toyotas sprangen aus dem Fahrzeug und suchten zu Fuß das Weite. Ich war hin und her gerissen. Was war mit Milo? Wie es schien, hatten ihn die Gangster mit dem Professor verwechselt. Aber da stieg Milo schon aus dem Mercury. Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich konzentrierte mich wieder auf die Gegebenheiten.
Einer der Kerle war in die Canal Street gelaufen und flüchtete nun in Richtung Hudson Street. Der zweite war zu den Piers gerannt. Der dritte war in irgendeinem Gebäude verschwunden. »Kümmere dich um den Kerl im Auto!«, rief ich Milo zu, dann rannte ich los. Es gelang mir in einer halsbrecherischen Aktion die West Street zu überqueren und dem Gangster, der in Richtung der Piers geflohen war, zu folgen. Meine Füße trappelten. Ich war gut in Form, sowohl im Hinblick auf die Schnelligkeit als auch hinsichtlich der Ausdauer. Regelmäßiges Training zahlte sich eben aus. Der Bursche rannte in Richtung des Piers 40. Sein Vorsprung betrug etwa hundert Yards. Auf dem Pier gab es alte Lagerhallen und Werkstätten. Tausend Möglichkeiten für den Kerl, sich zu verstecken und mir aufzulauern. Seine Beine wirbelten. Wahrscheinlich peitschte ihn die Angst vor mir voran. Hin und wieder schaute er sich um.
Als er wieder einmal zurückschaute, stolperte er. Er machte drei lange Schritte, konnte das Gleichgewicht nicht bewahren und stürzte. Vom Boden aus feuerte er auf mich. Aber auf diese Entfernung konnten mir seine Kugeln nichts anhaben. Ich blieb stehen. »Geben Sie auf!«, rief ich. »Sie können mir nicht entkommen.«
Er rappelte sich auf und machte einige hinkende Schritte. Dann wandte er mir das Hinterteil zu, schlug sich mit der flachen Hand darauf und rannte weiter. Ich folgte ihm. Er verschwand hinter einer der Lagerhallen.
Ich erreichte die Wand der Halle und schmiegte mich dagegen. Die SIG hielt ich in Gesichtshöhe. Die Mündung wies zum Himmel. Vorsichtig pirschte ich an der Wand entlang bis zur Ecke, lugte um sie herum und hatte die Giebelseite der Halle im Blickfeld. Der Kerl musste sich auf der anderen Seite befinden. Ich huschte um die Ecke und schob mich an der Wand entlang zur nächsten Ecke. Als ich einen Blick um sie riskierte, feuerte der Kerl auf mich. Ich sah ihn nur ganz kurz. Er lehnte mit dem Rücken an der Wand. Die Kugel fuhr über die Mauer und zog eine Furche. Putz und Gesteinssplitter spritzten. Der Querschläger quarrte durchdringend. Ich zog schnell den Kopf zurück.
Schritte trampelten. Ich wirbelte um die Ecke. Der Bursche rannte schräg über den freien Platz zur nächsten Halle. Mein Blick folgte ihm, die Hand mit der Pistole folgte meiner Blickrichtung. Ich jagte ihm eine Kugel hinterher, verfehlte ihn aber, weil er sich unheimlich schnell bewegte. Er erreichte die Halle und rannte um die Ecke, sodass er aus meinem Blickfeld verschwand. Für mich galt es, etwa zwanzig Yards ohne den geringsten Schutz zu überqueren. Der Gangster war im Umgang mit der Pistole sicherlich geübt. Jeder Yard konnte also der letzte sein. Auf der anderen Seite konnte ich den Burschen vielleicht aus der Reserve locken und ihn zu einem Fehler verleiten. Also setzte ich alles auf eine Karte und spurtete los. Während der Kerl am hinteren Ende der Halle verschwunden war, rannte ich zum vorderen, wo in die Giebelwand ein großes Tor eingelassen war, von dem die grüne Farbe schon abblätterte. Mein Gegner trat hinter der Ecke hervor und nahm mich unter Feuer. Ich schlug Haken wie ein Hase. Von den Detonationen war nichts zu hören, denn der Gangster hatte einen Schalldämpfer aufgeschraubt, der sie zum größten Teil schluckte.
Ich tat etwas, womit der Bursche wohl nicht rechnete. Ehe ich hinter der Ecke verschwand, hielt ich abrupt an und ging auf das linke Knie nieder, um ein möglichst kleines Ziel zu bieten. Meine Hand mit der SIG ruckte hoch, Schulter und Arm bildeten nur noch eine waagrechte Linie, über Kimme und Korn starrte ich auf den Kerl. Er schien verdutzt zu sein, wahrscheinlich hatte ich ihn mit meiner Reaktion irritiert. Und als er sich von seiner Verblüffung erholt hatte, drückte ich ab. Das Bein wurde ihm regelrecht vom Boden weggerissen. Er brach wie vom Blitz gefällt zusammen. Wie eine große Eidechse kroch er in den Schutz der Halle.
Ich richtete mich auf und verschwand im Schutz der Giebelwand, lief sie entlang und erreichte die andere Ecke, spähte um sie herum, und als die Luft rein war, pirschte ich an der Wand entlang in Richtung Rückwand der Halle, wo ich den Gangster vermutete.
Er war verwundet. Ich hatte ihm eine Kugel ins Bein geschossen und an Flucht konnte er wohl nicht mehr denken. Als ich die Ecke erreichte, hielt ich an und rief: »Es hat doch keinen Sinn. Ergeben Sie sich. Wollen Sie wirklich eine zweite Kugel kassieren. Wenn Sie sich nicht ergeben, zwingen Sie mich wahrscheinlich, auf Sie zu schießen.«
»Komm nur, Drecksbulle, und hol mich. Ich werde dir mit Vergnügen eine Kugel aufs Fell brennen.« Die Stimme klang schmerzgepresst. Ich lugte vorsichtig um die Ecke. Der Gangster stand mit dem Rücken zur Wand und presste die linke Hand auf seinen Oberschenkel. Er bemerkte wohl die flüchtige Bewegung an der Ecke und schoss. Ich sprang aus meiner Deckung. Ehe er das Ziel aufnehmen konnte, rief ich: »Waffe weg! Ich hab Sie im Visier.«
Trotz meiner Warnung richtete er die Pistole auf mich. Wir bedrohten uns gegenseitig. Es war ein stummes Duell und nur der Mann mit den stärkeren Nerven konnte gewinnen. Das Gesicht des Gangsters war verkniffen. Seine Mundwinkel zuckten. Ich hatte ihn in die Enge gedrängt und das machte ihn unberechenbar und gefährlich.
»Machen Sie schon!«
Da sah ich es in seinen Augen aufblitzen. Es mutete an wie ein Signal. Ich stieß mich ab und flog zur Seite. Er konnte sich nicht mehr schnell genug auf das so jäh veränderte Ziel einstellen. Seine Kugel pfiff an mir vorbei. Ich traf dafür umso besser. Kraftlos sank sein Arm mit der Pistole nach unten. Ein Aufschrei entrang sich ihm. Seine Hand öffnete sich und die Pistole fiel auf den Boden. Ich hatte ihm den Oberarm durchschossen. Er taumelte gegen die Wand und ließ den Kopf hängen. Seine blutbesudelte Linke umklammerte den rechten Oberarm.
Die Pistole auf ihn gerichtet näherte ich mich ihm. »Das hätten Sie auch weniger schmerzhaft haben können.«
»Fahr zur Hölle!«
Ich schob mit dem Fuß die Pistole des Gangsters außer Reichweite und hob sie auf, steckte sie in meinen Hosenbund, dann holte ich das Handy aus der Tasche und rief Milo an. Als er sich meldete, fragte ich: »Wie sieht es aus?«
»Der Kerl auf dem Beifahrersitz ist ziemlich schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens, der dem Toyota in die Seite knallte, hat nur den Schrecken davongetragen. Ich habe eine Ambulanz und Verstärkung angefordert. Hattest du Erfolg?«
»Ich habe einen der Kerle erwischt. Allerdings musste ich ihm eine Kugel ins Bein und eine zweite in den Arm schießen, ehe er aufgab.«
»Die beiden Wunden werden ihn nicht daran hindern, zu reden«, meinte Milo. »Bin neugierig, was er uns zu erzählen hat.«
»Okay, Milo. Ich muss eine Ambulanz bestellen. Bis später.« Ich drückte die Unterbrechungstaste und wählte die Nummer des Notrufs.
10
Der Mann, den ich geschnappt hatte, hieß Morton Donovan. Er befand sich in Rikers Island. Der Name des anderen Burschen, der bei dem Unfall ziemlich schwere Verletzungen davongetragen hatte, war Sven Hammer. Er lag im künstlichen Koma im New York Hospital, sein Zustand war kritisch.
Milo hatte bei dem Anschlag nur eine Streifschusswunde auf dem Rücken davongetragen. Sie war verarztet worden und würde meinen Kollegen nicht umwerfen. Der Überfall war ein weiteres Indiz dafür, dass die Gangster, mit denen wir es zu tun hatten, absolut rigoros und skrupellos vorgingen.
Wir trafen Donovan im Krankentrakt des Gefängnisses an. Er lag im Bett und sah ziemlich schlecht aus; bleich, eingefallen, dunkle Ringe unter den Augen …
»Wie geht es Ihnen?«, fragte ich.
»Es geht mir blendend«, versetzte der Gangster mit bitterer Ironie in der Stimme. »Eine Kugel im Bein, die andere im Arm – wie könnte es mir besser gehen?«
»Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben.«
Donovans Brauen schoben sich zusammen. Seine Mundwinkel sanken nach unten. »Was wollt ihr?«
»Können Sie sich das nicht denken? Haben Sie schon einen Anwalt konsultiert?«
»Ich bekomme einen Pflichtverteidiger.«
»Sind Sie bereit, auch ohne ihn mit uns zu sprechen?«
»Von mir erfahrt ihr kein Wort.«
»Wir können uns auch mit Ihrem Komplizen unterhalten«, drohte Milo. »Mordversuch an einem Bundesbeamten wird das Gericht entsprechend honorieren. Ihr Kollege wird sicher versuchen, für sich zu punkten, um beim Strafmaß etwas glimpflicher davonzukommen. Wir kriegen mit Sicherheit heraus, was wir wissen möchten. Sie werden allerdings auf der Strecke bleiben, Donovan.«
Im Gesicht des Gangsters arbeitete es. Es war deutlich: Er focht einen innerlichen Kampf aus. Gefühl und Verstand lagen bei ihm in zäher Zwietracht. Seine Miene war Spiegelbild dieser Auseinandersetzung.
»Was mein Kollege sagt, stimmt«, hakte ich nach. »Auch Kooperation wird vom Gericht entsprechend honoriert.«
Donovan überwand sich. »Was wollen Sie wissen?«
»Von wem hatten Sie den Auftrag, Professor Hydeman zu ermorden?«
»Von Glenn Warner. Er wohnt in der 37th Street. Wer hinter ihm steht, weiß ich nicht.«
»Nennen Sie uns die Namen Ihrer Komplizen.«
»Sven Hammer habt ihr ja erwischt. Er hat auf dem Beifahrersitz gesessen und geschossen. – Verdammt, dass er auf einen Bundesbeamten schoss, wussten wir nicht. Wir nahmen an, dass in dem Mercury Hydeman sitzt.«
»Da wir einen derartigen Anschlag befürchteten, haben wir ein wenig die Plätze getauscht«, gab Milo zu verstehen. »Die Namen der beiden anderen Kerle, Donovan. Und wenn es geht, auch gleich ihre Adresse.«
»Richard Callaghan und Jeff Overholser. Callaghan wohnt in der Cherry Street, Overholser in der 17th. Mit Hausnummern kann ich leider nicht dienen.«
»Die finden wir schon heraus.« Milo sprach es, zog sein Notizbüchlein aus der Jackentasche sowie einen Kugelschreiber und notierte die Namen und die dazugehörigen Adressen.
Dann verließen wir Rikers Island.
»Wen schnappen wir uns zuerst?«, fragte Milo. »Ich würde sagen, wir beginnen bei Glenn Warner. Er kann uns schätzungsweise mehr sagen als Hammer, Callaghan und Overholser, die meiner Meinung nach nur zum Fußvolk gehören, das die Schmutzarbeit zu verrichten hat.«
»Ich bin – wie so oft – deiner Meinung«, antwortete ich.
Milo bemühte den Computer. Minuten später wussten wir, dass Glenn Warner unter der Nummer 215 in der 37th Street wohnte. Es dauerte seine Zeit, bis wir wieder in Manhattan waren. Schließlich landeten wir in der 37th Street, und ich fand einen Parkplatz, der so eng war, dass es mein ganzes fahrerisches Können erforderte, um den Sportwagen einzuparken. Nun, ich schaffte es und erntete dafür ein paar anerkennende Worte von Milo.
Das Apartment befand sich in einem vielstöckigen Wohn- und Geschäftshaus, und von dem Doorman an der Rezeption erfuhren wir, dass Warner in der zwölften Etage wohnte. »Soll ich ihn informieren, dass Sie kommen?«, fragte der Mann.
»Auf keinen Fall«, erwiderte ich, und Milo fügte grinsend hinzu: »Es soll eine Überraschung werden.«
Wir fuhren mit dem Aufzug nach oben. Dann standen wir vor der Tür des Apartments. Milo klingelte. Niemand öffnete uns. Milo legte noch einmal den Daumen auf die Klingel. Der Klingelton war durch die geschlossene Tür zu hören. In der Wohnung rührte sich nichts.
Ich fuhr wieder hinunter in die Halle und sagte zum Doorman: »Geht Warner einem Job nach?«
»Natürlich. Er arbeitet bei Henders & Dexter. So weit ich weiß, ist er in dem Stahlwerk Abteilungsleiter.«
»Erweisen Sie mir einen Gefallen?«
»Wem soll ich den Gefallen erweisen?«
Jetzt zeigte ich dem Mann meine ID-Card. »Special Agent Trevellian, FBI New York.«
»Großer Gott, was hat das FBI …?«
»Wir müssen mit Warner sprechen«, unterbrach ich den Burschen. »Rufen Sie bei H & D an. Ich will wissen, ob er an seinem Arbeitsplatz erreichbar ist.«
»Einen Moment«, sagte der Mann kleinlaut, dann klickte er das elektronische Telefonbuch her und begann, seine Tastatur zu bearbeiten. Wenig später nahm er den Telefonhörer und hob ihn vor sein Gesicht, tippte eine Nummer, und gleich darauf sagte er: »Mister Warner bitte. – Danke.« Kurze Zeit verging. »Ich höre«, sagte dann der Doorman. Und sogleich: »Vielen Dank.« Er legte auf und schaute mich an. »Ich habe mit Warners Sekretärin gesprochen. Warner ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Er hat sich auch nicht entschuldigt.«
»Ist es möglich, die Wohnungstür zu öffnen?« Mir schwante Schlimmes.
»Es gibt einen Hausmeister. Ob er natürlich ohne Durchsuchungsbefehl …«
»Rufen Sie ihn an. Er soll in die zwölfte Etage kommen. Wir warten auf ihn.«
Der Aufzug trug mich nach oben. Es dauerte fast eine Viertelstunde, dann erschien ein vierschrötiger Bursche, der mit einem blauen Overall bekleidet war. Wir wiesen uns aus, und er machte keine Zicken. Ohne irgendwelche Fragen zu stellen, schloss er uns die Tür auf.
Glenn Warner lag mitten im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Seine Finger waren im Teppich verkrallt. Sein Gesicht wies die absolute Leere des Todes auf. Das Blut auf seiner Hemdbrust war bereits eingetrocknet.
Uns blieb es nur, die Kollegen von der SRD zu informieren. Den entsetzten Hausmeister schickten wir wieder weg. Die Kollegen kamen nach über einer Stunde. Der Leiter des Teams sagte mir zu, mich über die Erkenntnisse der Spurensicherung zu unterrichten, dann fuhren Milo und ich zur 17th Street.
11
Overholser und Callaghan waren beide polizeibekannt. Jeder von ihnen hatte eine ganze Latte von Vorstrafen aufzuweisen. Jetzt kam versuchter Mord hinzu und die beiden würden wohl für eine Reihe von Jahren hinter Gittern verschwinden.
Overholser wohnte in der dritten Etage. Nachdem ich geläutet hatte, kam er zur Tür. »Wer ist draußen?«
»Die Special Agents Trevellian und Tucker vom FBI New York. Öffnen Sie, Mister Overholser.«
Ich hörte eine Verwünschung, dann rief Overholser: »Was wollt ihr denn von mir? Wüsste nicht, was ich mit dem FBI zu tun hätte.«
»Dafür wissen wir es umso besser«, rief Milo. »Schöne Grüße von Morton Donovan. Er war schlau genug, die Chance, die wir ihm boten, beim Schopf zu ergreifen.«
»Bleibt mir bloß vom Leib, ihr verdammten Bullen. Ich habe nur in dem Wagen gesessen und wahr völlig ahnungslos, was Donovan und Hammer vorhatten.«
»Wenn Sie unschuldig sind, dann können Sie ja öffnen. Und sollte sich Ihre Unschuld herausstellen, wird man Sie unverzüglich wieder auf freien Fuß setzen.«
Sekunden verstrichen. Ich hörte eine murmelnde Stimme in der Wohnung. Wahrscheinlich telefonierte der Gangster. Ich entschloss mich von einem Augenblick zum anderen und warf mich mit meinem gesamten Gewicht gegen die Tür. Sie hielt meinem ersten Anprall stand. Und dann pfiffen zwei Kugeln durch das Türblatt. Aber ich war sofort zur Seite getreten und so gefährdeten mich die Geschosse nicht. Das Türblatt wies zwei fingerdicke Löcher auf, die Kugeln waren in die der Tür gegenüberliegenden Wand geklatscht und im Mauerwerk steckengeblieben.
Ich nahm die SIG und hielt sie gegen das Türschloss. Ein dumpfes Dröhnen und die Tür sprang auf. Ich versetzte ihr einen Tritt. Das Türblatt schwang nach innen. Durch die geöffnete Tür pfiffen wieder zwei Kugeln. Ich lugte um den Türrahmen. Es sah so aus, als hätte sich Overholser hinter einem Sessel verschanzt.
»Was wollen Sie damit erreichen?«, fragte ich.
»Verdammt, ich habe doch wirklich nicht gewusst, was Hammer und Donovan vorhaben.«
»Mit wem haben Sie eben telefoniert, Overholser? Haben Sie Callaghan gewarnt?«
Overholser gab mir darauf keine Antwort.
»Sie sollten aufgeben, Overholser.«
»Bei mir sind eben die Sicherungen durchgebrannt. Ich will mir nichts in die Schuhe schieben lassen. In Ordnung, ich gebe auf. Sie können in die Wohnung kommen.«
»Stehen Sie auf und heben Sie die Hände!«, gebot ich.
Die Gestalt des Gangsters wuchs hinter einem der Sessel in die Höhe. Er hielt die Hände in Schulterhöhe. Ich betrat die Wohnung und hielt Overholser mit der SIG in Schach. Milo folgte mir auf dem Fuße und trat hinter den Gangster. Er hielt Handschellen in den Händen. »Hände auf den Rücken.« Die Handschellen klickten.
»Noch einmal«, sagte ich. »Mit wem haben Sie telefoniert?«
»Mit – mit Callaghan.«
»Das war nicht sehr klug von Ihnen.«
»Ich – ich war völlig von der Rolle, als ich hörte, dass das FBI vor meiner Tür steht.«
»Was können Sie uns über Glenn Warner erzählen?«
»Glenn Warner?«, Overholser schaute fragend.
»Von ihm hattet ihr den Auftrag, Hydeman umzubringen. Donovan hat es gestanden. Warner wurde in seiner Wohnung ermordet. Wahrscheinlich wurde er seinem Auftraggeber zu gefährlich, nachdem wir Donovan und Hammer kassiert haben.«
»Ich hatte doch wirklich keine Ahnung von dem Auftrag«, sagte Overholser und verlieh seinen Worten eine besondere Betonung. »Ich kenne auch diesen Glenn Warner nicht. Richard wird es Ihnen bestätigen.«
»Sie meinen Callaghan?«
»Ja.«
»Der hat sicher das Weite gesucht, nachdem Sie ihn gewarnt haben. Nun, wir werden sehen.«
Wir führten Overholser ab. Um seine Wohnung würde sich die Spurensicherung kümmern. Da er nur ein kleiner Fisch war und wir uns von ihm wirklich keine Aufschlüsse erwarteten, brachten wir ihn zum nächsten Polizeirevier und baten den Revierleiter, dafür zu sorgen, dass Overholser nach Rikers Island gebracht werde. Er sagte es uns zu. Einen Haftbefehl würden wir nachreichen.
Erwartungsgemäß war Richard Callaghan ausgeflogen. Wir würden die Fahndung nach ihm einleiten müssen. Um seine Wohnung erkennungsdienstlich zu checken, forderten wir ein Team von der SRD an. Dann fuhren wir zurück ins Field Office.
12
FBI Field Office Boston, zur selben Zeit. Die beiden Special Agents Joseph Baker und Robert Nelson saßen an ihren Schreibtischen. Joseph Baker studierte eine Akte, Nelson starrte auf den Bildschirm. Baker schaute ziemlich skeptisch drein. Seine linke Braue hatte sich gehoben. Plötzlich sagte er: »Dieser Clinton Carter hat sich meiner Meinung nach einige Male zu oft in Widersprüche verstrickt. Wir sollten ihn uns vielleicht noch einmal zur Brust nehmen.«
»Du willst doch nur, dass Sarah Anderson und Josy O'Leary noch einmal einen Grund haben, nach Boston zu kommen«, versetzte Nelson lachend. »Sarah hat's dir angetan. Glaubst du, das wäre mir entgangen.«
»Sie ist aber auch eine ausnehmend attraktive Frau«, gab Baker zu verstehen. »Erzähl mir bloß nicht, dass sie bei dir keinen besonderen Eindruck hinterlassen hat.«
»Nun, die kleine Irin ist auch nicht ohne. Aber es stimmt schon. Ich stehe auch mehr auf Schwarzhaarige. Von mir aus, fahren wir noch einmal zur John Lincoln Ltd. Wenn wir bei Carter auch auf Granit stoßen. Soviel dürfte jedenfalls klar sein: Jemand von Henders & Dexter hat die chemische Zusammensetzung der neuen Legierung an die John Lincoln Ltd. verraten. Unser Job ist es, den Verräter zu finden.«
»Bei dem Verräter dürfte es sich auch um den Mörder des Chemikers Fred Mercer handeln.«
»Für mich steht Clinton Carter an erster Stelle der Verdächtigen.«
Die beiden Agents fuhren zu dem Betrieb. Sie betraten das Büro von Carters persönlicher Sekretärin. Die junge, hübsche Frau kannte die beiden Agents bereits von früheren Besuchen. Sie sagte: »Mister Carter ist seit drei Tagen nicht mehr zu Arbeit erschienen. Nachdem er telefonisch nicht zu erreichen war, haben wir die Polizei eingeschaltet. Seine Wohnung ist verwaist. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm. Die Polizei hat ihn auf die Liste der vermissten Personen gesetzt. Wir alle hier hoffen nur, dass Mister Carter wohlauf ist.«
Baker und Nelson fuhren zu Carters Wohnung. Die Tür war mit einem Siegel der Staatsanwaltschaft versehen. Joseph Baker forderte jemand von der Staatsanwaltschaft an, der ihnen die Tür öffnete. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bestätigte ihnen, dass in der Wohnung nichts verändert wurde. Nichts deutete darauf hin, dass Carter die Wohnung fluchtartig verlassen hätte.
»Wird nach Carter gefahndet?«, fragte Nelson.
»Im Rahmen der Vermisstenanzeige«, versetzte der Staatsanwalt.
Baker und Nelson kehrten ins Field Office zurück. Baker rief in New York an. Wenig später hatte er Sarah Anderson am Apparat. »Carter ist verschwunden.«
»Das ist ja interessant«, erwiderte Sarah Anderson. »Ist er geflohen? Das wäre ja fast so etwas wie ein Geständnis.«
»Das wissen wir leider nicht. In seiner Wohnung deutet nichts auf eine Flucht hin. Allerdings werde ich eine Wohnungsdurchsuchung veranlassen. Vor allen Dingen sein Computer dürfte interessant für uns sein. Wir werden auch seinen Arbeitsplatz bei der John Lincoln Ltd. filzen. Ich finde, die Widersprüche, in die er sich anlässlich seiner Vernehmung verwickelt hat, sind ziemlich krass. Wir wollten ihn deswegen noch einmal in die Mangel nehmen.«
»Habt ihr die Fahndung nach ihm eingeleitet?«
»Nach ihm wird im Rahmen einer Vermisstenanzeige gesucht. Für eine Fahndung reicht das Material nicht, das wir haben.«
»Haltet uns auf dem Laufenden«, bat Sarah. »Wir betreiben unsere Ermittlungen bei Henders & Dexter, treten aber nach wie vor auf der Stelle. In der Zwischenzeit wurde bei H & D der Leiter der Produktionsabteilung ermordet. Mord Nummer zwei also bei H & D. Ob der Mord an Glenn Warner jedoch etwas mit der Betriebsspionage zu tun hat, muss im Moment noch dahingestellt bleiben.«
»Jedenfalls liegen, wie es scheint, beide Fälle sehr dicht beisammen«, meinte Joseph Baker, dann verabschiedete er sich von Sarah und legte auf.
»Deine Augen glänzen richtig«, grinste Robert Nelson. »Als wärst du soeben von Santa Claus beschert worden.«
»Ich muss diese Frau wiedersehen«, murmelte Baker. »Sie hat Gefühle in mir wachgerufen, die ich schon lange nicht mehr bei einer Frau verspürt habe.«
»Stell dich unter die kalte Dusche«, schlug Nelson vor.
»Das meine ich nicht, und das weißt du auch.«
»Na schön, dann muss ich dich auf andere Gedanken bringen. Wir müssen zwei Durchsuchungsbefehle beantragen. Einen für Carters Wohnung, den anderen für seinen Arbeitsplatz bei der John Lincoln Ltd.«
Baker sprach mit dem Staatsanwalt persönlich, und zwei Stunden später hatten die beiden Agents die Durchsuchungsbefehle in Händen. Sie fuhren mit einigen weiteren Beamten zu Carters Wohnung, öffneten sie und stellten sie auf den Kopf. Ein anderes Team unterzog den Arbeitsplatz einer Durchsuchung. Sowohl der Computer am Arbeitsplatz als auch Carters privater Rechner wurden beschlagnahmt und von den Spezialisten der Spurensicherung unter die Lupe genommen. Auf beiden PCs war das Betriebssystem kennwortgeschützt. Aber es kostete den EDV-Spezialisten des FBI ein Lächeln, die Passwörter zu knacken. Und schon hatten sie Zugriff auf die Dateien. Es gelang, gelöschte E-Mails wieder herzustellen. Und gegen Mittag des folgenden Tages läutete bei Joseph Baker das Telefon. Er meldete sich, dann lauschte er angespannt. Als der Kollege geendet hatte, sagte er: »Das ist ja ausgesprochen interessant. Ich danke dir. Den schriftlichen Bericht kriege ich irgendwann, wie?«
Er grinste, bedankte sich noch einmal und legte auf, dann schaute er Nelson an. »Es hat einen regen Briefwechsel zwischen Carter und Glenn Warner von Henders & Dexter gegeben. Verschlüsselte E-Mails, die noch entschlüsselt werden müssen. Jedenfalls ist die Verbindung da. Das wird Sarah Anderson und Josy O'Leary sicherlich interessieren.«
Joseph Baker griff zum Telefon.
13
Mein Telefon klingelte. Ich nahm ab und nannte meinen Namen sowie die Dienststelle. Eine Stimme sagte: »Sie suchen doch diesen Richard Callaghan.«
»Das ist richtig«, sagte ich. »Haben Sie einen Tipp für mich?«
»Soeben hat New York One die Fahndungsmeldung ausgestrahlt« erklärte der Anrufer. »Ich habe Callaghan sofort erkannt. Er hat sich mir gegenüber zwar als Josh Bannister ausgegeben, aber ein Zweifel ist ausgeschlossen.«
»Reden Sie schon, Mann!«, stieß ich ungeduldig hervor. »Wo finden wir Callaghan.«
»Gibt's 'ne Belohnung?«
»Nein. Außer ein paar anerkennenden Worten ist wohl nichts drin.«
»Das ist natürlich nicht sehr viel. Aber sei's drum. Ich bin Portier im Penn Hotel, West 111th Street. Da ist Callaghan abgestiegen. Sie können ihn abholen.«
Wir fuhren sofort los. Das Hotel lag in Spanish Harlem, also im Norden Manhattans. Es war eine Absteige. Der Portier saß rauchend hinter der Rezeption und war nur mit einem grauen Unterhemd und einer abgewetzten Jeans bekleidet. Seine Arme waren tätowiert, an seinem rechten Ohrläppchen funkelte ein goldener Ohrring. Wir betraten das Hotel, gingen zur Rezeption und ich hielt dem Burschen meine ID-Card unter die Nase.
»Zimmer 207«, sagte er.
Wir stiegen hinauf in die zweite Etage. Schließlich standen wir vor Zimmer 207. Ich rammte mit der Schulter die Tür auf. Auf dem Bett lag ein Mann. Er war angezogen und ruckte jetzt erschreckt in die Höhe. Mit zwei Schritten war ich mitten im Zimmer und richtete die SIG auf ihn.
»FBI! Ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes. Keine falsche Bewegung.«
Callaghan erhob sich. In dem Moment, als er stand, beugte er sich nach vorn, seine Rechte zuckte unter das Kopfkissen des Bettes. Als sie wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine Pistole. Seine Aktion nahm nicht mal eine Sekunde in Anspruch. Milos Dienstwaffe krachte. Der Knall schien den Raum zu sprengen. Es roch nach verbranntem Pulver.
Milo hatte nicht auf den Gangster geschossen. Seine Kugel war über Callaghans Kopf hinweggepfiffen und steckte in der Wand. Sie bewirkte, dass Callaghan erschreckt die Waffe aufs Bett warf und die Arme hochreckte.
Milo fesselte ihn, dann führten wir ihn ab. Wir brachten ihn ins Field Office. Ehe er arretiert wurde, wurden seine Taschen durchsucht. Alles, was er besaß, wurde ihm abgenommen. Da war auch eine Bordkarte für einen Flug von Boston nach New York. Der Flug war vor drei Tagen durchgeführt worden. Ich stellte sofort eine Verbindung zu der John Lincoln Ltd. her, die, wie es schien, bei Henders & Dexter einen Spion sitzen hatte.
Von Sarah hatten wir erfahren, dass Glenn Warner von H & D in einem regen elektronischen Briefwechsel mit Clinton Carter von der John Lincoln Ltd. gestanden hatte. Die Frage war nun, ob Warner der Spion war. Hatte er mit Fred Mercer, dem Chemiker zusammengearbeitet? Stand hinter den beiden gegebenenfalls noch jemand.
Wir ließen Callaghan ins Vernehmungszimmer bringen. Er setzte sich an den Tisch in der Raummitte und streckte die Beine weit von sich.
»Overholser hat Sie gewarnt, nicht wahr?«, begann ich.
Callaghan nickte. »Wir sind gute Freunde.«
»Sie wissen, was wir Ihnen vorwerfen.«
»Ich habe damit nichts zu tun. Donovan fragte Jeff und mich, ob wir mitkommen. Er und Sven hätten eine kleine Spazierfahrt vor. Also fuhren wir mit.«
»Jeff ist Overholser, wie?«
»Ja.«
»Ihr habt doch sicher Fragen gestellt, als Donovan und Hammer in die Pine Street fuhren und dort warteten«, knurrte Milo. »Dann seid ihr dem Mercury des Professors gefolgt. Erzählen Sie mir bloß nicht, ihr hättet keine Fragen gestellt.«
»Doch, aber Hammer meinte nur, wir würden es schon sehen und sollten abwarten.«
»Warum sind Sie geflohen, wenn Sie nichts von dem Anschlag auf Hydeman wussten?«
»Wenn ihr Bullen einen mal in der Mangel habt, dann lasst ihr ihn doch nicht mehr los. Ich war dabei, und das reicht für euch aus, mich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ich hatte Angst, für etwas verhaftet zu werden, mit dem ich nichts zu tun habe.«
»Und warum haben Sie im Hotel nach der Pistole gegriffen?«
»Weil – weil …«
»Das reicht jedenfalls, um Sie für ein paar Jahre hinter Gitter zu bringen. Was haben Sie vor drei Tagen in Boston getan?«
In den Augen des Gangsters flackerte es unruhig. Er zog den Kopf zwischen die Schultern. »Ich …« Er brach ab, und ich konnte ihm deutlich vom Gesicht ablesen, dass er krampfhaft nach einer Ausrede suchte. »Ich habe einen Freund besucht.«
»Nennen Sie uns den Namen des Freundes, und seine Telefonnummer.«
»Er heißt Bob Anderson. Seine Telefonnummer weiß ich nicht. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Anderson wohnt. Wir haben uns in einem Lokal getroffen. Er hat mich angerufen.«
»Sehen wir wirklich so dumm aus?«, fragte Milo an mich gewandt.
»Wenn Sie ein krummes Ding in Boston gedreht haben, kommen wir drauf«, sagte ich. »Und wenn Ihre Pistole im Spiel war, wird das von der Ballistik festgestellt werden.«
Mir schien, dass Callaghan um einige Nuancen bleicher wurde. Er leckte sich unruhig mit der Zungenspitze über die Lippen.
Ich fuhr fort: »Wir werden diesen Bob Anderson – so es ihn gibt -, finden. Und wenn Sie keine Verabredung mit ihm hatten, werden Sie uns einige Fragen beantworten müssen. Sagt Ihnen der Name Clinton Carter etwas?«
Callaghan schluckt krampfhaft. Sein Blick irrte ab. Seine Körpersprache war nahezu eindeutig. Er wusste, wovon ich sprach.
»Clinton Carter ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden. Haben Sie etwas damit zu tun?«
»Ich kenne keinen Clinton Carter«, behauptete Callaghan.
»Bleiben Sie dabei?«
»Ja.«
Wir ließen Callaghan abführen.
»Der hat Dreck am Stecken«, sagte Milo, als wir mit dem Aufzug nach oben fuhren.
Ich nickte. »Diesen Bob Anderson gibt es wahrscheinlich nicht. Callaghan konnte meinem Blick nicht standhalten. Er würgte regelrecht, als ich ihn fragte, ob ihm der Name Clinton Carter etwas sagt.«
»Du hast doch sicher eine Theorie, Kollege«, meinte Milo.





























