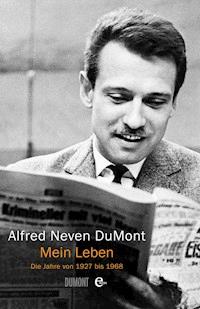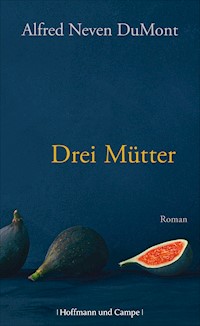
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alfred Neven DuMont hat einen großen Entwicklungsroman geschrieben, in dem der Protagonist durch die Schule der Liebe geht: "Aber kann man jemandem vorwerfen, im Übermaß zu lieben?" Alwyn ist vom Glück begünstigt, er erfährt von Geburt an hingebungsvolle Liebe, zuerst von seiner Mutter, später von seiner Schwester und seiner Stiefmutter. Ausgestattet mit der Liebe der Frauen, kann Alwyn sich zu einem begabten jungen Mann entwickeln und hinausgehen in die Welt: nach Italien, dann nach Afrika zu seinem Großvater, um zurück in der Heimat schließlich Eva zu heiraten, seine Kindheitsliebe. Den Eindrücken und Impulsen um ihn herum hält er manchmal nicht stand, aber er wird den Spagat zwischen Außen- und Innenwelt zu meistern lernen und seinen Platz finden in einem oftmals verwirrenden Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alfred Neven DuMont
Drei Mütter
Roman
Hoffmann und Campe Verlag
Es gibt nichts, was mit der Geburt zu vergleichen ist. Die beiden: der Tod und der schmerzliche Abschied aus dem Mutterschoß. Deshalb erinnere ich mich auch an meinen Tod. Das liegt daran, dass meine frühe Kindheit eine nimmer endende Geburt war. Und dann der Engel! Es muss kurz nach meiner Geburt gewesen sein, da sah ich meinen Engel. Vielleicht nur wenige Augenblicke später. Ich wusste sofort, dass er mein Engel war. Obwohl mir das niemand sagte. Aber wer hätte es mir auch sagen können, wo ich doch der Einzige war, der ihn sah, und sonst noch gar nichts verstand. Dabei blickte er mich nicht einmal richtig an, sprach noch weniger. Er war einfach nur da, tauchte auf, für Augenblicke, und verschwand wieder. Er war ein richtiger Engel, da war ich mir gleich ganz sicher. Vielleicht mit langen blonden Haaren, die über sein weites Kleid bis zu den Kniekehlen reichten, mit Flügeln, so leicht, fast durchsichtig, federleicht. Ob er sich bewegte, schwebte, sogar flog, wie es Engel nun einmal so machen? All das weiß ich nicht. Spielt es eine Rolle? Wie lange er auch immer da war, wichtig war doch nur, dass ich ihn gesehen habe. Und dass ich ab dieser Stunde nicht allein sein würde und beschützt. Das glaubte ich. Mein Vertrauen war unerschütterlich. Ob Ma ihn auch wahrgenommen hatte – oder nicht? Vielleicht, sie ist das Erste, woran ich mich dann erinnern kann, ihre vollen, runden Brüste so nahe vor meinen Augen, dass meine kleinen Arme sie ganz leicht greifen konnten. Mein Entzücken fand ich in dem Ausdruck ihres Gesichtes, wenn sie mich stillte: Die halbgeschlossenen Augen, das von ihrem tiefen Atem getragene betörende Lächeln. Wieso glaube ich, mich genau erinnern zu können? Es liegt wohl daran, dass Ma mich so lange stillte, bis ich stehend, ihre Brust in meinen Händen haltend, aus ihr trinken konnte. Sie sagte: »Du weißt es am besten, wann du mich nicht mehr brauchst.« Im Grunde wollte sie mich nicht hergeben. So erging es mir wie Romulus und Remus, die fast mannbar waren, bevor ihre göttliche Mutter Rhea Silvia ihnen die Brust entzog. Auch sie labten sich stehend zwischen ihren Spielen an der Quelle der Mutter. So ausgestattet sollte ihnen ein wirkungsvolles Leben bevorstehen. Warum sollte es mir anders ergehen?
Ich bin ein Opfer der Frauen. Immer wieder werde ich von wohlmeinenden Menschen damit konfrontiert: »Schau dich an, du Muttersöhnchen!« Dass ich mich wichtig machen würde und ein Angeber sei und ein Zappelphilipp, dass ich stottern würde und kein Ziel vor Augen hätte. »Gib zu, dass du schwul bist!« Was ich mir im Laufe meines Lebens nicht alles anhören musste!
Diese Leute machen ihre Meinung daran fest, was vielleicht einmal war, und an dieser Meinung halten sie dann ewig fest. Ich stottere schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Gut, ich war unruhig, habe den Unterricht gestört. Na und? Und schwul bin ich erst recht nicht. Leider, denn für eine Zeit lang hätte mich das vielleicht sogar gerettet. Aus welch unglückseliger Episode meines Lebens die Menschen auch immer irgendwelche Gerüchte aufgeschnappt haben, es waren Neider darunter, die meine frühen Erfolge nicht verkraften konnten. Auch wegen der Mädchen, die mich oft mehr nervten als Spaß machten. Ich war ein Kinderstar, ein umjubelter Sänger, ein toller Sportler. Na ja, vielleicht nicht ganz so toll.
Heute bin ich ein glücklicher Ehemann und ein hoffnungsvoller Vater, der im Begriff ist, einen hoch angesehenen Beruf zu ergreifen. Warum soll gerade ich, der ich doch Tag für Tag nur Liebe, Geborgenheit, Verständnis und Zuwendung erfahren durfte, ein Opfer der Frauen sein? Meine Mütter! Um sie geht es, um meine drei Mütter, die sich in Liebe für mich aufopferten. Bis heute empfinde ich für Ma, selbst für Alwena, für Milena ausschließlich Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit für eine Zeit von annähernd zwanzig Jahren, die ich im Paradies verbringen durfte, um anschließend umso tiefer zu fallen. Vielleicht ist übergroße Liebe gefährlich, sehr gefährlich. Vielleicht sogar tödlich. Man denke nur an Ikarus, der aus Liebe zur Sonne ihr zu nahe kam und dem das Wachs an den Flügeln schmolz. Gott mag Mäßigung, alles andere wird bitter bestraft. Und ich muss zugeben, dass sich mir die Vorboten der Abgründe meines Lebens schon früh ankündigten, zu einem Zeitpunkt, zu dem ich noch nicht wissen konnte, dass es so etwas gibt. Diese Abgründe blieben Erscheinungen einer rabenschwarzen Nacht in meinem Kohlenkeller. Mein Kohlenkeller.
Meine Mutter war von umwerfender Schönheit. An ihrem Körper war alles voller Harmonie, makellos, weich und dennoch voller Kraft. Ihre Wangen, ihr langgezogener Hals, der ihr liebliches Gesicht trug, eingerahmt von der goldenen Lockenmähne, ihre schmalen Arme, ihre zarten Hände, die Rundung ihrer Hüften. Und ich war ihr kleiner Mann, ein Teil von ihr. In der Morgendämmerung meines Lebens gab es nur Ma. Später sagte sie, ich hätte ihr die Unschuld zurückgegeben. Unsere Liebe war meine erste und letzte unschuldige Liebe. Es gab keine Wiederkehr. Leider nicht. Ma vertrat die Meinung, ich sei der zärtlichste, ausdauerndste Liebhaber ihres nicht ereignisarmen Lebens gewesen.
Wann mein Vater in mein frühes Leben eintrat, vermag ich nicht zu sagen. Lange war mir nicht klar, welche Rolle er für mich spielen sollte. Ich sei, so wurde erzählt, in ein erbärmliches, nicht enden wollendes Geschrei ausgebrochen, als er sich mir zum ersten Mal jählings mit seinem völlig fremden Gesicht näherte. »Ein kleiner Teufel«, soll er daraufhin gesagt haben und mit einem zur Grimasse verzogenen Gesicht: »Du gehörst mir! Mir! Hörst du, kleiner Bengel!«
Nachdem diese erste Begegnung von Vater und Sohn alles andere als glücklich verlaufen war, erklärte ich meinen Vater früh schon als meinen Feind, der sich gefälligst aus meinem Leben heraushalten sollte. Sehr zeitig erkannte ich, dass in der Person des Vaters ein Rivale aufgetaucht war, den ich aus dem Feld schlagen musste. Mein Kampfgeist war geweckt. Und ebenfalls wurde mir sehr früh klar, dass, wenn jemand mit einer sich überschlagenden Stimme sein vermeintliches Eigentum einfordert, der Anspruch zumeist auf wackligen Beinen steht.
Morgens wartete Ma auf mein Erwachen, bevor sie mich behutsam ins anliegende Badezimmer hinübertrug. Im Sommer waren wir wohl beide nackt, und ob wir im Winter bekleidet schliefen, ist meiner Erinnerung entfallen. Sie wusch mich und rieb meinen Körper von oben bis unten mit Duftwasser ein, um mich danach ausgiebig einzusalben. Danach legte sie mich eingehüllt in weiche Tücher so ab, dass sie mich im Auge behalten konnte, während sie duschte.
In einen Morgenmantel eingehüllt, zog Ma mit mir auf dem Arm zurück in unser Schlafzimmer, wo ich alsbald wieder mitten auf dem Bett landete. Sie selbst nahm an einem Tisch am Fenster mit Blick zum nahen Bett Platz, wo sie ihr Frühstück einnahm.
Gelegentlich, wenn er es sich zeitlich einrichten konnte, gesellte sich Vater, schon im Anzug, unserem oder vielmehr Mas Frühstück bei. Die Beziehung von Vater und mir blieb unterkühlt, aber die Umstände hatten uns keine andere Wahl gelassen, als den anderen notgedrungen zu akzeptieren: zwei Nebenbuhler, mehr oder weniger, obwohl er einige Versuche unternahm, unser Verhältnis aufzufrischen, etwas freundlicher zu gestalten. Mit wenig Chancen. Ich sah sein Gesicht nahe dem meinen, eine vorspringende Nase, die an einen Schnabel erinnerte, stechende dunkle Augen, die nichts Gutes verhießen, eine fliehende Stirn und große, anliegende Ohren: Vögel waren mit die ersten Tiere, die ich in meinen Bilderbüchern entdeckte, und die nicht zuletzt durch Vater keineswegs zu meinen Lieblingstieren gehörten.
Später nahm ich an dem Frühstück, das wohl mehr oder weniger als Familienzusammenführung gedacht war, in einem erhöhten Kinderstühlchen teil, löffelte unlustig in einem übel schmeckenden Brei, der die Milch von Mutter ergänzen sollte.
Alwena, meine ältere Schwester, glänzte bei unseren morgendlichen Treffen durch Abwesenheit, da sie zu dieser Zeit bereits in die Schule eilte. Wir beide beäugten uns mit wechselnden Gefühlen, mal freundlich, mal distanzierter und gelegentlich mit feindlichen Impulsen. Mutter wusste, wenn sie es wollte, trefflich die Eifersucht unter uns zu schüren.
Mehr erregte mich der Umstand, dass Ma mitten in der Nacht unser gemeinsames Bett verließ. Ich wachte auf, sah mich ihrem wärmenden Körper entzogen und begann ein erbarmungswürdiges Geschrei, das in der Stille der Nacht besonders günstig bei den im Haus schlafenden Mitbewohnern zur Geltung kam. Früher oder später eilte Mutter herbei, Entschuldigung über Entschuldigung auf den Lippen, um meine Wut zu stillen.
Während ich heranwuchs, wurden oft genug Fotos von mir gemacht, mal mit Mutter, mal alleine, schon mal mit Alwena, und auch mal nackt, stolz als properes Baby auf einem Eisbärenfell posierend abgelichtet und so der Ewigkeit anvertraut. Der Anblick scheint aufs Erste betörend, bemüht, Begeisterung hervorzurufen, doch mit einem weniger milden Blick und im Nachhinein alles andere als erfreulich: Ein Kind, das in seinen allerersten Monaten und Jahren bereits in sich den Keim gelegt hat für List, Raffinesse und Eigenliebe, eine stattliche Ausrüstung für die Bewältigung späterer Jahre.
Mit dem Sprechen und Laufen verwöhnte ich meine Umwelt erst spät. Warum hätte ich mir auch Neues vornehmen sollen, so paradiesisch, wie ich gebettet war? Jede Veränderung musste eine Verschlechterung mit sich bringen. Ich sollte recht bekommen. Genügte nicht das mit vielen Facetten ausgestoßene »Mama«, mal liebevoll, mal vorwurfsvoll, mal Zuwendung erheischend, das Nicken und das Schütteln des Kopfes, mal grummelnd, mal gacksend: ein unverkennbarer Spiegel meiner Erwartungen, gespickt mit nachhaltiger Kritik am Mangel der mir erbrachten Zuwendungen. Dass solches Verhalten bei meinem Vater und der Schwester auf weniger Liebe stieß, beunruhigte mich nicht im Geringsten, solange Ma von allen meinen Regungen in Entzücken geriet.
Die erste ernsthafte Annäherung mit der fünf Jahre älteren Alwena kam von ihrer Seite wohl durch reine Neugierde an dem brüderlichen Einfaltswesen zustande, zugleich aber auch aus Interesse an einer Person, die im Begriff war, ihr allzu sehr Konkurrenz zu machen. Ihn in die Hand zu bekommen, Einfluss auf ihn auszuüben, wäre eine sichere Handhabe, den lästigen Nebenbuhler auszuschalten. Sie war es, die mir tagtäglich Wortbrocken in den Mund legte und mich dazu aufforderte, sie zu wiederholen. Sie fiel auf keine List von meiner Seite herein, jede Ablenkung wusste sie zielgerecht zu durchzukreuzen. Genauso hielt sie es in ihren Lehrstunden, in denen ich, das verharrende Krabbelkind, angeschubst wurde, um endlich und spät genug von meinen Beinchen Gebrauch zu machen. Ich war mal ihr kleines Dummchen, dann wieder ihr süßes Äffchen, das sie aus der Finsternis des Dschungels in das Licht der Zivilisation führen wollte.
Mutters allumfassender Einfluss auf mich lockerte sich zu dieser Zeit. In den Vordergrund rückte dafür etwas ganz Entscheidendes, das unser kleines Glück erschüttern sollte. Die Beziehung von Mutter und Vater, schon seit Jahren empfindlichen Schwankungen ausgesetzt, zeigte sich nachhaltig gestört. Im Mittelpunkt stand für mich immer noch unantastbar Ma, alles andere blieb nebensächlich und einer ernsthaften Betrachtung entzogen, so auch Frau Zeh, unsere Haushälterin und Köchin, die bei seltenen Gelegenheiten, wenn Mutter unpässlich war, für sie einsprang, was ich großzügig und stoisch über mich ergehen ließ.
Wenn es zu Hause immer häufiger zu dem fast schmerzend lauten Türenschlagen kam, gesellte sich die schrille, ja, gellende Stimme von Vater dazu. Ich war inzwischen drei, bald vier Jahre alt, ein durchaus stattlicher Junge mit einer Bubifrisur, die Ma so sehr an mir liebte, was später in der Schule, wie manch anderes auch, zur Erheiterung meiner Klassenkameraden führte.
Vater sah sich, wie auch wir Kinder mitbekamen, von Mutter im Stich gelassen, vernachlässigt, beiseitegeschoben und Ähnliches mehr. Während Alwena davon unbehelligt blieb, traf mich sein geballter Ärger umso mehr, er bezeichnete mich als den Unhold, der am Fundament seiner Ehe sägte, Zwietracht gesät habe. Lächerlich! Wie sollte ich, noch vor kurzem ein Baby, unschuldig und unwissend, zu so etwas fähig sein? Vor allem aber, wie sollte ich bei so bösartigen Beschuldigungen, an denen ein Kind schwer genug zu tragen haben musste, Vaterliebe entwickeln? Trieb er mir, dem Sohn, nicht jede liebevolle Empfindung ihm gegenüber mit Gewalt aus?
Zugegeben, das letzte Türenschlagen, diesmal das der schweren Haustür, dessen Getöse bis ins letzte Zimmer zu hören war, empfand ich folglich als Wohltat. Endlich kehrte Frieden ein, endlich ungestörte Harmonie, keine Vorwürfe mehr, und ich, der Vierjährige, sah mich von einer Minute zur anderen als der Mittelpunkt und unangefochtener Herr des Hauses.
Liebevoll trocknete ich die Tränen von Mutter, nahm mit Nachsicht Alwenas Geschrei über den Verlust des Vaters zur Kenntnis, deren Gefühle von Frau Zeh, wenn auch zurückhaltender, geteilt wurden. Die Frauen beruhigten sich schneller als gedacht wieder. So stand dem ersehnten Frieden nichts mehr im Wege, der allerdings nicht ewig dauern sollte. Ich war noch immer Mutters »Baby«, wie sie mich umschmeichelnd rief. Aber es kam nicht mehr zu unserem morgendlichen Reinigungsritual, bei dem ich mich in ungebrochener Bewunderung ihrer Schönheit erfreuen durfte. Sie meinte, ich sei jetzt zu groß für so etwas.
Zwei weitere unerwartete Vorkommnisse geschahen in der Folge. Zum einen stand der Auszug aus dem behaglichen Haus unserer verkleinerten Familie an, zum anderen konfrontierte meine Mutter mich, den nunmehr Fünfjährigen, mit einer mir bis dahin unbekannt schwärmerischen Stimme über eine wesentliche Veränderung in unserem Leben:
»Lieber Alwyn – hörst du zu? –, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Wie du weißt, hat uns Vater vor einiger Zeit im Stich gelassen, und ich bin der Meinung, dass ich unter diesem Umstand genug gelitten habe. Es ist für eine Frau nicht leicht, verlassen zu werden und alleine zu leben. Ich meine ohne einen Mann. Du verstehst diesen Umstand nicht, das kannst du nicht, dafür bist du noch zu jung. Es kommt hinzu, dass ich bald dreißig Jahre alt werde, das ist eine für eine Frau einschneidende Zäsur. Wie du siehst, ich bin keine junge Frau mehr. Aber auf der anderen Seite jung genug, um noch etwas in meinem Leben erwarten zu dürfen. Noch habe ich nichts verloren, was eine Frau auszeichnet.« Sie stockte, schien mit einem Mal verlegen, bevor sie trotzig sagte: »Ich bin, das darf ich in aller Freimut gestehen, eine durch und durch begehrenswerte Frau!« Sie lachte, bevor sie fortfuhr: »Hörst du auch zu, mein Lieber? Ich habe mich also vor einiger Zeit, um die Wahrheit zu sagen, sogar schon vor geraumer Zeit …«
Sie lachte wieder und schien ganz ergriffen, liebevoll streichelte sie meine Wangen, um anschließend in einem verzeihenden Ton endlich auf den Punkt zu kommen: »Ich habe einen Freund, einen guten Freund, einen engen Freund gefunden, der mir ein echter Trost ist. Der junge Mann ist übrigens ein erfolgreicher Tennisspieler, gut aussehend und mit angenehmen Manieren, ohne sich aufzudrängen. Du verstehst, lieber Alwyn. Ihr beide werdet selbstverständlich durch sein Erscheinen nicht im Geringsten leiden, alles bleibt beim Alten, und ich hoffe sehr, ihr gönnt mir den Spaß …«
Mutter hatte mich zum ersten Mal mit meinem Namen angesprochen, wo sie doch über eine Großzahl von Kosenamen für mich verfügte. Ich war erstarrt. Und verstand nichts.
In der Zwischenzeit bewohnten Mutter, Alwena und ich eine Wohnung in einem benachbarten Stadtteil. Es gab weniger Zimmer, die Räume waren kleiner, dafür besaßen wir einen weitläufigen Balkon, der auf einen verwilderten Garten hinunterschaute. Mutter schien glücklich wie immer, obwohl sie Alwena und mir geheimnisvolle Andeutungen gemacht hatte, dass wir drei uns in der neuen Situation ohne Vater einschränken müssten. Jeder hätte einen kleinen Beitrag zu leisten. Sonst blieb alles beim Alten. Nur Frau Zeh, die in die Jahre gekommen wäre, wie Mutter sagte, könnte nicht mehr bei uns wohnen. Sie würde uns aber weiterhin drei bis vier Tage in der Woche zur Verfügung stehen und bei besonderem Bedarf hätte sie sich bereit erklärt, auszuhelfen.
Nach den Erklärungen von Mutter, die Alwena kichernd zur Kenntnis genommen hatte, statuierte Ma alsbald ein Exempel und blieb eine volle Nacht aus, was mich zutiefst verärgerte und mit Sorgen beschwerte. Jetzt war Alwenas Stunde gekommen, sie erklärte mir: »Lieber Alwyn, heute Nacht schläfst du bei mir. Oder willst du lieber mit Frau Zeh die Nacht verbringen? Mein Bett ist zwar nicht so breit wie das von Mutter, aber wenn ich ein wenig rücke, haben wir beide genug Platz.«
Ich fügte mich notgedrungen Alwenas Vorschlag, denn die Nacht allein im Bett und gar im Zimmer verbringen zu müssen, erschien mir undenkbar. Als wir uns am Abend zusammenkuschelten, fragte ich meine Schwester: »Warum hast du, als Mutter über diesen Mann sprach, eigentlich so gekichert?«
»Das verstehst du nicht, noch nicht. Es geht um eine Sache, die sehr wichtig für sie ist, wie für alle Frauen, das weiß ich.«
»Auch für Frau Zeh?«
»Bei Frau Zeh bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist sie auch zu alt.«
»Und du? Ist es für dich wichtig?«
»Ich?! Spinnst du? So eine Unverschämtheit.«
Ich antwortete patzig: »Du weißt offensichtlich gar nichts. Du gibst nur an.«
Ich erhielt einen heftigen Schlag mit ihrem Ellbogen in meine Bauchgegend: »Du Flegel! So redet auch ein kleiner Junge nicht mit einer heranwachsenden Dame! Dir fehlt jede Erziehung. Es ist höchste Zeit, dass wir das nachholen, sofort und mit Strenge. Und weißt du was? Ich werde mich deiner Erziehung annehmen, wer denn sonst! Mutter ist dafür ganz und gar unfähig. Also werde ich dich erziehen. Da staunst du! So kann man dich ja nicht auf die Menschheit loslassen!«
Sie hatte das Nachtlicht noch einmal angemacht, sich neben mir aufgesetzt und sah mich herausfordernd an: »So! Und jetzt darfst du mir einen Gutenachtkuss geben, mein Brüderlein. Und dann wird geschlafen!«
Ich folgte um des lieben Friedens willen ihrer Anordnung, wälzte mich zur Seite und schlief kurz darauf ein. Zuvor schoss mir durch den Kopf: Jetzt fängt eine neue Zeit an: Ich habe eine neue Mutter! Mal sehen …
Ich war damals immer noch fünf und sie im ehrwürdigen Alter von zehn Jahren, wo der Altersunterschied, so erklärte es mir Alwena, zwischen Jungen und Mädchen doppelt zählt.
So fing die Geschichte von Alwena und Alwyn an, eine Geschichte, die mit Unterbrechung an die zehn Jahre dauern sollte. Die Erinnerung an die unvergleichbare Erfahrung von Mas umwerfend fürsorglicher Mutterschaft in meinen ersten fünf Lebensjahren verblich. Der Freund, so wie sie den Mann verharmlosend genannt hatte, nahm von Tag zu Tag eine immer bedeutendere Rolle bei ihr ein. Für eine Zeit schien sie vollends in den Armen des Unbekannten zu verschwinden. Übrig blieb, wenn sie bei uns nach Tag und Nacht wieder einmal auftauchte, eine Hülle, die ermattete Liebe ausstrahlte. Sie war verändert, irgendetwas war geschehen. Im Übrigen fiel auf, dass sie sich in neue modische Kleider warf, meistens in Hosen und knappe Blusen, stets in Weiß, in Weiß von oben bis unten. In Weiß morgens, mittags und abends: sehr schick!
»Die Männer drehen sich nach mir auf der Straße um«, trällerte sie mit dem ihr eigenen unschuldigen Augenaufschlag. Doch jener Mann, der all dies an Mutter ausrichtete, blieb lange im Hintergrund, geheimnisvoll. In meiner Phantasie wuchs er von Tag zu Tag immer mehr zu einer Figur wie Tarzan oder Superman heran. Ich fragte Alwena: »Du hast ihn doch einmal gesehen. Wie ist er denn so?«
Sie sah mich nachdenklich an: »Hm. Was soll ich sagen?! Er hat kaum ein Wort gesagt und hatte eine Tenniskluft an. Sonst sah er ziemlich normal aus. Gut, er ist ziemlich groß, aber neben Mutter macht er eine eher mickrige Figur. Mit Vater ist er jedenfalls gar nicht zu vergleichen! Da hat sie sich Mutter halt einen Sportsmann gefangen. Frauen machen Fehler.«
»Gut«, war meine Antwort, »ich verstehe. Dann müssen wir uns auf Schlimmes gefasst machen.«
»Im Gegenteil«, resümierte Alwena, »das ist kein Grund, sich aufzuregen. Ich glaube, er ist einfach nur dumm. Keine Angst, Alwyn, den stecken wir locker in die Tasche.«
Aber zuerst galt es, sich in den Alltag mit Alwena einzufügen. Schon der Morgen nach ihrer Ankündigung, sich um meine Erziehung kümmern zu wollen, unterschied sich für mich, wie ich mich erinnerte, erheblich von dem zuvor: Kaum war sie erwacht, erhielt ich einen energischen Klaps auf mein Hinterteil und den Befehl: »Aufstehen!«
Es gab kein Pardon! Sie packte mich, zerrte mich kichernd ins Badezimmer, riss mir meinen Pyjama vom Körper und stellte mich unter die Dusche, die sie noch nicht einmal auf lauwarm eingestellt hatte, um mich, wie sie meinte, abzuhärten. Bei Mutter hatte sie sich abgeguckt, mich von oben bis unten wie ein Baby einzuseifen, und danach wurde ich abermals mit noch kälterem Wasser abgeduscht, ohne auch nur im Geringsten auf mein Wehklagen Rücksicht zu nehmen.
Breitbeinig stand sie dann in ihrem Nachthemdchen vor mir, mich einen Kopf überragend, und erklärte, dass wir jetzt einige Turnübungen machen würden, um nach einem kurzen Frühstück schließlich meinen Stundenplan abzuarbeiten.
»Stundenplan?«, protestierte ich energisch, »ich bin doch noch gar nicht in der Schule.«
»Schlimm genug«, fegte sie jeden Einwand beiseite, »nicht einmal in den Kindergarten wurdest du geschickt. Das war für den kleinen Pascha ja unzumutbar. Das Resultat ist, dass du vor Dummheit nur so strotzt. Ich werde dir einige Grundkenntnisse beibringen. Beispielsweise im Rechnen, ein bisschen Schreiben, Lesen und so. Dann stolperst du nicht unvorbereitet in die Schule, und ich bekomme keine Klagen zu hören.«
Das hagere, hochaufgeschossene Mädchen, das vor mir stand, fieberte vor Energie: Alwena hatte offenbar Großes mit mir vor. Vom ersten Tag an wurde ich ihr williger Schüler. Ich merkte sehr schnell, dass es viel bequemer war, sich den Schicksalsschlägen zu beugen, als sich dagegenzustemmen.
Da stand sie immer noch in ihrem Hemdchen vor mir, aus dem zwei dürre Beine hervorschauten. Wenn sie ging, erschien mir das nicht wie ein Schreiten, sondern wie ein hastiges Trippeln wie der Hufschlag eines Ponys. Ich liebte es, ihr dabei zuzuschauen, ihre schmalen Schultern, die kindlichen Ärmchen, die immer in Bewegung waren, der lange Hals, auf dem ein zartes Gesichtchen umrahmt von dunklen Locken thronte. Aber die Augen hielten mich am meisten gefangen, faszinierend und schwarz wie die Nacht. Heimlich beobachtete ich sie, obwohl es mir strengstens verboten war, wenn sie sich entkleidete, betrachtete ihren flachen Bauch und die schmalen Schenkel.
Alwenas mädchenhafte Erscheinung war das glatte Gegenteil von Mutters, eine Strichzeichnung. Das aber sollte sich bald, als sie sich in ein großes Mädchen verwandelte, ändern: Ein erstaunlicher Vorgang! Alwenas hagerer Kinderkörper entwickelte weibliche Eigenschaften. Jetzt sah sie noch komischer aus. Aber ich akzeptierte sowieso alles, was mit ihr zusammenhing. Längst war ich ihrer Faszination erlegen.
Vielleicht lag es auch an unseren Namen, die uns geradewegs aufeinander zu führten. Alwyn und Alwena unterscheiden sich lediglich darin, dass sie die männliche und die weibliche Variante desselben Namens sind. Für diese Namensgebung hatte Mutter gesorgt. Als Siebzehnjährige hatte sie einen Sommer lang bei einer englischen Austauschfamilie zugebracht, die westlich von London in Wales lebte. Sie verliebte sich in aller Unschuld, so meinte sie, in Alwyn, den Sohn des Hauses, wohl ein hübscher Junge. Und schon nannte sie einige Jahre darauf, in schöner Erinnerung an die Jugendliebe, ihre Tochter Alwena. Weil das so schön und richtig gewesen war, erhielt ich dann meinen Namen, der immer wieder zur Erheiterung bei meinen Schulkameraden führte: Wer hieß schon »Alwyn«!
Alwena gestand mir später, dass sie von früher Kindheit an eine unauslöschbare Sehnsucht nach Mutterschaft in sich gespürt habe. Wann immer sie ein Baby sah, wurde sie beseelt von dem Gefühl, das Kind in die Arme zu nehmen und zu herzen. Es war verständlich, dass sie bei der Wahl ihrer Leidenschaft auf das Nächstliegende verfiel, und das war nun mal ich. Als sich Mutter mit Begeisterung ihrer neuen Liebe, dem Tennisspieler, hingab, war ich über Nacht vakant geworden. Zuerst einmal musste ich für Alwena die Babyzeit nachholen, die sie als Mutter verpasst hatte. Sie schleppte mich auf dem Arm durch die Wohnung, obwohl ich dafür längst viel zu schwer geworden war, wiegte mich, wenn ich abends nicht müde werden wollte, in den Schlaf. Sie stopfte mich in den längst ausrangierten Kinderwagen, obwohl ich kaum noch reinpasste, und fuhr mich bei schönem Wetter auf den umliegenden Straßen spazieren.
Die Nachbarn und Freunde bewunderten sie: »Mein Gott, was für ein liebes Mädchen, so hilfsbereit. Und das Baby ist ja so ungewöhnlich groß! Ein Riesenbaby!«
Ich nahm es gelassen. Aber die anbrechende Schulzeit, die sie mir bescherte, war kaum ein beglückender Ausgleich. Im Gegenteil. Sie triezte mich mit zunehmendem Eifer, als wollte sie mich zum Genie erziehen. Ich entwickelte nicht den geringsten Ehrgeiz dafür. Sie wollte Mutter wohl in jeder Hinsicht überbieten. Wenn ich gelegentlich aufmuckte, machte sie sich es zur Gewohnheit, dass sie zu meiner Empörung mit fester Hand auf mein Hinterteil klopfte. Es waren nicht die Schmerzen, die mich zum Weinen brachten, sondern die Erniedrigung, die ich erfahren musste. Alwena fühlte sich durch solche emotionalen Regungen nur bestätigt. Später machte sie mich mit einem Haselnussstock bekannt, mit dem sie mich bei Gelegenheit überfiel, um mir blitzschnell einige Schläge zukommen zu lassen.
»Jungens sind störrisch und widerspenstig. Sie brauchen eine strenge Hand, das ist ganz zu ihrem Vorteil. Ich habe das alles nachgelesen. Im Gegensatz zu Mädchen. Die besitzen eine feinere Seele und sind viel einsichtiger.«
»Wie du«, rief ich patzig.
»Genau, du hast es erraten«, triumphierte sie.
Zu dieser Zeit war die Falle längst zugeschnappt. Es gab kein Entrinnen mehr. Ich hatte mich ihr längst völlig ergeben. Jeden neuen Tag wurde ich zufriedener und glücklicher. Bald konnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Sie, meine Schwester, war die große Spinne, in deren Netz ich mich längst verfangen hatte.
Das seien, so sagte Alwena später, die glücklichsten Jahre ihres Lebens gewesen. War es umgekehrt nicht genauso?
Angefangen hatte alles, als wir uns an diesem ersten Morgen im Badezimmer gegenüberstanden. In dem Augenblick hatte mich das Leuchten ihrer Augen umfangen, und ich wurde von einer Liebe zu ihr erfasst, die weit über jeden Verstand hinausreichte.
Am folgenden Sonntag heirateten wir. Alwena war vor kurzem bei einer Trauung Brautjungfer gewesen, wie sie mir stolz erklärte. In Wahrheit durfte sie vor Braut und Bräutigam mit anderen Mädchen die feierlich geschmückte Kirche unter Glockenläuten verlassen und Blumen ausstreuen, was bei ihr einen riesigen Eindruck hinterlassen hatte: das wunderschöne, mit Perlen bestickte weiße Kleid der Braut, der großartige Zylinder des Bräutigams, das feierliche Gefolge, nicht zuletzt ihr bodenlanges, rosarotes und mit künstlichen Rosen bestücktes Kleid, das Zauber durch einen Blumenkranz um ihren Kopf abrundete.
Jetzt wollte sie auch eine Hochzeit, möglichst sofort, und was lag näher, als nach ihrem Brüderchen zu greifen. Eine große Diskussion darüber, ob ich das auch wollte, gab es sowieso nicht. Im Mittelpunkt stand ihr weißes Brautkleid, an dem Frau Zeh mit zeitaufreibendem Einsatz Tag und Nacht arbeitete. Als Termin für die Feierlichkeiten war der kommende Sonntag vorgesehen. Am Vortag durfte ich, der Bräutigam, die Braut nicht sehen, in der Nacht vor der Trauung musste ich allein in dem engen Kämmerchen schlafen, das sowieso für mich vorgesehen war. Ich sollte vor allem in der Nacht, bevor ich den Status des Junggesellen verlieren würde, auf keine dummen Gedanken kommen, was dies auch immer bedeutete. Ich trug ein weißes gestärktes Hemd mit einem schwarzen Binder, einen dunklen Umhang, schwarze Lackschuhe, die eigens für den feierlichen Tag erstanden wurden, und einen abenteuerlichen Hut, der wohl aus den Karnevalsbeständen des Hauses herausgezaubert worden war.
Im Mittelpunkt stand Alwena, die alle Erwartungen übertraf. Sie glänzte vom Scheitel bis zur Sohle. Zweifellos wollte sie die Erscheinung der echten Braut, die sie noch vor wenigen Wochen bestaunt hatte, übertreffen. Das Wohnzimmer war auf die Schnelle zur Kirche umstrukturiert worden. Es gab einen Altar, einen mit wertvollen Stoffen bedeckten Tisch, auf dem viele Kerzen standen. Es gab eine Klingel und vor allem einen vorbildlichen Priester, den unser Schornsteinfeger in seinem speckigen schwarzen Sonntagsanzug abgab, über den er als Priestergewand eine farbige, bestickte Decke als Umhang trug. Er las brav seine Worte, die ihm Alwena aufgesetzt hatte, vom Blatt ab. Dann kam die schicksalhafte Frage: »Willst du, Alwyn, die hier anwesende Braut Alwena zur Frau nehmen, ihr immer treu bleiben und beistehen in guten und schlechten Tagen, so sage ›Ja‹.«
Meine Antwort, wohleinstudiert, kam laut und deutlich: »Ja, ich will.«
Alle waren beeindruckt. Nachdem auch meine Braut ihren Reim über sich ergehen hatte lassen, hauchte sie ein unschuldiges »Ja!«, und wir durften uns küssen und die Ringe, die bereitlagen, tauschen. Beim Küssen versuchte sie, ihre Zunge in meinen Mund zu stecken, was ich als überflüssig empfand. Später erklärte sie, der »Zungenkuss« sei notwendig gewesen, um die Hochzeitszeremonie der Großen auch richtig nachzumachen. Nun gab es den Hochzeitsmarsch, der einem bereitstehenden Grammophon entlockt wurde, und das junge Paar schritt unter dem Jubel der Anwesenden feierlich in die Küche hinüber, wo das festliche Hochzeitsmahl bereitstand.
Nachdem es eine bescheidene, nicht zu aufwendige Hochzeitszeremonie sein sollte, waren nur wenige Gäste eingeladen worden: Mutter, Frau Zeh, das unter uns wohnende ältere Ehepaar, das uns freundlich in unserer neuen Bleibe willkommen geheißen hatten, und eine Schulfreundin von Alwena. Frau Zeh hielt eine gefühlvolle Rede für das Brautpaar. Der Text, den sie ablas, war, wie konnte es anders sein, von Alwena aufgegeben. Es gab reichlich zu essen, einen richtigen Braten, der herrlich roch, dicke Röstkartoffeln und Gemüse dazu, mit viel Kompott. Den Höhepunkt stellte die Hochzeitstorte dar, die Mutter beigetragen hatte.
Ich hatte zur Feier des Tages so viel gegessen, dass mir nach dem dritten Tortenstück ziemlich übel wurde. Aber das half alles nichts: Nach dem Festessen musste ich als Bräutigam nach dem Ehrentanz mit der Braut und dann mit allen anwesenden Damen tanzen, eine ziemliche mühsame Angelegenheit.
Abends musste ich meine Braut entkleiden, wobei sich Alwena ziemlich zierte. Schließlich sei sie ja noch, wie sie immer wieder kicherte, eine Jungfrau. Meinetwegen. Ich trug einen frischgebügelten weißen Pyjama und sollte nun meine Braut in ihrem angeblich durchsichtigen Nachthemd zum Bett tragen: eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Immerhin war sie einen Kopf größer als ich, und ich hatte Schwierigkeiten, überhaupt noch die Augen offen zu halten, so müde war ich.
Im Bett erklärte Alwena: »Du hast Glück, Alwyn, dass du so klein bist! Sonst wären deine Pflichten als Bräutigam noch nicht zu Ende, und du müsstest mich jetzt entjungfern.«
»Wird so schlimm nicht sein. Gut, dann meinetwegen morgen früh«, murmelte ich.
»Ganz schön stressig für den Bräutigam. Na, vielleicht später«, antwortete Alwena, gab mir noch einen dicken Schmatz, und weg waren wir, Mann und Frau.
Als Alwenas Mann wollte ich ihr mehr und mehr ähnlich werden. Wenn ich unter Mutters Schutz ein Teil von Ma war, so zog mich meine Schwester mit solcher Gewalt an sich, bis sie mich ganz einnahm. Sie wollte Ma übertrumpfen, ja, das war es. Ich sollte nicht Alwena nicht nur gleichen, nein, ich sollte wie Alwena selbst sein. Wir standen gleich nach dem Aufstehen noch mit Strubbelhaaren Hand in Hand vor dem Spiegel. Sie sah mich an, ich sah sie an, sie sah wieder mich an, ich wieder sie, so, als wenn wir nicht genug voneinander bekommen könnten. Sie küsste mich, mal da, mal dort, und hatte es so schnell wieder vergessen, dass sie mich gleich noch einmal küsste.
Wenn ich böse Träume hatte und im Schlaf weinte, küsste sie meine Tränen weg, ich schmiegte mich so nah wie nur möglich an ihren hageren Körper. Ich wollte wachsen, so groß werden wie sie. Ich wollte ein Mädchen wie sie sein, aber als ich Alwena das beichtete, lachte sie mich schallend aus und zeigte mir zwischen die Beine:
»Nichts da! Den brauchen wir noch.«
»Was du alles weißt«, staunte ich.
»Warte ab, Kleiner. Nicht so neugierig! Und wieso ich etwas weiß? Das kommt davon, wenn man fleißig lernt und seine Bücher gründlich liest. Was meinst du, was Ma immer macht.«
»Die ganze Zeit?«
»Was denn sonst! Was soll die Arme sonst mit dem Tennisspieler anfangen.«
»Vielleicht lernt sie jetzt Tennis spielen.«
Sie schaute mich belustigt an: »Du träumst! Sie ist eine schlafende Wildkatze. Sie bewegt sich nur, wenn Gefahr lauert. Und sie ist viel zu listig, um sich Gefahren auszusetzen.«
»So klug wie du möchte ich auch mal werden.«
»Na, mit dem Lernen haben wir ja schon angefangen. Der Anfang ist das Schwerste. Und vielleicht wirst du ja noch klüger als ich, eines Tages, wer weiß.«
»Klüger als du möchte ich ja gar nicht werden.«
»Das warten wir dann mal ab«, beendete sie unser Gespräch.
Während ich versuchte, in Alwenas Fußstapfen zu treten, entwickelte ich eine große Fertigkeit: Ich lernte, sie nachzumachen. Wenn sie erkältet war, schniefte sie mit ihrer Nase, und ich tat es ihr gleich. Wenn sie mit den Fingern auf dem Tisch trommelte, trommelte ich mit den Fingern ihr nach. Wenn sie sich die Haare schneiden ließ, musste es bei mir auch sein. Das Beste dabei war, dass sie es gar nicht wahrnahm und mich deshalb niemals zur Rede stellte. Wenn Alwena sich aufregte, über was auch immer, fingen sich ihre Worte an zu verheddern, sie stotterte. Bald darauf begann auch ich zu stottern, aber ohne mich weiter aufgeregt zu haben. So konnte es geschehen, dass wir beide um die Wette stotterten, ein Stotterkonzert. Ich fand, dass es sich gut anhörte. Und stotterte weiter. Wenn ich redete, unterbrach sie meinen Redefluss, einfach so, mitten im Redeschwall. Sie unterbrach mich immer wieder bis sie mich endgültig dahin brachte, dass ich ein Stotterer wurde. Ein echter Stotterer.
Eines Tages sagte sie: »Ist es nicht süß, wie er stottert? Und wenn er stottert, kriegt er keine Freundin und bleibt bei mir.«
Zu der Zeit hatte sie es sich abgewöhnt zu stottern.
Sie meinte: »Liebe gibt und Liebe nimmt.« Sie wusste Bescheid.
Alwena ging am Vormittag, nachdem sie zehn Jahre geworden war, Tag für Tag in ihre neue Schule, ins Gymnasium. Um ihre Abwesenheit für mich nutzbringend zu gestalten, stellte sie mir von Tag zu Tag Aufgaben. So musste ich, gleich in aller Früh, wenn sie das Haus verlassen hatte, mich im Rechnen, Lesen und Schreiben, aber auch im Malen und Zeichnen üben, bis mir der Kopf brummte und ich sie heimlich verfluchte. Wenn ich die Aufgaben nicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt hatte, gab es ein Donnerwetter, gelegentlich klopfte sie auch fest mit ihrer harten Hand auf mein Hinterteil. Einmal wurde sie wegen meiner angeblichen Faulheit fuchsteufelswild und traktierte mich mit hochrotem Kopf mit dem kleinen Haselnussstock. Ich heulte erbärmlich, was sie offenbar zufrieden stimmte, und kam zu der Auffassung, dass Alwena einfach schlechte Laune hatte, die sie ausgerechnet an mir auslassen musste. So erfuhr ich schon in früher Jugend von weiblichen Launen.
In ihrer Fürsorge führte mir Alwena aber auch Jungen in meinem Alter aus unserer Nachbarschaft zu, mit dem Ziel, dass so Freundschaften entstehen würden. Weit gefehlt! Der gelegentliche Besuch von Gleichaltrigen war meistens eine kurze Angelegenheit. Ich interessierte mich nicht für andere Jungen. Ich fand sie langweilig, rabaukenhaft und dumm. Außerdem weigerte ich mich, in einem anderen Haus Besuche zu machen. Bei Mädchen sah es ganz anders aus, Mädchen hätte ich gerne getroffen, vor allem eines, das um die Ecke wohnte und so lustige Zöpfe und Sommersprossen auf der Nase hatte. Aber für einen solchen Kontakt war wiederum Alwena nicht zu gewinnen. Sie meinte, damit könnte man noch etwas warten.
Ich spielte am liebsten alleine, sammelte Käfer, Schnecken, Regenwürmer und weiteres Ungeziefer mit Begeisterung, schob sie in Schachteln, schleppte sie in unser Schlafzimmer und war erschrocken, wenn ich sie am nächsten Tag leblos vorfand. Mausetot. Ich wollte es nicht fassen. So kam es zu Begräbnissen, nicht selten feierliche Geschehen, zu denen alle, deren ich habhaft werden konnte, kommen mussten. Und dies öfter, als mir lieb war. Von dem älteren Ehepaar, das im Erdgeschoss wohnte, war mir erlaubt worden, in dem wilden Garten vor dem Haus zu spielen, was ich mit Begeisterung tat. Wenn Mutter zugegen war, warf sie einen gönnerhaften Blick auf mich, schenkte mir gelegentlich, wohl in Erinnerung an unsere gemeinsamen Jahre, auch einen Kuss und träumte vor sich hin, wie ich glaubte, von ihrem Tennisspieler. Auch mein Treiben mit meiner Schwester goutierte sie mit einem nicht enden wollenden Lächeln, hochzufrieden, mich so gut versorgt zu sehen. Sonst nahm sie niemals weiteren Anteil. Mutter war gewöhnlich erschöpft und glücklich, wenn sie ihren eigenen Interessen und Leidenschaften nachgehen konnte.
Zu uns beiden sagte sie immer wieder: »Spielt schön miteinander, Kinder! Amüsiert euch!«
Frau Zeh sah auch immer wieder nach mir. Und später, als sie die regelmäßige Arbeit bei uns wegen ihres Alters aufgegeben hatte, kam sie vorbei und brachte mir meist ausgesuchte Süßigkeiten mit. Sie half nur noch gelegentlich aus, darüber hinaus mussten wir uns selbst versorgen.
Mit sechs Jahren kam ich in die Schule. Mir wurde vorher von allen Seiten Schlimmes über die Schule berichtet und dass damit ein neues Zeitalter für mich beginnen würde. Ich hatte mich fest entschlossen, mein Leben mit Alwena durch nichts beeinträchtigen zu lassen. Und war in jeder Hinsicht erfolgreich: So wurde ich ein verträumter Schüler. Und blieb dies meine ganze Schulzeit über.
Für den Mund von Frau Zeh interessierte ich mich deshalb schon lange, weil sie so gut wie keine Zähne hatte. Kein Mensch nahm daran Anteil, ich umso mehr. So wurde ich ihr Liebling. Frau Zeh war, solange sie für uns arbeitete, eine Art graue Maus, niemand nahm sie ernsthaft wahr. Eine andere Rolle ließen Mutter und mein Schwesterlein nicht zu.
Nachdem Frau Zeh dann in Rente gegangen war, holte sie das ihr gestohlene Leben nach und entwickelte ihre Persönlichkeit. Das Aufregende daran war, dass sie mit einem Mal wunderschöne, gleichmäßige, blendend weiße Zähne besaß. Als wir bei einem ihrer Besuche einmal unter uns waren, demonstrierte sie ihre neue Errungenschaft: Sie nahm zu meinem Entsetzen ihre Zähne Stück für Stück aus ihrem Mund und legte sie auf den Küchentisch. Ich durfte sie sogar anfassen. Dann steckte sie ihre Zähne vor dem Spiegel stolz wieder in ihren Mund: Das konnte sonst niemand.
Bevor uns Frau Zeh an diesem Vormittag verließ, bläute sie mir ein, dass ich niemals über das Gesehene sprechen durfte. Sonst dürfte ich ihre Zähne nie mehr anfassen.
Mit ihrem Eintritt in das Gymnasium verärgerte Alwena mich, sie verschwand sang- und klanglos am Abend. Sie sprach später, ohne sich zu entschuldigen, von Elternsprechstunden, von Klassentreffen und Sportevents. Als Sprecherin ihrer Klasse, behauptete sie, müsse sie überall dabei sein. Ich sollte lernen, ohne Theater zu machen, am Abend schon mal ohne sie auszukommen. Es gehöre zu einer rechten Erziehung, mit kleinen Entbehrungen auszukommen. Am Anfang wurde mir ein farbloses Mädchen als Babysitterin zugeteilt. Doch Alwena war durch nichts zu ersetzen.
Mein Leben wurde immer aufregender. Ich schlief noch, als ein Kopf sich über mich beugte, ein fremder Kopf, ein großer Kopf mit vielen Falten im Gesicht und noch mehr Haaren, wilden Haaren. Ob ich ihn zuerst hörte, ob ich ihn zuerst roch oder einfach seinen Körper so nahe bei mir spürte: Ich weiß es nicht. Vielleicht alles zusammen.
Als ich meine Augen aufschlug, wunderte ich mich nicht. Vielleicht hatte ich ihn schon erwartet. Vielleicht war er nur mein Engel, der sich in einen anderen Menschen verwandelt hatte und mich zum Narren hielt. Ich hätte mich eigentlich wundern sollen: Denn dieser Kopf und das, was sich dahinter versteckte, war offensichtlich ein Mann. Und ich kannte bisher keinen Mann, obwohl mein sechster Geburtstag anstand. Ich kannte nur Frauen. Ein Mann, ein alter und fremder Mann in aller Frühe an meinem Bett! Er grinste und verzog sein Gesicht zu einer Grimasse. Wirklich, er sah furchterregend aus. Der breite Mund, der sich bis zu den wackelnden riesigen Ohren streckte, die gewaltigen Augenbrauen und die großen, runden Augen, die mich fordernd ins Visier nahmen. Hätte ich nicht nach Hilfe schreien sollen? Aber ich lächelte und fragte: »Wer bist du?« Er schnaufte, wackelte stärker mit den Ohren, und stieß endlich in einem heiseren, dunklen Tonfall und einer unverständlichen Sprache einige Worte aus.
Ich setzte mich auf: »Ich verstehe dich nicht. Du redest Kauderwelsch!«
Wir waren beinahe mit unseren Köpfen zusammengestoßen. In seinen Augen funkelte es lustig. Ich dachte, er müsse ein Clown sein!
»Ich bin dein Elefant! Und komme aus Afrika.«
Sein Tonfall wurde noch tiefer, und seine Stimme krächzte ganz fürchterlich.
Ich lachte: »Du bist doch kein Elefant! Du lügst!«
»Gut, zugegeben, ich bin kein Elefant. Ich bin aber ein Freund von einem Elefanten. Der wohnt in meinem Garten und weckt mich jeden Morgen mit einem Trompetenschrei. Hast du auch einen Elefanten?«
»Nein«, räumte ich ein, »aber ich würde deinen Elefanten gerne einmal kennenlernen.«
»Kein Problem. Du musst nur eine weite Reise machen. Höchste Zeit, dass du mich mal besuchst. Denn schließlich und endlich: Ich bin dein Großpapa!«
»Großpapa? Was ist das denn? Kommen du und der Elefant aus dem Zoo?«
»Nein, ich komme nicht aus dem Zoo. Ich bin der Papa deines Papas, und ich komme aus Afrika.«
»Und das soll ich glauben!«, rief ich aus. »Alwena, sag mir, wer das ist!«
Alwena trat zu meiner Seite, während sie sich die Haare kämmte: »Glaub ihm, er ist dein Großpapa.«
Es stellte sich heraus, dass Großpapa oder Großpa, wie ich ihn bald nannte, wirklich mitten in Afrika lebte. Ich wollte alles über ihn wissen. Jetzt rächte es sich, dass zwischen Vater und mir nach wie vor eine Art Burgfrieden herrschte.
Afrika, da ist es immer sehr heiß. Deshalb gibt es wenig Wasser, sodass viele Felder und Wiesen vertrocknen. Oftmals haben die vielen wilden Tiere, die Elefanten, die Löwen, die Hyänen, die Zebras, die Büffel und die anderen Tiere – und die Menschen auch – ihre liebe Not. Großpa besaß eine große Farm, auf der viele schwarze Männer und Frauen arbeiteten und wo Tee für die ganze Welt angebaut wurde. Er hatte mir Kindertee mitgebracht, der mit Milch und Zucker gar nicht so bitter schmeckte. Großpa lebte in einem riesigen Steinhaus mit dicken Wänden, damit es drinnen nicht so heiß werden konnte. In dem Haus lebte er, wie er behauptete, ganz alleine.
Ich fragte ihn: »Großpa, dann bist du ja einsam! Ist das nicht langweilig?«
»Du brauchst dir über mich keine Gedanken zu machen, Söhnchen, mein Leben ist immer lustig. Ich schlafe morgens bis in die Puppen, und zwar so lange, wie es mir gefällt. Dann kommt, während ich noch im Bett liege, eine dicke Mami, die für mich sorgt. Morgens, wenn ich noch im Bett liege, fährt sie mit einem nassen Tuch über mein Gesicht und kämmt meine Haare. Sie ist die Einzige, die das darf.«
»Das kenne ich«, rief ich dazwischen.
»Anschließend bringt sie ein Tablett, auf dem mein Frühstück mit vielen Früchten und dicken Würsten steht. Dazu gibt es köstlichen Tee aus meiner Plantage. Nach dem Frühstück lässt sie meinen Verwalter herein, der ein tüchtiger Mann ist und aufpasst, dass meine Arbeiter auch immer fleißig sind.«
Wir beide saßen auf unserer Terrasse und ließen uns von der Wintersonne wärmen. Großpa hielt ein Glas mit Portwein in der Hand, obwohl der Vormittag erst anfing und es gar nicht so lange her war, dass Alwena in die Schule verschwunden war. Zu seinen Ehren waren meine morgendlichen Aufgaben entfallen, sodass wir beide ausgiebig zusammen schwätzen konnten.
»Wie herrlich kühl, euer Winter! Das kennen wir nicht. Ich lebe am Äquator. Die Sonne liebt uns dort am meisten. In der Hitze lässt es sich gut faul sein, und das Leben ist etwas gemütlicher«, erzählte Großpa.
»Dein Verwalter, von dem du erzählst, ist der nun ein Schwarzer?«, wollte ich wissen.
»Gute Frage! Sein Gesicht ist weder das eine noch das andere: Es ist kaffeebraun, also eine Farbe dazwischen.«
»Toll, Großpa! So möchte ich auch aussehen!«
»Ja, warum nicht«, räumte er ein, »aber dafür ist es leider zu spät. Da hätte dein Vater eine afrikanische Frau nehmen oder ich hätte einem schwarzen Mädchen ein Kind machen müssen. So etwas kommt schon vor.«
»Und jetzt, Großpa? Was machst du heute?«
Er rollte sich unruhig auf seinem Stuhl hin und her und nahm einen großen Schluck vom Portwein: »Gut, Söhnchen …«
Er nannte mich »Söhnchen«, obwohl er mein Großpa war. Aber daran war nun nichts mehr zu ändern. Und mir war es auch recht, in meiner Begeisterung, dass ich einen Freund bekommen hatte, mit dem ich über alles reden konnte. Besser als mit Frauen, wo man bei kitzligen Fragen anstelle einer vernünftigen Antwort Gekicher, Gegluckse oder sonst was zu hören bekam. Alwena ausgenommen, natürlich. Ich dachte nach: »Großpa, dann schläfst du auch mit deiner dicken Mami in einem Bett?«
»Ja, und dann gibt es genug Frauen, auch junge, mit langen Beinen. Und herrlichen weißen Zähnen. Die duften ganz süßlich, so als wenn sie aus Zucker wären.«
»Großpa, du redest durcheinander. Du weißt nicht, was du sagen willst. Alwena hat mir beigebracht, dass ich erst nachdenken soll und dann erst reden.«
»Da hat Alwena sicher recht. Sie ist ein kluges Mädchen, ein sehr kluges sogar, da müssen wir zwei uns ganz ordentlich anstrengen …«
»Du musst«, unterbrach ich ihn, »erst nachdenken …«
Jetzt unterbrach er mich: »… und dann reden. Also ich wollte dir sagen, dass du eine Freundin in Afrika haben kannst und trotzdem hier im kühlen Norden noch eine andere. Und dann hast du den Vergleich, mit wem von den beiden es mehr Spaß macht.«
»Zwei Frauen«, sinnierte ich, »das ist dann wie bei mir. Jetzt habe ich eine Mami und eine Schwester. Und eigentlich auch noch eine Mami.«
»Wer ist das denn?«
»Wer denn schon! Natürlich Alwena.«
»Aber davor war doch nur Ma deine Mami?«
»Weißt du doch, Großpa!«
»Jetzt aber Schluss«, brauste er auf.
Großpas Besuch war der erste, seitdem ich auf der Welt war. Er sollte auch nicht lange bleiben und behauptete, dass er Heimweh hätte. Natürlich fragte ich ihn, warum er so schnell wieder zurückwolle. Da meinte er, wegen allem. Er hätte sein Herz eben in Afrika verloren. Hier wäre es zu kalt, die Menschen zu ernst, in Afrika dagegen oft zu heiß. Dort würde ihn manchmal die Sehnsucht nach dem Norden packen und umgekehrt hier die Sehnsucht nach seiner Farm in Afrika. Ich müsste ihn bald besuchen, um alles selbst zu sehen. Es wäre dort ein Leichtes, mir eine neue Mami zu besorgen.
Großpa lebte während seines Besuchs bei uns in der Kammer, in der früher Frau Zeh geschlafen hatte. Die Wochen, die wir zusammen verbrachten, waren wie Weihnachten. Ich konnte mich von einem Tag auf den anderen freuen, es gab immer etwas Neues. Mal gingen wir in den Zoo oder in den Zirkus, besuchten eine Blumenshow und das Aquarium, wo er mir über die vielen bunten Fische erzählte, die von überall her kamen, und Eiscafés oder italienische Restaurants, wo wir uns die Bäuche vollschlugen.
Eines Tages hatte Großpa ein Brett und ein Kistchen unter dem Arm. Er setzte sich mit Bedacht an einen Tisch und wies mich an, gegenüber von ihm Platz zu nehmen. Dann öffnete er das Kistchen und stellte verschiedene Figuren, die er dem Kistchen entnahm, auf das Brett, das schwarz-weiß gemustert war. Er machte dabei ein ernstes Gesicht, ja, er hatte so etwas wie einen feierlichen Ausdruck. Großpa kommentierte die Positionen der schwarzen und weißen Figuren, ich sollte mich an alles, was er machte, später erinnern. Jede Figur vollzog auf dem Brett unter seiner Regie einen bestimmten Zug. Die schwarzen Figuren waren eine Mannschaft, und sie hatten nichts anderes im Sinn, als den weißen Figuren durch geschickte Züge oder Sprünge den Garaus zu machen. Und die weißen Figuren genauso. Das war ein bisschen viel für mich auf einmal, aber Großpa zeigte sich als unerbittlich und gab nicht nach, bis ich durch tägliches Training das Spiel beherrschte. Er paukte mit mir mehrere Eröffnungszüge, die mich in vorteilhafte Positionen für den weiteren Verlauf des Spiels bringen sollten. So beherrschte ich bald das Schachspiel, gerade zu der Zeit, als ich das kleine Einmaleins und das Alphabet lernte.
»Ich habe viele Turniere gespielt. Einmal war Bobby Fischer, der große Fischer, mein Gegner«, sagte er stolz.
Ich hatte mir angewöhnt, wenn Großpa es sich gemütlich gemacht hatte, im Sauseschritt um ihn herumzurennen.
Nach einer Zeit blickte er auf: »Du bist ein Wibbelstetz, Alwyn, eine Nervensäge. Schlimmer als ich. Sind deine Verrenkungen als Sport zu verstehen? Und die Faxen, die du mit deinem Gesicht anstellst?«
Am Abend und gelegentlich am Nachmittag war auch Alwena dabei. Das war nicht so lustig, weil ich spürte, dass sie auf Großpa mehr und mehr eifersüchtig wurde. Sie meinte, ich würde sie beim Reden nur selten ansehen, und das, obwohl er genauso ihrer wie mein Großvater war. Eifersucht, so dachte ich, sei eine Sache, die für Frauen da wäre. Die waren ja sowieso immer wieder so komisch. Bis ich später, ein gutes Jahrzehnt später, von derselben Krankheit erfasst wurde, und zwar so heftig, dass ich dachte, ich müsste verrückt werden.
Mutter ließ sich in diesen Wochen noch weniger sehen als sonst. Sie glaubte uns bestens versorgt. Bob, ihr Freund, sei so erfolgreich als Tennisspieler, dass sie ihn auf all die aufregenden Tennisturniere begleiten müsse. Er brauchte sie, behauptete sie.
Am schönsten war es, wenn wir, Großpa und ich, am Vormittag, wenn die Sonne schien, in dem nahen kleinen Park, wo man so gut spielen konnte, zusammenhockten. Mich interessierte alles, was er über sein Leben erzählte. Es klang wie im Märchen. Ich erfuhr, wie sein Tag nach dem Aufstehen verlief, wann er seine Arbeiter besuchte und einen Blick auf die Ernte warf, wann er über die weite Steppe bis zu den Bergen ausritt. Begleitet wurde er dabei meistens von einem Mädchen und einem Jungen, die kaum älter als ich waren. Beide konnten sich wie die Teufel noch beim schärfsten Galopp oder bei weiten Sprüngen im Sattel halten. Den Jungen müsste ich unbedingt kennenlernen, wenn ich zu Besuch käme. Großpa ging auf die Jagd, auf seiner Farm oder zu einem Nachbarn. Sie schossen Rebhühner, Hasen, eigentlich alles, was nicht verboten war. Wer einen Löwen oder einen Elefanten erschoss, musste ins Gefängnis. Am Abend besuchte er seine Freunde in den umliegenden Farmen, oder er bekam zu Hause Besuch. Männer mit dunklen Gesichtern und vielen Falten im Gesicht, wild polternd, wenn sie das Haus betraten, die von dem einheimischen Bier und dem schottischen Whisky zum Essen nicht kleinzukriegen waren. Bis spät in die Nacht wurde Karten gespielt und dabei um Pennys gewettet. Die Damen, meistens große, hagere Frauen, bestanden gelegentlich darauf, dass getanzt wurde. Das weckte keine große Begeisterung bei den Männern, aber der Alkohol half nach.
Erst später erfuhr ich, dass Großpa, wie es seine Art war, alles in Rosarot gezeichnet hatte. Es gab Missernten, große Dürren, bei denen die Tiere starben und die Menschen verhungerten. Großpa musste immer wieder in die Hauptstadt fahren, um seine Bank zu besuchen. Dort wurde erwartet, dass er mit den Chefs Whisky trinken ging, spätabends in einem Club lautstark Lieder sang, um dann anschließend mit den ältlichen Ehefrauen Foxtrott und Tango zu tanzen, weil er das doch am besten konnte. Nach solchen Prüfungen war er endlich in der Lage, seinen abgemagerten Arbeitern den Lohn zu bezahlen.
Schließlich verschwand Großpa ebenso geheimnisvoll und unerwartet, wie er aufgetaucht war. Voranmeldung war nicht seine Sache. Er hasste, wie er immer wieder ausführte, Abschiedszeremonien, Krokodilstränen, die Wiederholung von Beteuerungen und Küsse, die nicht enden wollten. Zurück blieben riesige Stapel von Zeitungen, ein Herz und noch ein Herz, die er für Alwena und mich in der letzten Nacht an die Wand gepinselt hatte, und ein Hauch seines Parfüms, unverwechselbar und zauberhaft. Ich glaube, dieser Duft hat nie meine Nase verlassen. Alwena erschien im Gegenteil zu mir eher erleichtert und warf sich mit neuem Elan in ihre Mutteraufgaben mir gegenüber. Sie meinte, meine Manieren hätten ziemlich durch Großpas Einfluss gelitten. Vor allem bei den Hausaufgaben, jetzt vor meinem Eintritt in die Schule, müsste sie mich strenger zur Ordnung rufen. Was hieß, dass mein Hinterteil öfter leiden musste. Aber da ich mich schon an diese Prozedur gewöhnt hatte, tat es mir so gut wie gar nicht mehr weh. Nur mein Gezeter behielt ich bei, was sie immer wieder mit Genugtuung erfüllte. Ach, wäre doch alles ewig so weitergegangen!
Dann kam mein sechster Geburtstag, der viel Neues in mein Leben brachte. Ich musste in die Schule, auf die ich von Alwena hervorragend vorbereitet worden war. Zugleich traten drei Männer auf, die, einer nach dem anderen, deutliche Spuren hinterlassen sollten. Vor allem Alberto, der Elefant, mein Großpa, der kurz zuvor gekommen und viel zu früh wieder gegangen war. Plötzlich verfügte ich über einen echten Opa. Einen Mann! Schließlich aber auch über einen Vater, der sich in einem völlig veränderten Licht präsentierte, obwohl ich lange brauchte, bis wir zwei auf Tuchfühlung kamen. Und das förmliche Sie in der Anrede aufgaben. Ja, es fiel uns schwer, den Graben, der am Anfang zwischen uns aufgeworfen worden war, zu überwinden.
Im Schatten von Großpa und Vater stand Bob, ewig angesagt, im Voraus gefürchtet, beneidet, belächelt, schon fast eine Witzfigur! Er machte neben der gravitätisch schreitenden Ma eine schüchterne Figur. Er trug einen korrekten Anzug mit einer leuchtend roten Krawatte, hielt einen bunten Blumenstrauß in der Rechten. Er drückte mit der Andeutung eines Dieners Alwena die Blumen in die Hände, während er mich mit einem kumpelhaften Klaps auf die Schulter bedachte. Bob blieb zum Mittagessen. Es war Sonntag, und wir hatten viel Zeit. Ma hatte eine besondere Mahlzeit vorbereitet, insofern war sein »Antrittsbesuch«, wie es mein Schwesterlein nannte, ein Erfolg. Das Gespräch, »Konversation« genannt, verlief jedoch schleppend. Mutter beschränkte ihren Anteil auf den wiederholten Zuruf, wir sollten es uns schmecken lassen. Ansonsten strahlte sie bis über die Ohren über die »Zusammenführung«, wie sie unser Treffen bezeichnete.