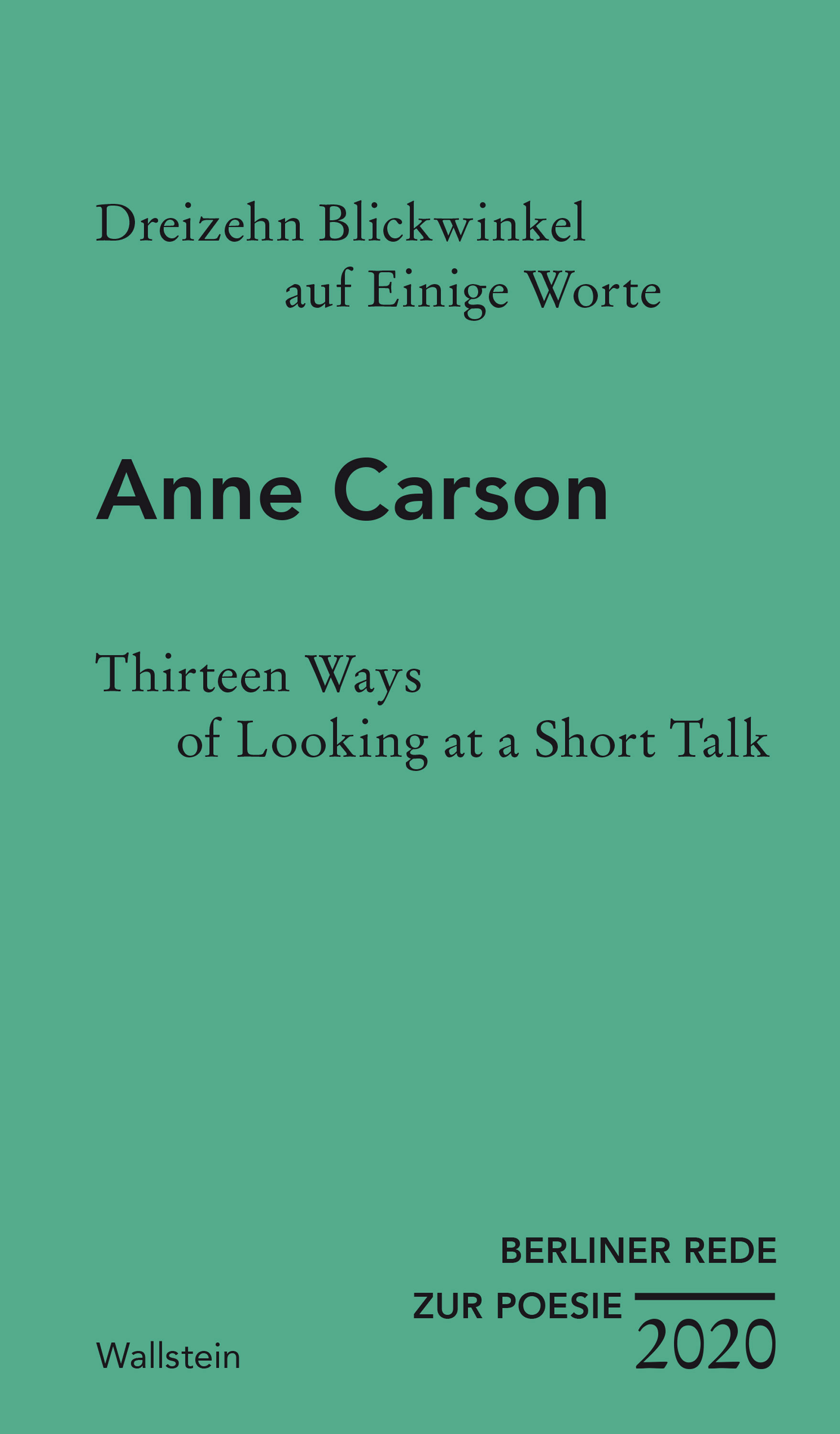
Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte / Thirteen Ways of Looking at a Short Talk E-Book
Anne Carson
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berliner Rede zur Poesie
- Sprache: Deutsch
Eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwart aus Kanada: am 7. Juni 2020 in Berlin. Am 7. Juni 2020 wird die Berliner Rede zur Poesie von der 1950 in Toronto geborenen kanadischen Dichterin, Essayistin, Übersetzerin und Klassischen Philologin Anne Carson gehalten. Carson lehrte von 1980 bis 1987 an der McGill University, der University of Michigan und der Princeton University. Sie wird in Kanada und den USA als eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwart gefeiert. In ihren Büchern vermischt sie die Formen von Poesie, Essay, Prosa, Kritik, Übersetzungen, dramatischem Dialog, Fiktion und Non-Fiction. Anne Carson wird sich in ihrer Rede intensiv mit den verschiedenen Formen von Poesie, Prosa und bildender Kunst auseinandersetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Carson
Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte
Aus dem Englischen von Anja Utler
Thirteen Ways of Looking at a Short Talk
Herausgegeben von Matthias Kniep und Thomas Wohlfahrt
Wallstein Verlag
Die Berliner Rede zur Poesie wurde am 7. Juni 2020 im Rahmen des 21. poesiefestival berlin gehalten, veranstaltet vom Haus für Poesie.
Inhalt
Dreizehn Blickwinkel auf Einige Worte
Thirteen Ways of Looking at a Short Talk
Kurzbiografien
1. Einige Worte dazu worüber ich am meisten nachdenke
Irrtümer.
Und die Gefühle dazu.
An der Grenze zum Irrtum liegt die Angst.
Inmitten eines Irrtums herrschen Torheit und Niederlage.
Den eigenen Irrtum zu erkennen verursacht Scham und Schuldgefühle.
Wirklich?
Schauen wir uns das genauer an.
Eine Menge Leute, darunter Aristoteles, halten den Irrtum
für einen interessanten und wertvollen geistigen Vorgang.
In seiner Rhetorik erörtert Aristoteles die Metapher
und sagt, es gibt drei Arten von Wörtern.
Fremdartige, gewöhnliche und metaphorische.
»Fremdartige Wörter verwirren uns einfach;
gewöhnliche vermitteln etwas, das wir schon wissen;
die Metapher aber liefert uns etwas Neues und Frisches«
(Rhetorik, 1410b10–13).
Was ist das Frische an einer Metapher?
Aristoteles sagt, die Metapher erlaubt dem Denken sich selbst dabei zu erleben
wie es einen Fehler macht.
Er stellt sich vor wie das Denken sich über die glatte Oberfläche
gewöhnlicher Sprache bewegt
und diese Oberfläche
wird auf einmal brüchig oder kompliziert.
Unerwartbarkeit taucht auf.
Alles wirkt zunächst sonderbar, widersprüchlich oder falsch.
Dann ergibt es Sinn.
Und in diesem Moment, so Aristoteles,
wendet sich das Denken an sich selbst und sagt:
»Wie wahr! Und doch hatte ich mich geirrt darin!«
Aus dem wahren Irren der Metapher lässt sich etwas lernen.
Nicht nur, dass die Dinge anders sind als sie scheinen,
weshalb wir uns in ihnen irren,
sondern auch, dass diese Irrtümer wertvoll sind.
Nicht abbringen lassen davon, sagt Aristoteles,
hier gibt es viel zu sehen und zu fühlen.
Metaphern lehren das Denken
die eigenen Fehler zu genießen
und etwas zu lernen
aus dem Nebeneinander dessen, was der Fall ist, und was nicht.
Ein chinesisches Sprichwort sagt,
Ein einzelner Pinselstrich schreibt keine zwei Zeichen.
Und doch
macht ein guter Fehler genau das.
Hier ein Beispiel.
Es ist ein Fragment aus der altgriechischen Lyrik,
das einen arithmetischen Fehler enthält.
Der Dichter scheint nicht zu wissen,
Alkman Fragment 20:
[?] machte drei Jahreszeiten, Sommer
und Winter und Herbst als die dritte
und als viertes den Frühling wenn es
die Blüten gibt nur genug zu essen gibt
es nicht.
Nun lebte Alkman im 7. Jahrhundert v. Chr. in Sparta.
Sparta war ein armes Land
und es ist unwahrscheinlich, dass Alkman
dort ein wohlhabendes oder wohlgenährtes Leben führte.
Diese Tatsache bildet den Hintergrund für seine Äußerung,
die in den Hunger führt.
Hunger, wenn er dir widerfährt,
fühlt sich immer an wie ein Fehler.
Alkman erlaubt uns diesen Fehler gemeinsam mit ihm
zu erfahren
durch den zielführenden Einsatz einer falschen Rechnung.
Für einen armen Dichter in Sparta, der nichts
mehr in seinem Schrank hat
am Ende des Winters –
für den kommt der Fühling so
als hätte die Naturwirtschaft es sich plötzlich anders überlegt,
als viertes in einer Reihe von dreien,
was seine Arithmetik aus dem Gleichgewicht treibt
und seinen Vers ins Enjambement.
Alkmans Gedicht bricht ab, mitten in einem jambischen Metron,
ohne zu erklären,
woher der Frühling kam
oder warum Zahlen uns nicht dabei helfen,
die Wirklichkeit besser unter Kontrolle zu kriegen.
Es gibt drei Dinge, die mir an Alkmans Gedicht gefallen.
Erstens, dass es klein ist,
leicht
und mehr als perfektioniert ökonomisch.
Zweitens, dass es Farben andeutet etwa ein fahles Grün
ohne sie zu nennen.
Drittens, dass es ihm gelingt ein paar zentrale
metaphysische Fragen ins Spiel zu bringen
(wie Wer hat die Welt gemacht)
ohne offenkundiges Urteil.
Ihnen ist aufgefallen, dass das Verb »machte« im ersten Vers
kein Subjekt hat: [?]
Für das Griechische ist es sehr ungewöhnlich,
dass ein Verb kein Subjekt hat, tatsächlich
ist das ein grammatikalischer Fehler.
Strenge Philologen würden Ihnen sagen,
dass es sich schlicht um eine Überlieferungspanne handelt,
dass das Gedicht wie wir es haben
gewiss ein Fragment ist, abgebrochen
von einem längeren Text
und dass es so gut wie sicher ist, dass Alkman
den für die Schöpfung Verantwortlichen genannt hat
in den Versen, die dem vorangingen, was wir hier haben.
Das kann gut sein.
Aber wie Sie wissen, ist das Hauptziel der Philologie
alle Freude, die man an einem Text haben kann,
auf eine geschichtliche Panne zu reduzieren.
Und mir ist nie wohl bei der Behauptung, man wisse genau,
was ein Dichter sagen will.
Lassen wir also das Fragezeichen dort
am Anfang des Gedichts
und bewundern wir den Mut, mit dem Alkman
sich dem stellt, was es einklammert.
Und viertens gefällt mir
an Alkmans Gedicht
wie es den Eindruck erweckt,
dass ihm die Wahrheit wider Willen herausplatzt.
So mancher Dichter strebt nach
diesem Ton absichtsloser Klarheit,
aber nur wenigen gelingt er in dieser Einfachheit wie Alkman.
Natürlich ist die Einfachheit nur vorgetäuscht.
Alkman ist ganz und gar nicht einfach,
er ist ein Meistertüftler
an der Wirklichkeit –
oder, wie Aristoteles sagen würde, ihr »Nachahmer«.
Nachahmung (auf Griechisch mimesis) ist
Aristoteles’ Sammelbegriff für das wahre Irren der Poesie.
Mir gefällt an diesem Begriff
wie umstandslos er akzeptiert, dass das, womit
wir uns befassen, wenn wir Poesie betreiben, der Irrtum ist,
die mutwillige Produktion von Irrtümern,
der bewusste Bruch und die Verkomplizierung von Fehlern
bis zum Auftritt von
Unerwartbarkeit.
Damit umgeht ein Dichter wie Alkman
Angst, Sorge, Scham, Schuld und all
die anderen albernen Gefühle, die mit dem Fehlermachen in Verbindung gebracht werden
und nimmt es auf
mit der Tatsache an der Sache.
Für Menschen ist Unvollkommenheit die Tatsache an der Sache.
Alkman bricht die Regeln der Arithmetik,
gefährdet die Grammatik
und lässt die Metrik in seinem Vers auflaufen,
um uns mit dieser Tatsache in Berührung zu bringen.
Diese Tatsache bleibt auch am Ende des Gedichts
und Alkman hat wahrscheinlich noch genauso viel Hunger.
Nur in unserem Erwartungsquotienten hat sich etwas geändert.
Indem er die Erwartungen in die Irre gehen ließ,
hat Alkman etwas perfektioniert.
Tatsächlich hat er
etwas mehr als perfektioniert.
Mit einem einzelnen Pinselstrich.





























