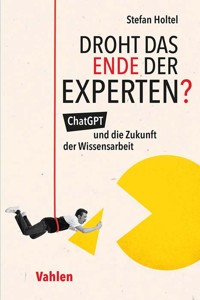
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vahlen
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kurzweilige, praktische Einführung über den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Zukunft der Experten und in die Arbeit mit ChatGPT
Am 30. November 2022 stellt das Unternehmen OpenAI einen Chatbot namens ChatGPT vor. Er könnte als der „iPhone-Moment“ in die KI-Geschichte eingehen. Denn ChatGPT tut Dinge, die bisher undenkbar erschienen. Ohne Vorbereitung. Ohne Programmierung. Ohne Training.
ChatGPT erledigt komplexe Wissensarbeiten in Sekunden, für die Menschen bisher Stunden oder Tage benötigten. Viele Experimente der Benutzer geben einen Vorgeschmack auf das Portfolio der Anwendungen: Marketingtexte, Titelvorschläge für Bücher, Excel-Code, Lexikonerklärungen, Blog- und Zeitungsartikel, Filmskripte, Gedichte, Haikus, Lieder, Gebrauchsanleitungen, Geschenkideen, Rezeptvorschläge, Fragebögen-Design oder Umfragen, Coaching und Lebensberatung. ChatGPT scheint so etwas zu sein wie eine Art „Schweizer Messer der KI“.
Es scheint der Zeitpunkt gekommen, dass Wissensarbeit in ähnlicher Weise umgekrempelt wird, wie die Elektrizität den Weg für die Massenproduktion ebnete. Wissensarbeit wandelt sich von der Manufaktur- zur Fabrikarbeit. Deshalb überschlagen sich seit dem denkwürdigen Tag im November 2022 die Ereignisse.
Dieses Buch ist für jeden relevant, der direkt oder indirekt von Wissensarbeit betroffen ist: Entscheider, in deren Organisation Tätigkeiten wie Kundenkontakt, Recherche, Marketing oder Reporting effektiver vonstatten gehen könnten; Journalisten, Autoren und Texter, die schneller texten oder die Qualität der Texte erhöhen wollen; Finanz- und Versicherungsberater oder andere Experten mit Nischenwissen, weil sehr viele Fragen inkl. Vorschlägen und Empfehlungen vollständig durch Maschinen übernommen werden ... Alle werden die Frage stellen, inwieweit ChatGPT bzw. GAI (Generative Artificial Intelligence) ihr heutiges oder zukünftiges Tätigkeitsfeld verändert, ob sie überflüssig werden oder wie sie darauf reagieren können.
Denn ChatGPT bzw. GAI „demokratisieren“ viele Dienstleistungen der Wissensgesellschaft, die heute nur teuer durch das Abschöpfen menschlicher Expertise zu haben ist. Das fließbandartige Erzeugen von Texten, Bildern und Videos für den Alltagsgebrauch wird plötzlich für jeden zu marginalen Kosten möglich. Und bedroht damit ergiebige Einnahmequellen und etablierte Wertschöpfungsketten. Unternehmen und Institutionen werden sich fragen, welche organisationalen Tätigkeiten sich durch GAI effizienter und effektiver gestalten lassen. Die Frage ist nicht, ob diese Herausforderung besteht. Ab sofort geht es nur noch darum, sie nicht rechtzeitig zu bewältigen.
Das Buch hilft, das Konzept von ChatGPT und GAI besser zu verstehen und zu erkennen, welche Praxisrelevanz für das eigene Arbeitsfeld besteht. Die Ideen und Konzepte werden gut veranschaulicht und mit Beispielen unterlegt.
Über den Autor
Stefan Holtel entwickelt seit 2018 als Kurator für digitalen Wandel bei PricewaterhouseCoopers Lehr- und Lernformate zur digitalen Weiterbildung. Er blickt auf mehr als drei Jahrzehnte in der ITK-Branche zurück und war u.a. in der Forschung und Entwicklung bei der Vodafone Group tätig. Stefan Holtel ist Mitglied mehrerer Arbeitskreise im Fachverband BITKOM sowie Lehrbeauftragter an der HAUFE-Akademie, der FOM und am St. Gallen Management-Institut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Inhalt:
Kurzweilige, praktische Einführung über den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Zukunft von Experten und in die Arbeit mit ChatGPT
„Ein kraftvolles und fundamentales Buch. Es hilft, die Thematik KI praktisch einzuordnen und zu einer persönlichen und sachlichen Einschätzung zu gelangen ... Wer eine Haltung zur KI-Zukunft aufbauen möchte, sollte dieses Buch inhalieren.“Oliver Gerstheimer, CEO der digitalen Innovationsagentur chilli mind GmbH
„Dieses Buch liefert den Schlüssel zur Entschlüsselung der Zukunft der Wissensarbeit.“Lucas Sauberschwarz, Managing Partner Venture Idea & Direktor des Center for Innovation am SGMI Management Institute St. Gallen
„Stefan Holtel stellt die Frage, wie sich die Rolle des Wissensarbeiters entwickeln wird. Er argumentiert, dass Generalisten, die Probleme verstehen können, immer wichtiger werden. Diese neuen ‚Kombinatoren‘ werden in der Lage sein, verschiedene Aufgaben zu analysieren und zu lösen, indem sie die Automatisierung von Chatbots nutzen und sich auf komplexe sowie strategisch wichtige Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren.“Gunnar Sohn, Wirtschaftspublizist, Blogger, Dozent
„Stefan Holtel liefert ein hochaktuelles wie inspirierendes Orientierungswerk zum Wandel der Wissensarbeit in Zeiten von ChatGPT. Pflichtlektüre für alle, die die Probleme der Arbeitswelt verstehen und überwinden wollen, anstatt nach halbgaren Lösungen zu suchen. Den Kombinator als neuen Rollentypus des digitalen Zeitalters sollten wir uns merken.“Dr. Johannes Winter, Chief Strategy Officer, L3S Research Center
„Wie ChatGPT die Arbeitswelt umkrempelt? Dieses Buch ist die perfekte Mischung aus fundierter Analyse und unterhaltsamen Metaphern für die neue Ära der Künstlichen Intelligenz.“Tobias Keller, Teamleader Data Analytics, gfs.bern
„Stefan Holtel enthüllt mit schonungsloser Direktheit das disruptive Chaos der KI. Er liefert hier den unverblümten, kompetenten Guide durch das Labyrinth eines Hypes, der unsere Welt auf den Kopf stellt. Ein Must-Read für alle, die den echten Durchblick wollen.“Konrad Buck, Pressesprecher, asvin GmbH
„Diese essenzielle Lektüre bietet eine fundierte und zugleich ermutigende Perspektive für Wissens- arbeiter und Skeptiker der Technologie. Sie inspiriert und ermächtigt durch tiefgründige Einsichten und fordert uns auf, klügere Fragen zu stellen und eigene Denkmuster zu hinterfragen.“Peter Rochel, Managementberater, Unternehmer und Consultant im Bereich JTBD Research & Innovation
„Für die einen ist ChatGPT nur ein Hype. Für die anderen das Ende der Wissensarbeit. Mit fundierter Expertise und sorgfältig recherchiert zeigt Stefan Holtel die Muster des Wandels auf, der sich durch Technologien wie ChatGPT ergeben wird ... Indem er die Funktionsweise von künstlicher Intelligenz und von Sprachmodellen erklärt, leitet er die Kompetenzen ab, die jeder Wissensarbeiter für sich entdecken sollte – wenn er die Chancen der neuen Technologie nutzen will. Absolute Leseempfehlung für alle, die für sich und ihre Aufgabe die Bedeutung von ChatGPT fundiert einschätzen möchten.“Dr. Torsten Herzberg, Unternehmensentwickler, Experte für Digitalisierung im Mittelstand, Herzberg Consulting GmbH
Zum Autor:
Stefan Holtel entwickelt seit 2018 als Kurator für digitalen Wandel bei PricewaterhouseCoopers Lehr- und Lernformate zur digitalen Weiterbildung. Er blickt auf mehr als drei Jahrzehnte in der ITK-Branche zurück und war u. a. in der Forschung und Entwicklung bei der Vodafone Group tätig. Stefan Holtel ist Mitglied mehrerer Arbeitskreise im Fachverband BITKOM sowie Lehrbeauftragter an der HAUFE-Akademie, der FOM und am St. Gallen Management-Institut.
DROHT DAS ENDE DER EXPERTEN?
ChatGPT und die Zukunft der Wissensarbeit
von Stefan Holtel
5Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Netscape: Triumph und Tragödie eines Internetpioniers
Die unsichtbare Hand des Rechnens
Der Geburtstag Künstlicher Intelligenz
KI sehen ist nicht dasselbe wie KI verstehen
Kapitel kompakt
Teil I Wie ChatGPT die Wissensarbeit durchrüttelt
Kapitel 1 Das Medium ist die Botschaft: ChatGPT für Autoren und Journalisten
Eine Nachricht mit dem Vorschlaghammer
Hast Du Angst?
Kreatives Schreiben
Der neue Praktikant ist da
Kapitel kompakt
Kapitel 2 Eine Fibel für die junge Dame: ChatGPT für Schüler, Lehrer und Studenten
Von „Peter ruft Flocki“ in die Grenzwelt
Interaktive Lesefibeln
Khanmigo und Duolingo
Kapitel kompakt
6Kapitel 3 Fiat Justitia: ChatGPT für Juristen
Gerechtigkeit für eine komplexe Welt
Denken in zwei Systemen
Recht sprechen mit ChatGPT?
Erste Hilfe für Rechtsfälle
Kapitel kompakt
Kapitel 4 Der mündige Patient: ChatGPT für Ärzte und Krankenhäuser
Von Il Dottore zu IBM Watson
Künstliche Röntgenaugen sehen mehr
Richtig oder falsch?
Kapitel kompakt
Kapitel 5 Autonome Kunst: ChatGPT für kreative Berufe
Malerei nach dem Ende der Malerei
Konfrontation mit Mustern
Ist ChatGPT die 10. Muse?
Hyperrealistische Kunst
Kapitel kompakt
Teil II Die Vorgeschichte zu ChatGPT
Kapitel 6 Der Traum vom digitalen Alleskönner
Eine Autofahrt schreibt Geschichte
Chatbots oder Ehepartner?
Beyoncé und die digitale Entourage
Masse oder Klasse? Die Geschichte der Maßproduktion
Kapitel kompakt
Kapitel 7 ChatGPT ist ein Proto-Werkzeug
Das Wesen der Proto-Dinge
Allgemeiner Problemlöser
Spekulationen über Superintelligenz
Dualität der Technik
Kapitel kompakt
7Kapitel 8 Warum ist ChatGPT ein Durchbruch?
Die Geschichte von Penicillin
Inkrementelle und disruptive Innovation
Warum ChatGPT erfolgreich ist
ChatGPT Inside
Kapitel kompakt
Kapitel 9 Die Rolle von ChatGPT in der KI-Evolution
Eine Übergangstechnologie namens ChatGPT
Automation oder Augmentation?
Verantwortung von Mensch und Maschine
Ein Teil steht für das Ganze
Kapitel kompakt
Kapitel 10 Das Wesen der Wissensarbeit
Von Immanuel zu „DigiKant“
Kant’sche Fragen zur Zukunft der Wissensarbeit
Richtige Fragen und richtige Antworten
Evolutionspfade der Wissensarbeit
Kapitel kompakt
Teil III Stochastische Papageien. Wie spricht ChatGPT?
Kapitel 11 Mit Sprache die Welt verstehen
Wenn Papageien reden
Denken wir nur das, was wir sprechen können?
Handeln oder Sein? Wie Menschen kommunizieren
Vergleichende Illusionen in Wort und Bild
Kapitel kompakt
Kapitel 12 Kleine Geschichte der Sprechmaschinen
Ein Frauenkopf namens Euphonia
Spielpuppe mit Gruselfaktor
Mit Händen und Füßen
Der erste Russen-Versteher
8Sprechender Schuhkarton
Kapitel kompakt
Kapitel 13 Wie funktioniert eine Sprechmaschine?
Das chinesische Zimmer
Ein-Wort-Geschichten
Worte sind Statistik
ChatBER, Ihr Touristenführer
Die schleichende Demenz von ChatGPT
Kapitel kompakt
Kapitel 14 Würde ChatGPT den Dichterfürsten verstehen?
Mehrdeutigkeit in der Kommunikation
Prompt Engineering: Wie spricht man mit einer Maschine?
Flüssige oder feste Intelligenz?
Viren oder Monster? Die Macht der Metapher
Kapitel kompakt
Kapitel 15 Was ChatGPT nicht kann
Wie intelligent ist ChatGPT?
Verstehen wir Fledermäuse?
Träumen Androiden von elektrischen Schafen?
Mehr Text! Von ChatGPT zu Multimodalität
Gedanken-Smoothies
Kapitel kompakt
Teil IV Denken auf Steroid. Wissensarbeit gestalten mit ChatGPT
Kapitel 16 Die Automation des Denkens
Von Tischlerbänken an Computerschreibtische
Die Tätigkeitsprofile der Wissensgesellschaft
Überleben in einer unsicheren Welt
Schneller, höher weiter: Wie macht ChatGPT produktiv?
Kapitel kompakt
9Kapitel 17 Werkzeuge für Wissensarbeit
Werkzeuge der Wissensarbeit
Von Technikmärchen und Technikmythen
Unser täglicher Lösungswahnsinn
Fahrradreparaturen, Badezimmer und COVID-19
Das Zeitalter der Generalisten
Kapitel kompakt
Kapitel 18 Welche Fähigkeiten braucht das 21. Jahrhundert?
Von Kompetenzen der letzten 500 Jahre …
… zu den Kompetenzen des 21. Jahrhunderts
Die Mutter aller Programmiersprachen
Pokern mit Sprache
Kapitel kompakt
Kapitel 19 Das Tätigkeitsprofil des Wissensarbeiters
Was bin ich? Drei Typen von Wissensarbeitern
Ein Fingerabdruck für Wissensarbeit
Auf dem Weg zum Kombinator
Kapitel kompakt
Kapitel 20 Wie man Wissensarbeit mit ChatGPT gestaltet
Verstehen, was man tut. Und tun, was man versteht
Wer hat das Sagen?
Kapitel kompakt
Danksagung
Anhang
Die Geschichte von ChatGPT
Wie redet man mit ChatGPT? Tipps und Kniffe zum Prompt Engineering
Fingerabdruck der Wissensarbeit
Tätigkeitsprofil der Wissensarbeit
Quellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
10Vorwort
Als ich im Mai 2018 auf dieser Bühne in Bochum stehe, ahnt niemand im Publikum, dass meine Ausführungen zur zukünftigen Rolle von Chatbots fünf Jahre später das weltweite Verständnis über Künstliche Intelligenz (KI) auf den Kopf stellen wird.
Auf einer lokalen TED-Konferenz halte ich den Vortrag „No Regrets! Chatbots will Guide You“ (dt.: Keine Reue! Chatbots werden Dich führen).1 Damals gelten intelligente Chatbots als technische Randerscheinung. Eine vage Idee, mehr Star Trek als Alltag. Meine Kernaussage lautet, dass Chatbots in Zukunft zu digitalen Gesprächspartnern avancieren würden. Sie würden uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen für kritische Situationen im Leben, wenn es keine einfachen Antworten gebe.
Damals war das eine ambitionierte Vorhersage. Betrachtet man den Stand der Technik zu dieser Zeit, zeigt sich eine durchwachsene Bilanz: Alexa, Cortana, Siri und Google Assistant sind zwar präsent, aber ihre Fähigkeiten bleiben begrenzt, der Nutzen unklar. Laut einer damaligen Studie beantwortet Google Assistant nur 75 Prozent aller Fragen, Siri schafft nicht mal ein Drittel.2 Der Kognitionswissenschaftler Kevin Murane stellt ernüchtert fest: „Diese Dinger sind meilenweit davon entfernt, intelligent zu sein.“3
Fünf Jahre später spricht davon niemand mehr: Im April 2023 stehen auf der Global TED Conference intelligente Chatbots im Mittelpunkt. Ihre Fähigkeiten ziehen sich durch die Vorträge und das Publikum in den Bann.4 Über Nacht sind meine Spekulationen eingetroffen. Tatsächlich arbeitet Google im August 2023 an Ideen, exakt die von mir skizzierten Anwendungsfälle umzusetzen.5 Aber die Entwicklung geht weit über das hinaus, was ich damals für machbar hielt. Chatbots und KI verändern unsere Kommunikation seit dem November 2022 grundsätzlicher und weitreichender als die Mehrheit der Experten vorhergesagt hatte.
Ich reihe mich mit diesem Buch nicht ein in das mittlerweile umfangreiche Arsenal an Einführungen zu ChatGPT. Wenn Sie so etwas suchen, werden Sie woanders fündig. Stattdessen greife ich meine Ideen aus dem Jahr 2018 wieder auf und nehme verschiedene Perspektiven ein in Hinblick auf ChatGPT. Ich denke sie weiter und verknüpfe alles mit der Zukunft der Wissensarbeit überhaupt. Welche Rolle werden Chatbots darin spielen?
11Wenn Sie Wissensarbeiter sind oder sich um die Zukunft der Wissensarbeit kümmern, dann lesen Sie weiter. Dieses Buch ist für Sie.Gerade dann, wenn Sie sich nicht als Experte für ChatGPT und KI verstehen. Denn ich reduziere das Komplexe auf das Notwendige, scheue mich aber nicht vor Tiefgang, wenn es für das Verständnis nötig ist. Sollten Sie sich darauf einlassen, werden Sie belohnt.
Ich habe einen Schreibstil gewählt, der Fachjargon vermeidet, wo immer es geht. Denn einfache Wortwahl verhindert nicht, komplizierte Dinge einfach auszudrücken und den Dingen auf den Grund zu gehen. Und sollten Sie in ein Thema noch tiefer einsteigen wollen, verweise ich auf viele Quellen.
Nach meinem Verständnis sind die meisten einfachen Antworten auf die Herausforderung ChatGPT meist falsch – oder zumindest unzureichend. Der Grund liegt darin, wie wir unsere gesellschaftlichen Debatten führen. Öffentliche Diskurse konzentrieren sich auf Aspekte eines Themas, die leicht zu verdauen sind und große mediale Aufmerksamkeit versprechen. Leider wird das der Komplexität von ChatGPT nicht gerecht.
Deshalb leite ich jede Überlegung genau her, lege sie mit Beispielen dar und erörtere ihre Plausibilität. Es ist mir ein Anliegen, meine Argumente und Schlussfolgerungen präzise zu belegen. Denn es hängt viel davon ab, gute Antworten auf das Phänomen ChatGPT zu finden. Für Sie und für mich. Für uns alle.
Die Einführungen, Metaphern und Analogien mögen einige Leser kurzweilig finden, andere könnten sie irritieren. Doch ich versichere, es sind erprobte Stilmittel, um komplexe Gedanken zu erfassen und sich ihrer zu erinnern. Oft hilft z. B. erst ein Blick in die Technikgeschichte der KI oder ein Verständnis über die Mächtigkeit menschlicher Sprache, um den Zeitenwechsel zu erfassen, den ChatGPT in die Geschichte der Digitalisierung eingeschrieben hat.
Im ersten Teil der Science-Fiction-Trilogie Matrix erhält der Protagonist Neo eine geheimnisvolle Aufforderung: „Folge dem weißen Kaninchen“.6 Diese Einladung bringt eine entscheidende Wende in seinem Leben. Sie eröffnet die Möglichkeit, eine trügerische Realität zu hinterfragen, und nach tieferen Wahrheiten zu suchen. Genauso wie Neo stehen Sie vor der Wahl, ob Sie meine Einladung annehmen werden. Eine Einladung, bei der Sie einige – aber nicht nur – einfache Antworten erwarten dürfen. Tatsächlich bleiben sogar viele Fragen offen. Um die Komplexität des Phänomens ChatGPT zu erfassen, hilft die Bereitschaft, zumindest für die Lektüre dieses Buches vermeintlich offensichtliche Fakten und Annahmen öfter auf den Prüfstand zu stellen. Dann eröffnen sich neue Einsichten.
Folgen Sie dem weißen Kaninchen? Noch haben Sie die Wahl.
Steinhöring, im Dezember 2023
13Prolog
Netscape: Triumph und Tragödie eines Internetpioniers
Große Ideen brauchen Menschen, die ihnen zum Durchbruch verhelfen. Für die Vision des Internets spielen zwei eine zentrale Rolle: Im Jahr 1994 trifft Jim Clark auf Marc Andreessen. Der eine ist bereits erfolgreicher Unternehmer und Gründer des Computerunternehmens Silicon Graphics. Der andere arbeitet an der University of Illinois und entwickelt einen Webbrowser. Zusammen gründen sie die Firma Netscape, um den Netscape Navigator zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser wird zum führenden Webbrowser der 1990er-Jahre und trägt maßgeblich zum Aufstieg des Internets bei. Netscape stellt den Webbrowser kostenlos zur Verfügung, um viele Menschen für das Internet zu begeistern. Rasch gewinnt der Netscape Navigator – später umbenannt in Mosaic – an Popularität und das Unternehmen erweitert das Produktportfolio. Im Jahr 1995 liegt der Anteil des Netscape-Browsers bei 90 Prozent.7 In der glorreichen Geschichte des Internet gilt Netscape heute als der Erfinder der Browsertechnologie, die der Verbreitung des Internet gegen Ende des letzten Jahrhunderts einen gewaltigen Schub verleiht. Das Internet wird zu einem Phänomen, mit dem sich erstmals Millionen von Menschen beschäftigen.
Aber was ist mit Netscape geschehen? Der Name ist heute nur noch Enthusiasten und Historikern ein Begriff. Beim rasanten Aufstieg des Internets bleibt Netscape auf der Strecke. Denn plötzlich sieht sich das Unternehmen ernsthafter Konkurrenz ausgesetzt: Microsoft schwemmt mit dem Internet Explorer den Markt, weil es ihn geschickt mit dem damals populären Betriebssystem Windows bündelt. Netscape findet keine Antwort auf diesen Vermarktungskniff. Der Marktanteil schrumpft kontinuierlich. AOL übernimmt den Internetpionier, 8 im Jahr 2004 dümpelt der Marktanteil bei fünf Prozent.9
Der Aufstieg und Fall von Netscape wirkt wie das Drehbuch für ein Wirtschaftsdrama, das sich heute wiederholen könnte. Ein anderes Unternehmen – OpenAI – wird im Dezember 2015 als gemeinnützige Organisation gegründet und gilt derzeit als Pionier für eine neue Art digitaler Assistenten.10 Der nennt sich ChatGPT und wird am 30. November 2022 kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach fünf Tagen benutzen ihn 14eine Million Menschen, drei Monate später bereits 154 Millionen. Allein im Februar 2023 verzeichnet ChatGPT eine Milliarde Zugriffe.11 Eine Umfrage von WordFinder zeigt, dass ChatGPT in den USA immer beliebter wird.12 Insbesondere die jüngere Generation nutzt es – 60 Prozent regelmäßig. Fast ein Viertel der Beschäftigten nutzt ChatGPT bereits in der Arbeit.
Aber wird OpenAI von diesem Boom profitieren? Oder droht dem Unternehmen ein ähnliches Schicksal wie Netscape in den 1990er-Jahren? Das Magazin Fortune spekuliert bereits: „OpenAI könnte eines Tages feststellen, dass sein Durchbruch, ähnlich wie die kurzlebige Herrschaft des Browsers von Netscape, eine Tür zu einer Zukunft geöffnet hat, zu der es dann nicht mehr gehört.“13
Das erste Jahr des Hypes um ChatGPT zeigt deutliche Parallelen zu Mosaic: OpenAI ist der unbestrittene Vorreiter für ein neues digitales Werkzeug. Es ist kostenlos, bringt einen großen Nutzen, und zog innerhalb weniger Tage und Wochen viele Interessenten an und die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Aber auch jetzt erkennt die Konkurrenz die Bedrohung und liefert Antworten. Denn unabhängig vom Erfolg von OpenAI: ChatGPT steht nur pars pro toto für eine neuartige Qualität der Interaktion zwischen Mensch und Maschine, die natürlichsprachliche Interaktion. ChatGPT markiert den Beginn von etwas völlig Neuem. Auch hierfür liefert die Computergeschichte ein Beispiel.
Die unsichtbare Hand des Rechnens
ChatGPT könnte für das Schreiben von Texten ein ähnliches Erdbeben auslösen wie das Erscheinen der Tabellenkalkulation VisiCalc im Jahr 1979 für den Umgang mit Geschäftszahlen.14, 15 Denn VisiCalc verändert die Art und Weise, wie Individuen und Unternehmen damit arbeiten. Vorher kritzeln die Menschen Zahlen auf Papier. Jede Rechenformel wird neu geschrieben. Änderungen an einer Stelle ziehen zwangsläufig an anderer Stelle unzählige Korrekturen und Überprüfungen nach sich. Eine komplexe Analyse geschieht Formel für Formel, Zahl für Zahl. Das ist quälend langweilig. Man benötigt sehr viel Zeit, regelmäßig schleichen sich Fehler ein. Komplexe Kalkulationen dauern so lange, dass sie in vielen Fällen gar nicht den Aufwand rechtfertigen,
VisiCalc ändert alles. Es führt das unbekannte Konzept „Tabellenkalkulation“ ein (Abbildung 1). Auf einen Schlag können Zahlen schnell, genau und flexibel erstellt, bearbeitet und manipuliert werden: Benutzer ändern eine einzelne Zelle – und sehen prompt an vielen anderen Stellen die Auswirkung. Für den Ökonomen Adam Smith steuerte die „unsichtbare Hand“ den Wettbewerb des Marktes – Angebot und Nachfrage synchronisieren sich augenblicklich.16 Mit VisiCalc zieht in die Geschäftswelt die „unsichtbare Hand des Rechnens“ ein.
Viele Menschen verwenden heute Tabellenkalkulation nur als überdimensionierten Taschenrechner. Er addiert lange Zahlenreihen. Aber für alle, die sich das Wesen der Tabellenkalkulation erschlossen haben, hat sich ihre Arbeit dramatisch geändert. In 15nur einer Tabelle verzahnt sich ein komplexer Prozess über eine Reihe mathematischer Operationen: An einer Stelle tippen wir Zahlen in die Gitterstruktur, an einer anderen stehen in derselben Sekunde bereits Resultate. Einmal erstellt, lassen sich mit jedem Modell problemlos Alternativen testen: Was passiert, wenn ich eine dritte Schicht in der Produktion hinzufüge? Was, wenn ich die Rabatte für Vorprodukte drücke? Werden mögliche Gewinne die Kosten decken, wenn ich die Gehälter erhöhe? Vor VisiCalc brauchte man Intuition und Fingerspitzengefühl, um zu erahnen, wo Risiken lauern oder Chancen liegen. Die Tabellenkalkulation liefert unmittelbare Antworten. Man probiert einfach alles aus.
Diese unfassbare Flexibilität und Geschwindigkeit bedeuteten den Durchbruch für Effektivität und Effizienz. Einige schätzen, dass die Produktivität um wenige Prozent gesteigert wurde,17 andere spekulieren sogar auf einen Faktor 80 (sic!).18 Aber VisiCalc hat noch weitreichendere Konsequenzen.
Abbildung 1: Bildschirmausschnitt von VisiCalc auf einem Apple II Computer
Als um etwa dieselbe Zeit wie VisiCalc der Personalcomputer erscheint, betrachten ihn Experten als Spielzeug für Enthusiasten und Hobbyisten. Ausgestattet mit einer Tabellenkalkulation wird er aber zu einem leistungsstarken Werkzeug für jede Art von Zahlenarbeit. VisiCalc gilt als trojanisches Pferd, das dem Personalcomputer das Tor in die Geschäftswelt öffnete.19 Es entsteht der neue Markt von Software für Geschäftszwecke. Das Zeitalter der Personalcomputer beginnt. Die Tabellenkalkulation begründet eine Softwareindustrie, die über Produkte und Dienste für Großrechner hinausreicht. VisiCalc offenbarte eine Nachfrage für Angebote, die echte Probleme lösen konnten. Der Einfluss von VisiCalc auf die Softwareindustrie und die Geschäftswelt ist unermesslich. Die Tabellenkalkulation ist der Urahn auf dem Weg in die digitale Welt.
16Ist das Erscheinen von ChatGPT am 30. November 2022 gleichzusetzen mit der Veröffentlichung von VisiCalc am 19. Oktober 1979? Es finden sich einige Parallelen zwischen dem Aufstieg der Tabellenkalkulation und dem Chatbot ChatGPT. Allerdings beginnt die Geschichte von OpenAI gerade erst. Wir wissen heute nicht, wann und wie sie einmal ausgeschrieben sein wird. Deshalb belassen wir es bei dieser Spekulation, behalten aber – während wir die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen – eine Daumenregel des Politikwissenschaftlers Michael Blume im Hinterkopf: „Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.“20
Der Geburtstag Künstlicher Intelligenz
Als die Software VisiCalc erscheint, ist der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) bereits 25 Jahre alt. Erfunden wird er im Sommer 1956 auf einer Konferenz von Mathematikern und Computerwissenschaftlern.21 Theoretische Konzepte dazu sind seit den 1940er-Jahren bekannt wie beispielsweise die erste Simulation eines Gehirnneurons.22 Nun will man Maschinen bauen, die menschliche Intelligenz nachahmen und übertreffen. Aber die Technik der 1950er ist nicht so weit. Nichts von dem, was sich die Forscher theoretisch ausdenken, lässt sich in die Praxis umsetzen und prüfen. Und für das, was bereits möglich ist, gibt es keinen praktischen Nutzen. Daran ändert sich nichts über Jahrzehnte. Trotz stetiger Fortschritte in der Computertechnologie bleibt KI eine kleine Sparte von Enthusiasten. Die Beschränkungen der Hardware, einschließlich begrenzter Speicher und langsamer Prozessoren, stellen unüberwindbare Hindernisse dar.
In den 1980er-Jahren beginnt ein Paradigmenwechsel. Mit dem Aufkommen von Expertensystemen, die menschliches Fachwissen in spezifischen Bereichen nachahmen, sieht die Welt die ersten praktischen Anwendungen von KI.23 Die Systeme bleiben aber in ihrer Intelligenz begrenzt und sind weit davon entfernt, die Art von KI zu repräsentieren, die Forscher vorhergesagt hatten. Aber sie zeigen prototypisch, dass KI einen praktischen Nutzen haben könnte. Trotzdem erweisen sich Expertensysteme als Sackgasse. Ein Durchbruch bleibt aus, die KI verharrt in ihrer Nische.
Nach der Jahrtausendwende nimmt die KI-Forschung wieder Schwung auf. Die heutigen Anwendungen in der Chatbot-Technologie basieren auf wissenschaftlichen Vorarbeiten, die sich erst vor wenigen Jahren manifestieren. Ein Konferenzbeitrag aus dem Jahr 2017 markiert den Beginn einer dynamischen Weiterentwicklung.24 Der Durchbruch besteht darin, dass es möglich wird, komplexe Muster in großen Datenmengen zu erkennen und zu analysieren. Damit erschließen sich neue Anwendungsgebiete wie autonome Fahrzeuge,25 oder neue Formen der Organisation von Wissen wie das Tagging (dt.: Verschlagwortung).26
KI sehen ist nicht dasselbe wie KI verstehen
Der Astronaut Jean-Francois Clervoy27 wurde einmal gefragt: „Was war das Überraschendste, was sie bei Ihrem ersten Raumflug erlebten, auf das sie trotz jahrelangen Trainings nicht vorbereitet waren?“ Seine Antwort: Die einer Bombe ähnliche Detonation 17der Triebwerke beim Start des Space Shuttle. Den Raketenstart zu erleben, scheint für Astronauten zu einem der eindrücklichsten Erlebnisse des gesamten Raumflugs zu gehören. Mit der Zündung der Triebwerke bricht 50 Meter unter ihnen die Hölle los.28 Die Rakete beschleunigt auf mehrfache Schallgeschwindigkeit, dreifaches Körpergewicht drückt die Astronauten in die Pilotensitze, um dann unvermittelt ins Gegenteil umzuschlagen: Sie entfliehen der Anziehungskraft der Erde und entschweben in dauerhafte Schwerelosigkeit.
Das führt zu dramatischen, körperlichen Veränderungen. Astronauten müssen beispielsweise lernen, sich in einer Umgebung ohne Schwerkraft zu bewegen. Treten auf der Stelle wie im Wasser funktioniert nicht. Sie brauchen Wände, Decken und Böden, um sich durch Abstoß und Aufprall gezielt zu bewegen. Die Anpassung an diese Art der Fortbewegung nimmt Zeit in Anspruch. Fehlende Schwerkraft macht es schwierig, sich zu orientieren und zwischen oben und unten zu unterscheiden. Das Verarbeiten räumlicher Information und die Koordination von Bewegungen sind beeinträchtigt, bis sich Astronauten daran gewöhnt haben. Denn ihr Gleichgewichtssinn muss sich anpassen. Im Innenohr des Menschen befindet sich das Vestibularsystem. Es ist für Gleichgewicht und die Orientierung im Raum zuständig. In der Schwerelosigkeit erhält diese Information, die nicht mehr wie üblich verfügbar oder sogar widersprüchlich ist. Das kann zu Schwindel, Übelkeit und Orientierungslosigkeit führen. Aber es geht noch weiter: Flüssigkeiten verteilen sich in der Schwerelosigkeit anders im Körper, denn die Schwerkraft zieht nicht mehr nach unten. Das führt zu großen Mengen in Kopf und Oberkörper. Gesichter schwellen an, Nasen sind eher verstopft und der Augeninnendruck steigt. Längerfristig erleben Astronauten weitere Effekte: Ohne Schwerkraft, die auf den Körper wirkt, verlieren die Muskeln und Knochen an Masse. Denn sie werden weniger beansprucht. Darum trainieren Astronauten regelmäßig, um diesen Veränderungen entgegenzuwirken und die körperliche Gesundheit während des Raumflugs zu erhalten.
Warum erzähle ich das alles?
Mit ChatGPT erleben nun Millionen von Menschen etwas Ähnliches. Die meisten von ihnen haben in den letzten Jahren von Künstlicher Intelligenz gehört oder gelesen. Tatsächlich sind wir alle schon von KI betroffen. Denn viele Internetdienste nutzen KI unentwegt: Google Maps29, WhatsApp30 oder Amazon31. Aber den wenigsten Menschen ist bewusst, wie unmittelbar KI ihren Tagesablauf und ihre Dialoge prägt. Die Unternehmensberatung Gartner Group präsentierte bereits im Jahr 2016 die These, im Jahr 2020 würden 85 Prozent aller Kundengespräche mit Chatbots geführt. Durchschnittlich würden dann die meisten Ehepaare mehr Gespräche mit Chatbots führen als mit ihren Ehepartnern.32 Trotzdem blieb das Phänomen KI bisher für die meisten seltsam entrückt und abstrakt. Es ist mental schwer fassbar, existiert lediglich als vage Idee. Eine Sache von und für Experten.
18Denn um eine neue Technik tatsächlich zu verstehen, muss man sie erleben. Wie fühlt sich ein Smartphone an, das zum ersten Mal in der Hand liegt? Was denkt der, der zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt und damit in eine fremde Welt eintaucht?33 Was geht jemandem durch den Kopf, der sich zum ersten Mal in ein Roboterauto setzt, in dem der Lenker fehlt?34 Vor jedem dieser Erstmomente gibt es eine Vorstellung davon, was eine bahnbrechende Technologie bedeuten könnte. Aber erst das persönliche Erlebnis machen daraus eine tiefgreifende Erfahrung und langanhaltende Erinnerung.
Jede neue Technologie braucht Zeit, um eine große Zahl von Menschen zu erreichen und akzeptiert zu werden. Sie muss ihren Platz im Alltag der Gesellschaft erst finden. Denn niemand hat auf etwas gewartet, was bis dahin nicht vorstellbar erschien. Dieser Prozess der Aneignung entsteht, wenn Menschen eine Technologie nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern sie selbst aktiv erfahren. Mit ihren eigenen Sinnen registrieren und verstehen sie, wie eine Technologie funktioniert, was sie tatsächlich im Alltag bedeuten würde. Erst dann ist eine Technologie „angekommen“ und ist auf dem Weg zur neuen Normalität.
Für die Technik der KI befindet sich die Menschheit gerade mittendrin in diesem Prozess: ChatGPT ist ein Instrument, das Millionen Menschen diesen einmaligen, ersten Moment beschert. Zum ersten Mal erleben sie, was die bewusste, persönliche Konfrontation mit einer radikal neuen Technik mit ihnen macht. Zum ersten Mal denken sie darüber nach, was ChatGPT eigentlichbedeutet.
Mein erster dokumentierter Moment mit ChatGPT datiert zurück auf den 27. Dezember 2022, knapp dreieinhalb Wochen nach dessen Erscheinen. Seitdem ist nichts mehr wie vorher. Denn ich nutze ChatGPT mittlerweile täglich. Es hat die meisten meiner alltäglichen Tätigkeiten rund um Wissensarbeit auf den Kopf gestellt. Ich bin fasziniert, wie sich in kürzester Zeit mein Vorgehen verändert hat, einen neuen Gedanken zu spinnen, die Gliederung dieses Buch zu konzipieren, sich Einleitungen oder Übergänge auszudenken, oder den Text zu paraphrasieren und zu redigieren. Noch lote ich – wie die meisten von uns – die Grenzen und Möglichkeiten von ChatGPT aus.35 Aber ich bin überzeugt, dass ChatGPT und ähnliche Werkzeuge die Art und Weise, wie wir denken und unsere Gedanken zu Papier bringen, grundlegend verändern werden. Denn diese Werkzeuge bieten nicht nur eine Fülle von Daten, Information und Wissen, sondern auch immer präzisere Möglichkeiten, dem Ideengeber eines Textes dabei zu helfen, seine Themen in Worte zu fassen.
Die Verwendung von ChatGPT wirft natürlich Fragen auf zur Urheberschaft. Wer ist der Autor eines Textes, der mithilfe von ChatGPT erstellt wurde? Ist es der Mensch, der die Themen und Ideen vorgibt, oder die Maschine, die die Worte und Sätze paraphrasiert? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, und sie werden zukünftig viele Diskussionen bestimmen. Dennoch gibt es keinen Anlass, dass wir uns vor dem Verwenden von KI wie ChatGPT fürchten sollten. Es sind nach meiner bisherigen Erfahrung 19Werkzeuge, die unsere Arbeit effizienter gestalten werden und die eigenen kreativen Fähigkeiten besser auszuschöpfen. ChatGPT wird viele Berufsprofile verändern.
Kapitel kompakt
Netscape ermöglicht mit einem kostenlosen Webbrowser in den 1990ern zum ersten Mal einen einfachen Zugriff auf die Internetwelt. Trotz großer Popularität und anfänglichem Erfolg verliert das Unternehmen durch den Aufstieg des Internet Explorers von Microsoft den Anschluss und verschwindet nach der Übernahme durch AOL vollständig vom Markt.Die Tabellenkalkulation VisiCalc revolutioniert das Arbeiten mit Zahlen und Daten. Es macht komplexe Berechnungen einfach und flexibel, steigert die Produktivität enorm und verhilft dem Personalcomputer zum Durchbruch.Die Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz (KI) liegt im Sommer 1956. Trotz theoretischer Konzepte scheitert die Umsetzung an den Grenzen der damaligen Technik. Nach der Jahrtausendwende gewinnt die KI-Forschung an Fahrt. Das Erkennen komplexer Muster in großen Datenmengen erschließt neue Anwendungsbereiche wie Roboterautos.Das Verständnis von KI bleibt trotz aller Lektüre und Kenntnisse abstrakt. Erst die persönliche Erfahrung ändert das. Mit ChatGPT erleben zum ersten Mal Millionen von Menschen bewusst diesen ersten Moment mit KI.21TEIL I Wie ChatGPT die Wissensarbeit durchrüttelt
23KAPITEL 1 Das Medium ist die Botschaft: ChatGPT für Autoren und Journalisten
„Du bist nur ein Soldat, wenn du im Kampf gewesen bist;du bist nur ein Händler, wenn du Geld verloren hast; du bist nur ein Unternehmer, wenn du gescheitert bist;und du bist nur ein Autor, wenn du plagiiert wurdest.“– Nassim Taleb
Eine Nachricht mit dem Vorschlaghammer
Der Medientheoretiker Marshal McLuhan gilt als Wegbereiter für das Verständnis der Funktion von Kommunikation durch Medien. Seine Medientheorie gipfelt in der der These „The Medium is the Message“ (dt.: Das Medium ist die Botschaft).36 Sie besagt, dass das Medium, durch das eine Botschaft übermittelt wird, wichtiger ist als der Inhalt der Botschaft selbst. Mit anderen Worten: Wie eine Information kommuniziert wird, kann die Wahrnehmung und Interpretation der Information stärker prägen als ihr Inhalt.
Im November 2019 stellt Tesla den Cybertruck vor, die futuristische Variante eines neuen Elektrofahrzeugs.37 Die Präsentation eines elektrischen Pickup-Trucks ist bedeutend für das Unternehmen. Wie sie abläuft, hat großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung. Firmenchef Elon Musk demonstriert die Robustheit des Cybertruck. Mit einem Vorschlaghammer trümmert sein Kollege gegen die Fahrertür. Die zeigt sich unbeeindruckt und bleibt unbeschädigt.38 Dann wirft er eine schwere Metallkugel auf die vermeintlich bruchsichere Autoscheibe. Zu Musks Überraschung hält die zwar stand, aber der Aufprall hinterlässt ein tiefes Rissmuster.39 Dieses Missgeschick zieht mediale Aufmerksamkeit auf sich. Die Aufzeichnung geht viral und führt zu einer Flut von Memen und Diskussionen in Medien.
Dieses Beispiel verdeutlicht die Bedeutung des Mediums für eine Botschaft: Eine spektakuläre Live-Präsentation, die schief geht, erregt mindestens so viel Aufmerksamkeit wie der Inhalt selbst. Die Art und Weise, wie man ein neues Autos ankündigt, beeinflusst die Wahrnehmung und Interpretation der Produktdemonstration hier mehr als die Botschaft. McLuhan argumentiert, dass jedes Medium eine spezifische Art und 24Weise habe, wie es Information darstellt und kommuniziert. So hat etwa das Fernsehen eine andere Art, Information zu präsentieren, als ein Buch oder das Radio. Das Medium selbst ist nicht lediglich das Transportmittel für eine Botschaft, sondern beeinflusst deren Wahrnehmung und Interpretation auf tiefgreifende Weise. Diese These legt nahe, dass wir nicht nur den Inhalt, sondern auch das Medium selbst, durch das Information übermittelt wird, kritisch betrachten müssen. ChatGPT ist ein sehr gutes Beispiel, um McLuhans Einsichten in die Kommunikation am Beispiel von Textmedien zu erklären: Es erzeugt Botschaften – und übermittelt sie gleichzeitig auch noch selbst.
Zunächst einmal verändert ChatGPT die Wahrnehmung von Information. Denn sie wird nicht einfach auf einen Schlag übermittelt, sondern entfaltet sich in einem natürlichsprachlichen Dialog zwischen Mensch und Maschine. Anstatt Information aus Büchern oder Artikeln aufzunehmen, stellen Benutzer Rückfragen und erhalten Antworten, die ihre spezifischen Bedürfnisse ansprechen. Das Medium des Chatbots beeinflusst, wie Information überhaupt weitergegeben wird, und in welche Richtung sich der Dialog entwickelt, während er sich über die Zeit entfaltet.
Aber der Chatbot verändert nicht nur, wie ein Benutzer Information aufnimmt. Es stellt sich die Frage nach der Urheberschaft des Textes. Denn je nach Einschätzung hegen Benutzer mehr oder weniger Vertrauen in eine Antwort. Diese Unsicherheit kann zu einer veränderten Einschätzung von Autorität und Zuverlässigkeit führen, die durch ChatGPT vermittelt wird.
Abhängig von den Vorkenntnissen eines Benutzers variiert das Vertrauen in die bereitgestellten Antworten: Vertraut er dem Chatbot? Dann sieht er die Information als glaubwürdig und nützlich an. Oder bringt er den Antworten generell Skepsis entgegen oder kann als Experte gar die Richtigkeit und Relevanz der Antworten bewerten? Für den Theoretiker McLuhan macht ChatGPT etwas, das selbst der Visionär Mitte der 1960er-Jahre nicht vorhergesehen hat: Die Botschaft wird ohne menschliches Zutun zusammengestellt. Das Medium ist sowohl Erzeuger wie auch Überbringer seiner Botschaft. Es schreibt die Botschaften selbst. Gut dokumentierte Beispiele zeigen, wie diese Tatsache die Wahrnehmung eines Textes verändert.
Hast Du Angst?
Im September 2020 macht die englische Zeitung The Guardian mit einer irritierenden Schlagzeile auf: „A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?” (dt.: Ein Roboter hat den ganzen Artikel geschrieben. Mensch, hast Du jetzt Angst?).40 Vermeintlich demonstriere dieser Artikel die Leistungsfähigkeit von KI für das maschinelle Erstellen von Texten. Der verantwortliche Redakteur stellt fest, der Text sei von einem Roboter geschrieben worden (er heißt GPT-3 und ist eine Vorgängerversion von ChatGPT).
Die Veröffentlichung erregt mediale Aufmerksamkeit, weil sie als Menetekel auf eine unangenehme Zukunft des Journalismus hindeutet: KI erfüllt Aufgaben, die menschlichen Journalisten und Redakteuren vorbehalten sind. Es entsteht der Eindruck, hier 25sei eine Maschine in der Lage, komplexe und für den Leser ansprechende Texte ohne menschliche Beteiligung zu erzeugen. Viele Reaktionen auf den Artikel teilen die Besorgnis, dass nun die Arbeitsplätze der schreibenden Berufe gefährdet seien. Andere argumentieren, dass dies Chancen für mehr Effizienz und Kreativität eröffne.
Dieser Diskurs entwickelt sich, weil die meisten Diskutanten ein wichtiges Detail übersehen: Der Blick ins Kleingedruckte des Artikels zeigt, dass der künstlich erstellte Text tatsächlich gar nicht vollständig von KI erzeugt wurde. Der Verantwortliche für den Artikel räumt ein, dass es insgesamt acht Anläufe bedurfte, um das Resultat zu produzieren. Außerdem stellt er klar, dass der Text nicht etwa in einem Schwung erstellt, sondern von ihm selbst aus prägnanten Versatzstücken zusammengestellt worden sei. Seine Argumentation dafür ist problematisch: „GPT-3 hat acht verschiedene Ausgaben oder Essays produziert. Jede war einzigartig, interessant und hat ein unterschiedliches Argument vorgebracht. The Guardian hätte einfach einen der Essays in voller Länge veröffentlichen können. Stattdessen haben wir uns jedoch dafür entschieden, die besten Teile aus jedem zu wählen, um die verschiedenen Stile der künstlichen Intelligenz einzufangen.“41Wir werden in Teil III darauf eingehen, warum dieses Vorgehen kein Lapsus ist, sondern einen großen Unterschied macht für die angebliche oder tatsächliche Fähigkeit einer schreibenden KI.
Zumindest Marshal McLuhan hätte seine Freude gehabt, denn seine zentrale These wird bestätigt: GPT-3 ist die Botschaft. Anstatt über die Möglichkeiten und Grenzen von KI zu sprechen, lamentierten Journalisten und Leser nach dieser Veröffentlichung über das Ende der schreibenden Zunft. Der Text bediente ihre Ängste und wurde zur Projektionsfläche eigener Befindlichkeiten. Leider verdrängt dieser eingeengte Blick viele wichtige Fragen nach den Chancen, Möglichkeiten und Risiken einer solchen KI.
Kreatives Schreiben
Denn natürlich ist diese Entlarvung von GPT-3 kein Freibrief für schreibende Berufe. ChatGPT wird das Arbeitsfeld der schreiben Berufe drastisch verändern. Das wird offensichtlich, wenn man sich die typischen Phasen eines Schreibprozesses genau anschaut. Ob fiktionaler oder nicht-fiktionaler Text, jeder Autor durchläuft mehrere Phasen, um seinen Text anzufertigen. Die Anzahl variiert je nach Genre (Zeitungs- oder Blog-Artikel, Drehbuch, Sachbuch oder Belletristik) und Arbeitsweise.42, 43 Das generelle Vorgehen aber bleibt identisch.
1. In der ersten Phase legt der Autor das Fundament für einen Text. Es ist wichtig, ein Thema zu durchdenken und eine Idee zuzuspitzen. Dafür sind Recherchen nötig und Material muss gesammelt und sortiert werden. Der Autor entwickelt eine Vorstellung davon, wie der Text aufgebaut sein wird. Er muss sich Gedanken machen, welche Zielgruppe er anspricht, oder welche Stimmung sein Stück vermitteln soll. Sorgfältige Vorbereitung und Planung sind zwingend, um einen Text zu schreiben, der lesenswert ist und trotzdem verständlich bleibt.
2.26In der nächsten Phase geht es darum, den Text als Gedankengebäude auf das Papier zu werfen. Der eigentliche Schreibprozess beginnt, der Autor bemüht und quält sich durchaus, seine Ideen präzise auszudrücken. Der Text muss ständig überarbeitet und korrigiert werden, während er seiner Fertigstellung entgegenwächst. Der Autor muss darauf achten, dass der Text stimmig bleibt, und die richtige Tonalität trifft, um Leser zu fesseln. Oft wird diese Phase auch von Schreibblockaden begleitet, die es zu überwinden gilt.44
3. In der dritten Phase liest der Autor den Text erneut und überarbeitet ihn. Er korrigiert Rechtschreib-, Grammatik- und Stilfehler. Er passt Inhalt und Struktur an, um Verständlichkeit sicherzustellen. Es braucht eine schlüssige Argumentation und begründete Aussagen im Text – ob frei erfunden oder durch Fakten unterfüttert. Diese Phase erfordert Geduld und Ausdauer.
4. In der letzten Phase geht es darum, den Text zu polieren. Der Schreiber stellt sicher, dass sein Resultat den Qualitätsansprüchen genügt, um abgegeben und veröffentlicht zu werden. Dafür zieht er auch andere Personen zu Rate. Sie lesen und prüfen, üben Kritik, geben Vorschläge und Hinweise. Der Fokus liegt nun auf dem Verbessern des Textes und dem Anpassen an die Bedürfnisse der Leser. Der Autor achtet auf stilistische Feinheiten und stellt sicher, dass der Text sich flüssig liest und verständlich bleibt.
Diese vier Phasen laufen nicht zwingend hintereinander ab. Meist springt der Autor hin und her. Aber generell skizzieren sie den Zyklus für das Entstehen eines Textes vom Anfang bis zum Ende. Der geübte Einsatz von ChatGPT kann in jeder dieser Phasen auf zwei Arten helfen: Entweder beschleunigt es den Prozess, ohne dass die Qualität leidet, oder es erhöht die Qualität der Ergebnisse – zum Teil dramatisch:
1. Zuerst sammelt der Autor Ideen und plant und entwickelt eine Struktur für seinen Text. Der Dialog mit ChatGPT hilft, aus einer Vielzahl von Vorschlägen konkrete Themen, Handlungsstränge oder Kapitelstrukturen herauszufiltern. Der Autor wählt aus, was seiner Intuition am nächsten kommt, seine Erfahrung einbezieht, ihn und seine Expertise und seine bisherigen Ideen besonders anspricht. Hier agiert der Autor oft als Kurator von vielen Ideen, aus denen er selbst die besten auswählen muss. ChatGPT spielt eine Rolle als Ideen- und Kreativitätscoach.45
2. Durch das Schreiben setzt der Autor seine ungeschliffenen Ideen in lesbaren Text um. ChatGPT schlägt alternative Worte oder Phrasen vor, verbessert den Schreibstil oder weist auf Rechtschreib- und Grammatikfehler hin. Durch die Zusammenarbeit mit ChatGPT beschleunigt sich der Schreibprozess. ChatGPT hilft, Gedankengänge zu strukturieren, logische Zusammenhänge herauszuarbeiten oder inspirierende Beispiele und Details zu ergänzen. Es weist auf Wiederholungen hin oder zeigt, wie kohärente Phrasen aussehen könnten, die eine gewünschte Wirkung entfalten.
3.27Nach dem Schreiben beginnt das Überarbeiten. Der Autor tritt einen Schritt zurück, betrachtet seinen Text kritisch und merzt Schwächen aus. ChatGPT hilft dabei, liefert Feedback und Vorschläge für Verbesserungen. Der Autor analysiert mithilfe von ChatGPT den Text genau und findet Verbesserungen für Handlung, Charakterentwicklung oder andere Aspekte. In dieser Phase agiert ChatGPT überwiegend als Korrektor. Es unterbreitet Vorschläge, aber Entscheidungen in Bezug auf Wortwahl, Stil und Inhalt liegen in der Hand des Schreibenden.
4. Schließlich überprüft der Autor den Text auf grammatikalische Fehler und verbessert den Lesefluss. Er führt mit ChatGPT eine Stilanalyse durch und erkennt Schwächen in der Struktur oder im Lesefluss seines Textes. ChatGPT agiert typischerweise in der Rolle eines Lektors.46, 47
ChatGPT unterstützt in jeder Phase des Schreibprozesses. Der kluge Einsatz beschleunigt den Schreibprozess nicht nur marginal, sondern führt zu dramatisch besseren Texten.





























