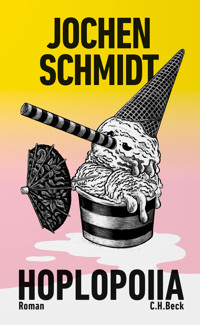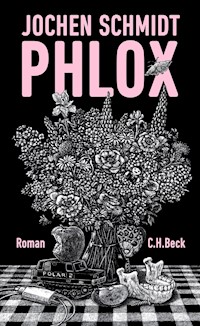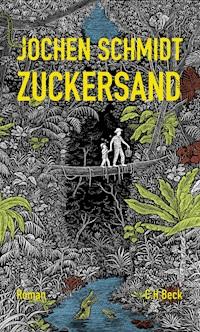9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zwei Deutschlands und zwei Jungen, fast zeitgleich geboren, nur nicht im selben Staat. Der eine wächst im Westen auf, unweit der Bundeshauptstadt Bonn, der andere im Osten: in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Sie spielen in der Wohnung, im Garten, zwischen Plattenbauten oder auf Baustellen und warten darauf, dass endlich das Fernsehprogramm beginnt. Sie fahren Rad mit Freunden, klauen ihren Geschwistern Süßigkeiten und streiten sich mit ihnen auf der Rückbank des Familienautos um den besten Platz. Sie träumen von der Fußballnationalmannschaft, üben wieder nicht Klavier und hören in der Schule, «"drüben» sei die Welt schlechter. Zwei der erstaunlichsten Schriftsteller ihrer Generation erzählen von der Kindheit: Jochen Schmidt, Jahrgang 1970, lebte in einem Neubaugebiet in Ost-Berlin, David Wagner, Jahrgang 1971, in einem Einfamilienhaus am Rhein. Von Kindheitsraum zu Kindheitsraum – Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Spielplatz, Viertel, Schule, bei Freunden, in den Ferien – durchmessen die beiden Meister der literarischen Alltagsbeobachtung ihre Vergangenheit. In unnachahmlich präzisen, aufeinander zu geschriebenen Erzählungen zeigen sie, was die eigene Kindheit links oder rechts der innerdeutschen Grenze ausgemacht hat: Alles war politisch, aber was weiß ein Kind davon. So entsteht das deutsch-deutsche Panorama zweier Kindheiten, die sich voneinander unterscheiden und doch auch wieder nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jochen Schmidt • David Wagner
Drüben und drüben
Zwei deutsche Kindheiten
Über dieses Buch
Zwei Deutschlands und zwei Jungen, fast zeitgleich geboren, nur nicht im selben Staat. Der eine wächst im Westen auf, unweit der Bundeshauptstadt Bonn, der andere im Osten: in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Sie spielen in der Wohnung, im Garten, zwischen Plattenbauten oder auf Baustellen und warten darauf, dass endlich das Fernsehprogramm beginnt. Sie fahren Rad mit Freunden, klauen ihren Geschwistern Süßigkeiten und streiten sich mit ihnen auf der Rückbank des Familienautos um den besten Platz. Sie träumen von der Fußballnationalmannschaft, üben wieder nicht Klavier und hören in der Schule, «„drüben» sei die Welt schlechter.
Zwei der erstaunlichsten Schriftsteller ihrer Generation erzählen von der Kindheit: Jochen Schmidt, Jahrgang 1970, lebte in einem Neubaugebiet in Ost-Berlin, David Wagner, Jahrgang 1971, in einem Einfamilienhaus am Rhein. Von Kindheitsraum zu Kindheitsraum – Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Spielplatz, Viertel, Schule, bei Freunden, in den Ferien – durchmessen die beiden Meister der literarischen Alltagsbeobachtung ihre Vergangenheit. In unnachahmlich präzisen, aufeinander zu geschriebenen Erzählungen zeigen sie, was die eigene Kindheit links oder rechts der innerdeutschen Grenze ausgemacht hat: Alles war politisch, aber was weiß ein Kind davon. So entsteht das deutsch-deutsche Panorama zweier Kindheiten, die sich voneinander unterscheiden und doch auch wieder nicht.
Vita
Jochen Schmidt, 1970 in Ost-Berlin geboren, veröffentlichte die Romane «Müller haut uns raus» und «Schneckenmühle» sowie die Erzählbände «Triumphgemüse» und «Meine wichtigsten Körperfunktionen». Außerdem erschienen von ihm die Bücher «Schmidt liest Proust», «Dudenbrooks» und «Schmythologie». Jede Woche liest er in der von ihm mitgegründeten Berliner Lesebühne «Chaussee der Enthusiasten». Jochen Schmidt lebt in Berlin.
David Wagner, 1971 in Andernach am Rhein geboren, veröffentlichte die Romane «Meine nachtblaue Hose» und «Vier Äpfel» sowie den Erzählungsband «Was alles fehlt», das Prosabuch «Spricht das Kind» sowie die Essaysammlungen «Welche Farbe hat Berlin» und «Mauer Park». Für sein Buch «Leben» wurde ihm 2013 der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. David Wagner lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Friedrich Kayser/plainpicture; Sewcz/akg-images
ISBN 978-3-644-04261-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Jochen SchmidtDrüben und drüben
Kinderzimmer
Morgens musste erst mein Bett hochgeklappt werden, bevor man im engen Kinderzimmer zum Fenster durchkam und die Vorhänge aufziehen konnte, sodass der Blick auf den von vier baugleichen, fünfgeschossigen Neubaublöcken gebildeten Innenhof fiel, mit Rasen, Sträuchern, Silberpappeln (die wuchsen am schnellsten), Sandkasten (dafür war ich schon zu alt) und dem eingezäunten Asphaltfußballplatz (meinem Lebensmittelpunkt). Ich hatte keine Lust auf diese Arbeit, jede nicht dem Spiel dienende Tätigkeit kostete mich Überwindung. «Das ist doch nur ein Handgriff!», sagte meine Mutter und machte es selbst, weil sie nicht die Geduld hatte, auf die Einsicht oder die nötige Reife ihrer Kinder zu warten. Man konnte das Bettzeug vorher mit einem Gurt festschnallen, aber ich drückte, wenn ich das Bett doch einmal selbst machte, einfach so fest dagegen, dass es irgendwie zuging. James Bond war einmal in so einem Wandbett hochgeklappt und durchs Bettgestell erschossen worden, aber es war dann nur ein Doppelgänger gewesen.
Ein grüner Vorhang verschönerte die Rückseite des Betts. Die Nägel, mit denen die Gardinenstange an der Presspappe befestigt war, fielen allerdings heraus, weshalb ein Ende der Stange nach unten hing und die Rädchen der Gardinenklammern abrutschten. Ich schlug mit der schmalen Seite des Hammers neue Nägel ein, aber von unten nach oben ließen sie sich nur schwer durchs glatte Furnier treiben, ohne zu verbiegen. Bei uns war immer etwas kaputt, und wir waren an die provisorischen Reparaturlösungen meines Vaters gewöhnt. Beim Wartburg war die Lenkradschaltung abgebrochen und durch eine Kugelschreiberhülse ersetzt worden. Die Teppichkante vor der Küchentür franste aus und bog sich nach oben: Wir besaßen eine Rolle rotes Teppichband aus dem Intershop, mit dem wir sie aber nur ungefähr einmal im Jahr abklebten, damit die Rolle länger reichte. Die Play-Taste des flachen Kassettenrekorders rastete nicht mehr ein, man musste sie mit einem Radiergummi unten halten, über den ein Einweckring gespannt war. Ich wollte immer wissen, was im Rekorder vor sich ging, aber es war wie verhext: Wie beim Kühlschrank passierte das Entscheidende erst, wenn die Klappe sich schloss.
Das Viertel war auf Feldern errichtet worden, am Anfang hatten wir begeistert im Baustellenschlamm gespielt und waren auf Kabeltrommeln balanciert. Die Baumaßnahmen hatten die Natur nur kurzzeitig zurückdrängen können. Mäuse kletterten durch die Abzugsschächte in die Küchen, oder sie kamen in den Spalten zwischen den Plattenbauelementen die Wände hoch. (Mein Vater erschlug mit der Faust einmal eine, sie hatte an der Wand gesessen und ihm beim Brotschneiden zugesehen. Als Vater musste man so etwas tun.) Motten fraßen den Filz von den Klavierhämmerchen, auf dem Balkon nisteten Schwalben. Unterm Fensterbrett im Kinderzimmer drang bei starkem Regen das Wasser durch, die Tapete löste sich. An der Decke vom Wohnzimmer störte ein nasser Fleck, die Stelle dichtete mein Vater mit Alufolie ab. Nach dem Regen lagen Hunderte verendete Regenwürmer auf den Asphaltwegen. Mit dem Kaufhallenmehl brachte man kleine schwarze Käfer nach Hause, die einmal im Jahr die Wohnung bevölkerten. Zu Weihnachten, wenn die Baumkugeln ausgepackt wurden, fanden wir sie tot in ihrem gläsernen Sarg.
Die Fenster standen in Sommernächten offen, und der Geruch der nahen Rieselfelder, wo die Abwässer Berlins in den Boden sickerten, erfüllte das Zimmer, tagelang hing er über dem Wohngebiet, kurios für Gäste, aber mir nicht unangenehm. Ich lag im Bett wach und hörte von ferne Autos auf dem Autobahnring fahren, der Berlin wie eine natürliche Stadtgrenze umschloss; Buch gehörte, obwohl es außerhalb lag, trotzdem dazu, dafür sorgte schon die S-Bahn. Das Gefühl von Geborgenheit machte es besonders lustvoll, sich vorzustellen, wie feindliche Soldaten Buch überfielen. Weil wir ganz oben wohnten, konnte ich mich ducken und unbemerkt bleiben, bis sie sich in den unteren Stockwerken ausgetobt hatten. Die Wohnungstür ließ sich mit den schweren Flurschränken verbarrikadieren, die Türen waren ja aus Pappe (für einen Dieb empfahl es sich, einfach ein Viereck rauszuschneiden und die Klinke zu betätigen). Ich würde mich an die Balkonbrüstung hängen und fallen lassen, um mich am Balkon ein Stockwerk tiefer festzuklammern. Konnte ich auf diese Weise die fünf Stockwerke bis nach unten gelangen? Ab welcher Etage würde man eine Landung in der weichen Erde des Vorgartens überleben? Ich malte mir das immer wieder aus, aber es war unmöglich, die Konsequenzen so eines Sprungs wirklich zweifelsfrei zu durchdenken.
Auf dem Gelände der Zivilverteidigung, einem abgezäunten Komplex zwischen S-Bahn-Gleisen und Panke, stand als Übungsobjekt ein eingestürzter Plattenbau, den man beim Vorbeifahren von der S-Bahn aus kurz durch die Bäume sehen konnte, oft machten wir uns darüber lustig, weil wir in ihm das Schicksal unserer Gebäude vorweggenommen sahen. Manchmal heulte dort mitten in der Nacht eine Sirene auf, dann wartete ich in meinem Bett mit zugeschnürter Kehle auf das Dröhnen heranjagender Bomberstaffeln. Deckte sich der Rhythmus des Sirenentons mit einem der Alarmsignale, die ich auf der Rückseite eines Jahreskalenderkärtchens in Form von Schlangenlinien aufgemalt gesehen hatte? Feueralarm, Katastrophenalarm, chemischer Alarm, Atom- und Luftalarm – bei Letzterem sollte man «Haupt-, Gas- und Wasserhahn schließen». Am Morgen stellte ich mit einem vorsichtigen Blick aus dem Fenster fest, dass sich draußen nichts verändert hatte. Eine Neutronenbombe tötete nur die Lebewesen und ließ alles andere unbeschädigt. Wäre es nicht aufregend, als einziger Überlebender des Wohngebiets die fremden Wohnungen zu durchstöbern, bei Nachbarn, Klassenkameraden, Lehrern?
Ein Zug tutete in der Ferne. Erst jetzt achtete ich auf das laute Zirpen eines Heimchens, das von meinem Bewusstsein zumeist ausgeblendet wurde. Einmal hatte eines unter dem letzten Treppenabsatz im Hausflur gesessen, wo in allen Häusern Streusand lag und es nach dem Urin ausgesetzter Katzen stank. Die Kanten meines Bettgestells, das an der Rückseite kein Furnier hatte, weil man, wo Blicke nicht hinreichten, Material sparen konnte, rochen süßlich nach Chemie. Im Westfernsehen war davon die Rede gewesen, dass Formaldehyd krebserregend sei, ich bildete mir ein, dass es genau so roch. Ich machte mir Sorgen um die Umwelt: Aus den Fabriken, die überall mitten in die Natur gebaut wurden, sickerte giftige Substanz in den Boden, die Nachrichten zeigten Männer in weißen Schutzanzügen, die die Gegend um Seveso mit an langen Stöcken befestigten Detektoren nach tödlichen Strahlen absuchten. Sogar Waldmeister war krebserregend, deshalb gab es den Geschmack nicht mehr, mein Bruder konnte sich noch an ihn erinnern. Im Westfernsehen hatten sie auch über lange, dünne Würmer im Büchsenhering berichtet, der Wein aus Österreich war mit Frostschutzmittel versetzt, für die Nudeln waren halbausgebrütete Eier verwendet worden. Mit der Lupe untersuchte ich unsere Nudeln und entdeckte tatsächlich schwarze Punkte.
Der Rahmen meines Bettkastens hatte in der Mitte schon einen Riss, man musste ihn immer mit einem Hocker abstützen, der aber etwas zu niedrig war, weshalb zusätzlich die Kleine Enzyklopädie: Die Frau draufgelegt wurde, die sich irgendwann einmal dazu angeboten hatte. Oben auf dem Bettkasten standen meine Platten. Leider wuchs dieser Block nur langsam, weil sie so dünn waren, und je mehr man hatte, umso weniger fiel es auf, wenn eine neue dazukam. Wenn ich auszog, würde das der Grundstock meines Besitzes sein. An einem Kleiderhaken am Kopfende des Betts hingen Beutel, auf einem stand «Jute statt Plastik», der stammte aus einem Westpaket. An den Beutel hatte mir meine Mutter Schulterträger genäht, man wollte die Hände frei haben, denn die gehörten in die Taschen. Musste es nicht «Jutet statt Plastik» heißen? An der Tür ein Aufkleber mit Humphrey Bogart: «No nukes, babe!» Ein runder Aufkleber: «Baum ab? Nein danke!» Auf einem verwaschenen, blauen Pullover stand «BOSS», auf einem anderen «FRUIT OF THE LOOM». Was bedeuteten diese Botschaften aus dem Westen?
Vom Umzug aus der Altbauwohnung im Friedrichshain stapelten sich auf dem Schrank noch die Apfelsinenkartons, in denen jetzt Eisenbahn und Metallbaukästen verstaut waren. Einmal im Jahr bekam ich mitten in der Nacht plötzlich Lust, die Bahn aufzubauen, aber dann war es doch schnell wieder langweilig, und ich legte Nägel quer auf die Gleise und atmete den Geruch von «verbranntem Strom» ein, weil Zerstörung unterhaltsamer war als konstruktives Wirken. Ganz oben auf den Kartons lag ein Lederköfferchen, in dem mein Großvater in der Nazizeit immer das Nötigste bereithielt für den Fall, dass er mitten in der Nacht abgeholt und ins Gefängnis gebracht würde. Jetzt war es der Koffer für unsere Indianersachen – Federschmuck, Cowboygürtel, Plastepistolen und Colts. Ein roter Tomahawk, schade, dass er aus Plaste war, ich hatte trotzdem versucht, die Klinge zu schärfen. Als es später Mode wurde, sich mit Objekten aus der Zeit der Großeltern zu schmücken (lange Wintermäntel, ausgeleierte Strickjacken, Nickelbrillen, Hebammenkoffer), benutzte ich den Koffer als Schultasche.
Meine Hand glitt über die Raufasertapete direkt an meinem Bett. Ich pulte an den Erhebungen, in denen überraschenderweise Holzfasern steckten. Auf der anderen Seite war das Bad, vom Duschen war die Wand an einer Stelle schon aufgeweicht, winzige Fliegen krabbelten hier. Jeden Abend zerdrückte ich ein paar davon, sicher war der Schimmelgeruch giftig. Warum kümmerte sich keiner darum? Warum musste ausgerechnet ich hier schlafen und bleibende Schäden davontragen? Ein eigenes Kinderzimmer hatten meistens nur die Einzelkinder, wir waren zu dritt, und es gab oft Streit. «Ihr seid Geschwister, ihr müsst zusammenhalten», hieß es dann. Wenn ich krank war, durfte ich nebenan ins «Omazimmer» umziehen, das so hieß, weil meine Großmütter dort wohnten, wenn sie zu Besuch waren. Dann schlief ich auf der Couch (unter der sonst mein Lieblingsplatz war, direkt unter den Sprungfedern, vor allem wenn ich mich geschnitten hatte und die Wunde mit Jod-Tinktur behandelt werden sollte), trank aus einer Schnabeltasse und bekam den höhenverstellbaren Tabletttisch übers Bettzeug geschoben. Mit einem weißen, angenehm griffigen Drehknauf ließ er sich stufenlos schräg stellen. Bei besonders schweren Erkrankungen durfte ich mir das Katzenfell um die Nieren binden, das noch von unseren Vorfahren aus Insterburg stammte, die eine Gerberei besessen hatten.
Im Omazimmer hing eine Weltkarte an der Wand, die ein anderer Vorfahr angefertigt hatte, wodurch wir uns ein bisschen berühmt fühlen durften. Er war zur Eröffnung des Suezkanals eingeladen worden. Es gab auf der Karte noch viele weiße Flecken (in Afrika), und die Dimensionen der Kontinente stimmten nicht. Unter der Karte stand der kleine Plattenspieler, der so unpraktisch konstruiert war, dass sich die Acryl-Abdeckung über Langspielplatten nicht schließen ließ. Im Gegensatz zum Fernsehen musste man bei Schallplatten nie um Erlaubnis fragen, weil das Hören von Platten «die Phantasie anregte», wie meine Mutter sagte. Ich wollte so leben wie Ehm Welks Heiden von Kummerow, in einem Dorf in Mecklenburg voller herzensguter, schrulliger Landleute, und heimlich mit der Tochter vom Pfarrer den Kirchturm hochklettern. Alfons Zitterbacke, der durch die Dummheit der Erwachsenen immer zu Unrecht bestraft wurde. Hundertmal hörte ich Die sieben Geißlein in der Aufnahme mit Joseph Offenbach – das ausgelassene Lachen der Geißlein, wenn sie am Ende den Wolf in den Brunnen warfen. Die besten Schauspieler des Landes sprachen diese Kinderproduktionen ein, mir wurde das aber erst viel später bewusst, als ich feststellte, dass ich die Stimmen der Schauspieler im Theater von meinen Kinderplatten kannte.
Wenn ich krank war, durfte ich vormittags fernsehen, aber leider begann das Programm erst um zehn. Ich guckte schon ab halb zehn das Testbild, hörte das Fiepen, versuchte, das Bild so scharf wie möglich zu stellen, und machte Sekundenwettzählen: in 60 Sekunden bis 300. Dann kam Schulfernsehen, seltsam, das zu Hause zu gucken, English for you mit Wörtern zum Nachsprechen und einem Gong: «Say after me, please!» Ich guckte sonst im DDR-Fernsehen eigentlich nur Fußballübertragungen, bis mein Vater mit dem Argument «Die schießen besser» auf Bundesliga umschaltete. Nachrichten, Politmagazine, Unterhaltungsshows nahm ich kaum zur Kenntnis. Es gab auch einen zweiten DDR-Sender, auf dem liefen sowjetische Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg, rumänische Krimis oder ein Bericht von den «18. Arbeiterfestspielen im Bezirk Rostock». Die Hornbrillen der Nachrichtensprecher, ihre roboterhafte Ausstrahlung, die ungelenken Bewegungen der Spieler beim Fußball, das alberne Fernsehballett (bei dem Männer mittanzten!). Und die Nachrichten dauerten doppelt so lange wie im Westen! Eigentlich ging ich immer davon aus, dass auch sonst niemand im Land unser Programm guckte, bis ich einmal im Krankenhaus war, wo sich alle Patienten, die gehen konnten, im Fernsehraum versammelten und im Bademantel Polizeiruf 110 sahen.
Vom DDR-Radio wusste ich noch weniger als vom DDR-Fernsehen. Am Sonntagmorgen weckte uns laute Orchester-Musik aus dem Wohnzimmer, die BBC-Wunschsendung aus London. Eine wohlklingende, freundliche Männerstimme, die einem vertraut vorkam, sagte die Stücke an: «Condaktet bei Hörbört won Karajahn.» Meine Eltern waren begeistert, weil ein Herr aus Ghana sich was von Bach gewünscht hatte: «Da sitzt der in Ghana und hört dieselbe Sendung wie wir! Ist das nicht herrlich?» Und dass man im Krieg für Sender London ins Gefängnis kam. Damals hörte man mit dem Kopf unter einer Decke Radio, genau wie ich. Oder sie rätselten: «Ist das Bruckner?» Das Orchester dröhnte, sie schrien dagegen an. «Nein, Mahler.» – «Neeein, das ist nicht Mahler.» Am Ende wurde durch den Moderator die Auflösung verkündet. «Tatsächlich, Bruckner! Hätt ich nicht gedacht!» Dass man die Komponisten an den Geräuschen erkennen konnte, die das Orchester machte!
Lange hatte ich unser Radio nur als eine Art Küchengerät wahrgenommen, es stand vor den Scheiben der Durchreiche, fettig von den Dünsten, die Antenne wie bei all unseren Radios abgebrochen und mit buntem Tesaband geklebt. Wenn meine Mutter in der Küche werkelte, hörte sie immer scheppernde Klassik. Erst im Ferienlager lernte ich, dass die Musik, zu der wir auf der Disko getanzt hatten, auch im Radio lief, man musste nur die richtigen Sendungen finden: Hits für Fans oder Musik nach der Schule auf RIAS 2. In der Liste der anrüchigen Begriffe kam RIAS nicht weit hinter «HJ» und «USA». Ich hatte ein Hemd, auf dessen Brusttasche «U. S. Army» gestickt war. Wir trennten das «y» auf, «U. S. Arm» ging durch. Seltsamerweise gab es in den USA die größte Ausbeutung, aber am wenigsten Arbeiterproteste. Der amerikanische KP-Chef hieß Gus Hall, ob seine Landsleute den überhaupt kannten? In Essen saß Herbert Mies von der DKP. Die hatten viel Arbeit vor sich.
Unsere Kassetten aus dem Chemiefaserwerk «Friedrich Engels», Premnitz, standen im Ruf, den Rekorder kaputtzumachen, und eine 60er kostete 20 Mark. Nach und nach luchsten wir unseren Eltern deren alte West-Kassetten ab, auf denen sie Schlager für unsere Klassenpartys aufgenommen hatten, ideale Stuhltanzmusik: Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Dass meine Mutter auf die Frage, ob sie eigentlich früher Beatles- oder Stones-Fan gewesen sei, antwortete, sie hätten für so etwas kein Interesse gehabt, zog einen tieferen Graben zwischen uns als zwischen mir und meinen Westcousins, die lediglich in einem anderen Staat lebten.
Die Kassettenhersteller waren noch nicht darauf gekommen, die Kassetten umgekehrt in die Hüllen zu legen, damit sie flacher wurden. Wir hatten einen Grundig C2600 Automatic, den meine Hamburger Großmutter meinem Vater bereits vor meiner Geburt geschenkt hatte. Heimelektronik war eine Anschaffung fürs Leben. Das Schöne am Grundig war der praktische Schiebeknopf zum Spulen, den man auch mal anfassen durfte, während der rote Knopf tabu war, ein entfernter Verwandter des roten Knopfs in Moskau und Washington, der den Weltuntergang auslösen konnte. Nur manchmal wurde der Rekorder aufgebaut, und wir durften ein Gedicht aufsagen oder einen Witz erzählen. Die Kassette mit unseren Kinderstimmen hörten wir uns immer wieder begeistert an. Weil mein Bruder auch Musik aufnehmen wollte, kauerten wir vor dem offenen Kassettenfach und hielten unsere leeren Kassetten bereit. Es kam darauf an, wer das angesagte Lied schon hatte oder gar nicht wollte oder näher am Gerät saß oder rücksichtsloser reagierte und blitzschnell seine Kassette einwarf. Ab Mitte der 80er wurde im Radio manchmal ein Lied «von CD» gespielt, das markierte ich sorgfältig auf dem linierten Papier in der Kassettenhülle. Ich füllte einen grau marmorierten Karteikasten mit einem ausführlichen Register meiner Kassetten, Lied für Lied, alles auf Karteikarten in Schönschrift. Die Länge der Lieder addierte ich und berechnete meine erbeutete Musikmenge. Ich benutzte diese Kartei nie, um irgendetwas zu finden, dazu hätte ich ja erst einmal die Übersicht verlieren müssen.
«Schalt dein Radio an, denn der Treffpunkt ist dran!» Am Ende vom Treffpunkt zählten sie auf, welche Bands am Abend in den West-Berliner Clubs spielen würden, im Quartier Latin, Loft, Quasimodo, KOB. Dort wurde Bier aus Büchsen getrunken, das wusste ich aus der Abendschau. Sie gaben auch wöchentlich neue Tarnadressen durch, über die man an den RIAS schreiben konnte, um ihm sein Herz auszuschütten. Aber ich war schreibfaul und schon mit meinen Patentanten überfordert. Und hörte die Stasi die Sendung denn nicht? Eine Cousine aus Hamburg behauptete, das Radioprogramm in West-Berlin sei nicht sehr gut. Es gab demnach Unterschiede? Ich wäre gerne Radiomoderator geworden, das klang, als wäre es nicht so anstrengend, und man bekam die Platten umsonst. Regelmäßig hörte ich eine weniger bekannte abendliche Anrufsendung: Die Wählscheibe – Von ABBA bis Zappa. Der Moderator plauderte mit den Hörern, was an sich schon ziemlich spektakulär war, denn diese entspannte Form zu reden kannte ich nur aus den Westmedien, wo niemand Angst hatte, durch ein falsches Wort sein Schicksal zu besiegeln. Ich nahm auf Verdacht Lieder von Neil Young oder Jethro Tull auf, weil ich die Namen von den Jeansjacken irgendwelcher Rocker kannte. Mit einem kleinen Telefunken-Empfänger namens «mini partner», der wie ein Robotergesicht aussah (Lautstärke- und Senderknopf waren die Augen, der Lautsprecher der weit aufgerissene Mund), lag ich noch spätabends im Bett, das Ohr an den Lautsprecher gedrückt. Im Nachttisch meines Vaters lag ein flacher Minilautsprecher, der dazu gedacht war, ihn unter das Kopfkissen zu legen. Auf Mittelwelle empfing ich den Süddeutschen Rundfunk, da werde die beste Musik gespielt, hatte man mir verraten, aber die Wellen überstanden die weite Anreise nicht unbeschadet, ich musste immer nachjustieren, auch wenn ich die Zentralheizungsrohre als Antenne benutzte. Sie spielten Oldies, Musik aus der Vergangenheit, Sänger wie David Bowie hatten nämlich schon vor Let’s Dance Lieder gemacht. Aber gut konnten die nicht gewesen sein.
Manchmal nahm ich ein Lied auf, bei dem mir Zweifel blieben, ob ich es wieder löschen sollte. Kreuzberg ist so wundervoll von MDK (Mekanik Destrüktiw Komandöh) war so ein Lied. Weil es kürzer als eine Minute war, hatte es einen Platz am Ende einer meiner Kassetten sicher. Ich stellte mir die Bandmitglieder als bärtige Männer vor – wie die Gebrüder Blattschuss, die bei der ZDF-Hitparade Kreuzberger Nächte sind lang gesungen hatten, was in eine Polonaise ausgeartet war, den klassischen Tanz der VEB-Brigadefeiern. «Kreuzberg», das klang wie ein fernes Dorf, in dem alle aussahen wie Ingo Insterburg, den meine Oma verachtete, weil er dem Namen ihrer Heimatstadt Schande machte. In Wirklichkeit war der einminütige Song, in dem es hieß: «Kreuzberg ist so wundervoll, Kreuzberg ist so einwandfrei. Diese geilen Außenklos! Diese grau’n Betonsilos!», mein erster Punk-Song. Ich spielte ihn bei der Klassendisko, und wir bestaunten gemeinsam diesen hastig erzeugten Krach. Musik konnte ja noch bedrohlich sein und den Teufel beschwören.
Ich legte mich gerne auf den Boden und schmiegte das Gesicht an den glatten, kühlen PVC-Belag mit dem aufgedruckten Parkettmuster. Unsere Wohnung war neu und hell, neue Dinge lösten bei mir Glücksgefühle aus. In Detektiv Pinky hing auf einer Illustration von einem amerikanischen Kaufhaus fast an jedem Produkt ein Schild, auf dem «chic» oder «new» stand. «New» hieß «neu», das konnte man sich denken. Auch auf Westverpackungen stand ja immer: «Neu», oder: «Jetzt neu!» Auf dem Spielplatz hielten wir Müll in die Luft und sagten: «Jetzt neu!» Oder wenn einer gefurzt hatte: «Der neue Duft!» Wann hat das aufgehört, dass einen alles Neue vor Lust vibrieren ließ? Auf dem Boden unserer Wohnung fühlte ich mich wohl. Wenn es nur keine Atomwaffen gegeben hätte. In meinem Pionierkalender stand, dass ein Wissenschaftler berechnet hatte, der Dritte Weltkrieg werde im Jahr 1984 ausbrechen. Ich formulierte beim Einschlafen im Bett in Gedanken lange Briefe an Jimmy Carter, in denen ich ihn zu überreden versuchte, die Atombombe abzuschaffen. Die Sowjetunion werde das dann auch tun, sie hatten ja einen schrecklichen Krieg hinter sich. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Wie konnte ich mein Anliegen möglichst überzeugend formulieren, damit der amerikanische Präsident zur Vernunft kam? «Jimmy», so hieß doch eigentlich kein böser Mensch.
Das Buch Die letzten Kinder von Schewenborn war in einem Westpaket gekommen. Eine Familie, die nach dem Atomkrieg durch das zerstörte Land irrte. Die Sonne von Rauch und Staubwolken verdunkelt. Am Ende kriegt die Mutter ein Kind, das wegen der Strahlung keine Augen hat. Wenn die Bombe fiele, würde ich mich schnell umbringen, das stand für mich fest. Druckwelle, Feuersturm, Radioaktivität, lieber gleich aus dem Fenster springen. Aber wenn man dann gar nicht starb, weil der Boden vom Vorgarten doch weich genug für die Landung war?
Zum Trost dachte ich an das nächste Klassenspiel gegen die a. «A wie Angeber», sagten wir, und sie antworteten: «B wie bekloppt!» Wir hatten noch nie gegen «die a» gewonnen und auch gegen keine andere Klasse. Unsere guten Spieler blieben immer sitzen. Wenn ich nicht unten war und auf einem der vielen Plätze im Viertel Fußball spielte, guckte ich durchs Fenster anderen zu, was genauso interessant war wie Fußball im Fernsehen. Auf dem Hof war das Gittersegment, das wir als Tor nahmen, von den vielen Schüssen lädiert. Ein bärtiger Mann aus dem Haus gegenüber hatte es einmal in Eigeninitiative zugeschweißt. Die meiste Zeit diskutierten wir beim Spielen, ob der Ball im Tor gewesen oder am gedachten Pfosten abgeprallt war. Undirekter oder indirekter Freistoß? Wir spielten auf Asphalt wie die Nationalmannschaft von Malta. Ich trug zu jeder Jahreszeit Stoffhandschuhe, auch im Hochsommer, um bei Stürzen meine Handflächen zu schützen. Einmal im Leben auf einem richtigen, rechteckigen Rasen spielen! Mit weißen Linien und Tornetzen!
Gedanken an meinen Geburtstag lenkten vom Atomkrieg ab. Ich hatte so viele Wünsche, dass es mich vor Gier zerriss, wenn ich den alten Otto-Katalog durchblätterte, der unter den Kollegen meiner Eltern die Runde machte. Ein Schnorchel mit einem Ventil, sodass kein Wasser reinfloss. Damit könnte ich endlich den Grund der Oder erforschen. Angeblich lag an unserer Badestelle eine Granate, jemand hatte sie schon mal mit den Füßen im Schlamm ertastet. Unter «Spielsachen» ein Walkie-Talkie. Ich wusste nicht, was das war, aber ich wünschte es mir trotzdem, schon um seinen Zweck zu erfahren. Wie sich herausstellte, sprach man das nicht deutsch, sondern englisch aus. Es war ein Funkgerät, mit dem wir uns heimlich hätten verständigen können, wenn unsere Bande durchs Viertel patrouillierte. (Sie hieß die «Schwarze Hand», nach einem Kinderbuch. Ich hatte für jedes der fünf Mitglieder einen Anstecker mit einer schwarzen Hand gebastelt.) Wir würden dann immer «roger» sagen, wie im Film. Ich glaube, wir machten das eine Weile beim Telefonieren. «Kommst du heute zu den Betonröhren? Roger.» – «Nein, ich hab Stubenarrest. Roger.» – «Roger.» – «Roger und Ende.» Wäre ein Walkie-Talkie ein zu großer Wunsch? Man durfte den Bogen ja nicht überspannen, man musste die akzeptable Wunschgröße ausdehnen, ohne dass die Verwandten es merkten. Sie durften einen nicht für unverschämt halten, sonst würden sie vielleicht gar nichts mehr schicken. Was man sich nicht klarmachte, war ja, dass dieselben Verwandten auch anderen Wünsche erfüllen mussten, das kam einem richtig komisch vor, als man es erfuhr. Einmal beschwerte sich eine Westcousine, wir würden immer so tolle Sachen bekommen, Tim und Struppi etwa (während ihnen Comics aus pädagogischen Gründen vorenthalten wurden). Wenn zu Weihnachten in einer Großaktion Pakete gepackt wurden, betrachteten die Kinder in der Küche ungläubig die für die verschiedenen Ostverwandten aufgehäuften Süßigkeiten. Andererseits konnte man die Pakete an uns ja von der Steuer absetzen.
Die Kinder-Mannequins im Otto-Katalog sahen merkwürdig aus, rosige Bäckchen, blonde Haare. Der Junge, auf dem Boden ausgestreckt, mit Lego beschäftigt, einen Hubschrauber hält er in die Höhe, und die Eltern gucken heimlich um die Ecke und freuen sich, weil ihre Geschenke so gut ankommen. Immer was für Jungs und was für Mädchen, leicht an der Machart zu erkennen. Das Westspielzeug war schöner, die Playmobil-Figuren waren schon bei ihrer Erschaffung vollkommen, ohne die jahrhundertelange Annäherung, die in der Bildhauerei bis zum Menschenideal der griechischen Plastik nötig gewesen war. Westsachen erkannte man an den leuchtenden Farben und am unverwüstlichen Material. Die Schlümpfe hatten so eine verführerische Gummi-Konsistenz, dass man ihnen den Kopf abbeißen wollte. Meine Gummi-Indianer aus heimischer Produktion mochte ich immerhin; meine Mutter schrieb unsere Namen auf die Unterseite, damit wir sie später würden auseinanderhalten können, wenn wir sie in unsere eigenen Wohnungen mitnahmen. Ich besaß ein Dutzend Häuptlinge, die sich nur in der Farbe unterschieden. Sie rauchten alle eine quergehaltene Friedenspfeife. Ein «Schleicher», der auf dem Boden kroch, vielseitig einsetzbar, ein Kniender, der einen Bogen spannte, einer, der mit der Hand an der Stirn für immer Ausschau hielt: Szenen aus dem alltäglichen Indianerleben. Silberne Ritter mischten aber auch mit. Manche Freunde hatten sogar NVA-Soldaten, einen, der eine Handgranate warf. Ich konnte mir nicht vorstellen, mit flachen, angemalten Zinnsoldaten zu spielen wie meine Vorfahren, Gummi war besser.
Manchmal bekam ich beim Einschlafen plötzlich ein Würgen in der Kehle, weil ich an die unangenehme Realität denken musste, die Pflichten, die das Erwachsenwerden auf mich zuwälzte wie ein Gletscher Geröll. Mit 18 musste man arbeiten gehen. Dann musste man noch früher aufstehen, und man hatte nur noch wenige Tage im Jahr Urlaub. Was sollte ich denn werden? Meinen Bruder erwischte das alles schon zwei Jahre vor mir. Ab der siebten Klasse PA-Unterricht, «Produktive Arbeit», was bedeutete, sich alle zwei Wochen in blauer Arbeitskleidung in einem Betrieb von einem Lehrmeister anschnauzen zu lassen. Die Lehrlinge, denen man da begegnete: alle schon mit einem Bein im Knast. Mit so einer Brusttasche und am Hosenbein einer schmalen für den Zollstock. Und nach der Schule die Armee. Wenn ich wehrdienstuntauglich wäre? Irgendetwas müsste sich doch machen lassen. Ich dachte lieber wieder an etwas Angenehmes. Die Taschenlampe mit Knopf für Blinkzeichen. An den Griff mit den Batterien ließ sich eine Verlängerung schrauben, die könnte ich mir besorgen. Und im Deckel steckte immer eine Ersatzbirne. Das Morsealphabet lernen? Zur Not konnte ich nach «drüben» gehen, es würde sich schon ein Weg finden. Am letzten Tag in der Schule noch einmal richtig auftrumpfen. So eine Freiheit verschaffte einem auch ein Selbstmord. Zum Lehrer sagen: «Sie können mich mal!» Die Verwandten in Hamburg: «Da bist du ja endlich …» Wo wir überall Verwandte hatten, zählte meine Mutter gerne auf, nach Ulm könnte ich, in Bonn käme ich unter, und aus Tübingen schickte Onkel Gottlieb immer ein Weihnachtspaket. Der hatte als Student meine Mutter heiraten wollen, jetzt müsste er Farbe bekennen. Zur Not müsste ich nach Frankreich ausweichen, Onkel Michel in Straßburg, auch ein ehemaliger Bewerber. Zu Geburtstagen schickte er immer ein Päckchen mit zehn Tafeln Schokolade, vier fürs Geburtstagskind, je drei für die Geschwister. Er hatte von seinem Vater Land geerbt; wenn er Geld brauchte, verkaufte er ein Stück davon, das klang logisch, so musste man es machen. Aus Rendsburg kamen die Stifte und Klammeraffen, auf denen «Behring Diagnostics» stand, die Firma, für die Onkel Bernhard arbeitete. Filzstifte, die auf Plaste schrieben und nicht verwischten, eigentlich ein unlösbares Problem. Die rochen natürlich ziemlich giftig.
Über die Heizkörper in unserem Schlafzimmer hörte ich, wie jemand im Haus hustete. Herr Wallat rief laut den Namen seiner Mutter, das machte er, wenn er gute Laune hatte. Ein Heizungsknopf wurde quietschend zugedreht. Wieder tutete eine Bahn. Zur Konfirmation würde ich von Onkel Bernhard hoffentlich einen Kassettenrekorder bekommen wie alle Cousinen und Cousins im Osten. Onkel Bernhard war beim Mauerbau als Einziger von den Geschwistern meines Vaters in den Westen gegangen, er war zufällig in West-Berlin gewesen. In wenigen Wochen hatte er eine Arbeit gefunden, und jetzt besaß er ein Haus. Ich wünschte mir einen Rekorder, bei dem sich das Fach ganz langsam öffnete und nicht mit einem Schnappen. Es gab ja auch welche mit zwei Fächern, damit konnte man überspielen. Dann konnte man es so einrichten, dass die Lieder genau auf die Kassette passten und man kein Band verschwendete.
Ich sollte vor dem Einschlafen eigentlich beten, aber ich war zu träge, genau wie beim Zähneputzen. Ich entschuldigte mich bei Gott, dass ich heute nicht beten würde, und die Entschuldigung dauerte länger als ein Gebet, weil ich mich so umständlich herausredete, und sicher hatte Gott mitbekommen, dass ich in Gedanken Beten mit Zähneputzen verglich. Man wusste ja auch nicht, ob man ihn einfach so ansprechen durfte. In der Schule sollten sie lieber nicht mitbekommen, dass unsere Familie an Gott glaubte, von den anderen war keiner christlich, höchstens bei dem einen oder anderen eine störrische Oma. Und Teresa war katholisch, der wurde das aber nicht angekreidet, katholisch sein, dafür konnte man anscheinend nichts. Was machte ich, wenn ich einmal Gott verleugnen sollte wie Petrus? Wäre es nicht falsch verstandener Heldenmut, an dieser Stelle sein Leben zu riskieren? Ob er mir das nachsehen würde? Außerdem hatte er mich ja selber so erschaffen, mit allen Fehlern. Er hätte mich eben mutiger machen müssen.
Die Christen in den Römerfilmen, in der Arena ängstlich die Löwen erwartend. Christen waren friedlich und sozial eingestellt, während die römischen Frauen intrigant und bösartig waren, aber auch besonders reizvoll gekleidet, nur die großen Brüste hinderten das dünne Gewand am Herabrutschen. Eigentlich gefielen mir die Römerinnen, wenn sie mit ihren pechschwarzen Haaren und böse funkelnden Augen den Tod der Christen forderten. Die Christen, an Pfähle gebunden, zerrten an den Seilen. Der Stärkste drehte wenigstens einer der Bestien den Hals um, aber allen, das war zu viel verlangt. Freiwillig würde ich keinen Fuß in ein anderes Jahrhundert setzen. Galeerensklave, die Peitsche über dem Kopf. Den Pharaonen hatten sie als Babys den Hinterkopf verformt, sodass sie ein spezielles Kissen brauchten, um sich im Schlaf nicht das Genick zu brechen. In einer Eisernen Jungfrau stehen, wenn die Klappe sich langsam schloss und lange Nägel sich einem in die Augen bohrten. Andere Erdteile waren mir genauso suspekt. In Afrika durch den Dschungel wandern, und dem Vordermann wird von einem Speer der Schädel durchbohrt? Ich kannte das aus den Tarzan-Filmen vom Nachmittagsprogramm. Da war mal einer an biegsame Bäume gebunden und von den zurückschnellenden Stämmen auseinandergerissen worden.
Ich schlug das Ende der Bettdecke um und wickelte meine Füße darin ein. Mit 18 konnte ich natürlich auch einen eigenen Fernseher haben. Der überraschende Gedanke fühlte sich so intensiv und erregend an, dass ich mich darauf zu konzentrieren versuchte, ihn festzuhalten und bis zum Einschlafen an nichts anderes mehr zu denken.
Wohnzimmer
Manchmal schlich ich nachts ins Wohnzimmer, um heimlich zu trainieren, Armbeugen an zwei Stuhllehnen, Schlusssprünge, bei denen es mir darauf ankam, die Decke zu berühren und möglichst lautlos zu landen, Kniebeugen mit einer Zeltrolle auf dem Rücken. Alles stand genauso da wie am Tag, aber es wirkte geheimnisvoller, wie wenn man nachts einen Blick auf den Geburtstagstisch warf und sich die Geschenke als Gebirge unter einer weißen Tischdecke abzeichneten. Die Bücherregale mit Glasscheiben, die immer leise klirrten. Das Barometer, das das zukünftige Wetter anzeigte. Der Museumsschrank mit den Familienerinnerungsstücken, den wir einmal im Jahr aufschließen durften, um die nach Meer stinkende Krabbe zu betrachten. Ein südamerikanischer Silberdollar (lange verfolgte ich seinetwegen den Dollarkurs). Ein versteinertes Seepferdchen. Ein Bezoarstein aus einem Kuhmagen, mit dem sich das Wetter beschwören ließ. Siegel mit rotem Siegellack. Unsere Milchzähne. Ein Seeigel. «Edelsteine» (in Wirklichkeit Bergkristalle, vom Urgroßvater aus den Dolomiten mitgebracht). In der Mitte des Zimmers der große Tisch, den man bei Geburtstagsfeiern mit mehreren eingelegten Brettern verlängern konnte. Der Cognac-Schrank, in dem die edleren Gläser standen und Schnaps, der nie getrunken wurde, vielleicht fand ich ja eine angebrochene Tüte Engerlinge? Ich leckte gerne an einer kleinen Flasche mit länglichem Hals, die nie leerer wurde, Schlehenfeuer. Die rote Plattenspieler-Radio-Kombination. Sie hatte einen Dioden-Ausgang für unsere Kopfhörer, die nach jeder Benutzung zurück in ihre Pappschachtel geräumt wurden. Wenn ich mit Kopfhörern eine Platte hören wollte und auf dem «kleinen» Sessel saß, musste ich mich jedes Mal bücken, wenn wer vorbeiwollte, weil das Kabel den Weg versperrte. Im Plattenschrank meiner Eltern, in dem es nach Schallplatten roch, gab es fast nichts, was mich interessierte, nur Klassik, Schlager aus UFA-Filmen oder Orchester-Tanzmusik (So tanzte man in Alt-Berlin). Eine rote Karl-Valentin-Platte; den Humor verstand ich nicht, was wollte dieser mürrische Mann mit seinem Hasenbraten? Der Fernseher: ein hinten erstaunlich raumgreifender Kasten, die Bildröhre zog die Härchen der Finger knisternd an. Das Klavier hinter dem Fernsehsessel, Unterricht hatte ich nie gehabt, und Klimpern machte nie lange Spaß. Ich fragte mich, warum es weiße und schwarze Tasten gab, das verkomplizierte doch alles unnötig. Die Kakteen auf dem Fensterbrett, manche hatte der Vater meines Vaters aus Bolivien mitgebracht. Staunenden Klassenkameraden zeigte ich die Luftwurzler: «Die leben nur von Luft!» Wir hatten viele Dinge, die sonst niemand hatte, darauf war ich stolz. Eine Lichtmühle, in der sich schwarze Blechquadrate drehten, ohne jeden Motor. Wie laut die Pendeluhr tickte, das fiel am Tag überhaupt nicht auf. Was passierte, wenn sie einmal zufällig synchron mit meinem Herzschlag tickte? Sonntagmorgens hörte ich, wie mein Vater das schwere Eisengewicht an der Kette hochzog, ein Geräusch, als würde die Zeit zersägt.
Ich guckte zum Zehngeschosser gegenüber, die vielen Fenster, da kannte man niemanden. Hinter manchen flackerte im selben Wechsel bläuliches Licht, dort sahen sie noch fern. War denn noch nicht Sendeschluss? Ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn das Programm einmal mitten am Tag unterbrochen würde und ein Nachrichtensprecher uns mitteilte, dass der Dritte Weltkrieg begonnen habe und uns noch fünf Minuten blieben. Es hatte zwei Weltkriege gegeben, also würde es auch einen dritten geben, und sie wurden ja immer schlimmer. Der Sprecher würde sich sogar in so einem Moment bemühen, sich seine Erschütterung nicht anmerken zu lassen. Eltern und Nachrichtensprecher durften ihre Gefühle nicht zeigen, darauf musste man sich verlassen können. Ich würde dann natürlich sofort zum Telefonapparat rennen und überprüfen, ob es noch einen Signalton gab.
Im Altbau hatten wir einen schwarzen Bakelit-Apparat gehabt, die Nummer wusste ich noch lange auswendig. Hier in Buch stand bei allen das gleiche graue Modell mit der praktisch geringelten Strippe. Wir hatten im Neubau fast alle Telefon, mir war nicht bewusst, dass das ein glücklicher Umstand war. Auf keinen Fall sollten wir uns verwählen und aus Versehen in Japan anrufen, das würde teuer. Ich rief oft die Zeitansage an, weil man den eigenen Uhren nicht traute und weil ich die stoische Frau dabei erwischen wollte, wie sie sich verhaspelte, wenn eine Minute um war. Oder die Kinoprogrammansage, bei der in einer Schleife alle Kinos und Filme aufgezählt wurden. Als ich später mit Mädchen telefonieren wollte, musste ich den Apparat ins Schlafzimmer zerren, sodass die Schnur unter dem Türspalt spannte. Trotzdem kam manchmal meine Mutter rein, um sich umzuziehen. Wir machten immer Scherze darüber, wenn es im Hörer knackte, weil sich dann vielleicht jemand dazugeschaltet hatte. Ich schraubte die Muschel auf und hoffte, eine Wanze zu finden, aber wie sah so etwas überhaupt aus? Das gelbe Telefonbuch war sehr wichtig, zählen, zu welchem Namen es die meisten Einträge gab, Schmidt vor Müller und Lehmann. Mädchen raussuchen, die man kannte, so erfuhr man auch die altmodischen Vornamen ihrer Eltern. Ich telefonierte Stunden mit Schulfreunden, wir sahen dabei ein Fußballspiel im Fernsehen, es kostete ja nichts. Was wohl die weiße Taste bewirkte? Anrufe in den Westen waren nicht leicht, meine Mutter saß den halben Tag im Wohnzimmer, nahe beim Telefon, und wartete, dass sie durchgestellt wurde. Wenn es gelang, musste man möglichst laut sprechen, der andere war ja weit weg. Ich stellte mich daneben und versuchte, sie dazu zu bringen, meine Schallplattenwünsche durchzugeben: The Piper at the Gates of Dawn. Wie bitte?
Später, in der eigenen Altbau-Wohnung, hatte ich kein Telefon, aber ich hängte sofort einen Zettelblock mit Bleistift an die Tür, man schrieb auch direkt aufs Holz. Ich erinnere mich gerne an die abendlichen Spaziergänge zu den nach Urin stinkenden Telefonzellen im Viertel, vor denen sich überall eine Schlange bildete. Für Hundehalter ist es ja auch eine angenehme Pflicht, abends noch mal raus zu müssen. Wo die Zellen gestanden haben, weiß ich noch, genau wie sich alte Leute an die Wasserpumpen erinnern, die ihnen nach dem Krieg das Leben gerettet haben.
Als wir nach Buch III zogen, das dritte Neubauviertel von Buch, waren wir für die anderen die Neuen – so wie alle Neubaubewohner für die aus Alt-Buch. Eines Tages waren wir auf der Chaussee gefahren, vielleicht zum Liepnitzsee, und unsere Eltern hatten auf ein Feld gezeigt und gesagt: «Da werden wir wohnen.» Das ist meine früheste Erinnerung an Buch. Wir hatten das Haus dann im Rohbau besichtigt. Ich liebte die Neubauten sofort, leider hatten wir keinen Fahrstuhl und keinen Müllschlucker im «Fünfer». Es war alles so schön neu und geometrisch. Alle Wohnungen der verschiedenen Wohnungstypen waren gleich geschnitten oder spiegelverkehrt. Es roch aber bei jeder Familie speziell, vielleicht weil die Väter auf ihrer Arbeit anderen Schweiß produzierten, oder der Geruch war ihnen von ihren Vorfahren vererbt worden. In jedem Häuserkarree gab es einen Spielplatz. Die meisten, die nach Buch zogen, waren jung und hatten mehrere Kinder. Wir bewegten uns immer in größeren Pulks, und vor der Kaufhalle standen ein Dutzend Kinderwagen mit unseren Nachfolgern. Ich fand es schön, dass in jedem Haus so viele Familien wohnten, es war wie bei einem Adventskalender, die vielen Türen. Gerne hätte ich im «10er» oder «11er» gewohnt, mit Müllschlucker und Wechselsprechanlage. Ich war beim Einzug sieben Jahre alt und weinte, als ich zum ersten Mal alleine unten war, weil ich noch nicht wusste, dass man am Klingelbrett neben unserem Namen den Knopf drücken musste, um dann, wenn es brummte, die Tür aufzuziehen. Die weißen Klingelknöpfe wurden von Jugendlichen gerne mit Zigaretten verschmort. Jugendliche waren eine Gefahr für die Gesellschaft, sie standen immer zusammen, rauchten und hinterließen Spuckelachen.
Für die Schule mussten wir eine Karte von Buch zeichnen, was mein Vater für mich übernahm. Die Gärtnerei, der Heimwerker-Laden, der Frisör, die Sparkasse, die Kirche, der Schlosspark, ein Spielzeugladen, ein Eisstand, das Kontex-Kaufhaus, das sowjetische Ehrenmal, die Clubgaststätte mit Kegelbahn, der Dienstleistungswürfel, mehrere Krankenhauskomplexe, das Maisfeld, das wir erkundeten, in meiner Tasche immer mein Überlebensset: eine leere Filmbüchse mit halbierten Streichhölzern, Reißzwecken, Gummilitze, ein paar Nägeln, einem abgesägten Bleistift und Knallplätzchen. Ich nahm aber auch den roten Messerschleifer aus der Küche mit. Am Rand des Maisfelds gab es einen runden Bunker, auf dessen geteertem Dach wir im Sommer lagen und die Wolken betrachteten, beim Atomkrieg müsste ich es irgendwie bis hierher schaffen. Ich stellte mir vor, dass im Inneren des Bunkers, in das ein schneckenförmiger Gang führte, hinter einer Stahltür ein toter deutscher Soldat lag. Wir kannten vom Radfahren oder Fußballspielen jede Unebenheit des Asphalts, jede Wurzel, die nach oben drängte, wir wussten, wo Eisenteile aus dem Boden ragten, wo ein Gullydeckel wackelte, wo man an der Panke in ein Abwasserrohr klettern konnte, wo man bei Regengüssen unter Balkons Schutz fand, welche Bordsteinkante besonders hohe Sprünge mit dem Rad erlaubte, wo der Wind zwischen zwei zu eng stehenden Blöcken so stark blies wie in einem Windkanal.
Zu Hause hatten wir so viele Bücher, dass an allen Wänden Regale standen, mein Vater brachte abends immer neue Bücher mit. Niemand hatte so viele wie wir, ich hielt das noch für einen materiellen Wert. Meyers Konversationslexikon, in Fraktur, und der neue Meyer – das Wissen der ganzen Welt, oder zumindest das von Herrn Meyer. Manchmal nutzte ich alle Finger als Lesezeichen, weil ich mich in Artikeln festlas, die ich gar nicht gesucht hatte, und immer andere Stichwörter hinzukamen. Aber die meisten Bücher las ich nicht, auch wenn viele davon eigens für uns angeschafft worden waren (Gerstäcker, Mark Twain, Jules Verne, Franz Fühmanns Nacherzählungen antiker Sagen). Wenn mein Vater sich wunderte, dass wir etwas wussten (Curare, Elmsfeuer, Boxer-Aufstand), stammte es meistens aus Tim und Struppi. Im Ferienlager erfuhr ich später von Büchern mit «Stellen», jemand hatte Die geschützten Männer von Robert Merle dabei. Im Kin Ping Meh ging es um eine schmerzhafte Penisverlängerung, so etwas war natürlich interessant. Sogar die Bibel bot Stoff: Hezekiel 12. Meine Mutter hatte einen eigenen Schrank für ihre englischsprachigen Autoren, Jane Austen, John Galsworthy, Katherine Mansfield. Seltsamerweise war Evelyn Waugh ein Mann und George Eliot eine Frau. Ich kannte die Bücher aus dem Regal, weil sie jahrelang an derselben Stelle standen, aber ich las nie darin, denn es waren ja Bücher für Erwachsene, mit kleiner Schrift und ohne Bilder. Auf dem Tisch meiner Mutter lag mal ein Buch von Agatha Christie auf Englisch, das konnte sie lesen! In einen französischen Pif-Comic schrieb sie uns die Übersetzung in die Sprechblasen, tagelang arbeitete sie daran. Mein Vater machte sich in seinen Büchern hinten immer Notizen. Er legte Wert auf «Erstausgaben», ich wusste nicht, warum. Ein Mitschüler fragte mich beim Abitur, ob wir was von Erich Fried hätten, ich bejahte, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass wir nicht einfach alles hatten, was es gab. Wir hatten dann gar nichts von Erich Fried, dafür ein Regal mit sehr alten Büchern, aus Pergamentpapier, in Leder gebunden. Es war immer spannend, die Frage zu klären, wie alt unser ältestes Buch sein mochte. Wir gingen in jede Buchhandlung, an der wir vorüberkamen, Kontrollgänge, die nur Sinn hatten, wenn man sie über lange Zeiträume regelmäßig wiederholte. In den Ferien, wenn wir beim Wandern durch kleine Orte kamen, fand man in Buchhandlungen, die es manchmal selbst in Dörfern gab, Bücher, die dort niemand zu würdigen wusste. Jeder hoffte, etwas in seinen Einkaufskorb aus Draht legen zu können, die hier genauso aussahen wie im Konsum. Mit ungefähr 13 fing ich selbst an, Bücher zu kaufen, ein Reclam-Band Nathan der Weise machte den Anfang, weil er so billig war und weil ich sofort nach Vollständigkeit strebte. Woher das Verlangen, alles selbst zu besitzen? Gelesen habe ich erst später, vorher kam die Zeit mit dem C64, bei der ich nie sagen kann, ob sie verloren oder eine Bereicherung war. (Unvergessen der Tag, als ich «Impossible Mission» schaffte.)
Viele Bücher standen hinter Glas. Meine Mutter war vor meiner Geburt monatelang jeden Montag in der Mittagspause zum Hellerau-Möbelgeschäft am Spittelmarkt gegangen, um nach Schränken zu fragen. Morgens: «Wir haben leider nichts», und in der Mittagspause: «Schon wieder alles raus.» Geld in Aussicht zu stellen («Es soll ihr Schade nicht sein»), das war schäbig, so etwas tat man in unserer Familie nicht. Es musste auch ehrliche Menschen geben im Sozialismus. Dann lieber keinen Schreibtisch haben und auf den Knien schreiben wie Humboldt im Urwald. Schließlich hatte sie sich durch ihre Beharrlichkeit das Privileg verschafft, bedient zu werden, und ihr Chef half mit einer Schachtel West-Zigaretten nach. Hinterher drückte meine Mutter der Verkäuferin fünf Westmark in die Hand, aber erst hinterher! Genau wie beim begehrten Kegeltermin im «Parkblick»: Den Kaffee brachte meine Mutter der zuständigen Dame hinterher vorbei. Mein Vater staunte, als er die alte Kleiderstange in den neuen, hell gemaserten Schrank aus wieder etwas billigerem Material hielt und sie passte. Die alte TGL-Norm galt also immer noch!
Bei den Klassenkameraden hingen keine echten Bilder, nur manchmal im Flur verkleinerte Reproduktionen von der Dame mit dem Hermelin oder vom Mann mit dem Goldhelm, auf Holz geklebt. Bei der Gitarrenlehrerin immerhin winzige Stiche von kopulierenden Käfern, eine Lupe daneben. Wir hatten echte Gemälde, die ich für wertvoll hielt, schon weil der Rahmen so prächtig und golden war. Eine finstere Schlucht, kaum zu erkennen ein Jäger mit Hund. Oder die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche (ein durchsichtiges Blatt mit den Silhouetten und Namen der Anwesenden war leider verlorengegangen). Mein Vater sammelte auch Kunstpostkarten, eigentlich wurde ja alles gesammelt. Die Verluste durch den Krieg (ausgerechnet der Koffer mit seinem Spielzeug war bei der Flucht gestohlen worden) und das Desinteresse der Geschwister bei der Auflösung des Hauses meiner verwitweten Großmutter waren nie verwunden worden.
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, die Wohnung zu durchforsten. Im Schlafzimmer, einem Wurmfortsatz des Wohnzimmers, suchte ich gerne unsere «Schildkröte» auf, einen Gummi-Blasebalg für Luftmatratzen. Beim Anblick der vielen Zettelkästen, die sogar hier standen, ermüdete ich sofort und legte mich hin. Zettelkästen mit Poesiealbumsprüchen, mit Stilfehlern, mit Zitaten aus Fernsehsendungen und Büchern, alles in Vaterschrift, auf Zeitungsartikeln waren immer Zeitungsname und Datum am Rand notiert. Papierstapel – Papier wurde gehortet, in jeder Form, denn man wusste nie, ob es morgen noch welches zu kaufen geben würde. Der Stapel Le point unter dem Bett: Mein Vater hatte die alten Hefte von jemandem für den Fall übernommen, dass er einmal Französisch lernen wollte. Nach mehreren Jahren