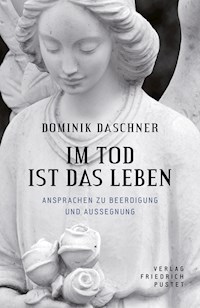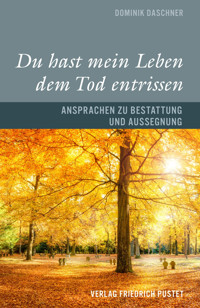
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Seit längerem verändert sich die Bestattungspraxis: Beisetzungen im engen Familienkreis statt in der Öffentlichkeit; kleine Trauerfeier am Friedhof statt Totenmesse; Urnenbeisetzung statt Erdbestattung; Beisetzung in Fried- oder Trauerwäldern statt auf einem Friedhof … Unverändert ist hingegen das Bedürfnis der Angehörigen, dass das Lebensbild der/des Verstorbenen beim Abschiednehmen noch einmal lebendig und anschaulich werden soll. Und sie möchten hören, was sie angesichts des Todes für ihre Lieben hoffen dürfen. Deshalb verknüpft der Autor verschiedene Lebensbilder mit der christlichen Hoffnung auf Auferstehung und Leben, damit trauernde Angehörige von dem Erzählten leben und ihren Lebensweg ohne ihre Lieben getröstet weitergehen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du hast mein Leben dem Tod entrissen
Dominik Daschner
Du hast mein Leben dem Tod entrissen
Ansprachen zu Bestattung und Aussegnung
Verlag Friedrich Pustet
Regensburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8, 93051 Regensburg
Tel. +49 (0)941 / 920220, [email protected]
1. Auflage 2025
ISBN 978-3-7917-3606-8
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de
Umschlagmotiv: © stock.adobe.com (eyetronic)
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2025
Diese Publikation ist auch als eBook erhältlich:
eISBN 978-3-7917-6275-3 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter
www.verlag-pustet.de
Gewidmet den Verstorbenen und ihren Angehörigen, denen die hier vorgelegten Predigten galten und die ich in ihrem Sterben und in ihrer Trauer seelsorglich begleiten durfte.
Inhalt
Vorwort
Geleitwort
Ansprachen bei der Bestattung alter Menschen
Geführt vom guten Hirten
Damit uns niemand wie ein Löwe das Leben raubt
Am Ende doch nicht genug?
Wie ein Stehaufmännchen
Das Gratisangebot Gottes
Die in weißen Gewändern einhergehen
Ich mache alles neu
Eine tüchtige Frau, wer findet sie?
Ansprachen mit Bezug zur (Kirchen-)Jahreszeit
Neujahr, bevor ein neues Jahr beginnt
Zwischen den Jahren
Boten Gottes in der Welt
Ernte des Lebens
Die Zeit der fallenden Blätter
Über die neblige Brücke des Todes
Ansprachen mit Bezug zum Beruf oder Hobby der/des Verstorbenen
Bücher in der Lebensbibliothek
Eingereiht in den Chor der Erlösten
Die Haare auf dem Kopf alle gezählt
Auf Fels gebaut
Schlüsselgewalt
Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?
Bienenfleiß
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit
Ansprachen bei besonders tragischen Sterbefällen
Hoffen und Bangen
Zwei Jünger gingen voll Not und Zweifel
Dem Netz des Jägers entkommen
Neu zusammengefügt für die Ewigkeit
Jetzt wird er hier getröstet
Ansprachen in besonderen Situationen
Wir schauen zurück auf die Schatten und das Licht
Unter keinem guten Stern
Unter die falschen Freunde geraten
Vieles bleibt im Dunkeln
Kurzansprachen zur Aussegnung
Die Tür nach nebenan Tod im Alter – Allgemein
Ende gut, alles gut? Tod im Alter – Allgemein
Sterben ist mir Gewinn Tod im Alter – Allgemein
Weihnachten und Ostern Schneller Tod gegen Ende des Advents
Ein Christkindl? Tod an Heiligabend
Kreuzwege Tod in der Österlichen Bußzeit
Wir aber hatten gehofft … Tod nach langer Krebserkrankung
Wende, Herr, unser Geschick Plötzlicher Tod
Mühselig und beladen Tod eines behinderten Menschen
Von einem Tag auf den anderen alles anders geworden Tod durch Verkehrsunfall
Ein Ausweg, der sprachlos macht Tod durch Suizid
Verzeichnis der verwendeten Schriftstellen
Vorwort
In den zurückliegenden Jahren hat sich in unseren Breiten ein massiver Wandel in der Bestattungskultur vollzogen. Der auch anderweitig zu beobachtende Rückzug ins Private führt dazu, dass Beisetzungen von Verstorbenen immer häufiger nicht mehr in der Öffentlichkeit der gesamten Pfarrei- oder Ortsgemeinschaft vollzogen werden, sondern nur noch im kleinen Kreis von Familie und Freunden. Die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen öffentlicher Versammlungen hat dabei als beschleunigender Katalysator dieses schon länger in Gang befindlichen Wandels gewirkt. So bleibt heute häufig das Requiem zwar öffentlich, die Beisetzung jedoch findet – womöglich zeitlich davon getrennt – nur im Familienkreis statt. Auch für katholische Christen wird – von diesen selbst oder ihren Angehörigen – immer häufiger keine Totenmesse mehr gewünscht, sondern nur eine kleine Feier am Friedhof zur Verabschiedung und Bestattung. Urnenbeisetzungen machen gegenüber Erdbestattungen mittlerweile auch in ländlichen Gebieten die überwiegende Mehrheit aus. Urnen mit der Asche von Verstorbenen werden neuerdings immer öfter in Fried- oder Trauerwäldern statt auf einem klassischen Friedhof beigesetzt.
Zwei Konstanten, was Menschen bei der Bestattung ihrer verstorbenen Angehörigen wichtig ist, sind jedoch weiterhin zu beobachten. Das Lebensbild der/des Verstorbenen – so wie sie/er gewesen ist und gelebt hat – soll beim Abschiednehmen möglichst lebendig und anschaulich noch einmal aufscheinen. Und sie möchten hören, was sie angesichts des Todes für ihre Lieben hoffen dürfen; woraus sich aus diesem konkreten Lebensbild eventuell Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus schöpfen lässt. Deshalb ist im Rahmen der Bestattung vom Leben der Verstorbenen zu erzählen und in dieses Lebensbild unsere christliche Hoffnung auf Auferstehung und neues Leben hineinzusagen, damit trauernde Angehörige von dem Erzählten leben können, ihren Lebensweg ohne ihre Lieben getröstet weitergehen können – wie der Freiburger Pastoraltheologe Bernhard Spielberg die Aufgabe der Trauerpredigt umreißt.
Diesem Ansatz wissen sich die hier vorgelegten Beerdigungspredigten verpflichtet. Wie in den Vorgängerbänden greifen alle Ansprachen reale Lebens- und Glaubensbiografien von konkreten Verstorbenen auf, wie sie sich in der ländlich geprägten, vorstädtischen Gegend einer Pfarreiengemeinschaft in Niederbayern zugetragen haben. Alles, was in ihnen zur Sprache kommt, hat sich tatsächlich so ereignet. Die Predigten bieten nichts Erfundenes, für die Veröffentlichung Geschöntes oder Dazugedichtetes, sondern benennen, wie das Leben manchmal so spielt. Deshalb wurde auch die gesprochene Sprache einer Predigt – im Sprachduktus, so wie er in ihrer Herkunftsregion üblich ist – für die Veröffentlichung beibehalten. Trotz der oft sehr persönlich gefärbten Lebensgeschichten können die Predigten leicht auf andere, ähnlich gelagerte Sterbefälle übertragen und für diese adaptiert werden.
Die dargebotenen Kurzpredigten entstammen Feiern zur Aussegnung, die in den Tagen zwischen dem Tod und der Beisetzung des Verstorbenen als öffentliche Feier am Friedhof gehalten wurden. Da im Rahmen der Totenmesse eine ausführliche Beerdigungspredigt erst noch folgt, enthalten sie kein detailliertes Lebensbild des Betroffenen, sondern wollen lediglich die noch sehr frische Trauersituation der Angehörigen auf Hoffnung hin aufbrechen. Die Kurzpredigten können jedoch leicht auch für Feiern in einer Trauerhalle zur Verabschiedung und Beisetzung des Verstorbenen verwendet werden. Biografische Daten lassen sich dazu leicht in die Ansprachen einbauen.
Die in den vorgelegten Beerdigungspredigten verwendeten Hoffnungsbilder, Beispiele oder Deutungsansätze entstammen nicht allein meinem eigenen Erleben, Überlegen und literarischem Schaffen. Sie verarbeiten auch anderswo Erlauschtes, Gefundenes oder Gelesenes, ohne dass ich deren Quelle jeweils im Einzelnen noch nachvollziehen könnte. Allen, die auf diese Weise den hier vorliegenden Predigten zugearbeitet haben, gilt mein herzlicher Dank. Wenn ich selbst mit den hier dargebotenen Ansprachen anderen Predigerinnen und Predigern für ihre eigene Verkündigung bei der Bestattung von Verstorbenen Anregungen geben kann, freut es mich, und der vorliegende Band hat seinen Sinn erfüllt.
P. Dominik Daschner OPraem
Geleitwort
Vor dreizehn Jahren sprach mich mein Freund David an und fragte, ob ich nicht Nachrufe für ihn schreiben wolle. David ist Redakteur und arbeitet für die Berliner Zeitung Der Tagesspiegel. Jeden Freitag erscheint dort im Lokalteil eine Seite, auf der verstorbene Berliner portraitiert werden. Keine Berühmtheiten. Ganz gewöhnliche Menschen. … „Was genau soll ich tun?“ fragte ich. „Du schreibst über tote Menschen. Keine Prominenz. Alltagstote.“ „Und wie soll das ablaufen?“ „Ich gebe dir Namen und Telefonnummer des Angehörigen. Du vereinbarst ein Gespräch. Dann schreibst du den Text. 4000 Zeichen. Zwei bis drei Schreibmaschinenseiten.“ „Für ein ganzes Leben?!“1
So beginnt der Schriftsteller Gregor Eisenhauer sein überaus lesenswertes Buch „Die 10 wichtigsten Fragen des Lebens“, das aus seiner Tätigkeit als Nachruf-Schreiber für eine Zeitung erwachsen ist. Des Schriftstellers anfängliche Verwunderung kann jeder leicht nachvollziehen, dem diese Aufgabe gestellt wird oder von Berufsseite gegeben ist: in erster Linie Geistliche und Trauerredner – oder einfach die, die den/die Verstorbene(n) gut kannten. Der kleine oben vorgestellte Dialog bringt die Kernproblematik eines Nachrufs oder einer Traueransprache auf den Punkt: Wie kann der Prediger/Redner in einem eng gefassten Format – hier 4000 Zeichen – dem Leben des Verstorbenen gerecht werden? Und der Situation, dass da ein ganz konkretes, einzigartiges Dasein zu Ende gegangen ist? Und auch der hohen Kunst des Abschiednehmens?
Für uns Geistliche ein Alltagsgeschäft, dem wir uns immer wieder zu stellen haben. Dieser Herausforderung stellt sich P. Dominik Daschner OPraem, insbesondere seitdem er – nunmehr seit über 25 Jahren – als Gemeindepfarrer tätig ist. Nicht genug damit. Denn unter anderem motiviert durch seine Mitbrüder in der Abtei Windberg, gibt P. Dominik vielen Seelsorgerinnen und Seelsorgern im gesamten deutschsprachigen Raum Anteil an diesem Wirken: durch das Veröffentlichen seiner Texte als Druckerzeugnis im Umfeld von Tod, Trauer und Abschiednehmen.
Nun, nach 2006, 2011 und 2017, liegt jetzt der vierte Band vor, umso erstaunlicher angesichts des schweren Fahrwassers, in das die verschriftlichte Predigtliteratur – verstärkt durch Digitalisierung, Corona und den immer kleiner werdenden Kreis von Benutzern – in den letzten Jahrzehnten hineingeraten ist. Wenn der Verlag Friedrich Pustet, der in den letzten Jahren unter anderem aus besagten Gründen sein gesamtes Predigtœuvre vollständig herunterfahren musste, sich entschließt, diese Reihe weiterzuführen, dann kann es nur an der zweifellos gegebenen, hervorragenden Qualität der Texte des Verfassers liegen. P. Dominik und allen Verantwortlichen im Verlagshaus Pustet gebührt daher großer Dank für dieses alles andere als selbstverständliche bibliophil-pastorale Unterfangen.
Einem Verstorbenen beim Abschiednehmen gerecht zu werden, ist und bleibt eine große Herausforderung. Aber grundgelegt in unserer christlichen Weltanschauung, befruchtet aus den reich fließenden Quellen der Bibel sowie den mannigfaltigen Zugängen unterschiedlichster religiöser Traditionen bestehen viele Chancen, diese Herausforderung in hohem Maß adäquat, professionell und glaubwürdig zu bestehen. Ein paar solcher qualitätsvoller Spurenelemente in den Texten von P. Dominik möchte ich nennen:
Überzeugend ist zunächst der souveräne Umgang mit biblischen Texten, weil der Autor versucht, den jeweiligen Kontext zu berücksichtigen, und nicht der Gefahr unterliegt, die Heilige Schrift als nützlichen Steinbruch zu missbrauchen.
Da die Sprache der Information zu wenig ist, gelingt es immer wieder, eine passend-aufschließende Bildersprache zu finden; darin kommt der Überschuss an Hoffnung zum Ausdruck, der der christlichen Botschaft zu eigen ist (im Gegensatz zu Ernst Bloch, der den Tod als „das große Umsonst“ bezeichnete).
In den Texten wird aufgezeigt, dass Sterben und Tod auch zur christlichen Grundbewegung der Liebe (theologisch: Hingabe) gehören.
Immer wieder stellt sich der Verfasser in seinen Texten der mannigfaltigen Auseinandersetzung mit aktuellen Vorstellungen des Todes, die es in unserer Gesellschaft gibt, z. B. das Ideal der Selbstvervollkommnung (mein Körper als Kunstwerk).
Wie ein roter Faden durchziehen die Ausführungen das Bemühen, ein Leben wirklich kennenzulernen, um nicht zu sehr bei dem hängen zu bleiben, was jemand getan oder nicht getan hat, sondern um zu vergegenwärtigen, was ihn berührt oder bewegt hat.
Gerade aufgrund des dörflich-ländlichen Umfeldes, aus dem diese Texte erwachsen sind, ist zu spüren, dass Erzählgemeinschaften entstehen: Weißt du noch …, wir kennen die Familie schon lange …
Des Öfteren leuchtet auf, dass es gilt, für die Trauernden wie für die mitgehende Gemeinde (inkl. Vorsteher, Pfarrer) die entscheidende christliche Grundhaltung einzuüben: die Sympathie, das Mitleiden und Mitgehen.
Wohl dem oder der, die beim Verlust eines lieben Menschen gute Begleitung finden. Das lehrt auch die Erfahrung, wie eine rituell ansprechende Feier und das richtige Wort, das berührt und aufrichtet, das Trauern in Bahnen lenken können, die ein positives Weitergehen ermöglichen – auch mithilfe dieser Predigtliteratur, die das Leben alles andere als trost- und zukunftslos erscheinen lässt.
Mit diesem Gedanken möchte ich nochmals Gregor Eisenhauer aus dem besagten Buch zitieren:
Als ich von den vielen traurigen Geschichten überwältigt wurde, die ich als Heranwachsender las, dachte ich, die Welt ist nicht mehr zu retten. Das Böse hat triumphiert. Was ich durch das Schreiben der Nachrufe begriffen habe: Wenn jeder nur einem Menschen hilft, hilft das allen. Die Liebe des einen rettet das Leben des anderen. Das klingt einfältig, ist es auch. Aber es wirkt, sofern jeder mittut. Nicht, dass Sie mich missverstehen: Wir sind nicht nur da, um uns für andere aufzuopfern. Wir sind da, weil andere zuweilen in uns ihr Glück finden. Und wir in ihnen.2
Ich möchte für das Predigtgeschehen ergänzen: Das Wort des einen rettet das Leben des anderen.
Werner Schrüfer
Leiter der Homiletischen Aus- und Fortbildung im Bistum Regensburg
1Gregor Eisenhauer, Die 10 wichtigsten Fragen des Lebens, Köln 2014, 9f.
2Ebd., 143.
Ansprachen bei der Bestattung alter Menschen
Geführt vom guten Hirten
Als aus einer Landwirtschaft stammende Ehefrau, Mutter und Grundschullehrerin hatte die Verstorbene Jesus als guten Hirten als Leitbild für ihr Leben vor Augen. Durch ihr eigenes Leben und Wirken ist sie selbst zu einer guten Hirtin für andere geworden. Ihre Krankheit, an der sie schon länger litt, hatte sie für sich behalten, bis sie daran im Alter von 73 Jahren starb. Für ihr Requiem hatte sich die gläubige, in einer konfessionsverbindenden Ehe lebende Christin ausdrücklich Texte und Lieder gewünscht, die das Bild vom guten Hirten thematisieren.
Lesung: Ez 34,11-16
Evangelium: Joh 10,11-15.27-29
Von Gott, der sich um die Menschen kümmert wie ein Hirt um seine Schafe – sie sammelt, sie auf gute Weide führt, darauf achtet, dass keines verloren geht, sich um verletzte Tiere kümmert –, und von Jesus, der sich dieses Bild aus dem Buch des Propheten Ezechiel zu eigen macht, es auf sich bezieht und sich selbst damit identifiziert – Jesus als der gute Hirte, der die Seinen kennt, der keinen von ihnen verloren gehen lässt und dafür sogar sein Leben hingibt –, davon haben wir in den Schrifttexten gerade gehört. Dieses Bild war Ihrer Ehefrau und Mutter sehr wertvoll und hat ihr gläubiges Leben geprägt.
Durch ihre Herkunft aus der Landwirtschaft ihrer Eltern N. und N. N. in N., wo sie am [Datum] zur Welt gekommen und zusammen mit ihrem jüngeren Bruder N. aufgewachsen ist und schon in jungen Jahren fleißig mithelfen musste, von daher war N. N. diese Bilderwelt der menschlichen Fürsorge für die ihm anvertrauten Tiere bestens bekannt. Der Ort N. mit seiner Landwirtschaft dort lag ihr ein Leben lang besonders am Herzen.
Von Christus, dem guten Hirten, heißt es, dass er die Seinen genau kennt. Jesus hat es uns eben im Evangelium noch einmal zugesprochen: „Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ Er ruft sie einzeln beim Namen, heißt es ein paar Verse davor; sie hören auf seine Stimme und folgen ihm. Gott kennt und liebt uns Menschen nicht nur so allgemein. Nein, jeder Einzelne ist vor ihm wertvoll mit seiner ganz individuellen Lebensgeschichte.
Dazu gehört bei unserer Verstorbenen ihr Berufsleben. Trotz der fleißigen Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft, wodurch Lernen und Hausaufgabenmachen hintangestellt werden mussten, konnte sie das Gymnasium in N. besuchen, wo sie 1969 Abitur gemacht hat und dann an der Universität N. Lehramt studiert hat. Nahezu 40 Jahre war sie Lehrerin: zunächst an verschiedenen Grundschulen im Landkreis und ab 1979 fest in N., wohin sie jeden Tag zusammen mit ihrem Mann gefahren ist, der ebenfalls an der dortigen Schule unterrichtet hat.
Zu diesem unverwechselbaren Leben gehören die vielfältigen Begabungen und Interessen Ihrer Schwester, Schwägerin und Tante. Ihre Liebe zur Natur: die Arbeit im Garten, die Blumen, die sie gezüchtet hat, ihre Tierliebe – ganz besonders zu Katzen. Ihr großes Hobby: das Lesen. Sie kannte sich gut aus in der Literatur. Dazu ihr musikalisches Talent. Sie liebte klassische Musik – Beethoven vor allem –, mochte aber auch moderne Tanzmusik gern. Sie hatte große Freude am gemeinsamen Chorgesang, war selber lange Jahre sängerisch aktiv beim N.er Singkreis. Beim Gottesdienst hatten es ihr lateinisch gesungene Messen besonders angetan.
Zu dieser Lebensgeschichte gehört als ganz wesentliches Element das Familienleben von N. N. als Ehefrau, Mutter und Oma. Gleich nach dem Abitur hatte sie ihren Mann N. geheiratet, und noch im selben Jahr kam Sohn N. zur Welt. Neun Jahre später war mit Sohn N. die Familie komplett. Darin war unsere Verstorbene der Mittelpunkt. Sie war die Managerin des gesamten Haushalts. Als Oma hatte sie ihre Freude an ihren Enkelkindern, ganz besonders an N., der 2020 zur Welt kam und für sie ein Lichtblick in ihrer Krankheit war, die die letzten Lebensjahre von N. N. beschwerlich gemacht hatte. Sie hat darüber nicht öffentlich gesprochen und diese Dinge lieber mit sich selbst ausgemacht. Trotzdem hat sie nie ihren Lebensmut und ihre Lebensfreude verloren. Beim Abschiednehmen an ihrem Krankenbett in ihren letzten Lebensstunden im Krankenhaus in N., wo sie am Montag im Alter von 73 Jahren verstorben ist – so haben Sie mir erzählt –, hat sie selbst gesagt: „Das Leben war schön.“ Das ist doch etwas Wunderbares, wenn ein Mensch das am Ende seines Lebens als Resümee so sagen kann.
Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, das Bild vom guten Hirten war unserer Verstorbenen ein wertvolles Leitbild für ihr Leben und für ihren Glauben. Für ihr Requiem hat sie sich deshalb Texte und Lieder gewünscht, die dieses Bild thematisieren. N. N. war eine gläubige Frau, hat im Gebet ihr Leben immer wieder in Beziehung zu Gott gebracht. In einer traditionell-konservativ glaubenden Weise ist sie mit ihrem Leben Christus, dem guten Hirten, gefolgt.
Und sie ist auch selbst für andere Menschen zu einer guten Hirtin geworden. In ihrer Familie als Ehefrau und Mutter, wo sie – trotz ihrer eigenen Berufstätigkeit und der Hausarbeit – ihrem Mann Freiraum für berufliche Projekte gelassen hat; wo sie – bescheiden und nicht auf sich selbst bedacht – in jeder Situation für ihre Kinder da war und immer ein offenes Ohr für alle Probleme hatte.
Gute Hirtin war N. N. auch für die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Die meiste Zeit als Lehrerin waren das die ganz Kleinen der ersten und zweiten Klassen, die sie behutsam in den Schulalltag hineinbegleitet, sie ins Lesen, Schreiben und Rechnen eingeführt hat und in all die anderen schulischen Lernfelder. Denn N. N. hat alle Fächer selbst unterrichtet und hatte vom Bischof auch die Missio canonica verliehen bekommen – die Lehrbefähigung für katholische Religion –, wo sie ihren Kindern das Bild von Gott als einem guten Hirten unseres Lebens vermittelt hat.
Mit diesem Hirtesein für andere ist Ihre Ehefrau, Ihre Mutter, Schwiegermutter und Oma Christus, dem guten Hirten, ein Stück ähnlich geworden. Darauf wird Gott mit Lob und Anerkennung schauen und sie nun – so dürfen wir vertrauen – auf die Weide des ewigen Lebens führen.
Denn vom guten Hirten sagt Jesus im Evangelium, dass dieser keines seiner Schafe verloren gehen lässt. Wo sich eines im Leben verlaufen hat, geht er ihm nach, sucht es und bringt es zur Herde zurück. So ist Gott. Wenn wir uns im Leben auf Abwege verlaufen oder mit unserem Handeln in die Irre gehen, dann schreibt er uns nicht ab, sondern geht uns durch Jesus nach, um uns auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er auch unserer verstorbenen Schwester im Glauben vergeben, wo sie aus menschlicher Schwachheit etwas schuldig geblieben oder an anderen schuldig geworden sein sollte.
Und auch im Tod lässt er uns nicht verloren gehen. Als guter Hirte ist Jesus selbst vor dem Tod nicht zurückgewichen, der uns wie ein reißender Wolf nach dem Leben trachtet, sondern hat sich ihm in den Weg gestellt. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden: dass keiner von denen, die wir lieben, sterben muss. Aber doch so, dass er uns nicht dem Tod überlässt; dass uns der Tod nicht für immer verschlingt wie ein reißender Wolf.
Bei seinem Sterben am Kreuz ist Jesus in das für uns undurchdringliche Dornengestrüpp des Todes hineingegangen, in dem wir uns zu verlieren drohen, aus dem wir alleine nicht herausfinden. Er hat dabei auf eigene Wunden nicht geachtet, sondern sein Leben für uns dahingegeben, um uns aus dem Tod zu befreien. Auch für N. N. hat Christus das vollbracht. So dürfen wir zuversichtlich sein, dass Christus sie aus dem Gestrüpp von Krankheit und Tod herausholen wird und sie nun heimführen wird auf die gute und frische Weide des ewigen Lebens.
Damit uns niemand wie ein Löwe das Leben raubt
Dem Familienvater, umtriebigen Geschäftsmann mit vielerlei Talenten und geselligen Mitbürger in der Dorfgemeinschaft, der trotz angeschlagener Gesundheit weiterhin mitten im Leben stand, wird vom Corona-Virus, mit dem er sich bei der Dialyse infiziert hatte, mit 76 Jahren das Leben geraubt. Seine Angehörigen, die erst nach seinem Tod verständigt wurden und erfahren haben, dass es so schlecht um ihn stand, sind schockiert. Sein Tod fiel in die Osterzeit.
Lesung: 2 Tim 1,9-14
Evangelium: Joh 5,24-29
In der Bibel werden Tod und Teufel wiederholt mit einem reißenden Löwen verglichen. Im ersten Petrusbrief heißt es, er schleiche wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann (vgl. 1 Petr 5,8). Ja, der Tod lauert uns in vielfältiger Gestalt auf und stellt unserem Leben nach.
Ein brüllender Löwe, das ist eine sichtbare Gefahr, der wir aus dem Weg gehen, vor der wir fliehen können. Ein mikroskopisch kleines Virus jedoch, das unsere Welt seit Wochen in Atem hält und in Schrecken versetzt, das uns befällt, ohne dass wir es zunächst merken, das ist eine unsichtbare Gefahr – aber genauso tödlich.
Ihrem Ehemann, Ihrem Vater, Schwiegervater, Opa und Bruder hat es den Tod gebracht. Gesundheitlich angeschlagen, wie er seit seinem schweren Herzinfarkt 2016 war, hat er die Infektion mit dem Corona-Virus nicht überstanden. Das Virus hat ihm das Leben geraubt.
Ja, der Tod kommt wie ein nächtlicher Dieb, wie Jesus einmal sagt, und raubt uns das Leben. N. N. hat er nach 76 Jahren das Leben genommen, ihm den weiteren Lebensweg abgeschnitten. Ihnen als Familie hat der Tod den Ehemann geraubt, mit dem Sie 40 Jahre verheiratet waren und der in allem ganz stark auf Sie fixiert war. Ihnen, seinen vier Kindern, hat er den Vater geraubt, der Ihnen den Weg ins Leben geebnet hat; mit allem, was Sie mit ihm an Erinnerungen verbinden – schöne und zum Teil auch belastete. Seinen Enkelkindern ist der Opa genommen worden, der seine Kleinen noch so gerne hätte aufwachsen sehen.
Unserer Gesellschaft ist mit dem Tod von N. N. ein umtriebiger Geschäftsmann geraubt worden, der Händler, der er von Jugend an war: sich bei Nachbarn etwas Geld verdienen, damit er sich bei der Kirta3 etwas leisten kann; mit seinem Großhandel für Fleisch- und Wurstwaren in N. und mit seiner Baumschule in N. Die Arbeit in der Natur, beim Bäumeveredeln, beim Christbaumverkauf, das war in den zurückliegenden Jahrzehnten sein Leben. Nicht nur dabei hat ihn großer Ehrgeiz ausgezeichnet, der ihm sogar einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde beschert hat, für einen Apfelbaum mit 500 verschiedenen Apfelsorten daran, oder wenn er mit Sportkameraden drei Tage lang durchgehend Eisstock geschossen hat. In gesunden Tagen hatte N. N. Kraft wie ein Stier, war stark wie ein Löwe; ein Kämpfer war er bis zuletzt.
Unsere Dorfgemeinschaft hat mit N. N. zudem einen gemütlichen, ruhigen und geselligen Mitbürger verloren. Alles das ist Ihnen und uns vom Tod mit seiner Macht geraubt worden. Wir können den Tod nicht aufhalten.
In seinem eigenen Sterben und Auferstehen jedoch hat sich Christus dem Tod in den Weg gestellt und ihm die Macht genommen, wie der Apostel Paulus es in der Lesung eben formuliert hat. An unserer Windberger Klosterkirche ist das sehr schön bildlich dargestellt. Im steinernen Tympanon über dem Seiteneingang der Kirche ist Christus zu sehen mit einem Schwert in der Hand, wie er einem Löwen mit weit aufgerissenem Maul, dem Symbol für das Böse und für den Tod, der uns verschlingen möchte, den Weg versperrt und dessen Macht in die Schranken weist. Dessen gedenken wir jetzt, in diesen österlichen Tagen, wenn wir Jesu Durchgang durch Leiden, Tod und Grab zur Auferstehung feiern: dass durch Christus dem Tod die Macht genommen worden ist.
Vielleicht nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden: dass keiner von denen, die wir lieben, sterben muss. Aber doch so, dass Gottuns nicht im Tod lässt; dass uns der Tod nicht für immer verschlingt wie ein brüllender Löwe. Sondern dass unser Weg durch Christus aus dem Tod herausführt, durch Tod und Grab hindurch in ein neues Leben.
Die Osterikone der Ostkirche stellt genau diese Szene dar. Als der Auferstandene ist Christus ins Totenreich hinabgestiegen, wie wir im Credo bekennen. Er hat die Tore zum Totenreich aufgesprengt. Zu seinen Füßen liegen die Türflügel und die zerbrochenen Riegel und Schlösser, so ist auf der Ikone zu sehen. Und Christus führt in einer langen Menschenkette, angefangen von Adam, die Verstorbenen aus dem Tod heraus, dem Himmel entgegen. In diese Prozession himmelwärts dürfen wir auch unseren verstorbenen Bruder im Glauben eingereiht wissen.
Nicht einfach aufgrund unserer Werke, wie der Apostel schreibt, weil wir uns durch ein fehlerfreies Leben das selbst verdient hätten, sondern aus Gottes „eigenem Entschluss und aus Gnade“. So wird Gott alles Gute und Gelungene im Leben von N. N. dankend anerkennen und es ihm lohnen. Aber er wird ihm aufgrund seiner Gnade den Zugang zu diesem neuen Leben auch nicht verweigern, wo in seinem Leben etwas offengeblieben ist oder wo er an anderen schuldig geworden sein sollte, sondern ihn durch Christus aus den Fesseln des Todes herausführen in ein erfülltes, neues Leben in Gottes ewiger Herrlichkeit.
Was der Tod geraubt hat, das wird bei der Auferstehung der Toten zurückgegeben werden: Ihrem verstorbenen Ehemann und Vater das Leben; ein neues, ewiges Leben. Und Ihnen als Familie und uns allen, die ihn gekannt und geschätzt haben, ein Wiedersehen mit ihm.
Am Ende doch nicht genug?
Die sehr fleißige Frau aus einer konfessionsverbindenden Ehe, die sich stets um vieles gekümmert und sich für viele andere Menschen eingesetzt hat, die jahrelang den Mesnerdienst in ihrer Pfarrei versehen hat, stirbt – gezeichnet von den Gebrechen des Alters – mit 82 Jahren. Trotz des vielen Guten, das sie getan hat, hat sie doch immer ein unterschwelliges Ungenügen empfunden und in der Sorge gelebt, ob ihr Leben damit vor Gott bestehen kann.
Lesung: Eph 2,4-10
Evangelium: Mt 25,31-40
Vergangenes Jahr haben wir in Deutschland das Gedenken an 500 Jahre Reformation mit zahlreichen Veranstaltungen begangen. Durch ihren evangelischen Ehemann N. – den sie in N. kennengelernt hatte, wo er als Bundeswehrsoldat, aus dem Schwabenland stammend, stationiert war und wo sie im Gasthaus gearbeitet hatte; 1960 wurde in N. geheiratet – durch ihren Mann hatte N. N. einen guten Blick hinüber auch in die evangelische Kirche, und das Thema „Ökumene“ war ihr ein persönliches Anliegen. Als wir im September bei uns in N. anlässlich des Reformationsjubiläums einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert haben, war sie deshalb – wenn ich mich recht erinnere – noch in der evangelischen Kirche in N. mit dabei – im Rollstuhl, schon schwer gezeichnet von ihrem Rückenleiden, den zahlreichen anderen Gebrechen und den dauernden Schmerzen. Nach einem Leben voller körperlicher Arbeit war Ihre Mutter im Alter – wie man bei uns so sagt – regelrecht zusammengeschunden. Sie so zu erleben, von Alter und Krankheit gekrümmt, war schwer mitanzusehen; und das, wo unsere Verstorbene doch ihr Leben lang so aktiv war, so eine zupackende Frau, in verschiedensten Tätigkeiten.
Die große Frage Martin Luthers, die ihn regelrecht umgetrieben hat, war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, um am Ende meines Lebens vor Gott bestehen zu können? Die Antwort spätmittelalterlicher Frömmigkeit auf diese Frage, zu Zeiten Martin Luthers also, die hat gelautet: gute Werke tun. Durch regelmäßiges Gebet, durch den zahlreichen Besuch von Gottesdiensten, durch Wallfahrten sich Gottes Gnade erwerben. Werke der Nächstenliebe anhäufen, gute Werke auf der Habenseite verbuchen, um sich so einen Schatz im Himmel zu sichern. Damit Gott am Ende meines Lebens mit Wohlwollen darauf schauen kann und mir die Tür ins Himmelreich auftut.
Liebe trauernde Angehörige, liebe Trauergemeinde, wenn wir auf das Leben von N. N. schauen, dann entdecken wir reichlich solche guten Werke, die sie vorweisen könnte. Ob das in der Familie ist. In 57 Jahren treu gelebter christlicher Ehe, in denen sie mit ihrem Mann immer wieder an seine verschiedenen Stationierungsorte gezogen ist: von N. nach N. und wieder nach N., bis sie sich im früheren Elternhaus in N. endgültig heimisch machen konnten, wo sie nach der Vertreibung aus dem Sudetenland nach verschiedenen Zwischenstationen eine Bleibe im Ortsteil N. gefunden hatten. Dort hat sie ihrem Mann und ihrer Familie ein gemütliches Zuhause bereitet. Wenn ihr Mann mit der Bundeswehr im Manöver war, aber vielfach auch sonst, hat unsere Verstorbene daheim im Haus alles gemanagt oder die Wohnung renoviert, ganz alleine tapeziert und das große Gartengrundstück samt Wald betreut, das zum Haus gehört; hat dort Gemüse und Obst angebaut, gepflanzt und geerntet, Pilze gesammelt und Heidelbeeren gepflückt, eingeweckt und Marmeladen gekocht.
Und natürlich hat N. N. für ihre beiden Töchter N. und N. gesorgt, denen sie eine höhere Schulbildung ermöglicht hat, die ihr selber durch Krieg und Vertreibung leider verwehrt geblieben war. Dabei war Ihre Ehefrau und Mutter eine sehr wissbegierige Frau mit vielen Talenten, die an so vielem interessiert war. Unter anderen äußeren Umständen hätte sie sicher eine anspruchsvolle Ausbildung machen und einen guten Beruf ergreifen können. So aber hat sie in verschiedensten Tätigkeiten gearbeitet und sich viele Fertigkeiten selbst angeeignet.
Für ihre vier Enkelkinder war unsere Verstorbene eine bemerkenswerte Oma und auf vielerlei Weise für sie da. Solange sie gesundheitlich fit war, hat sie mit ihren Enkeln weite Radtouren unternommen, im Garten Abenteuerhütten gebaut oder im Bachtal gemeinsam Schiffchen fahren lassen. Auch sonst hat Ihre Schwester, Ihre Schwägerin und Tante die Familienbande sehr gepflegt: Sie hat in der Verwandtschaft zahllose Kontakte gehalten, hat Verwandtentreffen organisiert und alle Daten von Geburtstagen etc. in der großen Verwandtschaft im Kopf gehabt.