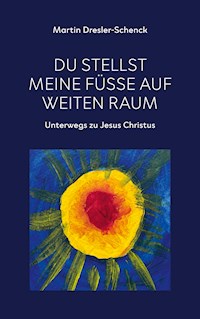
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Martin Dresler-Schenck lässt uns in diesem Buch an seiner tiefen, persönlichen Begegnung mit Jesus Christus teilhaben. Jesus im Beziehungsgeflecht seines Umfeldes und Jesus im Erleben der christlichen Mystik: viele Facetten leuchten auf. Christus wird für den Leser zu einem lebendigen Bruder und Wegbegleiter zu einem neuen Leben und einer tieferen Verbundenheit mit ihm. Beim Lesen beeindruckt die Bandbreite der Zitate aus der Literatur, welche die Vielfalt der Aspekte Jesu und des individuellen Glaubens beleuchtet. So gibt dieses Buch viele Anstöße für den Lesenden selbst und seine Beziehung zu Jesus. Ein beeindruckendes Werk für jeden Tag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
Taizé
Inhalt
Einleitung
Jesus Christus, die Mitte meines Lebens
Die Dreieinheit des Menschen: Körper, Seele, Geist
PERSONEN UM JESUS
Maria – Die Mutter der Glaubenden
Johannes der Täufer
Der Jünger Johannes
Simon Petrus
Judas Ischkariot
Thomas
Die Kinder
Martha und Maria
Lazarus
Maria Magdalena
Nikodemus
Zachäus
Die Samariterin
Der Reiche
Der Pharisäer und die Ehebrecherin
Der Blindgeborene
Die trauernde Mutter und ihr toter Sohn
Der reuige Schächer
Lieber Bruder Paulus,
SZENEN AUS JESU LEBEN
Das Leben in Nazareth
Der lernende Jesus
Die Fußwaschung
Die Verwandlung
Verklärung
JESUS CHRISTUS – DIE MITTE
Dein Freund Jesus
Mit Jesus beten lernen
Eins-Sein in Jesus Christus
Engel – Boten Gottes
Jesus – Sieger über die Hölle
Gott, der Herr des Hauses
Erlöst und befreit von den Ketten
Der Leib – ein Tempel des Heiligen Geistes
Jesus Christus – der Heiler
Über Ehe, Partnerschaft und Freundschaft
Sexualität und Glaube aus der Sicht der Bibel und Mystik
Jesus – der Gekreuzigte und der Auferstandene
Das Leben nach dem Tode
FENSTER ZUM REICH GOTTES
Die Seligpreisung der Sanftmütigen und Friedensstifter
Der gütige Vater und seine zwei verlorenen Söhne
Der Spiegel
Vom Wachstum im Reich Gottes
Der Lohn im Reich Gottes
Zeitliches Leben verlieren – ewiges Leben gewinnen
Die Klugheit des Verstandes und die Klugheit des Herzens
Dankbarkeit als Lobpreis
Im Feuerofen Gottes
AUSBLICKE
Jesus – das Wort Gottes
Jesus Christus – wahrer Mensch und wahrer Gott
Die Sehnsucht der Schöpfung nach Erlösung
Jesus Christus im Größten wie im Kleinsten
Die Wiederkunft Christi
Das neue Leben
Quellennachweise und Anmerkungen
Einleitung
Mit dieser Schrift möchte ich Möglichkeiten zeigen, wie der einzelne Mensch heute Jesus Christus begegnen kann. Dies kann durch das Lesen in der Bibel geschehen oder auch durch die Lektüre der Lebensgeschichten von Mystikern oder einfach durch das Vorbild anderer Christen. Mir geht es nicht darum, das Außergewöhnliche dabei hervorzuheben, sondern ich möchte Hilfen zum Glauben in unserem Alltag vermitteln. Jesus Christus wartet nirgends anders auf uns als in den uns geschickten Menschen und Erfahrungen. Ich bin mir dabei stets bewusst, wie wenig ich von ihm, dem bedeutendsten Menschen der Weltgeschichte, erfassen und ausdrücken kann. Sind doch in ihm die Schätze aller Weisheit und Liebe verborgen.
Dieses Büchlein ist keine „mystische Schrift“, aber es ist von Aussagen verschiedener Mystikerinnen und Mystiker durchtränkt. Der Einfachheit halber werde ich nur von Mystikern schreiben, ohne dass ich vergessen möchte, dass es mindestens ebenso viele Mystikerinnen gibt. Bei meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Mystik hat mich der inflationäre Gebrauch dieses Begriffes in den letzten Jahren überrascht. Ich sehe dies als Hinweis, dass das Interesse an diesem Gebiet gewachsen ist.
Ich möchte einzelnen Lehrern in diesem Bereich folgen und von zwei verschiedenen Deutungen ausgehen. Der Jesuit Christian Rutishauser spricht im Sinne von McGinn von „Mystik als Lebensstil“ im Unterschied zu einem „mystischen Leben“. Von Mystik als Lebensstil kann dann gesprochen werden, wenn ein Mensch sein Leben aktiv und kontinuierlich auf eine unmittelbare und persönliche Begegnung mit Gott ausrichtet und von der Bereitschaft, von seiner Heiligkeit und seinem Geheimnis im Inneren verwandelt zu werden.“ 1 Es handelt sich hierbei um einen Weg, den jeder gehen kann. In diesem Sinne verstehe ich die Worte von Karl Rahner, dass die Zukunft des Christen mystisch sein werde. Wer offen und empfänglich dafür ist, kann in seinem Leben Erfahrungen mit Gott machen. Am Anfang dieses Weges steht die Selbsterkenntnis. Meister Eckhart sagt: „Wer kommen will in Gottes Grund, in sein Innerstes, der muss zuvor kommen in seinen eigenen Grund, in sein eigenes Innerstes, denn niemand vermag Gott zu erkennen, er muss zuvor sich selbst erkennen.“ Die Selbsterkenntnis steht am Anfang jeder Christus- und Gotteserkenntnis. Das wichtigste Gebet von Niklaus von Flüe beginnt mit den Worten: „Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir.“
Das mystische Leben dagegen geht weit darüber hinaus, wenn auch die Grenze zur Mystik als Lebensstil nicht immer eindeutig ist. Christian Rutishauser definiert das folgendermaßen: „Mystisches Leben ist schließlich eine von Gott geschenkte Berufung.“ 2 Mystiker sind Menschen, die in tiefster Verbundenheit mit Christus, Gottvater und der unsichtbaren Welt leben. Ein solches Leben kann ein Mensch weder planen noch selbst herbeiführen. Es ist allein Geschenk, Gnade und Berufung von Gott. Mystiker vermögen im Unterschied zu anderen Menschen ihr übersinnliches Erleben mit ihrem Bewusstsein klar zu erfassen. Die für sie größte Schwierigkeit besteht darin, das, was sie durch Erleuchtung empfangen haben, in menschliche Sprache zu übersetzen. Jedes gesprochene und geschriebene Wort empfinden sie als bruchstückhaft und unvollkommen gegenüber dem ursprünglichen Erleben. Das habe ich wiederholt bei dem Mystiker Carl Welkisch erlebt. Jakob Boehme brauchte zwölf Jahre, ehe er – von innen gedrängt – sein übersinnliches Erleben zu Papier bringen konnte.
Als evangelischer Christ fühle ich mich nach wie vor der evangelischen Kirche verbunden. Doch empfinde ich es ebenso als sehr bereichernd, neben den Texten evangelischer Mystiker und Christen auch die von katholischen, orthodoxen oder anglikanischen Mystikern sowie die von Chassiden, den jüdischen Mystikern, und von Sufis, den islamischen Mystikern, zu lesen. Es ist die Weite, die Freiheit, aber auch die teilweise große Übereinstimmung der Aussagen, die mich beeindrucken. Sicherlich ist der jeweilige Mystiker ein Kind seiner Zeit, geprägt von seiner spirituellen, sozialen Herkunft und Umwelt, das müssen wir im Blick behalten. Die Entwicklung von uns Menschen bekommt immer wieder neue Impulse, damit wir nicht stehen bleiben; denn unser Wille zum Beharren ist groß. Die Mystikerin Therese von Lisieux entstammte einem kleinbürgerlichen Milieu, doch wurde sie in ihrem kurzen, leidvollen Leben von Christus dahin geführt, dass sie weit über ihre eigenen Grenzen, ja über konfessionelle Grenzen hinweg zu einer bedeutenden Botschafterin der Gottes- und Nächstenliebe geworden ist. Für uns sollte immer das Wort des Paulus gelten: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“ (1. Thess 5,21) und das des Gamaliel: „Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird’s untergehen; ist’s aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten … “ (Apg 5, 38b–39a)
Ein wissenschaftlich geschulter Mensch hat die Aufgabe, Dinge zu prüfen, zu beurteilen und sie einzuordnen. Dabei muss genau beachtet werden, von welchen Voraussetzungen der einzelne Forscher ausgeht. Leider haben statische Vorstellungen oft noch den Vorrang vor dynamischen. Dabei geht es doch darum, dass wir in einem weiten Beziehungsgefüge mit Gott stehen und dass sowohl die Schöpfung als auch die Erlösung nie aufhören. Aus gläubiger Sicht kennt die Entwicklung keinen Stillstand. Heute wird diese Ansicht auch von vielen bedeutenden Natur- und Geisteswissenschaftlern geteilt, die damit den Aussagen von Mystikern sehr nahe kommen. Leider wird diese Entwicklung zu wenig in einer breiteren Öffentlichkeit beachtet, denn das würde eine völlige Umkehr in allen Lebensbereichen bedeuten.
Eine mystische Sicht ist nicht – wie in früherer Zeit immer wieder behauptet wurde – allein auf das Jenseits gerichtet. Es geht in ihr immer um die Zusammengehörigkeit der sichtbaren und unsichtbaren Welt, des Diesseits und des Jenseits. Gerade der Mystiker weiß darum, und er „schaut“ scheinbar sich widersprechende Dinge zusammen. Er weiß, dass Paradoxien zum Leben gehören. Was auf einer niederen Ebene paradox aussieht, das ist auf einer höheren Ebene gar nicht mehr widersprüchlich. Mystik ist absolut nondualistisch, weil sie stets Gott als die Quelle von allem sieht, aber zugleich die große Entscheidungsfreiheit berücksichtigt, die Gott dem Menschen mitgegeben hat. Gerade er ist dank seines göttlichen Auftrages berufen, an Gottes Schöpfungs- und Erlösungswerk mitzuwirken.
Richard Rohr weist in seinem lesenswerten Buch „Pure Präsenz – Sehen wie ein Mystiker“ darauf hin, wie Jesus das Menschliche und Göttliche in sich integriert hat. Jeder Mensch hat die Aufgabe, das Äußere und das Innere zu einer Einheit unter der göttlichen Führung wachsen zu lassen. Darauf richtet sich auch der letzte Teil des vorhin erwähnten Gebetes von Niklaus von Flüe: „Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.“ Mystisches Leben heißt im Sinne Jesu zu glauben: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ (Lk 17,21 nach Luthers Übersetzung)
Liebe und Leiden sind Gegensätze, die gegeneinander ausgespielt werden können. Dabei gehören sie untrennbar zusammen. Es gibt keine tiefe Liebe, in der nicht auch das Leiden erfahren wird. „Niemand kommt allein durch Lieben und Leiden zu Gott; und doch scheinen nur die, die geliebt und gelitten haben tiefer zu Gott zu kommen.“ 3 Es ist wohl Gottes Absicht, uns durch diese Erfahrungen tiefer zu dem zu führen, was göttliches Leben heißt.
Die ersten Kapitel dienen der Einführung und der grundsätzlichen Begriffsklärung. In den folgenden Kapiteln wird der Versuch unternommen, sich der Gestalt des Jesus von Nazareth von verschiedenen Aspekten her anzunähern und sie zu deuten. Mehr meditativ beschäftigt sich der letzte Teil mit einzelnen Gestalten, Ereignissen und Gleichnissen aus der Umwelt Jesu.
Möge die Schrift Türen öffnen für eine neue Begegnung mit Jesus Christus!
Jesus Christus, die Mitte meines Lebens
Meine Mutter gab mir schon vorgeburtlich und in den ersten Lebensjahren die Liebe zu Jesus Christus mit. Sie war von einer starken Liebe zu Carl Welkisch erfüllt und erlebte durch ihn Christi Nähe hier auf Erden. In der Zeit meiner Pubertät war ich auf der Suche nach Jesus Christus. Doch weder Religions- und Konfirmationsunterricht, noch regelmäßige Besuche einer evangelischen Jugendgruppe, Gottesdienste, christliche Jugendfreizeiten – nichts von ihnen konnte meine Sehnsucht nach Jesus Christus stillen. Ich befand mich in einer tiefen Depression.
Ende 1955, also im Alter von fast 18 Jahren, fand ich durch die tiefe Freundschaft mit Carl Welkisch auch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zuerst noch mehr unbewusst. Ich fühlte mich ausgeglichener und froher im Gemüt. In dieser Zeit veränderte sich mein Gesichtsausdruck, wie mir Menschen in meiner nächsten Umgebung sagten. Ich wurde freier, war vielseitig interessiert und wollte in die Liebe Christi hineinwachsen. So versuchte ich, entsprechend den Hinweisen von Carl Welkisch zu leben. Dies ist für mich zu einem lebenslangen Weg geworden, der mich täglich neu herausfordert. Jesus Christus wurde mehr und mehr zur Mitte meines Lebens. Wie recht hatte Carl Welkisch, als er zu mir sagte: „Jesus war das Licht der Welt, so lange er im Erdenkleid war. Er wirkte durch seinen göttlichen Geist zündend auf seine Umwelt. Und die ihn liebevoll aufnahmen, wurden durch seine Liebe wiedergeboren. Das hatte damals seine Gültigkeit und gilt auch noch heute.“ Immer wieder erfuhr ich Christi Führungen und Bewahrungen.
In der Folgezeit änderte ich meine beruflichen Pläne. Nun wollte ich nicht mehr Eisenbahner werden, sondern Sozialarbeiter. Dafür absolvierte ich die kaufmännische Lehre. Meine Einstellung zum Wehrdienst wurde durch die Kriegserlebnisse meines Vaters im Ersten Weltkrieg und die Gespräche mit meinem Freund in der Weise geprägt, dass ich den Wehrdienst ablehnte und stattdessen zum Friedensdienst bereit war. Während meines Praktikums im Schweizer Kinderdorf Pestalozzi in Trogen entschied ich mich, Lehrer zu werden. Bei der Fortbildung und besonders im Studium setzte ich mich intensiver mit dem damaligen Christus-Verständnis der evangelischen Theologie auseinander. Die Kopflastigkeit der Theologie bot mir keine Nahrung, weder für mein Gemüt noch für meinen Verstand. Diese Nahrung fand ich bei Carl Welkisch durch Gespräche mit ihm wie auch durch die intensivere Beschäftigung mit seinem Weg und dem Weg der Mystiker. Bei Carl Welkisch war das „Wort Gottes“ keine Leerformel. Ich spürte durch ihn etwas von der Kraft Gottes und dem Heiligen Geist. Öfter las ich ihm biblische Texte vor, wodurch er hohe Erlebnisse mit einzelnen biblischen Gestalten hatte.
Durch Carl Welkisch fühlte ich mich immer stärker von Christus geführt. Als ich ihm am 16. Oktober 1963 davon erzählte, wie wichtig es mir sei, in meiner Klasse ein Kreuz aufzuhängen, hatte er ein Christus-Erlebnis. Christus zeigte dabei, wie wenig die Menschen bis heute von ihm begriffen hätten. Darüber berichtete Carl Welkisch ausführlicher in seinem Buch „Im Geistfeuer Gottes“. 4
Während seines Aufenthaltes im Juni 1964 an meinem damaligen Schulort in Rheinbreitbach begleitete Carl Welkisch mich ein Stück des Weges zur Schule. Ich hatte zu der Zeit mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach dem Abschied – so erzählte er mir später – hatte er ein Erleben mit Christus, der ihn mit mir verband und sprach: „Er lebt in deinem Herzen und damit auch in Mir.“ Diese besondere Führung ist mir bis heute ganz wertvoll und stärkt mich, gerade in schwierigen Situationen. Carl Welkisch zeigte mir – besonders in seinen Briefen – seine große Liebe, die mich gleichzeitig immer tiefer mit Christus verband.
Oft ging es in den Gesprächen mit Carl Welkisch um die Entscheidungen des Alltags. So stellte ich ihm die Frage: „Wie kann ich mein Handeln aus der Seele ablegen?“ Seine Antworten lauteten: „Frage dich bei jeder Entscheidung und bei jedem Handeln: Was würde Christus dazu sagen? Wie würde er handeln? Prüft immer wieder jede eurer Handlungen auf den Wesensgehalt. Nie sollen wir etwas selbstverständlich deshalb so tun, weil es die Tradition so verlangt! Wo mein Ich noch ist, da kann Gott nicht sein.“ Carl Welkisch war es stets wichtig, dass der eigene, mit Christus und Gott verbundene Geist, immer stärker das äußere Tun durchdringt. Die Spiritualität von Charles de Foucault und Carlo Caretto gab mir damals wichtige Anstöße.
Auch verstandesmäßig setzte ich mich mit der Frage nach Jesus Christus und dem Verständnis meiner eigenen evangelischen und der katholischen Kirche auseinander. Die Auseinandersetzung mit dem rechten Glauben wurde verstärkt durch meine Tätigkeit an einer evangelischen Volksschule, die unter einem Dach mit einer katholischen Volksschule untergebracht war, und durch die Liebe zu meiner Freundin und späteren Frau, Marita, die aus einem frommen katholischen Haus kam und ihren Glauben intensiv lebte. Von ihren Eltern war eine Verbindung zwischen uns nicht erwünscht. Marita hatte in den Bombennächten des Krieges im Luftschutzbunker zum Glauben gefunden, als sie mit ihren Eltern und ihrer Großmutter gemeinsam um Schutz betete. Die Verwurzelung in dem je eigenen Glauben, die Nähe Christi und Mariens, unsere starke innere Liebe ließen uns intensivste Nähe spüren. Zugleich war unsere unterschiedliche christliche Sozialisierung eine schmerzende Wunde. Beide litten wir sehr darunter. Bei Carl Welkisch erlebte ich, wie oberflächlich jeder dogmatische Streit der Menschen ist. Bei Diskussionen unter den Freunden sagte er schon mal: „Im Himmel diskutiert man nicht.“ Er war sehr frei, weit und vielseitig. Für ihn waren die katholischen Rituale nicht heilsnotwendig. Aber er erlebte ebenso die Demut, die regelmäßige Frömmigkeit und die Gebete bei den Katholiken. Verschiedentlich tauchte Christus in ihn ein, wenn er Prozessionen oder Pilger sah. Die evangelische Glaubenspraxis empfand Carl Welkisch weithin als zu sehr vom Verstand geleitet. Das Gemüt würde viel zu wenig einbezogen. Öfter sprachen wir über Fragen der Christologie. Die Eucharistie, das Abendmahl bzw. die Kommunion sah er als ein Gedächtnismahl an. In jeder Hostie sei etwas vom Geist Christi gegenwärtig. Christus wirke bei den Menschen, die daran glauben.
Im weiteren Verlauf stand für mich die Entscheidung an, der Berufung von Carl Welkisch als Lediger zu folgen oder zu heiraten. Meinen Christusweg, den ich durch Carl Welkisch gefunden hatte, wollte ich auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Aber die tiefe, innere Liebe zu Marita war ebenfalls da. Das war für Marita, Carl und mich eine harte Prüfungszeit und wühlte Marita und mich in unserer ganzen Existenz auf. Anfang 1968 bestätigte Jesu Mutter Maria Carl Welkisch, dass die Heirat gewünscht sei. Inzwischen waren auch bei Maritas Eltern die inneren Widerstände gegen eine Heirat mehr und mehr gewichen. Eine Woche vor unserer kirchlichen Hochzeit, am 14. Juli 1968, verunglückte Marita zusammen mit meinen Eltern tödlich im Auto.
Ich fiel in eine tiefe Dunkelheit, lebte aber auch gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass es ein Leben nach dem Tod gebe und dass ich den Heimgegangen nach meinem Tod auf der uns nicht sichtbaren Seite wieder begegnen werde. In dieser Zeit konnte ich nur unter Tränen die Vaterunser-Bitte sprechen: „Dein Wille geschehe!“ Doch nach und nach drang es auch in mein äußeres Bewusstsein, dass das Geschehen wohl im Willen Gottes lag. Bei dem gewaltigen Erleben Carl Welkischs in Flims am 24. Juli 1970, bei dem ich auch dabei war, galten die Worte Gottvaters: „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ auch mir. 5
Ab 1967 beschäftigte ich mich noch intensiver mit dem Leiden Jesu Christi, dem Leiden von Carl Welkisch und dem Leiden in der Welt. Die Hiobsgestalt rückte in meinen Focus. Ich schrieb eine Examensarbeit über das Thema „Die Gestalt Hiobs im Alten Testament und in der modernen Literatur“ für das Lehramt an Realschulen im Fach evangelischer Theologie. Damit verarbeitete ich – besonders 1968/69 – das Unglück zum Teil. Vor allem das Zusammensein mit Carl Welkisch und sein Einsatz für mich halfen mir, über das Unglück hinwegzukommen. Die Hiob gestalt und mein eigener Weg ließen mich die Passion Jesu und Welkischs Leiden tiefer verstehen. Bis heute fühle ich mich von Christus getragen, geführt und bewahrt, auch in Zeiten der „dunklen Nacht“, der Anfeindungen und Anfechtungen, die es auch später immer wieder gab.
Ich war auch dunklen Einflüssen ausgesetzt, wie Gottvater am 29. Oktober 1970 Carl Welkisch in Bezug auf mich zeigte: „Du kannst für keinen Menschen garantieren. Der Mensch bleibt Mensch. Solange er auf der Erde lebt, ist er satanischen Einflüssen ausgesetzt … Wenn ICH die Menschen nicht behütete, so wären sie dem Widersacher ausgeliefert. Denn ICH bin Gott und wo ICH ihm die Grenze setze, da ist seine Macht zu Ende. Darum wachet und betet, seid aufmerksam und strebt ständig danach, Meinen Willen zu erkennen. Je mehr der einzelne sich an MICH hält, desto mehr kann ICH ihn schützen und leiten. Aber keiner glaube, solange er auf Erden ist, er sei gefeit.“ 6 An meinem Hochmut, meinen Schwächen und Hemmungen hatte und habe ich lebenslang zu arbeiten.
In den weiteren Jahrzehnten habe ich viele Lebensgeschichten und Ansichten von Frauen und Männern gelesen, die eine mystische Berufung hatten. Das waren Menschen mit katholischen, evangelischen oder orthodoxen Wurzeln, aber auch Menschen islamischer oder jüdischer Herkunft. So lernte ich unterschiedliche Lebenswege zu Gott kennen. Gestalten wie Franziskus von Assisi, Niklaus von Flüe, Jakob Boehme, Therese von Avila, Johannes vom Kreuz und Pater Pio sind mir zusammen mit vielen anderen Frauen und Männern wichtig geworden. Doch die Aussagen der Bibel und die von Carl Welkisch sowie dessen Werke sind mir stets wegweisend geblieben.
Jesus Christus stand stets im Mittelpunkt, sei es bei den Unterhaltungen mit Carl Welkisch, beim Unterrichten im Fach Religion, beim Lesen der unterschiedlichen Literatur, bei Gesprächen mit Gruppen von Jugendlichen und beim Vorbereiten von Schulgottesdiensten. Besuche in Taizé beeindruckten mich jedes Mal. 1974 fragte mich die evangelische Gemeinde in Mayen, ob ich bereit wäre, als „Predigthelfer“, heute unter dem Begriff „Prädikant“ bekannt, in der Gemeinde Gottesdienste zu übernehmen. Carl Welkisch empfahl mir, dem zu entsprechen. Nach einigen Vorbereitungskursen in der Rheinischen Landeskirche wurde ich im Februar 1976 ordiniert. Als Carl Welkisch einen meiner Gottesdienste besuchte, erlebte er von Christus her, dass diese Tätigkeit von oben gesegnet sei. Die Vorbereitung von Predigten und das Halten von Gottesdiensten konfrontieren mich immer neu mit biblischen Texten und insbesondere mit Jesus Christus.
Schon seit meiner Jugend bewegte mich das Schicksal der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Menschen sehr, insbesondere das Schicksal der Juden. 1985 bis 1987 organisierte ich mit Kolleginnen und Bekannten eine Ausstellung mit einer Begleitbroschüre unter dem Thema „Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung“ und 1999 zusammen mit einer Sozialarbeiterin und jüdischen Emigranten eine Ausstellung „Zur Situation der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in Mayen – gestern, heute und morgen“. Nach dem Besuch im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 1993 brauchte ich sehr lange, um die Eindrücke zu „verarbeiten“ und normal weiterleben zu können. „Nie wieder darf so etwas geschehen!“ Dieser Satz kam mir oft in den Sinn. Ebenso wichtig ist in dieser Beziehung die Vaterunser-Bitte: „Vergib uns unsere Schuld“. Brücken bauen, Frieden stiften, Vergebung und Versöhnung sind für mich zentrale Themen geworden. Doch leider ist der Unfriede in den Herzen der Menschen und in der Welt nicht kleiner geworden, weil Gott und Christus viel zu wenig Raum in den Herzen der Menschen finden.
In den letzten zwei Jahrzehnten zog ich mich mehr und mehr zurück. Dieser Umstand wurde auch durch meine vorzeitige Pensionierung und den Umzug nach Landau gefördert. Die Worte Carl Welkischs vor seinem Heimgang klangen öfter in mir: „Du musst dich nach innen ziehen!“ Der lebenslange Weg ins Innerste – zum Herzen – ist der Weg zu Jesus: „Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21) Ich glaube daran, dass Jesus mir nahe war und ist. Doch es brennt auch die Sehn sucht nach dem endgültigen Zuhause auf der unsichtbaren Ebene. „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“ (Lk 24,32) Die Sehnsucht nach Jesus lässt mich nicht los.
Durch seine Bücher hat Carl Welkisch viel zum Verständnis von Jesus Christus beigetragen. 7 Ich erlebte, wie selbst katholische und evangelische Geistliche, Mönche und Nonnen durch die Begegnung mit ihm zu einem tieferen Verständnis von Jesus Christus und zu einer neuen Beziehung zu ihm fanden. In einem geistigen Erleben in früheren Jahren musste Carl Welkisch eine gekreuzigte Christusfigur von dem vielen Schmutz der Kirche säubern. Auch schaute er, wie er eine Bibel von allerlei unschönem, schmutzigem Papier befreien musste. 8 Nie war es Welkischs Ansinnen, sich selbst über Christus zu stellen. Wie sagte Gottvater zu ihm? „Liebt MICH und liebt Christus, dann wird Meine Liebe in euch einfließen und eure eigene Liebe erhöhen. Erst wenn ihr euch MIR ganz hingebt, kann ICH in euch und durch euch wirken!“ 9
Die Hinwendung zu Jesus Christus ist mir ein Herzensanliegen. In den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts kam mir der Gedanke, ein Buch über Jesus Christus zu schreiben, worin ich vieles von dem, was ich bei Carl Welkisch aufgenommen hatte, mit einfließen lassen wollte; denn in Christus fand und finde ich alle Weisheit und alle Liebe. Von ihm bin ich begeistert und entflammt. In ihm bin ich geborgen.
Die Dreieinheit des Menschen: Körper, Seele, Geist
Seit frühen Zeiten wurde immer wieder über das Wesen des Menschen nachgedacht. Religion und Philosophie haben jeweils aus ihrer Sicht Antwort auf diese Frage gegeben. Im 1. Brief an die Thessalonicher (5,23W) schreibt Paulus: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euch ganz an Geist, Seele und Leib, dass ihr ohne Tadel seid, wenn unser Herr Jesus Christus kommt.“ Der Apostel nennt drei Schichten des menschlichen Wesens, eine Auffassung, die auch dieser Schrift zugrunde liegt. Der Mensch wird als eine Dreieinheit erfasst, wobei die einzelnen Wesensbestandteile selbständig und zugleich einander zugeordnet sind.
Wie Geist, Seele und Körper zu unterscheiden sind, möchte ich an zwei Situationen aus Jesu Leben verdeutlichen: Als Jesus bei Maria und Martha vom Tod des Lazarus hört, weint er. Jesus fühlt den Schmerz über den Verlust eines lieben Menschen tief mit, er leidet mit, obgleich es doch für ihn keine Grenze zwischen der Welt der Lebenden und jener der Heimgegangenen gibt. Dieses Mitfühlen geschieht aus seinem natürlichen Menschen, also mit Leib und Seele. Gleichzeitig heißt es, dass Jesus im Geist ergrimmt. Hier kommt eine völlig entgegengesetzte Regung zum Ausdruck, nämlich Empörung, ja Grimm. Das Leben hat seinen Ursprung in Gott, der Geist ist sein Träger. Der Tod ist die Verneinung des Lebens, mit ihm kann sich der aus der Freiheit Gottes kommende Geist Jesu nicht abfinden; deswegen ergrimmt Jesus.
Es gibt nur wenige Situationen, in denen Jesu seelisches Befinden in den Evangelien zum Ausdruck kommt. So kann Friedrich Daab in seinem Buch „Jesus von Nazareth“ schreiben: „Darum steht seine (Jesu; d. Verf.) Gestalt so sonnig, so voller Heiterkeit, so sicher und klar vor uns, weil er die Stürme und Schwankungen seiner Seele im Verborgenen überwand. Wenn er wieder unter die Menschen trat, hatte er schon den Kampf hinter sich und überwunden. Und was ihm dann zustieß, das konnte ihm nichts mehr anhaben, weil es innerlich schon erledigt war. Den ringenden und seufzenden Jesus hat niemand gesehen und gehört, nur sein Vater im Himmel. Das einzige Mal, wo er Beistand bei Menschen suchte, war im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Gefangennahme.“ 10 Dort spricht der Herr zu seinen Jüngern: „Meine Seele ist zu Tode betrübt; bleibet hier und wachet mit mir!“ (Mt 26,38W) Jesu Körper und Seele bäumen sich auf gegen das furchtbare Schicksal, sich foltern und kreuzigen zu lassen, das ihm bevorsteht. In diesen Stunden ist Jesu Seele vollständig verzweifelt, grenzenlos traurig und sucht Halt bei denen, die ihm am nächsten sind. Gerade jetzt ist er auf den Schutz und die Nähe seiner Jünger angewiesen, er findet sie jedoch im tiefen Schlaf. So muss er ihnen sagen: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ (Mt 26.41) Damals, als Petrus seinen Meister als den verheißenen Messias bezeichnete, sprach er aus dem Geist; denn Jesus sagte ihm: „Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“ (Mt 16.17) In Gethsemane jedoch waren Petrus, Jakobus und Johannes „im Fleisch“. Mit Fleisch ist hier der natürliche Mensch, also Körper und Seele, gemeint. Die Jünger sind den inneren Kämpfen nicht gewachsen, deshalb schlafen alle drei wie betäubt. Zur gleichen Zeit spielt sich in Jesus ein Weltendrama ab zwischen seinem Geist einerseits und seinem Leib und seiner Seele andererseits. Der Kampf endet damit, dass Jesus sein Schicksal in die Hände seines Vaters legt und anschließend von Engeln für den schwersten Weg aller Wege gestärkt wird. Der göttliche Geist Jesu behält die Oberhand auch in der Stunde der größten Anfechtung. Die Verbundenheit des Geistes Jesu mit Gott ist einzigartig.
Natürlich hat auch jedes anderen Menschen Geist seinen Ursprung in Gott, wenn Paulus im 1. Brief an die Korinther (2,11–12W) sagt: „Welcher Mensch könnte wissen, was das Wesen des Menschen ist, wenn es nicht in seinem Innern den menschlichen Geist gäbe? So hat auch niemand je erkannt, was Gottes Wesen ist, außer durch Gottes Geist. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Durch ihn sollen wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist.“ Der Geist ist die Brücke des Menschen zu Gott, seinem Schöpfer, während der Apostel von Seele und Leib sagt: „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes.“ (1. Kor 2,14)
Innerhalb der Dreieinheit des menschlichen Wesens ist der Körper das unentbehrliche Instrument, durch welches allein Seele und Geist auf der irdischen, der materiellen Ebene wirken können. Der Körper besteht aus vielen Billionen mikroskopisch kleinen Zellen, die zu einem durch höchste Weisheit geordneten Ganzen verbunden sind. Ohne die Seele aber ist er bewegungs- und empfindungslos. Trennt sich beim Tode die Seele von ihm, so bleibt dieser leblos zurück und ist der Auflösung verfallen.
Die Seele stammt wie der Körper aus der natürlichen Welt. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere haben eine Seele. Auch sie können Gefühle wahrnehmen und entsprechend reagieren. Wir wissen, dass ein Hund oder ein Pferd ganz tief mit seinem Besitzer verbunden ist und dessen Gefühlswelt in gewissem Rahmen erfassen kann. Doch die Seele spielt beim Menschen insofern eine über das Tier hinausgehende Rolle, als sie Bindeglied zwischen Geist und Körper ist. Die Seele trägt je nach Veranlagung das Verlangen nach gröberer oder feinerer Befriedigung ihrer Triebe, Wünsche und Erwartungen in sich.
Der individuelle Geist ist der Wesenskern des Menschen. Der Geist ist der Träger des Gewissens, der höheren Vernunft und des Verantwortungsgefühls. Durch ihn nimmt der Mensch Dinge wahr, die seiner Seele unzugänglich bleiben.
Geist und Seele sind in ihrer Willensstrebung und Liebesrichtung sehr verschieden. Meistens ist der Wille der Seele stärker auf das eigene Wohlergehen als auf das der anderen gerichtet. In diesem Fall führt ihre Eigensucht zu Zersplitterung, Vereinzelung, Vereinsamung und Ohnmacht. Aus dem selbstlosen Liebesstreben des Geistes hingegen erwächst Zusammenschluss, Vereinigung und Einigkeit. Der Seele gelten die Zehn Gebote, die Mahnungen und Rufe Jesu zur Umkehr, damit sie sich aus eigener freier Willensentscheidung ihrem Geiste zuwendet und seine Liebesstrahlung in sich aufnimmt.
Das Verhalten des Menschen lässt erkennen, ob seine Liebe mehr von der Seele oder mehr vom Geist geprägt ist. Um das innerste Streben des Menschen, die in ihm vorherrschende Liebe zu bezeichnen, spricht die Bibel oft von dem Herzen des Menschen. So sagt Jesus: „Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz“ oder „Ihr Herz ist fern von mir“. (Mt 6,21; Mt 15,8) Im 1. Buch Samuel 16,7 heißt es: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz.“ An vielen Stellen der Bibel ist von der Verstockung, Verhärtung oder Abstumpfung der Herzen die Rede, aber auch von Menschen, die demütigen, reinen oder sanftmütigen Herzens sind.
Im irdischen Leben geht es darum, dass der Mensch sich dazu durchringt, seinen eigenen Willen zurückzustellen und Gott um das eine zu bitten: „Dein Wille geschehe!“ Bei Christus sind in letzter Vollkommenheit Geist, Seele und Leib zu einer Einheit in Gott geworden. Wie Christus bedürfen auch wir der Hinwendung nach innen im Gebet und in der Stille. Dadurch werden wir offener, um das wahrzunehmen, was Gott von uns will. Wir können das erfahren, denn unser Geist ist mit Gott verbunden. Im Geiste erkennen wir Gott und seine Schöpfungsordnung, in ihm haben wir Gemeinschaft mit Gott. Doch ist die Stimme des Geistes so zart und leise, dass unsere Seele sie oft überhört, wenn sie nicht das Hören auf Christus und Gott gelernt hat. Solange wir leben, dürfen wir nicht nachlassen in dem Bemühen, auf die Stimme Gottes in unserem Geiste zu hören und ihr zu folgen. Paulus ermahnt uns: „Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern; denn Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen.“ (Phil 2,12f)
PERSONEN UM JESUS
Maria – Die Mutter der Glaubenden
Maria, wenn wir zu dir kommen, so verstummen wir. Schweigend nehmen wir daran teil, wie tief du mit dem neugeborenen Kind im Stall zu Bethlehem verbunden bist. Gott selbst hat sich dir offenbart, denn in diesem Kind liegt die Hoffnung und Erlösung des ganzen Gottesvolkes. Dieses Unfassliche und Unbegreifliche kannst du – kann jeder – nur im Gebet umfassen: Gott wird Mensch, um uns Menschen zu sich emporzuheben.
Sicher waren dir gerade im Stall zu Bethlehem die Worte im Sinn, die der Engel Gabriel dir verkündete: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“ Erschrecken und Erstaunen zugleich standen dir damals im Gesicht, als ein Engel zu dir kam. Welch ein Gruß ist das, den Gottes Engel dir einfache Frau überbringt? Und dann hörtest du die überwältigende Botschaft: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob ewiglich, und sein Reich wird kein Ende haben. Der heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (Lk 1,28.30–33.35) Gott schickte dir damals die ganze Fülle seiner Liebe und Gnade. Es war sicherlich viel mehr, als du zuerst fassen und begreifen konntest.
Eines erstaunt uns immer wieder, wenn wir an deine Begegnung mit dem Engel denken: dein vollkommenes und uneingeschränktes Ja zu Gottes Anruf. Du wehrst dich nicht wie Mose am Berge Horeb, du kennst kein Wenn und Aber. Deine Antwort ist die grundlegende Antwort des glaubenden Menschen: „Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ (Lk 1,38) Wie schlicht und einfach sind deine Worte. Da ist nichts von Theater. In deinen Worten spiegelt sich deine vollkommene Demut und Offenheit für Gott, sie geben Zeugnis von deiner ganz reinen und rückhaltlosen Hingabe.
Sicher haben die Evangelisten Lukas und Matthäus nicht von ungefähr von deiner Jungfräulichkeit gesprochen. Sie drücken damit deine vorbehaltlose und letzte Hingabe an Gott aus, die unbefleckt ist von Eigensucht und Eigenwillen. Jesus war nicht nur die Frucht des heiligen Geistes, sondern auch die Frucht einer natürlichen Vereinigung von Mann und Frau. Warum sollte Gott bei der Menschwerdung Jesu einen Bereich ausklammern, der gerade die schöpferische Macht Gottes im Menschen darstellt? Auch der Liebesakt zwischen Mann und Frau ist von Gott und Christus geheiligt. Jesus Christus hat alle Bereiche menschlichen Lebens verwandelt und erlöst.
Du bist eine ungewöhnliche Frau, begnadet mit einem Geist, der dem von Jesus sicher sehr nahe verwandt ist! Welche Seligkeit und welches Glück gehen von deiner Begegnung mit Elisabeth aus, wie sie uns im Evangelium überliefert ist. Du siehst das Erlösungswerk dessen, den du in dir trägst bereits voraus und kündest es: „Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge getan an mir, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er gedenket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unseren Vätern, Abraham und seinen Vätern ewiglich.“ (Lk 1,46ff) In deinem Lobgesang spricht nicht ein gewöhnlicher Mensch zu uns, hier erfahren wir dich als eine Frau voll des heiligen Geistes, die Worte von zeitloser Gültigkeit ausspricht. Du darfst das Wirken Gottes in dir und in deinem Sohn schauen. Du brauchst nicht erst auf Pfingsten zu warten, bis du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, du bist bereits hier begnadet und gesegnet von Gott.
Nach der Geburt deines Sohnes Jesus kommen die Hirten und die drei Weisen zum Stall nach Bethlehem, um dem Kind Ehre und Anbetung zuteil werden zu lassen. Du hörst von wunderbaren Dingen, die sich nach der Geburt deines Kindes zugetragen haben. Gleichzeitig bist du vollständig ausgefüllt mit der Sorge um das Kind. Die ersten Monate im Leben eines kleinen Menschleins sind für eine Mutter immer sehr anstrengend. Dazu kommen die leidvolle und bedrohliche äußere Not, die Armut und Verfolgung. Davon erwähnt der Evangelist Lukas nichts, sondern schreibt nur: „Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ (2,19)
Wenn wir über diese Worte nachdenken, so finden wir, dass du uns damit eine wichtige Grundlage für unseren Glauben an Jesus beispielhaft vorgelebt hast: Jesus, seine Worte und Taten, seine Wunder möchten in uns wirken. Wie ein Samenkorn fruchtbaren, bereiten Boden braucht, so benötigt Jesus in uns Empfänglichkeit, Aufnahmebereitschaft und Offenheit, damit der Same aufgehen kann. Dabei will Jesus nicht in erster Linie in unserem Kopf, sondern in unserem Gemüt und Herzen bewegt werden. Je mehr Jesus in unser Herz eingeht, in ihm Raum findet, je mehr Zeit wir ihm geben, desto mehr kann er uns ergreifen und zu seinem Eigentum machen.
Einige Zeit später bist du im Tempel zu Jerusalem. Dankbar über die gesunde Geburt deines Kindes bringst du mit Joseph, deinem Mann, das vorgeschriebene Opfer. Überraschend begegnen dir dort Hanna und Simeon. Der greise Simeon, erfüllt vom heiligen Geist, prophezeit dir nicht nur die Bedeutsamkeit deines Sohnes, er sieht auch deine Zukunft an seiner Seite und verkündet dir: „Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen.“ (Lk 2,35) Du fühlst immer gewisser, wie die Zukunft deines Sohnes untrennbar mit deiner eigenen Zukunft verbunden ist. Gerade der, der sich Gott hingibt, wird die Spannung zwischen Gott und dem Leben in der Welt immer wieder leidvoll erfahren.
Deine mütterliche Fürsorge ist etwas ganz Natürliches und Gutes. Doch dort, wo sie zum Hindernis für den Sohn wird, für seine Berufung und seinen Weg, da musst du lernen zurückzustehen. Der Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater steht über dem Gehorsam zu seinen Eltern. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung für dich. Manchmal wirst du über das seltsame Verhalten des 12-jährigen Jesus im Tempel nachgedacht haben und ebenso über das Gespräch bei der Hochzeit zu Kana. Warum hat dir Jesus hier widersprochen? Jesus kennt die Stunde für sein Wirken. Er kann es sich nicht vorschreiben lassen, auch von dir nicht. Sicher hast du deinen Sohn mit Tränen im Herzen begleitet. Aber du hast geschwiegen, du hast gelernt, deine Gefühle zurückzustellen, so schwer das dir als Mutter auch gefallen sein mag. Du hast auf ihn gehört, wie es uns dein Wort beim Hochzeitsfest sagt: „Was er euch sagt, das tut.“ (Joh 2,5) Dabei sind dir die Worte des Engels bei der Verkündigung vor Augen, sie sind dir Halt und Trost auf deinem oft so dunklen und steinigen Weg.
Es hat Zeiten gegeben, da ist dir das Verhalten deines Sohnes fremd gewesen. Wenn du an die Bloßstellung von dir und deinen Söhnen denkst, als Jesus lehrt und ihr vor der Tür steht. Ihr bittet um ein Gespräch mit Jesus, aber er hat keine Zeit für euch. Noch schlimmer schmerzen die Worte Jesu: „Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Siehe da, das sind meine Mutter und meine Brüder! Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ (Mt 12,48.50) Du wirst sicher lange über dieses Wort nachgedacht haben, ehe du es von innen her bejahen konntest.
Deine tiefe geistige Verbundenheit mit Jesus lässt auch dich immer mehr mitleiden auf seinem schweren Weg. Deine Söhne und Töchter, die Leute in dem kleinen Ort Nazareth finden Jesus anmaßend, sein Auftreten stört sie in ihrer Welt. Jesu schweres Ringen um seinen Weg, die Ablehnung durch die nächste Umgebung machen dir schwer zu schaffen. Vielleicht stehen dir die Jünger und die Frauen um Jesus zur Seite. Wir bewundern an dir, dass du trotz allem Schweren und Leidvollen stets völlig zu deinem Sohn gestanden hast. Zwar begleitest du Jesus nicht überall hin wie seine Jünger, aber im Geiste bist du stets bei ihm und bist ihm näher als die meisten.
Unter dem Kreuz finden wir dich wieder. Etwas abseits stehst du mit den Frauen. Deine Schmerzen über die Leiden, die deinem Sohn zugefügt werden, sind unvorstellbar. Für dich ist es die nahe Blutsverwandtschaft mit deinem Sohn, die dich alles an Leib, Seele und Geist miterleben lässt. Jesus weiß, wie tief du mitleidest. In seiner Todesstunde sieht er dich voller Liebe an und schenkt dir einen neuen Sohn, der dich auf dem Rest deines irdischen Lebensweges begleiten wird. Es ist der treue Jünger Johannes, mit dem dein Sohn sich in besonders tiefer Liebe verbunden fühlt. Darum spricht Jesus zu dir: „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ Zu seinem Jünger Johannes sagt er „Siehe, das ist deine Mutter!“ (Joh 19,26f) Es ist das letzte Zeichen seiner Liebe, das dir der sterbende Jesus hinterlässt.
In der Apostelgeschichte wird überliefert, dass du Pfingsten im Kreise der Apostel verbringst. Du gehörst mit zur Gemeinde Jesu und nimmst sicherlich an dem Wachstum der Jerusalemer Gemeinde und an der weltweiten Verbreitung des Evangeliums innerlich Anteil. Dass sie dich als die Mutter des Herrn besonders verehren, ist verständlich, denn sie haben gefühlt, dass du zum Leben unseres Erlösers dazugehörst. Dabei bist du stets Dienerin und ein leeres Gefäß für das Wirken Gottes gewesen. Insofern gibst du uns ein Beispiel und wirst zur Mutter der Glaubenden, eine Bezeichnung, die dir bereits die alte Kirche verliehen hat.
In allen Jahrhunderten – besonders in den letzten zwei Jahrhunderten – gibt es Zeugnisse davon, dass du erschienen bist. Dabei hast du zur Buße und Umkehr, zu Gebet und Sühne aufgerufen. Die Menschen seien so weit von Gott abgekommen, dass schweres Unglück bevorstünde. Die Botschaften erinnern uns an die Prophezeiungen der Propheten und an die des Johannes in der Offenbarung. Dabei ist der Wortlaut der Prophezeiungen stets auch von dem sie empfangenden Menschen und seiner Wiedergabefähigkeit und seinem Eigenen geprägt. Deshalb ist es gut, wenn wir sie im Gebet an dem Geist der Botschaft Jesu sorgfältig prüfen. Die Echtheit vieler Erscheinungen und Wunder ist nicht von der Hand zu weisen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Rat des Schriftgelehrten Gamaliel aus der Apostelgeschichte (5,38f) hinweisen: „Ist das Vorhaben oder das Werk von Menschen, so wird‘s untergehen; ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht hindern …“ Zu Lebzeiten bist du, Maria, stets Wegweiserin zu Christus gewesen. Nie bist du bei dir stehen geblieben. Auch heute willst du, dass das Licht Gottes und Jesu in unserer Welt heller erstrahlt.
Johannes der Täufer
Die Maler haben Johannes den Täufer als einen hageren, mit einem Kamelhaarfell bekleideten Mann dargestellt. Nicht seine Gestalt zieht die Menschen an, sondern das aus der Vollmacht gesprochene Wort. Dieser Mann ist von der Erfahrung der Wüste geprägt. Wer einmal die Wüste erlebt, gespürt und gerochen hat, den lässt sie nicht mehr los. Die Wüste ist der Lebensraum, in der der Mensch sich auf das Wesentliche seines Lebens besinnt. Alles Unwichtige fällt von ihm ab. Alle Sinne richten sich auf das Leben und Überleben. In diesem Raum wird der Mensch offener für die unsichtbare Welt von himmlischer wie von höllischer Seite. Moses empfängt seine Berufung in der Wüste Sinai, sein Volk ins gelobte Land zu führen. Der erschöpfte Elia hört in der Stille der Wüste die Gottesworte für seine weitere Prophetenaufgabe. Die Wüstenväter und Wüstenmütter machen dort in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten wichtige geistliche Erfahrungen.
Johannes erfährt ebenfalls den Ruf in der Wüste, wie es heißt: „Da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste.“ (Lk 3,2W) Für den Evangelisten Lukas ist die Offenbarung Gottes kein zeitloses Geschehen. Er benennt die mächtigste Gestalt der damaligen Zeit, nämlich den Kaiser Tiberius, und den Ort des Wirkens von Johannes, nämlich das Jordantal. In dieser Region der Steppe, die unmittelbar an die Wüste grenzt, leben Viehzüchter und Nomaden.
Die Zuhörer von Johannes dem Täufer kommen von weit her zu dem Propheten. Dabei sind seine Worte scharf wie ein Schwert und gewaltig wie ein Hammer und wühlen die Menschen auf: „Macht den Weg frei für den Herrn! Macht gerade seine Pfade!“, ruft der Büßer seinen Zuhörern zu. Anders gesagt: „Räumt alles, was dem Herrn im Wege steht, auf die Seite! Jetzt ist die Zeit seines Kommens. Haltet Hausputz in eurem Inneren. Kehrt allen Dreck aus den dunklen Ecken und verborgenen Stellen in euch weg. Reinigt das Haus von allen Spinnweben. Putzt eure inneren Fenster, damit ihr wieder klar sehen könnt. Seht, dass euer materieller und immaterieller Besitz nicht nur für euch da ist. Heißt Gäste und Fremde willkommen.“ Johannes der Täufer predigt die Buße und Umkehr. Seine schneidenden Worte treffen die Menschen in ihre Herzen; denn er hält ihnen den Spiegel ihrer Verkehrtheit und Gottvergessenheit vor. Damit gehört er zu den großen Propheten wie seine Vorgänger Elia, Jesaja und Jeremia und steht in der Tradition des Alten Testaments. Er weist wie sie auf die strenge, richtende Seite Gottes hin und fordert den Akt der inneren und äußeren Umkehr. Jeder Zuhörer soll durch konkrete Taten in seinem Leben und Beruf zeigen, auf welcher Seite er steht. Als die Zuhörer Johannes den Täufer fragen, was sie denn tun sollen, lautet seine Antwort in dem Sinne: „Haltet euch an Recht und Gesetz! Teilt mit dem, der weniger hat als ihr.“ Der Täufer will, dass jeder darauf achtet, dass sein Handeln von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geprägt ist. Der Ungerechte und Unbarmherzige handelt gegen Gottes Gebote und steht dem Kommen Gottes auf dieser Erde im Wege. Wer immer nur auf seinen Vorteil bedacht ist und nicht den anderen mit im Blick hat, stellt sich gegen Gott.
Während Johannes die Taufe der Buße und Umkehr ausruft, spricht er auch von dem, der die Geisttaufe bringt: „Ich taufe euch mit Wasser. Doch es kommt einer, der stärker ist als ich. Nicht einmal ihm die Schuhriemen zu lösen, bin ich gut genug. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen.“ (Lk 3,16) Mit seinem Worten bereitet der Täufer die Menschen auf das Wirken Jesu vor. Nur der Empfängliche und Offene kann ihn in sich aufnehmen. Das geht jedoch nicht ohne eine völlige Änderung des persönlichen Lebensstiles.
Er predigt das Kommen des Messias, denn er selbst weiß, dass er lediglich sein Vorläufer ist. Als er Jesus sieht, gibt er Zeugnis von ihm mit den Worten: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ (Joh 1,29) Jesus ist der Reine, der Unschuldige, der für die Menschheit die Leiden auf sich nimmt und sie damit befreit für den Weg mit Gott. Johannes der Täufer ist der erste, der Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. In der Offenbarung des Johannes wird das Bild des Lammes zum zentralen, überzeitlichen Thema des Wirkens Jesu Christi im Himmel und auf Erden. Das Lamm wird zum Synonym für Jesus Christus.
Johannes ist ein vom Geist Gottes Getriebener und weist König Hero des auf sein Unrecht hin und stellt ihn damit bloß. Der König solle Buße tun; denn er sei im Unrecht, weil er dem Bruder seine Frau weggenommen habe. Das geht Herodes deutlich zu weit. Aus diesem Grund nimmt er den Täufer gefangen. Töten will er ihn jedoch nicht, weil er auch Angst vor dem Volk hat.
Im Gefängnis befallen Johannes den Täufer tiefe Zweifel, ob Jesus auch der sei, den er verkündet hat. Jesus ist so ganz anders in seinem Auftreten, als er sich das vorgestellt hat. Während er fastet, ist Jesus bei allen möglichen zwielichtigen Leuten zu Gast, isst und trinkt wie jeder andere. Auch handeln er und seine Jünger nicht immer im Sinne der jüdischen Gesetze. Dunkelheit und Gemütsbedrückungen suchen den Täufer heim. Vielleicht geht es seinen Jüngern ähnlich. Die biblischen Quellen schweigen dazu. Als die Johannesjünger deswegen bei Jesus vorstellig werden, antwortet er ihnen: „Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote werden auferweckt, und Armen wird das Heil verkündet: Und selig ist, wer an mir nicht irre wird.“ (Mt 11,4ff) Die Antwort sollte den Täufer wieder an das erinnern, was bei Jesaja über den Messias zu lesen ist. Gleichzeitig bestärkt Jesus ihn darin, seine Zweifel fahren zu lassen.
Im Anschluss an diese Aussage geht Jesus auf die herausragende Bedeutung des Täufers als Vorbereiter seines eigenen Kommens ein. Es gipfelt in dem Wort: „Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er.“ (Mt 11,11) Dies ist ein geheimnisvolles, sperriges Wort Jesu. Einerseits zählt er Johannes zu einem der Größten unter den Propheten, andererseits ist er ganz klein im Himmelreich. Einerseits ist seine Rolle von nicht zu überschätzender Bedeutung, andererseits verschwindet er hinter der Gestalt des Jesus von Nazareth. Gefangen von Herodes besucht Jesus den Täufer nicht, noch befreit er ihn.
Jesus antwortet damit auf die unausgesprochene Frage, wie er denn den Täufer einschätze. Jesu Aussage weist den Zuhörer darauf hin, den Mann aus der Wüste nicht nach menschlichen Maßstäben von groß und klein einzuordnen und ihn entsprechend zu bewerten. Was von der Logik her widersprüchlich erscheint, kann nur aus einer tieferen, inneren Sicht betrachtet werden, bei der unsere üblichen Maßstäbe versagen. Zu Lebzeiten Jesu bleibt Johannes der Täufer die zentrale Gestalt, die dessen Kommen ankündigt.
Wie wahr ist in diesem Zusammenhang das Wort, das der Täufer von Jesus sagte: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh 3,30) Mögen auch wir transparenter werden für Jesus Christus, und möge unser Ich mehr und mehr zurücktreten zugunsten des Mannes am Kreuz. Der große Meister des Isenheimer Altares malte Johannes den Täufer mit übergroßem Zeigefinger, der auf den Gekreuzigten hinweist.
Johannes erleidet das Schicksal der großen, unbequemen Propheten, indem er hingerichtet wird, was durch die grausame und sadistische Weise der Frau des Herodes und deren Tochter veranlasst wird. Doch die überzeitliche Botschaft des Täufers bleibt. Sie ist in jeder Adventszeit zu hören: „Bereitet dem Herrn den Weg!“
Der Jünger Johannes
Einer unter den Jüngern Jesu ist empfänglicher und offener für die Liebe des Meisters als die anderen: der Jünger Johannes. Er lässt sich von dem Licht, das in die Welt kommt, erhellen und von der Liebe Gottes entzünden. Da der Herr diese Fähigkeit erkannt hat, hat er ihn berufen. „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt … “ (Joh 15,16) sagt der Herr später zu seinen Jüngern. Die Berufung des Herrn ist stets Gnade und unverdientes Geschenk zugleich. An der Hingabe des Menschen liegt es, ob er die Gnade nutzt und „Frucht bringt“. Letzteres heißt für Johannes, bis zu seinem Lebensende in der Liebe zu sein. Die Liebe des Jüngers Johannes zu Jesus und die von Jesus zu seinem Jünger spiegelt sich im Johannesevangelium wider. Es mag dahingestellt bleiben, ob der Jünger Johannes auch der Verfasser des Johannesevangeliums war, jedenfalls ist die geistige Nähe zwischen dem Jünger, „den Jesus lieb hatte“, und dem Verfasser des vierten Evangeliums nicht zu übersehen.
Johannes, der Sohn des Zebedäus, ist schon früh ein Suchender. Wie von einem Magneten fühlen er und sein Bruder Andreas sich zu Jesus hingezogen, der sie fragt: „Was suchet ihr?“ Sie aber wollen wissen: „Rabbi, wo bist du zur Herberge?“ Er spricht: „Kommet und sehet es!“ (Joh 1,38f) Die beiden sehen sich alles an. Schließlich werden sie vom Feuer der Liebe so entzündet, dass sie ihren Beruf verlassen und endgültig Jesus folgen. Darum auch das Zeugnis des Evangelisten: „Und das Wort ward Fleisch und nahm Wohnung unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit – eine Herrlichkeit, wie sie im einzig geborenen Sohn vom Vater widerstrahlt – voll von Gnade und Wahrheit.“ (Joh 1,14W) Sie finden beim Herrn nicht nur eine Herberge zum Essen und Schlafen, sondern sie erleben ihn. Sie finden ihre „geistige Heimat“. Ihr Suchen nach einer letzten Antwort hat in Jesus eine Antwort gefunden.
Doch wäre es verfehlt zu glauben, Johannes habe Jesus von Anfang an vollkommen verstanden. Der Feuereifer für den Meister ist bei ihm und seinem Bruder Jakobus noch ungeläutert. Die Bezeichnung „Donnerkinder“ für beide Brüder beleuchtet ihre Heftigkeit. So will Johannes eifersüchtig darüber wachen, dass nur die im Namen Jesu heilen dürfen, die als Jünger Jesu von dem Herrn dazu berufen sind. Als der Jünger berichtet, er habe es einem anderen deshalb verwehrt, weist Jesus ihn zurecht mit den Worten: „Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.“ (Lk 9,50). Jesus ist nicht so engherzig, dass er allein in seiner unmittelbaren Gefolgschaft Heilungen zuließe. Er will nicht, dass das Wirken im Namen Gottes auf seine kleine Jüngergemeinde beschränkt bleibt.
Als den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem in einem Samariterdorf die Unterkunft für Jesus und seine Jüngerschaft verwehrt wird, sagen die beiden Zebedäussöhne zum Meister: „Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elias tat.“ Wiederum muss Jesus sie zurechtweisen, dass er nicht den Untergang, sondern die Rettung der Menschen will: „Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten.“ (Lk 9,54f) Sicher werden die beiden Brüder über die harte Zurechtweisung sehr erschrocken gewesen sein. Doch Jesus weist ihnen seinen Weg der Liebe, den Johannes immer mehr mitgehen wird.





























