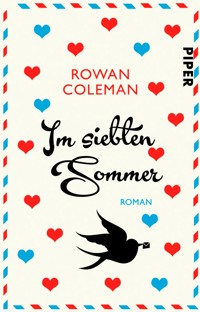10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als man ihr mitteilt, dass ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, bricht Trudys Welt zusammen. Abe, die Liebe ihres Lebens, ist für immer fort. Allein und mittellos sieht die junge Mutter keinen anderen Weg, als mit ihrem kleinen Sohn Will zurück nach Ponden Hall zu ziehen, in das verwunschene Haus ihrer Kindheit, das sie vor Jahren nach einem Streit mit ihrer Mutter verließ. Während sie mit der Trauer um Abe ringt und sich bemüht, Wills Schmerz zu lindern, spenden die alten Mauern von Ponden Hall ihr Trost. Doch erst als sie sich den Geistern der Vergangenheit stellt, erkennt Trudy, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als man sehen kann. Und dass die Hoffnung selbst in der dunkelsten Nacht leuchtet ... Nach ihren Erfolgsromanen »Einfach unvergesslich«, »Zwanzig Zeilen Liebe« und »Beim Leben meiner Mutter« der neue bewegende Roman von Bestsellerautorin Rowan Coleman!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Du und ich und tausend Sterne über uns« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Die Zitate nach den Teilen stammen aus folgender Ausgabe: Emily Brontë: Gedichte/Poems, Deutsch von Elsbeth Ort, Popa Verlag, München 1984, S. 188–191.
© Rowan Coleman 2019Titel der englischen Originalausgabe:»The Girl at the Window«, Ebury Press, London 2019© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 2020Redaktion: Barbara RaschigCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
ERSTER TEIL
Prolog
Kapitel 1
Acht Monate später
Kapitel 2
Ponden 1654
Kapitel 3
Tru und Abe
Kapitel 4
Ponden Hall 1655
Kapitel 5
Tru und Abe
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
ZWEITER TEIL
Tru und Abe
Kapitel 9
Kapitel 10
Ponden 1655
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Tru und Abe
Kapitel 14
Kapitel 15
1658
Kapitel 16
Tru und Abe
Kapitel 17
1658
Kapitel 18
Kapitel 19
DRITTER TEIL
Kapitel 20
1658
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Tru und Abe
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
VIERTER TEIL
Tru und Abe und Will
Kapitel 29
Oktober 1848
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1658
Kapitel 33
Kapitel 34
Tru und Abe
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
1658
Kapitel 39
Kapitel 40
Tru und Abe
FÜNFTER TEIL
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
1659
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
1659
SECHSTER TEIL
Kapitel 47
Kapitel 48
1659
Kapitel 49
Kapitel 50
1659
Kapitel 51
1659
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Tru und Abe
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Tru und Abe
Javari-Tal, indigenes Gebiet im Nordwesten Brasiliens
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Für Julie, Steve, Kizzy und Noah und alle anderen, die Ponden Hall je bewohnt haben, bewohnen und bewohnen werden.
ERSTER TEIL
Nicht feige ist meine Seele,
Sie zittert nicht in der sturmzerzausten Welt,
Ich sehe Himmels Herrlichkeit glänzen,
Desgleichen glänzt Glaube und sichert mich vor Furcht.
Emily Brontë
Prolog
Irgendwo in weiter Ferne klingelt ein Telefon.
»Aufwachen, Tru. Aufwachen. Aufwachen, Tru, wach auf!«
Abe. Ich bin sofort wach, als ich seine Stimme höre, und drehe mich zu ihm um. Doch ich will die Augen noch nicht aufmachen. Ich spüre sein Gewicht auf unserer Bettkante.
»Was ist?«, murmele ich und strecke die Hand nach ihm und seiner vertrauten Wärme aus. Seine langen, schmalen Finger, die sich so oft mit meinen verflechten … meine Liebe. Mein Mann. Mein.
»Ich hab geträumt. Von mir als Mädchen. Von dem Tag, an dem Dad gestorben ist«, erzähle ich ihm. »Das war so echt, als wäre ich wirklich wieder klein … Das Klingeln hat mich da rausgerissen. Wer ruft denn um diese Zeit an? Mitten in der Nacht? Es ist doch noch Nacht, oder?«
»Tut mir leid, Tru.« Abes Flüstern löst sich auf, als meine Hand auf einem kühlen, leeren Laken landet.
»Abe?« Meine Hand wandert suchend über das Bett, aber ich kann ihn nicht erreichen. »Abraham?«
»Aufwachen, Trudy, wach auf.«
»Es tut mir so leid, Tru, ich liebe dich«, flüstert er mir ins Ohr, so nah, dass ich seinen warmen Atem an meinem Hals spüren kann. »Vergiss nicht, dass ich dich liebe – daran wird sich niemals etwas ändern. Auch jetzt nicht.«
»Abraham?«
»Mummy!« Will packt mich am Arm und schüttelt mich.
»Ich bin wach.« Der Schlaf hängt mir schwer wie Blei in den Gliedern. »Ich stehe auf. Warte, Daddy war doch gerade … Abe?«
Doch da ist nichts, nur seine leere Betthälfte. Da fällt es mir wieder ein: Abe ist nicht hier. Er ist in Übersee, in Peru. Seit drei Wochen schon bringt er sich als Allgemeinchirurg in eine sechswöchige Hilfsmission ein.
»Kannst du nicht zu Hause bleiben?«, hatte ich ihn angefleht.
»Du weißt, dass ich das nicht kann«, hatte er gesagt.
»Mummy.« Will klettert zu mir ins Bett und schiebt seine dünnen Beine und eiskalten Füße zwischen meine. »Das Telefon hat mich geweckt. Es hat dauernd geklingelt. Immer wieder, ganz lange. Hast du das nicht gehört?«
»Nein.« Ich knipse die Nachttischlampe an.
Das Festnetztelefon steht daneben. Heutzutage ruft kein Mensch mehr auf dem Festnetz an. Will und ich zucken zusammen, als es wieder anfängt zu klingeln.
»Los, geh ran«, drängelt Will, die Augen weit aufgerissen und glockenwach, wie Achtjährige so sein können. »Das ist bestimmt Daddy!«
Ich weiß nicht, warum ich solche Angst habe abzunehmen. Aber ich habe Angst, als ich es tue. Ich höre sofort, dass es sich um ein Ferngespräch handelt.
»Hallo?«
»Ist das Daddy?« Will streckt die Hand aus, um nach dem Hörer zu greifen. »Ich will mit ihm reden!«
»Gleich.« Ich drehe mich von ihm weg und warte kurz darauf, dass die Stimme am anderen Ende der Leitung etwas sagt, doch dann überschwemme ich die Stille mit vielen hoffnungsvollen Worten. »Abe? Kannst du mich hören? Ich habe gerade geträumt, du wärst hier. Du fehlst uns. Will ist auch hier, sag mal was!«
Ich lache halbherzig und höre den Widerhall meiner verzweifelten Stimme in der Leitung. In der kurzen Stille, die folgt, wird mir schlagartig alles klar.
»Ms Heaton?« Das ist nicht Abe. Ich wusste, dass es nicht Abe sein würde. Es ist nicht mein Geliebter, mein Herz, mein Seelenfreund, mein Alles.
»Ms Heaton, es tut mir furchtbar leid, Ihnen mitteilen zu müssen …«
Ich beobachte Will, und er beobachtet mich. Ich sehe, wie sein Gesicht immer länger wird, und in seinen glänzenden Augen sehe ich unsere gemeinsame Welt implodieren.
Kapitel 1
Acht Monate später
»Da sind wir«, sage ich und reiche Will die Hand, um ihm aus dem Auto zu helfen, das wir am Ende der Straße geparkt haben. Ich atme tief durch und genieße den Anblick der Landschaft, von der späten Nachmittagssonne in Kupfer- und Goldtöne getaucht. Genau so habe ich mir das immer wieder vorgestellt: jedes Mal anders, jedes Mal wechselnd, jedes Mal gleich.
Ponden Hall ist ein aus Licht gebautes Haus.
Es ist ein Signalfeuer, ein Leuchtturm ohne Meer, es blinkt im Dunklen und sendet Nachrichten in die Ferne – für ein paar Auserwählte, die sie hören können.
»Du kannst sie hören, weil du eine Heaton bist und schon immer hier gelebt hast, seit 1540 der Grundstein gelegt wurde. Unsere Vorfahren haben das für dich gebaut und für jeden weiteren Heaton, der je geboren wird«, hat er mir oft gesagt und mir dabei versichernd schwer die Hand auf die Schulter gelegt. »Sie haben das Haus aus dem Berg gebaut. Deine Ma dagegen«, sagte er und senkte die Stimme, »ist keine Heaton, und darum kann sie die Lichter nicht sehen. Sie sieht nur die Schatten.«
Ich habe Ma sechzehn Jahre nicht gesehen. Sie befindet sich irgendwo hinter den dicken, uralten Mauern und wartet nur darauf, mich mit einem »Ich hab es dir ja gleich gesagt« zu begrüßen. Warum also bin ich hier? Weil Abe spurlos verschwunden ist und obwohl ich ganz bestimmt nicht bei ihr Zuflucht suchen wollte, gab es in dieser Situation nur einen einzigen Ort auf der Welt, an dem ich gern sein wollte: zu Hause. Monate verstrichen, Hoffnungen schwanden, das Geld wurde knapp … und am Ende gab ich dem Ruf des Leuchtturms nach. Ich kehrte zurück nach Ponden. Und Ma ist nun mal auch da.
Will klettert an mir vorbei, lässt mich links liegen, bleibt in der Mitte des Parkplatzes stehen und sieht sich um, versucht eine Landschaft zu verstehen, die meinem in der Stadt aufgewachsenen Sohn so fremd ist, wie es auch die Marsoberfläche wäre, in seinem Fall sogar noch fremder.
Für mich dagegen ist es, als würde ich auftauchen und nach Luft schnappen. Mit einem tiefen Atemzug inhaliere ich die saubere, ruhige Luft und recke das Gesicht dem gefälligen Wind entgegen, der meine erhitzten Wangen sanft streichelt und kühlt. Diese Erleichterung. Diese Freude darüber, an einem Ort anzukommen, wo sogar die Luft eine vertraute Freundin ist. Am liebsten würde ich die Arme ausbreiten, um diesen Ort, den ich die letzten sechzehn Jahre jede Sekunde vermisst habe, zu umarmen. Ich verkneife es mir, weil mein Sohn neben mir steht.
»Hier ist nichts«, sagt Will und zieht die Schultern hoch vor Kälte.
»Wie, nichts?« Ich lasse den Blick über das Tal schweifen, von den Hügeln beiderseits der flachen, kühlen Oberfläche des Stausees zum endlos hohen Himmel. »Hier ist alles.«
»Mir gefällt’s hier nicht, ich will nach Hause.« Wills Stimme klingt zerbrechlich und klein. Im folgenden Schweigen ist die Abwesenheit des Londoner Verkehrs zu hören, der nach ihm rufenden Schulfreunde, der gegen den Nachbarzaun rasselnden Fußbälle. Abwesend sind auch das Surren der Waschmaschine und der ständig laufende Fernseher. Und das Lachen von Daddy, der viel zu laut telefoniert, der letzte Mensch auf Erden, der überhaupt gerne telefoniert. Alle Geräusche, mit denen Will aufgewachsen ist, sind in dieser Stille hier abwesend.
»Hier ist es natürlich anders«, sage ich mitfühlend und lege den Arm um seine Schultern. »Ist ja klar, ich weiß. Aber dreh dich mal um, dann siehst du das Haus. Dein Haus. Das Haus, das schon vor deiner Geburt dein war.«
Der Kies unter unseren Füßen knirscht, und ich ignoriere, wie mein Sohn sich unter meiner Berührung versteift, als ich ihn umdrehe, damit er sich das Haus am Hang ansieht.
Dieses Haus, das meine Freundin ist, meine Mutter, mein Zufluchtsort. Ich sehe es im selben Augenblick wieder wie Will. Mein geliebtes Ponden Hall, an den Hang geschmiegt, wie es auf mich wartet, wie es wartet, dass ich nach Hause komme, mit offenen Armen.
Die alten Mauern sind so solide und unvergänglich wie die Felsen des Moors, aus dem sie gemacht sind. Die Rautenfenster blinken und zwinkern im kalten, strahlenden Blau eines wolkenlosen Oktobertages. Die hohe, den Garten umgebende Trockenmauer steht gerade noch so, einige Steine scheinen unsicher aufeinander zu balancieren, wie sie es seit Hunderten von Jahren tun. Was für eine Erleichterung, hier zu sein, in Sicherheit, an einem Ort, der mich bisher noch immer geheilt hat.
Jedes Mitglied der Familie Heaton weiß, dass es in Ponden dunkle Ecken gibt, dass die Geschichte des Hauses finstere Geheimnisse birgt. Dennoch hat bisher noch jeder Heaton das Haus geliebt, und jetzt ist Will dran.
»Ich mag es nicht«, sagt er. »Es sieht kalt aus und alt und voller Spinnen.«
Was Will jetzt sieht, ist nichts als ein Haus ohne seinen Vater darin.
»Ich glaube, du wirst es irgendwann lieben. Weißt du, warum?«
Will sieht zu mir auf, die braunen Augen voll Tränen, die er zu unterdrücken versucht. Langsam schüttelt er den Kopf.
»Weil dieses Haus für dich gebaut wurde. Vor fünfhundert Jahren. Jeder, der bisher hier gewohnt hat, war ein Heaton, und fast jeder Junge, der je hier gelebt hat, hieß entweder Robert oder William, genau wie du.«
»Echt?« Will betrachtet das Haus, und ich halte die Luft an, als seine kalte Hand unbewusst nach meiner fasst, wie sie das früher immer getan hat. »Aber ich bin ein Heaton Jones.«
»Das ist richtig«, sage ich. »Deswegen bist du trotzdem ein Heaton, und das wird dieses Haus wissen, sobald du es betrittst, das verspreche ich dir. Es wird dich erkennen.«
»Klingt ganz schön gruselig«, sagt Will. Womit er nicht ganz unrecht hat, dieser mit Einbauküchen und Nachtlicht aufgewachsene kleine Junge.
»Nicht gruselig, nur anders. Wirst schon sehen.«
»Aber …« Will bleibt auf dem Weg zur Haustür kurz stehen. »Was ist mit Daddy? Wie kann Daddy wissen, dass wir hier sind?«
»Er …« Ich verstumme. Seit dem Flugzeugabsturz wurde mir von allen Experten geraten, Will gegenüber sehr klar aufzutreten, was dieses Unglück betrifft. Das heißt, ich soll Will erklären, dass wir, obwohl kein einziges Wrackteil des Kleinflugzeugs und auch keine Überreste der Menschen an Bord gefunden wurden, leider davon ausgehen müssen, dass Abe tot ist. Dass es praktisch keine Überlebenschancen gibt, wenn man sich ohne jede Hilfe verletzt im tiefsten Regenwald befindet. Sagen Sie Ihrem Sohn, sein Vater wird nie wiederkommen, haben sie mir geraten, sagen Sie ihm, er wird ihn nie wiedersehen.
Nur so kann ein Achtjähriger Trauer wirklich verstehen, haben sie gesagt. Nur so kann er sie verarbeiten und sich vom Geschehenen erholen, auch wenn es keine Leiche und kein Grab gibt. Sagen Sie ihm nicht, dass sein Vater entschlafen oder eingeschlafen ist. Es mag brutal und grausam klingen, sagten sie, die Trauerbegleiter und Sozialarbeiter, aber am Ende ist es das Beste für ihn, nur so wird er damit umgehen und sich davon erholen können. Und darum tat ich genau das. Ich tat, was sie mir gesagt hatten, Will zuliebe, obwohl es mir das Herz brach.
Doch Will hört nicht auf mich. Er glaubt immer noch, dass sein Vater noch lebt, ganz gleich, was ich sage. Mehr noch: Er ist wütend auf mich, weil ich nicht dasselbe glaube.
»Ich habe zu Hause einen Zettel mit der Adresse hingelegt«, erkläre ich ihm, und das ist wahr: Ich habe eine Adresse für die Weiterleitung der Post hinterlassen. »Außerdem habe ich hier gewohnt, als ich Daddy kennenlernte – ich kann dir jede Menge Geschichten von damals erzählen. Daddy weiß das. Er weiß, wo wir sind. Er weiß, wenn wir nicht in der Wohnung sind, dann sind wir hier.«
»Und wieso bin ich dann noch nie hier gewesen?«, fragt Will, als wir den Eingang von Ponden Hall erreichen. Das ist eine Frage, die zu beantworten mir in diesem Moment der Mut fehlt. Den Bruchteil einer Sekunde zögere ich an dem in die hohe Gartenmauer eingelassenen Tor, ich sehe es aus dem Augenwinkel, vermeide, es direkt anzusehen, erinnere mich, was ich einst vor vielen Jahren dort sah. Ich entriegele die alte Haustür und drücke sie auf.
»Hallo«, sage ich zu dem Haus. »Das ist mein Sohn William. Wir sind wieder zu Hause.«
Das Licht fällt durch die bleiverglasten Fenster am anderen Ende der Eingangshalle auf die Steinplatten am Boden. Die Luft steht und ist staubig, es riecht wie in einem Museum, eine längst vergessene, untergegangene Zivilisation. Ganz anders als Ma und ihre Vorliebe für Desinfektionsmittel mit Zitronenduft, mit dem sie ständig alles putzte, pausenlos. Aber für jemanden wie mich, die ihr Arbeitsleben genau solchen Einrichtungen gewidmet hat, trägt es nur zum Gefühl des Nachhausekommens bei.
»Mummy.« Wills Stimme bebt in der Dunkelheit, die das Einzige ist, wovor er je Angst hatte. »Ich will nach Hause.«
»Ist alles in Ordnung, vertrau mir. Ich verspreche dir, dass es dir hier gefallen wird, wenn du dich erst dran gewöhnt hast.«
Wir folgen dem sanften Gefälle des Bodens und biegen rechts ab. Wir gelangen ins Zentrum des Hauses. Unter der Tür zum Wohnzimmer hindurch ist das Flackern von Feuer zu sehen, das Schnüffeln, Schnauben und Kratzen eines Hundes zu hören.
Jetzt ist es also so weit. Das große Wiedersehen. Ein Teil von mir fragt sich, ob sie nach dem ziemlich altmodischen Wechsel einiger kurz gefasster und mit B-Post verschickter Briefe sowie lediglich halb abgehörter Nachrichten auf dem Anrufbeantworter von Jean auf der Middle Farm tatsächlich weiß, dass wir kommen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt gibt es kein Zurück.
»Ma?«, rufe ich, als ich die Tür öffne. »Ma, wir sind da. Wir sind da.«
»Das sehe ich«, erklingt Mas körperlose Stimme. »Ich hab schließlich Augen im Kopf.«
Kapitel 2
Erst wirkt der Raum, einzig beleuchtet vom Feuer und dem letzten Rest Nachmittagssonne, als sei niemand da außer dem alten Retriever, der sie eher halbherzig anknurrt.
»Lass das, Mab«, sagt Ma, und ich sehe mich in Richtung ihrer Stimme um, die aus der dunklen Nische eines hohen alten Portierstuhls ertönt. Ihre klauenähnlichen Hände ruhen auf den rissigen, abgenutzten Armlehnen, bestrumpfte Beine enden in sich auflösenden Hausschuhen auf dem Boden gleich neben dem Hund, an den sich ihre Worte richten. »Jetzt ist es auch zu spät, so ein Theater zu machen, altes Mädchen.«
»Na, Süße.« Will geht in die Knie und streckt Mab die Hand entgegen. Die Hündin beschnuppert vorsichtig seine Fingerspitzen, ihr Schwanz wackelt und schlägt gegen dasselbe Sofa, das wir schon hatten, als ich noch ein Kind war. Will wagt sich noch etwas näher an sie heran, seine Augen leuchten auf, als sie ihren Kopf unter seine Hand schiebt und sich leicht bei ihm anlehnt. Als ich sehe, dass Will sich entspannt, entspanne auch ich, wenigstens ein bisschen.
Ma lehnt sich nach vorne, endlich kann ich ihr Gesicht sehen.
»Du bist älter geworden«, sagt sie.
»Du auch«, antworte ich. Ihr kräftiges, einst blondes Haar ist von Silberstreifen durchzogen. Zierlich wie ein Zaunkönig ist sie schon immer gewesen, jetzt aber ist sie wirklich richtig dünn. Viel zu dünn. Im Schein des Feuers wirkt jede Linie, jedes Grübchen in ihrem Gesicht viel tiefer, der Schädel unter der Haut tritt hervor und lässt sie so viel älter aussehen als fünfzig. Mit einem Mal erfüllt mich eine Sehnsucht, und mir wird klar, dass sie mir trotz allem, was passiert ist, gefehlt hat. Oder zumindest hat mir eine Mutter gefehlt.
»Und das ist der Junge.« Sie zeigt auf Will, ihr undurchschaubarer Blick begegnet meinem. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. »Das ist William.«
»Will. Er liebt Hunde«, sage ich, nur um irgendetwas zu sagen, während ich mich in diesem mir so vertrauten Raum umsehe. Hier bin ich aufgewachsen. Ich möchte dem Verlangen nachgeben, restlos nostalgisch zu werden. Die große Eingangshalle, wie sie sie vor langer Zeit nannten, obwohl sie doch gar nicht so groß ist. Am einen Ende steht der große Eckkamin Wache, am anderen das wuchtige Eichenbüfett, das fast genauso alt ist wie das Haus selbst und schon ganz schwarz durch die Abnutzung. Es reckt sich vom Fußboden bis zur Decke und ist so schwer, dass es mit Bolzen an der Wand befestigt ist. Als ich klein war, habe ich mir oft vorgestellt, es sei so etwas wie Pippi Langstrumpfs Schatztruhe und man könnte in jeder Schublade und hinter jeder Schranktür irgendetwas Wundersames finden, ganz gleich, ob es für Kinderhände gedacht war oder nicht – es war ein eigener Ort, eine ganz eigene Welt für mich. Ma spricht von Mab, irgendwas davon, dass sie sie halb verhungert hinten im Garten gefunden hat. Tieren ist Ma schon immer viel gütiger begegnet als Menschen.
Mit halbem Ohr höre ich, wie Will weitere Fragen zu Mab stellt, und sehe dabei zu, wie die Nacht sich langsam auf die Fenster legt, wie das rautenförmige Glas beginnt, das Kaminfeuer in das Zimmer zu reflektieren. Hoch oben an der Decke, gerade so zu sehen, befinden sich die Metallhaken, an denen früher Fasanen und Fleisch hingen, und am oberen Rand der Wände zeugen hübsch geformte Yorkshire-Stuckrosen davon, dass die Heatons einst von gehobenem Stand waren. Die Steinplatten unter Mas diversen Teppichen sind schon immer da gewesen und nur wenig abgenutzt von Tausenden von Füßen, die sich Tag für Tag über sie hinwegbewegt haben. Mir fällt wieder ein, wie ich früher manchmal mein Gesicht mit der Wange auf den kühlen Stein legte und die Augen schloss und über all diese Füße nachdachte, die den Stein abgewetzt hatten. Ich dachte insbesondere an ein ganz bestimmtes Paar Füße, das dieses Haus fast genauso gut kannte wie ich. Ich schloss die Augen und stellte mir Emily Brontë vor, wie sie an unserem Tisch saß, sich gegen unser Büfett lehnte, sich am Kamin wärmte und immer wieder über die Steinplatten zur Bibliothek des Hauses ging, die sie so sehr liebte. Und während ich so dalag, flüsterte ich ihr meine Geheimnisse zu, denn als ich zehn Jahre alt war, konnte ich mir niemanden vorstellen, der sie besser für sich behalten konnte als die Autorin von Sturmhöhe.
»Ist schon fast zehn Jahre her, dass ich sie zu mir genommen habe, zehn Jahre sind wir jetzt zu zweit ganz allein. Die alte Mab wird sich über etwas frischen Wind sicher freuen.« Ma erhebt sich, und es wird deutlich, dass ich jetzt größer bin als sie. »Sie hat mich gründlich satt. So ein alter Knochen wie ich. Und dann kann sie nicht mal drauf rumkauen, stimmt’s nicht, Mab?«
Mab gibt sich ganz und gar Wills Fürsorge hin und hört überhaupt nicht, was Ma sagt. Ihre große Pfote liegt auf Wills Schulter, während er ihr den Bauch rubbelt, das eine Hinterbein streckt sie freudig in die Luft.
»Tja, William …« Ma beäugt ihn ein klein wenig besorgt. »Ich bin also deine Großmutter.«
Will sieht zu ihr auf und blinzelt.
»Ich hab schon eine«, sagt er. »Granny Unity. Das ist die Mutter von meinem Vater, und sie lebt in Putney in London.«
Nachdem mir aufgegangen war, dass ich die Wohnung nicht alleine würde halten können, hatten wir mehrfach lange Gespräche darüber geführt, ob wir zu Unity ziehen sollten. Ich hatte mir Will und mich in ihrer großen, sonnigen Wohnung mit Garten vorgestellt. Wie sie für uns kochen und sorgen würde, wie sie sich um uns kümmerte und uns mit derselben Liebe und Güte überschüttete wie immer, im Grunde seit Abe mich ihr vorgestellt hatte. Warum also hatten wir uns nicht in ihre Obhut begeben, warum lehnten wir uns nicht an ihre starke Schulter? Sie hat geweint, als wir heute Morgen abfuhren, und Will hat sich auf seinem Sitz umgedreht und die Hände gegen die Heckscheibe gedrückt und ebenfalls geweint.
»Nimm mir nicht das Einzige, das mir von meinem Sohn geblieben ist«, hat Unity mich gestern Abend noch angefleht. Schlussendlich konnte nur die Wahrheit sie überzeugen, so verrückt sie auch klingen mochte.
»Ich will zurück an den Ort, wo für uns alles angefangen hat«, erklärte ich ihr. »Und ich weiß, dass alles viel schwieriger sein wird, als wenn wir bei dir einziehen würden, und ich weiß auch, dass das schwer zu verstehen ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er dort ist und auf mich wartet. Es ist nicht für immer, Unity, es ist nur etwas, das mein Herz jetzt braucht.«
Und das war die Wahrheit: Ich brauchte mein Zuhause. Ich brauchte Ponden mehr denn je, diesen einen magischen Ort auf der Welt, der jede Verletzung heilte, jeden Schmerz linderte wie eine flüsternde Mutter. Seit ich ihn verlassen hatte, war er Teil meines Lebens gewesen. Zwar haben andere freudige Lebensereignisse im Vordergrund gestanden, aber er hat immer im Hintergrund gebrummt. Und in den letzten Monaten hat er mich gerufen, im Dunklen gesungen. Es war der einzige Ort auf der Welt, von dem ich glaubte, dass ich an ihm irgendwann wieder so etwas wie Frieden empfinden könnte, nicht nur für mich selbst, sondern auch für meinen Sohn.
Und da war noch etwas: Ma. Ich hatte sie gefragt, ob wir kommen dürften, weil ich Will eine Pause vom Leben in London gönnen wollte, einen echten Tapetenwechsel, und weil ich Ponden brauchte. Ich hatte erwartet … Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber jedenfalls nicht, dass sie sofort Ja sagen würde. Und der zweite Grund, aus dem ich zurück nach Ponden wollte, war Ma. Vielleicht konnte Ponden ja auch unser Verhältnis heilen.
»Na, dann hast du jetzt eben zwei. Ich bin Granny Mariah«, sagt Ma an Will gewandt, beugt sich etwas steif zu ihm herunter und streckt ihm die Hand entgegen. »Freut mich, dich kennenzulernen, William. Wusstest du, dass alle Männer der Familie Heaton in diesem Haus entweder Robert oder William hießen? Dein Großvater war ein Robert.«
»Ja.« Will ziert sich etwas und schüttelt dann kurz ihre Hand. »Hat Mum mir gerade erzählt. Aber ich bin kein Heaton. Ich bin ein Heaton Jones.«
»Aber Heaton kommt zuerst«, sagt Ma. »Also bist du ein Heaton.«
»Ma …« Wenn sie mir nur etwas Zeit ließe, in der ich mit ihr darüber sprechen kann, wie man am besten mit Will redet, wie man mit ihm umgeht, aber Ma hat schon immer ihren eigenen Stiefel gemacht.
»Ich weiß, wer ich bin.« Will richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf den Hund, und Ma macht eine leicht amüsierte Miene.
»Heaton zuerst«, murmelt sie.
»Danke«, schalte ich mich schnell ein, bevor Ma noch mehr zu Will sagt. »Danke, dass wir herkommen durften. Ich kann mir vorstellen, wie sehr das eigentlich … stört, nachdem du hier so lange ganz allein gelebt hast.«
»Was hätte ich denn sonst sagen sollen?« Mas Blick wandert über mein Gesicht, als suchte sie nach Spuren des Mädchens, das ich mal war. »Du bist schließlich mein Fleisch und Blut. Ich habe dein altes Zimmer für euch hergerichtet, da ist dein altes Bett und eine Matratze. Ich schlafe nicht mehr oben – das Dach ist eine Katastrophe –, aber in dem Zimmer geht’s, solange es nicht regnet. Falls ihr Hunger habt – es gibt Brot, Käse, Butter und Schinken.«
»Ich habe Hunger!«, sagt Will.
»Na dann. Richtet ihr euch mal oben ein, ich mache ein paar Brote.« Ma stützt sich am Eichenbüfett ab und geht Richtung Tür. Kurz befürchte ich, sie könnte stürzen.
»Ma, das kann ich doch …«
»Du weißt doch gar nicht, wo alles ist.« Ma winkt ab. »Tu, was man dir sagt, und bring eure Sachen nach oben.«
»Gut«, sage ich und fühle mich wieder ein bisschen wie mit fünfzehn, als ich mich fast zwingen musste, das eine oder andere unbeholfene Wort rauszukriegen. »Ich habe mit dem Stromversorger gesprochen, da wurde mir gesagt, der Strom müsste heute oder morgen wieder da sein. Du hast denen ziemlich viel geschuldet.«
Kein besonders subtiler Hinweis darauf, dass ich von unserem kümmerlichen Ersparten ihre Schulden bezahlt habe, aber es rutscht mir trotzdem raus.
»Und bis dahin …« Ma zeigt auf drei halb abgebrannte Kerzen und eine platt gedrückte Streichholzschachtel.
Mab hebt schwach protestierend den Kopf, als Will aufsteht.
»Alle sagen, mein Vater ist tot.« Er sieht Ma an. »Aber das ist er nicht. Ich weiß, dass er das nicht ist.«
»Meinetwegen«, sagt Ma, aber Will ist noch nicht fertig.
»Granny Unity sagt, du bist eine Rassistin und dass du darum nicht wolltest, dass Mum und Dad heiraten. Und wenn du Rassistin bist, dann heißt das doch, dass du mich auch hasst, oder?«
»Will …« Mein Instinkt sagt mir, ich soll eingreifen, aber das ist falsch. Ich bin so stolz auf seine entschieden gestrafften Schultern, seine Weigerung, wegzusehen, sein erhobenes Kinn. Mein kleiner Junge, acht Jahre alt, und mit jedem Tag erhöht sich die Anzahl der Minuten, in denen ich ihn nicht beschützen kann, der Kämpfe, die nur er selbst austragen kann – und das Schlimmste ist, er hat sich bereits daran gewöhnt.
»Na dann«, sagt Ma. »Eine direkte Frage verdient eine direkte Antwort.« Sie wendet sich Will zu und fixiert ihn aus ihren blassblauen Augen. »Ich habe deinen Vater nie gehasst. Ich habe ihn für einen sehr anständigen Mann gehalten, nur nicht für den richtigen Mann für meine Tochter. Ich hatte meine Gründe dafür. Und deine Mutter hatte ihre. Darüber haben wir uns zerstritten. Aber eins kann ich dir sagen, Will, es hatte nichts damit zu tun, dass dein Vater schwarz ist. Überhaupt nichts. Man kann mir vieles nachsagen, aber nicht, dass ich Rassistin wäre, und wenn du hier je einem Rassisten begegnen solltest, dann jage ich ihn mit meinem Stock vom Hof, verstanden? Ich will diesen Abschaum nicht in meiner oder deiner Nähe haben. Du bist mein Enkel, und du bist hier herzlich willkommen. Was ich nicht von vielen Menschen sagen kann. Dass du’s nur weißt.«
»Mum hat auch gesagt, dass du keine Rassistin bist«, erklärt Will. »Sie hat gesagt, du bist einfach nur gemein. Ich wollte sehen, ob das stimmt.«
»Mag sein, dass ich gemein bin.« Ma zuckt die Schultern, als wollte sie sagen: Dem ist nichts hinzuzufügen. »Ich kann nichts dafür, dass ich bin, wer ich bin, oder? Wenn du willst, kannst du mich dafür hassen.«
Dieses Mal ist es Will, der die Schultern zuckt.
»Du magst Hunde«, sagt er. »Jedenfalls ist mein Dad nicht tot. Er kommt wieder nach Hause, das weiß ich.«
»Mag sein, dass du recht hast, mein Junge«, sagt Ma sanft. »Nach einem ganzen Leben in diesem Haus neige ich dazu, daran zu glauben, dass der Tod keine ganz so endgültige Angelegenheit ist, wie allgemein behauptet wird.«
Zum ersten Mal, seit wir in London losgefahren sind, lächelt Will.
Ponden 1654
Gelobt sei der Herr für seine Güte, mich an diesen Ort zu führen, an dem man mir Zuflucht gewährte und zu essen gab, an dem man mir Schutz bot, als ich verloren war und eine Ausgestoßene. Gelobt sei der Name des Herrn in Ewigkeit dafür, dass er mich errettet hat, und gelobt sei mein Freund und Bruder Robert Heaton, der mir, um seine eigenen Lehren, die ihm nun verwehrt werden, nicht zu vergessen, Wörter und Buchstaben beibrachte, auf dass ich einige der Bücher lesen kann, die es in diesem großen Haus gibt.
Die Worte, die ich nun niederschreibe, sind mein Geschenk an den lieben Robert. Die Worte, die ich zum Preis und Dank meines Herrgottes zusammenstellen möchte, sollen die Geschichten unseres Lebens festhalten und von dem Segen erzählen, dass wir durch Seine Gnade über so viele lange und schwierige Meilen hinweg zueinandergefunden haben.
Ich war kaum mehr als neun Jahre alt, als ich nach Ponden Hall kam, aber ich war kleinwüchsig und unterernährt, darum kann ich auch älter gewesen sein.
Der Krieg war zwei Jahre zuvor gewonnen, und doch marschierten immer noch Soldaten durch das Land und nahmen sich, was sie konnten, mit Gewalt. Viele Menschen starben des Hungers, selbst in dieser wunderschönen Grafschaft Yorkshire, wo die Menschen hohe Steuern zahlen. Die Armen kommen nie zur Ruhe, sie erhalten kaum Hilfe, nur das, was die Gemeinde erübrigen kann, und das ist kümmerlich. Und so kam es, dass meine eigene Mutter mich auf der Straße an meinen Herrn und Vater, einen gewissen Henry Casson, verkaufte. Möge Gott ihr vergeben.
Henry Casson war einst Söldner von der anderen Seite der Grenze, und er gab keinen gütigen Vater ab, vielmehr erwies er sich als ein durch und durch böser und grausamer Mann.
Wir reisten viele Tage, Tage, an denen er mich mal als seine Tochter bezeichnete, mal als seinen Hund. Wir zogen von Haus zu Haus, und er nahm und stahl alles, was er kriegen konnte, ohne Rücksicht auf die Folgen. Bis wir nach einem sehr blutigen Zusammenstoß auf der Straße, den ich nicht näher zu schildern wage, an diesen Ort kamen. Henry Casson wusste, dass die Hausherrin vermutlich verwitwet war, denn ihr Mann war nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er beschloss, hierzubleiben.
Am ersten Tag hatte ich große Angst vor dem, was er tun würde, ich versteckte mich in den Schatten und dem Rauch, der sich dort gesammelt hatte, als ich ihn an dem großen Tisch sitzen sah, im Schatten eines turmhohen Büfetts, wie er mit der Herrin des Hauses, Mistress Anne Heaton, sprach. Wie schon zuvor, bezeichnete er sich als meinen Vater und mich als ein mutterloses Mädchen. Er sagte ihr, dass sie des Schutzes eines starken Mannes bedurfte, der sich um sie und ihren Besitz kümmerte und dafür sorgte, dass alles mit rechten Dingen vor sich ging.
Er konnte einen sehr freundlichen Ton anschlagen, wenn es ihm von Nutzen war.
In dem Augenblick fand Robert Heaton mich, wie ich mich an die Wand kauerte, und er sagte mir, ich solle keine Angst haben, und dass das Dienstmädchen, Betty, uns in der Küche Buttermilch geben würde.
»Ich bin Robert Heaton, der Herr in diesem Haus«, erklärte er mir an dem Tag. »Ich bin zwölf Jahre alt, und du bist hier herzlich willkommen.«
Die Milch war warm und süß, das Feuer angenehm, und ich dankte dem Herrn, dass er mir so viel Gutes widerfahren ließ. In all den Tagen und Nächten, als ich Casson durch das Land gefolgt war und nicht wusste, was ich tun sollte, außer zu sterben, war ich meinem Herrn gegenüber nie ungehorsam gewesen. An jenem Tag aber, als ich sah, wie gut dieses Haus war, wie anständig und gottesfürchtig, beschloss ich, mich gegen Casson zu wenden und Robert vor der Gefahr zu warnen, die an seinem Tisch saß.
»Ich heiße Agnes, ich weiß nicht, wie alt ich bin, und dieser Mann ist nicht mein Vater«, erklärte ich ihm. »Ich weiß, dass er vorhat, deine Mutter zu heiraten. Er will hierbleiben, solange es für ihn von Nutzen ist.«
Während ich dies in schlichten, unbeholfenen Worten niederschreibe, kann ich den Schmerz und die Trauer in Roberts Gesicht wieder vor mir sehen.
»Vater zog in den Krieg und kehrte nicht zurück«, erzählte Robert mir. »Meine Mutter kommt alleine nicht zurecht.«
»Sie muss es versuchen«, sagte ich mit so viel Nachdruck, wie es ein so junges, unscheinbares Mädchen vermochte. »Sag ihr, dass sie es versuchen muss.«
Am selben Tag nahm Robert meine Hand und versprach mir, dass er mich, solange ich mich in Ponden Hall aufhielt, vor allem Übel beschützen würde. Lieber Gott, ich danke dir für dieses Geschenk, für den Schutz und die Fürsorge, für die Worte, die nun meine werden, obschon ich doch arm und von niedriger Geburt bin, und ich verspreche, dass ich sie auf immer und ewig nur gebrauchen werde, um Deinen Namen zu preisen.
Und dass meine Freundschaft zu Robert niemals gebrochen oder beendet wird, dass die ihr innewohnende tiefe Zuneigung im Gegenteil alle Zeiten überdauern wird.
Agnes Casson, denn ich weiß nicht, mit welchem Namen ich geboren wurde.
Kapitel 3
Knarzender Fußboden, ein Atemhauch an meiner Wange, Abes Hand warm und weich an meinem Rücken, sein Duft. Ganz kurz werde ich sehr ruhig, fühle mich sicher, und dann …
Ich öffne die Augen und starre das vorhanglose Fenster an, konzentriere mich darauf, die in meinem Brustkorb sitzende Trauer zurückzudrängen. Es ist jeden Morgen dasselbe, der Schock und das Verlustgefühl erneuern sich mit jedem Sonnenaufgang.
Die letzten Spuren des nächtlichen Himmels, die durch die Ranken des das Fenster zur Hälfte verdeckenden Efeus zu erkennen sind, lösen sich langsam auf und verwandeln sich in ein perfektes Königsblau. Ich habe viel länger geschlafen, als ich wollte, und verstehe gar nicht, wie das gehen konnte, auf diesem fadenscheinigen Teppich auf dem knarzenden, sich die ganze Nacht hindurch ständig unter mir bewegenden Fußboden.
Wills schmales Bett ist leer, er ist sicher auf der Toilette. Es fällt mir schwer, mich vom Boden zu erheben, meine Muskeln sind steif, und meine Knochen jammern.
»Will? Alles okay?«, rufe ich. Das Zimmer scheint kurz zusammenzuzucken, es hat lange keine Stimmen gehört, das gefällt mir. Als Kind habe ich manchmal stundenlang geschwiegen und die Stille genossen. Als Erwachsene verbringe ich viel Zeit alleine mit nichts als dem Flüstern von Büchern. Die Stille ist mir zur Gefährtin geworden, zu etwas, das sich außerhalb meines geschlossenen Mundes entwickelt und mich beschützt. Ma ist hier schon lange allein, schon sehr lange, und ihr Schweigen ist in alle Ritzen dieses Gemäuers gekrochen und hat auch das Haus zum Schweigen gebracht.
»Rede mit mir«, flüstere ich in die kühle Luft. »Du fehlst mir.«
Und das Zimmer, das einst mein Reich war, antwortet. Mit einem Füllhorn von Erinnerungen, die sich Gehör verschaffen wollen. Früher, lange vor meiner Geburt, war dieses Zimmer doppelt so breit und doppelt so lang, eine riesige, wichtige Bibliothek, die beste im Umkreis von Meilen, mit teilweise heute noch intakten Bücherregalen. Doch meine gesamte Kindheit hindurch war dieses Fragment eines ehemaligen Raums mein Zimmer, und die Bücher in den Regalen waren meine Freiheit. Es ist seltsam, den Ort, an dem ich so glücklich und zufrieden war, mit erwachsenen Augen wiederzusehen. Und sehr bewegend. Ich spüre die Echos jenes Kindes um mich herum. Selbst mit der abblätternden himmelblauen Farbe, die ich mir ausgesucht hatte, damit sie zum Blick aus meinem Fenster passte, und der dicken Staubschicht auf allen Oberflächen finde ich diesen Ort immer noch magisch – auch wenn ich zugeben muss, dass das große Loch in der Zimmerdecke ein wenig stört …
Irgendwann einmal muss sintflutartiger Regen einen Großteil des Deckenputzes zum Absturz gebracht haben, denn direkt über mir klafft ein schwarzes Loch und darüber eine kleinere Lücke zwischen den Dachziegeln.
»Um dich hat sich lange niemand gekümmert.« Ich spreche ganz natürlich mit dem Haus, wie ich es immer getan habe, als würde ich mit einem lieben Freund plaudern. »Tut mir leid, dass ich so lange weg war, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich werde das eine oder andere in Ordnung bringen, damit du wieder auf die Beine kommst.«
Heute habe ich das Gefühl, das ist möglich.
Gestern Abend, als ich unter dem Loch in der Decke lag, todmüde, sodass ich eigentlich wie ein Stein hätte schlafen können, sah ich ganz oben zwischen den hohen Gesimsen des Hauses etwas glitzern. Als meine Augen sich an die sanfte Dunkelheit der Nacht gewöhnt hatten, erkannte ich, dass es ein einzelner Stern war, der da über mir funkelte, dessen Licht durch die Zeit reiste, sich vor Tausenden, vielleicht Millionen von Jahren in einer fernen Galaxie auf den Weg gemacht hatte; der Geist eines Sterns, der vielleicht längst erloschen war, der einen so weiten Weg zurückgelegt hatte, nur um von mir gesehen zu werden. Da wusste ich, dass, ganz gleich, was mich an diesen endlos vor uns liegenden Tagen erwartete, nichts mir Angst machen konnte, weil das Licht so viele Millionen Kilometer zurückgelegt hatte, ohne die Erwartung, je gesehen zu werden, und doch gab es in dieser kleinen Ecke des Universums meine Augen, und die hatten es jetzt gesehen. Das machte mir Hoffnung, es machte mir Hoffnung, dass es wunderschöne Dinge gab, die ich noch nicht sehen konnte, die sich mir aber eines Tages zeigen würden. Und so blickte ich den Stern an, bis ich einschlief in dem Wissen, dass ich ihn bei Tageslicht nicht mehr würde sehen können – dass er aber immer noch da wäre.
Ich stehe auf, stromere herum, beginne mit dem Auspacken, lege Wills Sachen ordentlich ins Bücherregal. Ich brauche einen trockenen Platz für meine Unterlagen vom Lister-James-Museum, in dessen Archiven ich gearbeitet habe, bis … bis ich eine Pause von der Konservierungsarbeit brauchte, vom Erfassen und Registrieren jedes einzelnen Gegenstandes, den es dort gab, alt wie neu. Mir war diese etwas unausgereifte Idee gekommen, alle alten Familiendokumente zu durchforsten, die zum großen Teil in dem großen Büfett unten stecken, und aus vielen Jahrzehnten abgelegter Verwaltungsunterlagen ein richtiges Heaton-Archiv anzulegen. Aber das war, bevor ich wusste, in welch desolatem Zustand sich das Haus befindet. Sieht ganz so aus, als würde ich mein Erspartes viel schneller ausgeben müssen als gedacht, aber wenigstens würde eines Tages alles Will gehören.
Wo ist der eigentlich?
Wieder rufe ich nach ihm, ziehe die schwere Zimmertür auf und gehe zum Badezimmer. Da ist er nicht.
»Liebes Haus«, sage ich sehr höflich. »Bitte verrate mir, was du mit meinem Sohn gemacht hast.«
Am Ende des Flurs befindet sich der älteste Teil des Gebäudes, ein Wächter durch die Zeiten. Unter einem großen steinernen Sturz hängt noch immer die Originaltür, fünfhundert Jahre alt, sie öffnet sich einen Spalt, gerade genug, um etwas Licht in die Dunkelheit zu lassen. Natürlich wäre dieser Raum mit einer fertigen Höhle darin das perfekte Versteck für einen Achtjährigen, und da Will keine Ahnung hat von seiner Bedeutung, würde er nur finden, dass das Zimmer nachgerade zu Abenteuern einlädt.
»Will? Bist du hier drin?«
Ich öffne die Tür weiter, Staub wirbelt auf und tanzt wie Funkenregen im Licht, Holz knarrt und flüstert.
Das Zimmer sieht noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe, es ist leer bis auf den berühmten vierhundert Jahre alten Alkoven, jenes Schrankbett, das Emily Brontë in Sturmhöhe verewigte, und das Fenster, an dem sie den Geist von Catherine Earnshaw zu sehen glaubte, wie er mit blutiger Hand die Scheibe durchschlug. Heute sieht der Raum eher aus, als könne man Dornröschen darin finden, das Morgenlicht wirft grüne Schatten, es fällt durch die Bäume und die Reben, die das Haus inzwischen viel zu dicht bewachsen, sodass dieser Raum anmutet wie eine Lichtung in einem dichten Wald. Die Tür des Alkovens ist geschlossen, von Will nichts zu sehen.
»Will?«, rufe ich. Keine Antwort. Aber ich kann ihn spüren. Seine Bewegungen. Seine Stimmung. Ich muss behutsam sein. »Ziemlich cooles Zimmer, oder? Wegen diesem Zimmer ist Ponden Hall ganz schön berühmt, und weißt du, warum? Weil früher, vor langer Zeit, immer mal wieder eine berühmte Schriftstellerin nach Ponden Hall zu Besuch kam, Emily Brontë, der tollen Bibliothek wegen. Und dieses Zimmer und das Bett, in dem du gerade bist, beschreibt sie in ihrem Roman Sturmhöhe. Ist doch echt cool, oder? In einem Haus zu wohnen, das weltberühmt ist und in dem schon so viele Menschen zu Besuch waren – wenn auch nur im Geiste.«
Ich warte, er wartet. Das Zimmer wartet, gespannt.
Dann wird die Tür des Alkovens aufgeschoben, und Wills zerzauster Kopf kommt zum Vorschein, sein Gesicht ist schlafzerknittert.
»Was mache ich hier?« Er blinzelt mich an. »Hier bin ich doch nicht ins Bett gegangen, oder?«
»Hm«, sage ich. »Ich glaube, das heißt, dass Ponden dich mag.«
»Was willst du damit sagen?« Will schüttelt verschlafen den Kopf und blinzelt gegen das Licht an. »Wie bin ich hierhergekommen?«
»Ich vermute, im Traum«, sage ich und klettere neben ihn in den Alkoven. Die Scheiben des quadratischen Fensters in der Steinmauer sind von seinem Atem beschlagen, und ich strecke die Hand nach der auf der Fensterbank liegenden Familienbibel aus. »Als wir in London in die neue Wohnung gezogen sind, bist du manchmal geschlafwandelt, aber das hat sich mit der Zeit wieder gelegt. Ich schätze, du reagierst einfach auf die Ortsveränderung.«
»Ich mag keine Veränderungen«, sagt Will verzagt.
»Und das Bett hier auch nicht?« Lächelnd drücke ich die Handflächen gegen das dunkle Holz. »Als ich klein war, habe ich immer gespielt, das hier wäre mein Schiff, meine fliegende Untertasse, mein Flugzeug, mein Spielhaus …«
»Es ist ein Bett. Ein blödes Bett in einem Schrank«, sagt Will. »Warum sollte jemand in einem Schrank schlafen wollen?«
»Weil früher mal alles in ein und demselben Zimmer gemacht wurde: kochen, arbeiten, essen, schlafen … In ein Schrankbett konnte man sich zurückziehen.«
»Igitt.« Will rümpft die Nase.
»Weißt du noch, wie ich dir mal erzählt habe, dass Ponden voller Geschichten steckt?« Ich streiche ihm die langen Locken aus der Stirn. Im Morgenlicht leuchten seine eigentlich braunen Augen moosgrün.
»Ja«, sagt er. »Aber ich verstehe nicht, wie in einem Haus Geschichten stecken können. Häuser sind Gebäude, aus Stein, nicht aus Geschichten.«
»Stell es dir ein bisschen wie Hubble vor, das Teleskop«, sage ich und lege mich hin. Kurz darauf tut Will es mir nach. »Dieses Haus ist wie eine Linse oder ein auf Hochglanz polierter Spiegel in einem Teleskop. Es kann bis weit in die Vergangenheit blicken – und vielleicht sogar in die Zukunft. Man kann sich hier so viele Geschichten ausdenken, so viele Abenteuer erleben. Manche sind schon einige Jahre her, andere sind noch gar nicht passiert, aber alle warten sie hier auf dich.«
Will schweigt, sein Blick folgt den Wolken am Himmel.
»Ich weiß, dass das gerade alles sehr viel ist für dich«, sage ich. »Wirklich. Danke, dass du zu mir hältst.«
»Mir geht es schon wieder besser«, sagt Will und sieht mich an.
»Wirklich?«, frage ich behutsam. »Wie das?«
»Weil ich glaube, dass Daddy uns hier finden wird. Ist ein leuchtender Ort.« Er scheint sich seiner Sache so sicher, dass auch ich einen kurzen Moment daran glaube. Ich kann Abes Herzschlag spüren, seine Stimme hören, seine Größe und Stärke neben mir fühlen. Meine Vernunft sagt mir natürlich, ich soll Will widersprechen, aber ich spüre es immer noch, jenes Sehnen im Herzen, das mich nach Hause geführt hat.
»Komm«, sage ich und küsse seine warme Haut, während er sich entwindet. »Wir packen dich jetzt schön warm ein, und dann machen wir dir was zum Frühstück, okay?«
»Mummy …?« Will rollt sich in meine Arme, und ich drücke ihn an mich, halte ihn, meinen Sohn, mein Herz.
»Ja, mein Kleiner?«
»Du hast gesagt, du würdest mir deine und Daddys Geschichte erzählen, du hast gesagt, du würdest mir erzählen, wie ihr euch hier kennengelernt habt.«
»Stimmt.« Ich lasse ihn los, damit er aus dem Alkoven klettern kann. »Das ist eine lange Geschichte, Will.«
»Na ja«, sagt er, als ich ihn aus dem Zimmer trage und die Tür sich wie von selbst hinter uns schließt, »das scheint mir ein Haus zu sein, in dem man mehr Zeit hat als sonst.«
Kurios, er ist erst ein paar Stunden hier und hat das Haus bereits verstanden. Sieht aus, als hätte Ma recht: Er ist eben doch ein echter Heaton.
Tru und Abe
»Mir gefällt, wie du lächelst.«
Das war das Erste, das Abe zu mir sagte. Nicht mein Lächeln, sondern wie ich lächele.
Ich hatte ihn den ganzen Abend schon verstohlen beobachtet, während ich mich auf der einen Seite des Tresens befand, wo ich eigentlich nur benutzte Gläser einsammeln sollte, de facto aber auch Bier ausschenkte, und er auf der anderen Seite, wo er ein Glas nach dem anderen leerte. Er war nicht der, der am lautesten lachte, und er war auch nicht der lustigste oder der bestaussehende seiner Freunde. Aber ihn umgab eine Ruhe und Gemächlichkeit, es war, als folgten seine Bewegungen einer unbewussten Choreografie. Ich hatte mir bereits mindestens elf Geschichten über ihn ausgedacht – wer er war, was er machte –, bevor ich das erste Mal überhaupt mit ihm sprach, und hatte mich letztlich für Bergsteiger entschieden, ein Freeclimber, der schon den Everest bezwungen hatte. Seine Hände hatten mich davon überzeugt, seine einerseits eleganten, andererseits wahnsinnig starken Hände.
»Studenten«, hatte Mick, der Wirt, gemurmelt, und indem er mir deutlich machte, dass er wenig bis gar nichts von solchen Leuten hielt, hatte er meine schöne Geschichte mit einem einzigen Wort zunichtegemacht.
Studenten bekamen wir hier am Rande des Moors nur selten zu Gesicht, obwohl die nächsten beiden Unistädte gar nicht weit entfernt waren. Aber wir hatten immer reichlich Touristen aus aller Welt zu Gast. An einem x-beliebigen Abend hatten wir typischerweise eine Gruppe Japaner da, die gerade von Top Withens gekommen war, dem mutmaßlichen Schauplatz von Sturmhöhe, oder Paare im Anorak-Partnerlook oder einige Einheimische, für die der Pub eine Art zweites Wohnzimmer war. Man könnte meinen, in einer kleinen Dorfkneipe wie der unseren, vollkommen abseits der Rollbahn, würden alle verstummen, wenn ein Haufen Medizinstudenten hereinkam, doch weit gefehlt. Durch die Türen unseres Pubs war schon jede erdenkliche Form menschlicher Existenz getreten.
Mick wollte natürlich gerne Geld verdienen, aber gegen die Studenten hatte er irgendetwas, vor allem ihr lautes Gelächter konnte er nicht leiden, nur warum, das war mir nicht ganz klar. Aber sie sorgten ja für Umsatz, und darum bediente er sie weiter und ich auch.
»Mir gefällt, wie du lächelst«, hatte Abe also leicht schwankend gesagt. Hohe Wangenknochen, groß und eher dünn, sein Lächeln mit etwas Schlagseite wie er selbst.
»Wie ich lächele?«, fragte ich und lehnte mich weit zu ihm über den Tresen, weil seine Kumpel aus voller Kehle sangen und er etwas verwaschen sprach.
»Ja, irgendwie schief, und man sieht so viele Zähne.«
Ich lachte, er lachte – dann torkelte er zu einem Barhocker und pflanzte sich unbeholfen wie ein Welpe darauf.
»Um mich herum dreht sich alles. Ich trinke normalerweise überhaupt nicht«, sagte er. »Wir sollten wandern, für einen guten Zweck. Von Trinken war keine Rede gewesen. Und auf einmal ist die Ansage ›Wer nicht mittrinkt, gehört nicht dazu‹.«
»Bist du nicht ein bisschen alt für diese Art von Gruppenzwang?«, lachte ich und füllte ihm ein Glas mit Leitungswasser. »Hier, runter damit, und dann mache ich dir einen Kaffee.«
»Ich studiere Medizin«, sagte er, lehnte sich gefährlich weit auf dem Hocker nach hinten und schmiss sich gerade noch rechtzeitig wieder nach vorne. »Ich bin Abraham. Die meisten nennen mich Abe. Ich werde Arzt.«
»Glückwunsch«, sagte ich. »Ich bin Trudy, kurz Tru.«
»Macht dich das nicht an? Dass ich mal Arzt sein werde?«, fragte er und zeigte in Richtung seiner Kumpel, die tuschelten und feixten wie Kinder. »Die haben gesagt, damit könnte ich Eindruck schinden.«
»Dazu gehört schon ein bisschen mehr als ein zukünftiges gutes Einkommen«, antwortete ich.
»Zum Beispiel?«, fragte er.
»Zum Beispiel: Wer ist dein Lieblingsdichter? Welches Kunstwerk kann dich zu Tränen rühren? Hast du je oben am Moor gestanden und in den Himmel geschrien? Wie findest du Sturmhöhe? Kannst du Lieder schreiben, glaubst du an Geister, träumst du davon, zum Mars zu fliegen, glaubst du, dass du vielleicht nicht zum ersten Mal auf der Welt bist?«
Abe blinzelte mich an, legte kurz die Stirn auf dem Tresen ab und sah dann wieder zu mir auf.
»Ach, so eine bist du«, sagte er nach einer Weile. »So eine von denen, die denken können.«
»Ich kenne kein Mädchen, das nicht denken kann«, antwortete ich, wobei dieser Satz aussagekräftiger gewesen wäre, wenn ich in der Schule viele Freundinnen gehabt hätte. Hatte ich aber nicht, weil ich meine Zeit am liebsten mit Büchern und längst verstorbenen Schriftstellern verbrachte.
»Warum verdingst du dich dann hier im Pub?«, fragte er angriffslustig. »Bist du dazu nicht zu clever?«
»Wir können ja nicht alle Ärzte werde«, sagte ich. »Außerdem mache ich gerade Abi.«
»Oh.« Er kniff ein Auge zu. »Willst du mit mir rausgehen?«
»Nein«, sagte ich. »Draußen ist es scheißkalt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich übergeben wirst.«
»Aber ich sehe immer noch gut aus, oder?« Abe grinste mich an und fiel dann vom Hocker.
»Ich glaube, ihr geht jetzt mal besser nach Hause«, schaltete Mick sich ein und bewegte seinen nicht unbeträchtlichen Leib hinter dem Tresen hervor. »Na los, Jungs, ihr wollt doch morgen keinen Kater haben. Ich mach jetzt eh dicht.«
Die Studenten protestierten und fluchten und sangen weiter, aber alles ganz friedfertig. Ich beobachtete Abe dabei, wie er aus der Tür taumelte und sich kurz vorher noch einmal nach mir umsah. »Ich komme morgen wieder«, versprach er. »Nüchtern … Um dir zu sagen, dass ich mich auf den ersten Blick in dich verliebt habe.«
»Gute Idee«, sagte ich und verdrehte Richtung Mick die Augen.
Mick hatte mir zwar angeboten, mich nach Hause zu fahren, aber ich wollte lieber zu Fuß gehen, ich mochte die Ruhe, die Kälte und den Geruch in der Luft, nachdem es geregnet hatte, so erdig und satt mit dem leicht roten Geschmack von Eisen. Als ich in jener Nacht am Stausee vorbeispazierte, war der Mond so hell, dass er einen hellen Schein hinterließ, als er hinter den Hügeln unterging. Die Dunkelheit war magisch und verheißungsvoll, es war eine Nacht, in der Liebe auf den ersten Blick tatsächlich passieren konnte, wenn auch nicht mir. Ich hörte die Insekten im Dunklen surren und unsichtbares Getier im Unterholz rascheln. Schleiereulen und Fledermäuse sausten über meinen Kopf hinweg und riefen, und ich war ein Teil von all dem, auch ich war ein wildes Geschöpf unter den Sternen.
Und als ich an das dachte, was der Medizinstudent im Pub zu mir gesagt hatte, überkam mich das Gefühl, dass das Leben vielleicht doch nicht unbedingt so einsam sein musste.
Am nächsten Tag klopfte es an der Haustür. Mick.
»Muss ich arbeiten?«, fragte ich und wollte schon nach meinem Mantel greifen.
»Nein, aber ihr könntet euch mal ein Telefon zulegen.« Er schnaufte, obwohl er mit seinem Land Rover bis direkt vors Haus gefahren war. »In meinem Auto sitzt irgendein Vollidiot, der sich weigert, wieder zu gehen, bevor er mit dir gesprochen hat, und ich wollte ihm jetzt nicht unbedingt deine Adresse auf die Nase binden, von daher …«
Er zeigte zum Auto, in dem ein ziemlich bedröppelt aussehender Abe saß. Etwas halbherzig winkte er mir zu.
Ich sah Mick an. »Von daher dachtest du, du fährst ihn lieber persönlich her, damit er mich umbringen kann?«
»Ach, Scheiße.« Mick nahm die Kappe ab und raufte sich die wenigen verbliebenen Haare. »Jetzt komm schon, sprich mit ihm, ja? Ich warte hier und zieh ihm eins über, falls er sich als Bösewicht erweist.«
»Wer ist da?«, rief Ma aus der Küche.
»Niemand, Ma!«, rief ich zurück. »Nur Mick, der fragt, ob ich mehr im Pub arbeiten kann. Er will, dass wir uns ein Telefon anschaffen!«
»Lass mich da bitte aus dem Spiel«, sagte Mick und meinte das durchaus ernst. Mas scharfe Zunge war in der Gegend schon damals berühmt-berüchtigt.
»Ich glaube, du kannst verschwinden«, sagte ich, den Blick auf Abe gerichtet. »Der sieht harmlos aus.«
»Das tun Mörder immer«, sagte Mick. »Außerdem hat er mir erzählt, dass er Chirurg werden will, und wer, wenn nicht die, weiß, wie man Leichen zerlegt?«
»Wenn er mir zu nahe kommt, rufe ich nach meiner Mutter.«
»Und wie kommt er zurück?«, fragte Mick.
»Er ist zum Wandern hier, Mick. Ich glaube, er wird den Weg schon finden.«
»Wenn du heute nicht rechtzeitig zur Arbeit kommst, weil du tot im Graben liegst, gibt’s Ärger«, erklärte Mick bierernst. »Wind kommt heute aus Westen, wenn du laut genug schreist, hören wir dich vielleicht.«
Abe stieg aus und lächelte, doch bevor er ein Wort sagen konnte, zerrte ich ihn ein ganzes Stück den Hügel hinauf, außer Sichtweite des Hauses, und marschierte immer weiter. Es war ziemlich schnell klar, dass diese Wohltätigkeitswanderung mehr mit Trinken als mit Wandern zu tun hatte.
»Wo gehen wir hin?«, keuchte er, während er versuchte, mit mir Schritt zu halten.
»Meine Mutter ist neugierig«, sagte ich. »Glaub mir, du bist noch nicht bereit, sie kennenzulernen.«
»Stimmt.« Unbeholfen stolperte er mir hinterher.
Als wir uns außerhalb des Radars meiner Mutter befanden, blieb ich abrupt stehen. »Also, was willst du?«
Er sammelte sich und holte tief Luft. »Ich hab doch gesagt, dass ich wiederkomme …«
»Stimmt.«
»Um dir zu sagen, dass ich dich liebe.«
»So ein Blödsinn.«
»Vielleicht.« Er grinste und zuckte mit den Schultern. »Aber mir gefällt, wie du lächelst, so schief und mit so vielen Zähnen, und deine Haare sind so wild durcheinander, und ich mag deine blauen Augen. Hör zu, ich bin jetzt nüchtern, und ich finde dich wirklich toll und würde dich gerne wiedersehen. Sehr gerne. Ich studiere in Leeds, aber von da kommt man ganz gut hierher, oder vielleicht hast du ja mal Lust auf einen Ausflug in die Stadt und …«
Ich muss ziemlich skeptisch geguckt haben, denn er zögerte, den Blick zum Himmel gerichtet, wo sich ein Gewitter zusammenbraute, wo graue Wolken mit heftigem Regen drohten.
»Ja, ich weiß, du gehst noch zur Schule, und ich bin einundzwanzig. Aber das ist doch gar kein Problem, ich werde schon nicht, na ja, rumspinnen.«
»Tust du doch jetzt schon.«
»Okay.« Abe stopfte die Hände in die Taschen und betrachtete die Spitzen seiner kaum benutzten Wanderstiefel. »Aber würdest du mir denn wenigstens schreiben?«, fragte Abe dann. »Du könntest mir doch einfach schreiben.«
»Dir schreiben? Was? Briefe?« Ich dachte an Charlotte Brontës Briefe, an die Hoffnung, den Schmerz und die Freude, die sie darin festgehalten hatte, und ich stellte mir vor, wie wunderschön es wäre, einen Menschen zu haben, einen lebenden Menschen, dem ich Briefe schreiben könnte. »Im Ernst?«
»Ich dachte eigentlich eher an E-Mails, aber klar, gerne auch Briefe, warum nicht? So können wir uns ein bisschen kennenlernen, und wenn du mich magst, dann erlaubst du vielleicht, dass ich dich irgendwann mal besuche.«
»Ich bin schräg«, erklärte ich ihm. »Ich bin in der Schule die Außenseiterin. Ich liebe viktorianische Romane und bin am liebsten für mich.«
»Cool«, sagte Abe. »Ich zerschnippele Leichen.«
»Bist mir schon gleich viel sympathischer.«
Ich stand etwas höher am Hang als er und sah zu ihm hinunter, das letzte Sonnenlicht fiel ihm ins Gesicht. Seine braunen Augen schimmerten wie Bernstein und Gold, seine Haut leuchtete wie Kupfer und Eiche, und aus der Neigung seines Kopfes und der Haltung seiner Hände sprach so viel Zartheit und Hoffnung, dass ich ihn am liebsten an Ort und Stelle in den Arm genommen und geküsst hätte.
»Aber ich kann dir schlecht schreiben, wenn ich keine Adresse von dir habe«, sagte ich, weil es mir unvernünftig erschien, ihm sofort meine Gefühle zu gestehen, zumal ich mich doch gerade so verdammt cool gab.
»Ach, klar, natürlich.« Er klopfte seine Taschen ab. »Ich hab keine …«
»Du schreibst mir zuerst. Ist ganz leicht zu merken: Trudy Heaton, Ponden Hall.«
»Echt? Okay. Gut, mache ich. Das mache ich auf jeden Fall, Trudy Heaton von Ponden Hall.«
Dann küsste ich ihn, ziemlich ungestüm. Schlang die Arme um seinen Hals, dass er ein paar Schritte rückwärtstaumelte, und sog ihn in mir auf, als sei er der Wind und der Himmel und alles, was ich je brauchte, und er erwiderte meinen Kuss ganz genau so. Hinter meinen Lidern teilte sich das Sonnenlicht auf in Rot und Grün, dann ging das Licht aus, und ich schmeckte den Duft seiner Haut, Seife und Salz. Bis dahin hatte meine Kusserfahrung ausschließlich etwas mit Zähnen, Speichel und Zungen zu tun gehabt. Das hier war so viel schöner und größer: Es war der Himmel. Als ich Abe losließ, blinzelte er und sah mich kopfschüttelnd an.
»Verdammt«, sagte er. »Das war mein Ernst, als ich gesagt habe, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, warum und weshalb, aber es ist nun mal so, und es ist mir auch egal, wenn dich das jetzt irgendwie abschreckt, aber ich musste das einfach sagen.«
Wir standen noch eine Weile so da und sahen uns einfach nur an. In dem Wissen, dass das der Anfang von etwas war, das ewig halten würde. Und obwohl ich erst siebzehn war, hatte ich keine Angst. Ich war mir einfach nur sicher.
»Geh einen anderen Weg zurück«, sagte ich und zeigte in die Richtung des Fußpfades, der übers Moor nach Haworth führte. »Ist zwar weiter, aber so kommst du nicht an unserem Haus vorbei. Ich will nicht, dass meine Mutter ihre Nase in meine Angelegenheiten steckt.«
»Ich schreib dir«, sagte er, während er sich rückwärts den Pfad hinauf in Bewegung setzte.
»Ich weiß«, sagte ich.
Zwei Tage später kam der erste Brief.
Kapitel 4
»Und wieso warst du dir so sicher, dass Granny Mariah Daddy nicht mögen würde?«, fragt Will, als ich mit diesem Teil der Geschichte fertig bin, und schiebt sich noch einen Löffel Porridge in den Mund. Ich hatte im Laufe der Erzählung darauf geachtet, alles möglichst jugendfrei aufzubereiten.
Wie ich ihn jetzt so am Küchentisch sitzen sehe, eingewickelt in seine Bettdecke, die Pudelmütze bis knapp über die Augen gezogen, geht mir das Herz auf. Wir haben immer noch keinen Strom, trotz der vollmundigen Versprechungen des Stromversorgers, und das bedeutet, ich muss später mal den Berg hinaufwandern, wo vielleicht Handyempfang ist, und da anrufen. Trotz der Kälte und der Unannehmlichkeiten bereue ich meine Entscheidung, nach Hause zu fahren, nicht. An diesem Tisch zu sitzen, der mir so vertraut ist wie meine eigene Hand, zusammen mit meinem Sohn, während die Morgensonne durch die beiden großen Küchenfenster fällt und sich durch das viele Efeu kämpft, das so schöne Rahmen bildet, ist wie Balsam für meine Seele und gleicht alles aus.
»Granny …« Ich versuche, eine Begründung zu finden, die auch Will verstehen kann. »Granny hat schon immer allen um sich herum gesagt, sie sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern, gleichzeitig hat sie aber ihre Nase in den Kram aller anderen gesteckt. Ich schätze mal, am Anfang wollte ich deinen Daddy einfach gerne eine Weile für mich allein haben, weil ich zum allerersten Mal überhaupt verliebt war. So verliebt war ich seitdem nie wieder. Also, jetzt mal abgesehen von dir, in dich bin ich natürlich auch komplett verknallt.«
Will verzieht das Gesicht. »Ih! Wie peinlich! Und was hat Granny dann getan, dass du bis heute nicht mit ihr reden wolltest?«
»Das«, sage ich, »ist eine ganz andere Geschichte, Will. Die ich dir vielleicht in zehn Jahren mal erzählen werde.«
»Aber …«
»Na, dann lasst mal hören.« Ma kommt hellwach in die Küche, obwohl sie gerade erst aufgestanden ist, ihr dichtes, silberblondes Haar glatt gebürstet, der Morgenmantel eng zugeknotet. Ihre Haut schimmert wie Porzellan, wie Haut es nur tut, wenn man sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser gewaschen hat. Sie spürt, wie ich sie ansehe, und zieht den Morgenmantel noch enger um sich, dann wendet sie sich ab, entzündet mit einem Streichholz die Flamme am Gasherd und stellt einen Wasserkessel darauf.