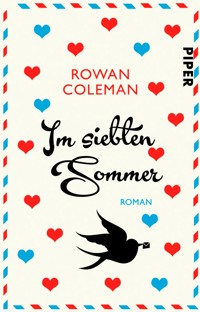
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines Tages beschließt Rose, dass das Leben zu kurz ist, um in einer unglücklichen Ehe zu leben. Sie schnappt sich ihre Tochter und fährt in das idyllische Millthwaite. Dort sucht sie Frasier, einen attraktiven Kunsthändler, in den sie sich vor sieben Jahren unsterblich verliebte. Sie sah ihn nie wieder – und alles, was sie von ihm besitzt, ist eine Postkarte aus diesem Ort. Schnell stellt sich heraus, dass Fraiser hier nicht mehr wohnt. Auf der Suche nach ihrer großen Liebe trifft Rose jedoch auf einen anderen Mann, der eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen wird. Und Rose begreift: Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Für Stanley Edward und Aubrey John, geboren am 10. April 2012
Übersetzung aus dem Englischen von Marieke Heimburger
ISBN 978-3-492-97634-3 August 2017 © Rowan Coleman 2012 Titel der englischen Originalausgabe: »Dearest Rose«, Arrow/Random House UK, London © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2017 Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München Umschlagabbildung: PinkPueblo/Shutterestock (Vogel); jointstar/Shutterestock (Rahmen) Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Allerliebste Rose,
unsere Begegnung neulich bei Ihnen zu Hause war nur kurz und doch sehr eindrücklich. Es ist keine Selbstverständlichkeit, einem so unvermittelt auftauchenden Fremden derart freundlich zu begegnen, und darum bin ich Ihnen umso dankbarer. Zwar konnten Sie mir nicht dabei helfen, das gesuchte Gemälde zu finden, aber was Sie mir alles über Ihren Vater erzählt haben, hat mich restlos fasziniert und tief berührt.
Ich frage mich, wie es sein kann, dass viele Künstler in der Lage sind, solche Schönheit hervorzubringen und gleichzeitig sich selbst und anderen so viel Leid anzutun. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich eines Tages mit Ihrem Vater versöhnen und Antworten auf Ihre Fragen finden werden.
Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Ihnen schreibe, dass Sie eine äußerst bemerkenswerte Frau sind und alles Glück, alle Zufriedenheit und alle Liebe der Welt verdient haben. Sie sind einzigartig. Jemand wie Sie ist mir noch nie begegnet.
Alles Liebe,
Frasier McCleod
1
»Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?« Die Stimme einer reichlich verärgerten Frau war nur gerade so durch die geschlossene Haustür zu hören.
»Ja, weiß ich, aber … Das hier ist doch ein Bed & Breakfast, oder?«, fragte Rose. Sie hatte ihre siebenjährige Tochter Maddie auf dem Arm, die schwer auf ihrer Hüfte wog, sich an ihr festklammerte und fröstelte. Es war Hochsommer, aber kalter Nieselregen tropfte ihnen vom Kopf, und Rose hatte vergessen, Maddies Jacke mitzunehmen. Sie hatte keine Zeit gehabt, an Jacken zu denken. Sie hatte überhaupt keine Zeit gehabt, sie hatte sich nur das vor langer Zeit gepackte und seither versteckte Bündel geschnappt, das vermutlich nur auf diesen Augenblick gewartet hatte. Sie hatte gerade genug Zeit gehabt, um abzuhauen.
»Wir schließen um Punkt neun Uhr abends!«, rief die Stimme. »Steht doch überall. Es ist drei Uhr morgens. Ich hätte gute Lust, die Polizei zu rufen.«
Rose holte tief Luft. Nein, sie würde jetzt nicht weinen. Sie war den ganzen Weg bis hierher gekommen, ohne zu weinen, und sie würde nicht zulassen, dass nach allem, was sie bereits durchgemacht hatte, jetzt ausgerechnet diese unbekannte Stimme ihre Augen zum Überlaufen brachte.
»Ich weiß, aber … Bitte. Wir sind schon so lange unterwegs. Ich habe meine Tochter dabei. Wir möchten einfach nur irgendwo schlafen. Ich hätte ja im Voraus gebucht, aber ich wusste nicht, dass wir herkommen würden.«
Sie hörte Gemurmel von der anderen Seite der Tür, eine Männerstimme war hinzugekommen. Rose presste Maddie noch fester an sich und versuchte, das Zittern des Mädchens mit ihrer Umarmung zu mildern. Und auch das andere, weniger kostbare Bündel drückte sie fester an sich: ein nicht sonderlich großer, rechteckiger Gegenstand, den Rose eilig in eine Wolldecke gewickelt hatte.
»Sie haben ein Kind dabei?«, erklang die Stimme der Frau wieder.
»Ja. Ein Mädchen. Sie ist sieben.«
Beklommen hörte Rose, wie Riegel aufgeschoben und Schlösser geöffnet wurden. Dann, endlich, tat sich die schwere Holztür auf, gelbes Licht fiel hinaus in die Regennacht und ließ die Tropfen glitzern und schimmern. Eine Frau undefinierbaren Alters lugte durch den Spalt und betrachtete die durchnässten Gestalten. Dann trat sie einen Schritt zurück und öffnete die Tür ganz.
»Ich muss mich schon sehr wundern«, schimpfte sie, als Rose den Flur betrat. »Mitten in der Nacht hier reinzuwollen. Was sollen denn meine anderen Gäste sagen?«
»Du hast gar keine anderen Gäste.« Ein gut gebauter, bärtiger Mann Ende fünfzig in Jogginghose und Unterhemd lächelte Rose an, während er sprach. »Also reg dich nicht auf, Schatz. Ist doch alles gar kein Problem. Ich bin Brian, und das ist meine Frau Jenny. Jenny, du bringst die beiden nach oben und gibst ihnen ein paar Handtücher, und ich komme gleich mit etwas Warmem zu trinken hinterher. Wie wäre es mit einem heißen Kakao, junge Dame?«
Maddie vergrub ihr Gesicht noch tiefer an Roses Hals und schlang die Arme noch fester um ihre Mutter. Maddie war es noch nie leichtgefallen, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, und dieses Mal war es sicher noch viel schwerer für sie, weil die Umstände, die sie hierhergeführt hatten, so traumatisch waren.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Rose war dankbar. »Ein heißer Kakao wäre jetzt genau das Richtige, stimmt’s nicht, Maddie?«
»Wie gesagt, gar kein Problem.« Brian lächelte. »Irgendwelches Gepäck, das ich für Sie hereinholen soll?«
»Ich … nein. Kein Gepäck.« Rose lächelte schwach und hob den Ellbogen leicht, um auf das seltsame Bündel unter ihrem Arm hinzuweisen. »Nur wir und das hier.«
Jenny hob skeptisch die Augenbraue. Diese neuen und einzigen Gäste würden nichts Gutes mit sich bringen, da war sie sich sicher. »Normalerweise muss man hier im Voraus bezahlen, fünfundzwanzig pro Nacht. Sie haben doch Bargeld mit?«
»Ja, ich …« Rose versuchte, sich in die Tasche zu fassen, während sie weiter das Kind und das Bündel festhielt.
»Herrjemine, Jenny.« Brian schüttelte den Kopf. »Nun lass die beiden doch erst mal in Ruhe. Das mit dem Geld regeln wir morgen früh. Okay, Mrs …?« Fragend sah er sie an.
»Ach so, Pritchard. Rose Pritchard, und das hier ist Maddie.«
»Gut. Ich glaube, Mrs. Pritchard muss jetzt erst mal die kleine Maddie ins Bett bringen.«
»Woher willst du wissen, dass sie nicht vielleicht eine psychopathische Mörderin ist?«, zischte Jenny ihrem Mann so zu, dass Rose es hören konnte.
»Angenommen, sie ist eine, dann vermute ich, dass sie zu müde ist, um uns heute Nacht noch zu erledigen. Und jetzt hör endlich auf mit dem Quatsch und bring sie nach oben.«
Erst als Rose Jennys beachtlichem Hinterteil die schmale Treppe hinauf folgte, bemerkte sie, dass die Vermieterin ein ziemlich gewagtes, rosafarbenes Negligé trug. Der zarte Stoff bewegte sich auf der steilen Stiege über Roses Kopf wie eine Qualle und ließ hier und da einen Blick auf die umfangreichen und delligen Oberschenkel seiner Trägerin zu. Kurz ging Rose durch den Kopf, dass vielleicht Jenny und Brian hier die psychopathischen Mörder waren, aber sie war von den vielen Stunden Fahrt und dem vielen Nachdenken über das, was passiert war, körperlich und geistig so erschöpft, dass es ihr schlicht unmöglich wäre, noch in dieser Nacht ein zweites Mal davonzulaufen. Schließlich hatte sie den Großteil ihres Lebens Anlauf nehmen müssen, um den Mut für ihre erste Flucht aufzubringen. Millthwaite war eine Ortschaft im tiefsten Lake District, die sich in keiner Weise je einen Namen gemacht hatte und von der entsprechend wenige Menschen je gehört hatten. Und doch war es genau hier, an diesem Ort im Nirgendwo, wo Rose auf eine zweite Chance hoffte.
Jenny öffnete die Tür zu einem Zimmer unterm Dach und schaltete das Licht ein. Das Zimmer war klein und sauber, unter altmodischen, bestickten Überwürfen in Altrosa standen zwei schmale Betten mit etwa dreißig Zentimetern Abstand. Das kleine Rosenmuster der Tapete wiederholte sich in den Vorhängen und den Schabracken, die vor etwa dreißig Jahren mal modern gewesen waren.
»Ich gebe Ihnen dieses Zimmer, weil es sein eigenes kleines Badezimmer hat«, erklärte Jenny, als Rose sich auf eines der Betten setzte, ohne Maddie loszulassen. Das Bündel legte sie neben sich ab. »Da sind frische Handtücher. Ich schalte den Durchlauferhitzer an, Sie wollen ja bestimmt duschen.«
»Im Moment möchte ich einfach nur schlafen«, sagte Rose und schloss kurz die Augen.
»Und Sie haben kein Gepäck außer dem Ding da?«, fragte Jenny sie, in der Tür stehend, während ihr Nachthemd sie seltsam lebendig umspielte. »Wo, sagten Sie, kommen Sie her?«
»Aus Broadstairs. In Kent«, sagte Rose, ließ Maddie auf das Bett gleiten und machte sich daran, ihr mit einem der Handtücher die Haare trocken zu rubbeln. Maddie drehte sich auf den Bauch und weigerte sich, der fremden Frau oder auch nur dem fremden Zimmer ihr Gesicht zu zeigen.
»Und da haben Sie nicht mal eine kleine Reisetasche mit?« Jenny bemühte sich nicht im Geringsten, ihre Neugierde zu verbergen – ebenso wenig wie ihr beträchtliches Dekolleté.
»Nein«, sagte Rose knapp und hoffte damit klarzustellen, dass sie das Thema nicht vertiefen wollte.
»Na ja. Da Sie Brian und mir jetzt ohnehin den Schlaf geraubt haben, suche ich Ihnen mal eben was zum Anziehen.«
»Nein, nein, bitte machen Sie sich keine Umstände«, rief Rose ihr hinterher, aber Jenny war bereits weg und sorgte dafür, dass Rose an ihrem Trampeln hören konnte, wie missmutig sie war.
Als sie einige Minuten später zurückkehrte, hingen ihr ein paar Kleidungsstücke über dem einen Arm und sie trug einen Becher dampfenden Kakaos in jeder Hand. Sie stellte sie auf dem Nachttisch ab, dann hielt sie ein rosa Nachthemd mit dem Glitzerschriftzug »Sex Bomb« hoch.
»Das ist von meiner Jüngsten, Haleigh«, sagte sie. »Nimmt sich gerade eine Auszeit in Thailand und nennt das ›Sabbatical‹, weiß der Teufel, warum. Na, jedenfalls ist an Haleigh nicht viel dran, ihre Sachen müssten Ihnen also einigermaßen passen.« Sie legte das Nachthemd ab und hielt einen Kinderschlafanzug hoch. »Und der hier ist von meinem Enkel, dem Sohn unseres Ältesten. Da ist Spiderman drauf, aber das wird ihr doch wohl nichts ausmachen, oder?« Sie legte auch den Schlafanzug ab und betrachtete Maddie. »Geht’s ihr gut? Sie ist so still.«
»Sie ist todmüde«, sagte Rose und streichelte Maddie über das dunkle Haar. »Und durcheinander.«
»Gut. Also. Zwischen acht und halb neun gibt es Frühstück. Extras gibt’s bei uns nicht, Sie müssen essen, was auf den Tisch kommt, und wenn Sie Kaffee wollen, müssen Sie selbst welchen kaufen. Ich halte nichts von dem Zeug. Ist unnatürlich. Ach, und das hier ist der Hausschlüssel. Nicht verlieren.«
»Danke«, sagte Rose und seufzte erleichtert, als Jenny ihr einen letzten missbilligenden Blick zuwarf und dann die Tür hinter sich zuzog. Rose stand auf und schloss ab, dann versuchte sie, ihrer Tochter das nasse Oberteil auszuziehen. Maddie quietschte ungnädig und kniff die Augen zu, um so die radikalen Veränderungen um sie herum zu ignorieren.
Veränderungen waren etwas, womit Maddie nur sehr schlecht umgehen konnte, und doch hatte Rose vor einigen Stunden beschlossen, sie aus ihrer gewohnten Umgebung herauszureißen und hierherzubringen. Hatte sie richtig gehandelt? Vorhin hatte sie das Gefühl gehabt, sie hätte keine andere Wahl, aber wie konnte sie sich dessen so sicher sein?
»Komm schon, Schatz, wir ziehen dir jetzt einen Schlafanzug an, und dann gehen wir schlafen.« Rose bemühte sich sehr, unbeschwert zu klingen, obwohl sie selbst hochgradig angespannt und verunsichert war.
»Wo ist Bär?« Maddie riskierte ein offenes Auge.
»Bär ist hier. Du weißt doch, dass wir Bär immer überallhin mitnehmen.«
Bär war gar kein Bär, sondern ein ziemlich oller Hase, den Maddie als Baby geschenkt bekommen hatte, aber Bär hatte schon immer Bär geheißen und würde das auch weiter tun.
»Wo ist mein Buch?« Damit meinte Maddie ihr Geschichtsbuch über das alte Ägypten, das sie sich nach einem Tagesausflug zum British Museum inständigst von Rose gewünscht hatte. Seither war Maddie wie besessen von Mumien, Pyramiden und allem, was sonst noch ägyptisch war. Sie stürzte sich auf alles, was sie zu dem Thema finden konnte, wahrscheinlich würde sie eine gute Kuratorin in einem Museum abgeben. Das Buch, das sie meinte, hatte sie schon unzählige Male gelesen, sie kannte es auswendig, und doch wusste Rose, dass sie es auch noch weitere Hundert Male lesen würde. Ihre Besessenheit von diesem Buch war einer der zahllosen Ticks, die sie in letzter Zeit entwickelt hatte und über die Rose sich aus Zeitmangel bisher kaum Gedanken oder Sorgen hatte machen können. Kinder konnten ziemlich exzentrisch sein, das war kein Geheimnis. Außerdem sagte jeder, dass Maddies obsessives Verhalten kein Grund zur Sorge war, und Rose wollte das gerne glauben, obwohl ihr Instinkt ihr etwas anderes sagte.
»Hier«, sagte Rose und zog das abgegriffene Buch aus der Handtasche. Gott sei Dank hatte sie es da bereits am Nachmittag reingesteckt, als sie mit Maddie wegen ihres Asthmas beim Arzt war, denn sonst hätte Rose es garantiert vergessen.
Maddie war zufrieden damit, dass das Buch neben ihr auf dem Kopfkissen lag, und ließ Rose ihr die nassen Sachen aus- und den Schlafanzug anziehen. »Spiderman mag ich nicht«, quengelte sie schwach, während sie kaum noch die Augen offen halten konnte. Vorsichtig schob Rose ihre Tochter unter die Bettdecke und machte das Deckenlicht aus, das grell aus einem rosa Lampenschirm mit Fransen herausschien. Sie wartete, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und schob dann das Bündel in der alten Wolldecke, die Rose seit ihrer eigenen frühesten Kindheit begleitete, unter Maddies Bett. Sie nahm sich einen Becher inzwischen lauwarmen Kakaos, kletterte in das andere Bett und genoss das Gefühl der kühlen Laken auf ihrer heißen, schmerzenden Haut. In der Hoffnung, schnell einzuschlafen, schloss Rose die Augen, doch obwohl ihr Körper vor Erschöpfung bebte, wollte der Schlaf sich einfach nicht einstellen. Irgendwann setzte Rose sich auf, lehnte sich an das velourgepolsterte Kopfende des Bettes, starrte aus dem Fenster in die dunkle, verregnete Nacht und fragte sich nicht zum ersten Mal, seit sie den Motor ihres Wagens angelassen hatte und von zu Hause weggefahren war, was in aller Welt sie da eigentlich tat.
Nachdrückliches Klopfen an der Zimmertür zwang sie schließlich, die Augen zu öffnen. Sie wusste nicht, wann sie letztlich eingeschlafen war, aber ihr kam es vor, als sei es erst wenige Sekunden her. Sie rieb sich die Augen und sah sich um. Die Erinnerung daran, wo sie sich befand – und warum –, kehrte schubweise im Takt mit ihrem Herzschlag zurück.
»Ja?«, rief sie und setzte sich schwerfällig auf.
»Rose? Guten Morgen, haben Sie gut geschlafen? Es ist schon nach zehn. Wir wollten Sie nicht wecken. Aber Jenny würde Ihnen jetzt noch ein bisschen Speck auf Toast machen, wenn Sie Hunger haben?«
»Oh nein! Entschuldigung!«, antwortete Rose, stand auf und sah sich nach ihren Klamotten um.
»Soll ich ihr sagen, in zehn Minuten?«, hakte Brian nach, der offenbar eine großartige diplomatische Leistung vollbracht hatte, um Maddie und ihr ein verspätetes Frühstück zu sichern.
»Fünf Minuten!«, rief Rose, während sie bereits in Slip und Unterhemd schlüpfte. Maddie beobachtete sie aus ihren großen blauen Augen von unter dem Bettüberwurf, den sie bis zur Nasenspitze über sich gezogen hatte.
»Komm schon, Süße, es gibt Toast!« Rose strahlte ihre Tochter in der Hoffnung an, die Aussicht auf ihr Lieblingsfrühstück könne sie aus der Reserve locken.
»Aber es ist nicht das, was wir zu Hause haben«, sagte Maddie, nachdem sie den Bettüberwurf immerhin bis unters Kinn heruntergezogen hatte. »Es schmeckt bestimmt anders. Zu Hause mag ich Toast, aber hier … nicht.«
»Das kann natürlich sein, dass es hier anderes Toastbrot gibt, mein Schatz. Aber es könnte sogar leckerer sein als das zu Hause. Das wirst du nur herausfinden, wenn du es probierst. Soll ich dir helfen, dein Kleid anzuziehen?«
»Ich will es aber nicht, wenn es nicht mein Toastbrot ist«, sagte Maddie und bezog sich damit auf die einzige Sorte Weißbrot, die sie mochte.
Rose schloss kurz die Augen und atmete tief durch.
Als sie beschloss, ihren Mann und ihr Zuhause zu verlassen, hätte sie vielleicht Maddies sehr eigene Ernährungsgewohnheiten etwas gründlicher bedenken sollen. Ihre Lehrerin nannte sie »extrem wählerisch«, aber ihre Lehrerin wusste auch nicht, dass Maddie regelrechte Angstzustände bekam, wenn etwas auf ihrem Teller lag, was da nicht liegen sollte.
»Du könntest es doch wenigstens mal probieren. Mir zuliebe. Wer weiß, vielleicht magst du es ja?« Rose lächelte ihre Tochter aufmunternd an.
»Ich mag es nicht, wenn es nicht mein Toastbrot ist«, maulte Maddie, und als sie ihrer Mutter die Treppe hinunterfolgte, fügte sie hinzu: »Wann können wir wieder nach Hause? Bevor die Schule wieder losgeht? Gleich nach den Ferien?«
Rose brachte es nicht übers Herz, ihr die Wahrheit zu sagen: Nie.
Im Flur angekommen, öffneten sie eine Tür nach der anderen auf der Suche nach dem Frühstückszimmer. Zuerst stießen sie auf ein Wohnzimmer für Hausgäste, das von einem riesigen Puppenhaus in einer noch größeren Glasvitrine dominiert wurde, von dem Rose Maddie förmlich wegzerren musste, und dann auf ein Arbeitszimmer, auf dessen Schreibtisch sich Papiere stapelten und ein uralter, im Grunde museumsreifer Computer thronte.
»Das hier ist kein Hotel, ja?«, begrüßte Jenny Rose und Maddie, als sie endlich das kleine Frühstückszimmer entdeckten, in dem sechs Tische fein säuberlich gedeckt waren, obwohl keine anderen Gäste im Haus waren.
»Na ja, doch, irgendwie schon«, sagte Brian und zwinkerte Rose zu. Dann schnappte er sich seine Schlüssel, gab Jenny einen Kuss und ging.
»Ich habe auch so genug zu tun. Auch ohne darauf zu warten, dass andere sich bequemen, mal aufzustehen!«
»Wir haben nicht von Ihnen erwartet, dass Sie auf uns warten«, sagte Rose. »Ich hätte mit Maddie auch auswärts frühstücken gehen können.«
»Kommt gar nicht infrage.« Jenny zeigte in einer unmissverständlichen Geste auf den Tisch neben dem Fenster. »Wo kämen wir denn da hin? Nein, nein, Tee und Toast sind gleich fertig. Und was ist mit dir, junge Dame? Möchtest du ein Glas Milch?«
»Ich mag keine Milch«, sagte Maddie.
»Dann vielleicht Orangensaft?«, fragte Jenny, und Maddie nickte.
»Soll das ›ja, bitte‹ heißen?«, schalt Jenny sie. Maddie nickte abermals.
Rose rieb sich das Gesicht und warf das lange Haar zurück, bevor sie wie so oft die Kunstpostkarte aus ihrer Tasche hervorholte. Sie schob Maddie ihr Buch über den Tisch zu und hoffte, es würde sie von dem Toast ablenken. Sie selbst las die kurze Nachricht auf der Karte, betrachtete die Bögen und Schlaufen der Schrift, die ihr über die Jahre so vertraut geworden war. Dann drehte sie die Karte um und besah sich das Motiv, das ihr inzwischen genauso vertraut war. Es war die Reproduktion eines Ölgemäldes, Millthwaite aus der Ferne, von John Jacobs. Diese Karte mit der handschriftlichen Nachricht war der einzige Grund, weshalb sie ausgerechnet hierhergeflohen war. Sie wusste, das war verrückt, aber es war so.
Frasier McCleod, der Absender der Karte, war der Grund, weshalb sie nach Millthwaite gekommen war, obwohl sie keine Ahnung hatte, wo er lebte und wer er überhaupt war. Diese Karte und dieser Ort waren das Einzige, was sie mit ihm verband. Seit ihrer nicht einmal eine Stunde währenden Begegnung vor über sieben Jahren hatte diese Karte Roses Glauben und Hoffnung genährt, dass Frasier McCleod möglicherweise das Gleiche für sie empfand wie sie für ihn. Dass Rose damals bei dieser einzigen Begegnung, als sie selbst schon seit Jahren verheiratet und außerdem hochschwanger war, die Liebe ihres Lebens getroffen hatte.
Jenny knallte einen Teller mit Toasts auf den Tisch, und Rose hielt gespannt die Luft an, als Maddie ein Stück nahm, es misstrauisch beäugte, es sich an die Lippen führte, daran leckte und vorsichtig daran knabberte, bevor sie schließlich herzhaft hineinbiss.
»Köstlich!«, sagte Maddie und nickte Jenny zu, die gerade ein Glas Saft vor ihr abstellte. »Vielen Dank, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen.«
»Bitte, sehr gern geschehen«, entgegnete Jenny, ein klein wenig verwirrt von Maddies plötzlicher ausgesuchter Höflichkeit und Eloquenz. Aber so war Maddie nun mal: Sie wusste sehr wohl, was sich gehörte – nur fand sie meistens, dass es unnötig war.
»Kennen Sie das Motiv auf dieser Karte?« Rose nahm ihren Mut zusammen, Jenny zu fragen, bevor diese wieder in die Küche verschwand, um miesepetrig Speck zu braten.
Jenny nickte und zeigte dann auf die Wand über Roses Kopf, wo eine Reproduktion genau desselben Gemäldes hing, nur in einem größeren Format.
»Das hängt hier in fast jedem Haus«, sagte Jenny. »Es hat Millthwaite eine gewisse Berühmtheit beschert. Obwohl – da hat die eine Folge von Wir ziehen aufs Land! fast noch mehr gebracht … Wie dem auch sei, Albie Simpson hat es mehr als genug Geld eingebracht.«
»Was meinen Sie damit?« Rose drehte sich auf ihrem Stuhl, um den Druck besser sehen zu können. Das Gemälde wirkte kühn und souverän, fast so, als hätte der Künstler sich bei der Arbeit daran gelangweilt und nicht abwarten können, endlich damit fertig zu werden und sich anderen Dingen widmen zu können. Es wirkte irgendwie nachlässig, ja fast schon hingerotzt, war aber gleichzeitig wunderschön.
»Der Künstler, John Jacobs, war Alkoholiker und im Dauerrausch. Vor vielen Jahren ist er mal im Pub aufgekreuzt und hat Albie das Bild als Bezahlung für eine Flasche Whisky angeboten. Albie – ein ziemliches Schlitzohr, wenn Sie mich fragen – hat sich drauf eingelassen, weil er fand, es würde sich gut über dem Tresen machen. Und da hing es dann. Bis vor ungefähr vier Jahren. Da ist dann plötzlich so ein geschniegelter Schotte hier aufgekreuzt und hat Albie fünftausend Pfund dafür geboten. Fünftausend!«
Jenny erwartete offenbar eine Reaktion von Rose, ein Staunen oder anerkennendes Pfeifen, und als diese ausblieb, machte sie ein enttäuschtes Gesicht.
»Na ja, jedenfalls hat Albie abgelehnt, keine Ahnung, warum – muss besoffen gewesen sein. Oder auch nicht, denn der Typ hat sein Angebot sofort und ohne mit der Wimper zu zucken, verdoppelt. Und ihm angeboten, einen Druck des Gemäldes anfertigen zu lassen, der dann statt des Originals über dem Tresen hängen konnte. Da hat Albie dann eingeschlagen. Der Mann bekam das Gemälde und Albie das Geld.« Jenny presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf.
Rose löste den Blick von dem Druck und strich mit den Fingerspitzen über die Handschrift auf der Karte. Ein gut gekleideter Schotte, der sich für John Jacobs interessierte und bereit war, viel Geld zu bezahlen, um an eins seiner Werke zu kommen. Das könnte er sein. Das könnte Frasier McCleod sein. Jetzt musste sie einfach nur mit dem Wirt sprechen, der vielleicht noch eine Telefonnummer oder eine Adresse des Mannes hatte, und dann … Dann was?
Rose biss sich auf die Lippe, während Jenny einfach weiterplapperte; es schien ihr egal zu sein, ob Rose ihr zuhörte oder nicht.
Und dann einfach vor Frasiers Tür stehen und ihm sagen, dass … Ja, was?
»Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Sie sind vor einigen Jahren auf der Suche nach Informationen über meinen Vater mal bei mir gewesen. Ich hatte geweint, und Sie waren sehr freundlich zu mir. Wir haben uns eine Weile unterhalten, und das Einzige, was ich danach je von Ihnen gehört habe, war eine Kunstpostkarte. Diese Karte habe ich seither wie einen Schatz gehütet. Ach ja, und im Übrigen glaube ich, dass ich Sie liebe. So, und jetzt können Sie gerne eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirken.«
Rose musste blinzeln, als ihr klar wurde, was für einen Blödsinn sie da gerade veranstaltete. Sie war doch komplett übergeschnappt, sich wie ein Backfisch auf so eine aussichtslose Unternehmung einzulassen – und dann auch noch ihre Tochter mit hineinzuziehen. Frasier McCleod hatte ihr keinen verschlüsselten Liebesbrief geschrieben, er hatte sich bedankt, das war eine formelle Geste der Höflichkeit, der sie etwas andichtete, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Was, um alles in der Welt, tat sie hier? Und doch konnte sie nicht zurück. Sie konnte Maddie nicht wieder in das Zuhause bringen, das sie kannte, wo sie ihr Lieblingsbrot essen konnte, nicht wieder zurück zu der Schule, in der die nette Begleitlehrerin neben ihr saß und ihr dabei half, dem Unterricht zu folgen, und die in den Pausen mit ihr spielte, wenn keines der anderen Kinder das tat. Sie würde auf gar keinen Fall zurückkehren. Eine Kunstpostkarte, ein Gemälde von Millthwaite, mochte der Grund dafür sein, dass sie ausgerechnet hier war – weit weg von zu Hause und mit einer Traumvorstellung, die sich sicher schon bald in Luft auflösen würde. Aber die Postkarte und das Gemälde waren ja nicht der Grund dafür, dass sie überhaupt weggelaufen war.
»Na, wie dem auch sei, der alte Albie hat ein ziemlich langes Gesicht gemacht, als das Gemälde ungefähr ein Jahr später für die vierfache Summe verkauft wurde. Der Mann, der es verkauft hat, war so ein Kunst-Guru aus Edinburgh. Hat sich richtig gesund gestoßen daran und sich inzwischen wohl eine goldene Nase damit verdient, auch den restlichen Kram von dem alten Spinner zu verkaufen. Dieser verfluchte John Jacobs, jetzt sitzt er auf einem Haufen Geld. Wissen Sie, was ich dazu sage? Ich sage: Schade, dass er inzwischen nüchtern und trocken ist, sonst hätten wir alle hier nämlich vielleicht die Chance gehabt, an eins seiner Bilder ranzukommen. Ich hätte ihm gerne im Austausch für eins seiner Gemälde ein ordentliches Frühstück serviert.«
»Was meinen Sie damit?« Plötzlich war Rose wieder in Jennys Redefluss eingetaucht. Ihr wurde so kalt, dass sie schauderte.
»Na ja, schließlich wohnt er ja gleich die Straße rauf.« Jenny sah in Roses entsetzte Miene. »John Jacobs lebt jetzt schon fast zehn Jahre da oben, und wie es heißt, ist er die letzten drei nüchtern gewesen. Früher haben wir ihn oft im Ort gesehen, im Pub, aber das hat stark nachgelassen, und das ist ja nur gut so, wenn Sie mich fragen. Der alte Geizknüppel. Streicht jede Menge Zaster ein, ja, aber glauben Sie mal nicht, dass er jemals was für die Gemeinschaft hier tun würde. Das Dorf siecht vor sich hin, und er sitzt einfach da oben wie ein König in seinem Schloss und pfeift darauf, was die anderen von ihm denken.«
»Das sieht ihm ähnlich«, sagte Rose langsam und wandte sich von Jennys Adlerblick ab, um nach Maddie zu sehen, die ihre Nase tief in das Buch gesteckt hatte. Bär saß ergeben neben ihr auf dem Tisch, während Rose von diesen Neuigkeiten ganz schwindlig wurde. Warum war sie nie darauf gekommen, dass der Künstler den Ort gemalt haben könnte, in dem er lebt? Warum war sie da bis jetzt nicht drauf gekommen? Sie hatte keine Ahnung, wie sie reagieren sollte.
»Wieso? Kennen Sie ihn etwa? Den alten Jacobs?«, wollte Jenny wissen.
»Ob ich ihn kenne?«, sagte Rose nachdenklich. »Nein, eigentlich nicht. Aber ich sollte ihn wohl kennen. Schließlich ist er mein Vater.«
2
Als Rose noch klein war, nahm ihr Vater sie im Sommer gerne mit zu seinen abendlichen Strandspaziergängen. Dann saßen sie im Sand, betrachteten die Farben des Himmels bei Sonnenuntergang und dachten sich Namen für jede Nuance zwischen Rot und Gold aus. Rose konnte sich erinnern, dass sie damals felsenfest davon überzeugt gewesen war, Johns absoluter Liebling zu sein, dass er sie mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt liebte, sogar mehr als ihre Mutter. Und sie konnte sich daran erinnern, was für ein wunderbares Gefühl das gewesen war, diese Nähe zwischen ihnen, die ihr das Gefühl absoluter Sicherheit vermittelte, sodass sie nie vor irgendetwas Angst hatte. John war ein hochgewachsener Mann mit langen Armen und Beinen und Fingern, die immer in Bewegung waren, während er sprach, und die das Gesagte unterstrichen. Ständig wollte er der Welt mitteilen, was er dachte, weil er der Meinung war, die Welt würde das interessieren. Rose interessierte es, sie hörte ihm stets aufmerksam zu und sog seine Weisheit in sich auf. Sie war ihm treu ergeben.
Sein dickes schwarzes Haar trug er lang und ungekämmt, und Rose rieb wahnsinnig gerne ihre Wange an seinen Bartstoppeln, wenn sie ihn umarmte. Seit er vierzehn Jahre alt gewesen war, trug er dasselbe Brillenmodell, klein und rund wie das von John Lennon, obwohl es überhaupt nicht zu seinem kantigen Gesicht passte, und seine Kleidung und seine Haut waren stets farbverschmiert. Eine Umarmung mit ihm duftete nach dem Leinöl, mit dem er seine Farben anmischte, und Rose konnte sich erinnern, wie sie alle drei – John, ihre Mutter Marian und sie selbst – die Samstagvormittage im großen Ehebett der Eltern verbrachten, dort lachten und redeten und Toast aßen und die Laken vollkrümelten. Wie es Kindheitserinnerungen so an sich haben, schien immer die Sonne, der Himmel war immer blau, Marian lächelte immer, und John war einfach nur toll und schuf eine Welt um sie herum, in der Rose das Gefühl hatte, etwas Besonderes zu sein. Sie war nicht wie die anderen Mädchen in der Schule, deren Väter tagsüber zur Arbeit gingen und erst nach Hause kamen, wenn die Kinder im Bett waren. Ihr Vater war märchenhaft, betörend, aufregend und voller Liebe. Ja, die ersten Jahre ihres Lebens war Rose überglücklich, einen so interessanten Vater zu haben. Natürlich kam sie erst viele Jahre später dahinter, dass John die meiste Zeit betrunken gewesen war.
Rose hatte ihn zum letzten Mal gesehen, als sie neun Jahre alt war.
Das Idyll, in dem sie sich wähnte, zerbrach nicht von einem Tag auf den anderen. Es bekam Woche für Woche, Jahr für Jahr Risse, und als Rose etwas älter wurde, bemerkte sie, dass die Goldschicht, mit der John ihr Leben überpinselt hatte, immer dünner wurde und die dunklen Abgründe darunter offenbarte. Der Duft nach Leinöl und Farbe wurde immer häufiger überlagert von einer sauren Whiskyfahne. Seine Anfälle von guter Laune wandelten sich in irrationale Wutausbrüche, während derer er Rose schon mal eine langte, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und auch ihre Mutter bekam Schläge ab. Rose gewöhnte sich an, den Fernseher immer lauter zu drehen, wenn ihre Eltern sich anschrien, und zum Spielen in den Garten hinauszugehen, wenn ihre Mutter, den Kopf in den Armen verborgen, am Küchentisch saß und weinte. Sie kletterte nicht mehr samstagmorgens zu ihren Eltern ins Bett, weil ihr Vater gar nicht da war.
Der Tag, an dem er sie verließ, war ein genauso strahlend schöner Tag gewesen wie alle anderen Tage, an die Rose sich erinnerte. Die Sonne fiel durch das bunte Bleiglas in der Tür und zeichnete ein undeutliches farbiges Muster auf die Dielen im Flur. John hatte sie auf eine der unteren Treppenstufen gesetzt, war vor ihr in die Hocke gegangen und hatte ihre Hände genommen.
»Ich muss weg, Röschen«, hatte er gesagt.
Rose konnte sich erinnern, dass sie sauer auf ihn gewesen war: Er hatte sie noch nie Röschen genannt. Noch nie. Wieso fing er jetzt auf einmal damit an?
»Wie, weg?«
»Weg von hier, um irgendwo anders zu leben. Deine Mutter und ich, wir … Ich muss weg. Ja. Aber … Du wirst immer mein Röschen sein und …«
»Ich bin nicht dein Röschen.« Rose legte die Stirn in tiefe Furchen. Sie erkannte diesen rotäugigen, lallenden Mann nicht wieder. Nicht einmal seine Stimme. »Wann kommst du wieder?«
»Ich komme nicht wieder.« Bei diesen Worten sah er ihr ganz fest und direkt in die Augen.
»Aber ich sehe dich doch wieder?« Rose wusste noch, wie ihre Stimme bei dieser Frage gebebt hatte, weil ihr langsam aufgegangen war, was da gerade passierte. Und doch war sie fest entschlossen, nicht zu weinen. John hatte es immer gehasst, wenn sie weinte.
»Natürlich«, hatte er gesagt. »Ganz oft, mein Rosa-Röschen.«
Er beugte sich nach vorn und küsste sie ziemlich feucht mitten auf die Stirn. Rose wollte die Arme um ihn legen, sich an ihm festklammern und ihn anflehen zu bleiben. Doch schon damals, mit nur neun Jahren, hatte sie gewusst, dass ihr Vater auch ihr zuliebe nicht bleiben würde. Dass, ganz gleich, wie sehr er sie liebte, er sie nicht genug liebte, um für sie zu bleiben.
»Bis bald!« Er hatte ihr zugezwinkert, seine Tasche genommen und die Haustür hinter sich geschlossen. Das war das letzte Mal, dass Rose ihren Vater gesehen hatte.
»Wer hätte das gedacht, dass der alte Miesepeter eine Tochter hat?« Jenny war aus ihrer Rolle als strenge Vermieterin geschlüpft und setzte sich nun mit einer Kanne frisch zubereiteten Tees zu Maddie und Rose an den Tisch. »Ich verstehe überhaupt nicht, wie eine Frau diesen Kotzbrocken an sich heranlassen kann. Der sieht doch aus wie ein Penner. Und riecht auch so.«
»Ich weiß es auch nicht.« Es war Rose extrem unangenehm, über ein Thema sprechen zu müssen, das sie immer noch so schmerzte. Die Nachricht, dass ihr Vater sich ganz in der Nähe befand, war ein solcher Schock für sie, dass alles, was in den letzten Stunden passiert war – sogar die Karte von Frasier McCleod –, darüber in den Hintergrund trat. Seit ihr Vater weg war, hatte sie tunlichst vermieden, an ihn zu denken, aber wenn sie es doch mal getan hatte, dann war das Bild von ihm sehr unscharf gewesen und eher die Vorstellung eines Mannes, den sie mal gekannt und dem sie mal vertraut hatte und der irgendwo existierte, aber nicht im echten Leben. Sie hatte ihn sich nie in einem Haus vorgestellt, und obwohl sie wusste, dass er mit einer anderen Frau verschwunden war, hatte Rose nie daran gedacht, dass diese Beziehung von Dauer sein konnte, dass er sich ein neues Leben mit einer neuen Familie und weiteren Kindern aufgebaut haben könnte. Rose holte tief Luft, als ihr klar wurde, dass sie möglicherweise Halbgeschwister hatte.
»John Jacobs ist also Ihr Vater, aber er ist nicht der Grund dafür, dass Sie hierhergekommen sind?« Jenny neigte den Kopf zur Seite und sah Rose fragend an.
»Nein, eigentlich nicht.« Rose rutschte auf ihrem Stuhl herum. »Ich wusste zwar, dass das Motiv dieser Karte von ihm stammt, aber ich hatte nicht damit gerechnet, ihn hier zu finden. Ich weiß auch nicht genau, womit ich gerechnet hatte.«
»Und warum sind Sie dann hier?« Jenny war offenbar nicht der Typ, der lange um den heißen Brei herumredete.
»Ich musste einfach weg, und dieses Gemälde hat es mir schon so lange angetan. Darum war Millthwaite der erste Ort, der mir einfiel. Das mag Ihnen ziemlich willkürlich vorkommen, ich weiß …« Wie sollte Rose ihr erklären, dass es nur einen einzigen Ort gegeben hatte, an den sie hatte fliehen können – und das, obwohl sie über diesen Ort so gut wie gar nichts wusste?
»Sie mussten weg im Sinne von weglaufen oder im Sinne von mal für eine Weile rauskommen?«
Rose dachte, dass streng genommen beide Definitionen auf sie passten.
»Sie wissen doch, wie das manchmal ist.« Rose nickte Richtung Maddie und hoffte, Jenny würde den Wink begreifen und das Thema wechseln. Jenny strahlte und drückte sich den Teebecher an die Brust. Sie war offenbar entzückt, so vollkommen unerwartet so spannende Gäste bekommen zu haben.
»Ach, wenn mein Brian doch bloß hier wäre! Der wird völlig platt sein, wenn ich ihm erzähle, dass John Jacobs’ Tochter bei uns wohnt. Wirklich. Das wird ihn total umhauen. Und der alte Stinkstiefel hat Sie also verlassen, ja? Als Sie noch klein waren?«
»Hmhm«, bestätigte Rose zögerlich, da sie es nicht gewöhnt war, darüber zu sprechen.
»Und ich wette, Sie haben nie auch nur einen Penny von dem vielen Geld gesehen, stimmt’s?« Jenny richtete sich augenscheinlich auf einen ganzen Tratsch-Vormittag ein. »Dieser widerliche alte Geizknochen.«
»Als er ging, hat er mit seiner Arbeit kein Geld verdient. Wir haben vor allem von dem Gehalt meiner Mutter gelebt.«
»Aha. Hat die arme Frau also ausgesaugt und sie dann gegen ein neueres Modell eingetauscht.« Blitzschnell fasste Jenny die Ereignisse für sich zusammen.
Rose dachte an Tilda Sinclair, das »neuere Modell«, ebenfalls Künstlerin. Sie hatte für ihren Vater Modell gestanden. Statuenhaft und atemberaubend schön mit jeder Menge tiefschwarzer Haare und dunkelblauen Augen. Sie war aber gar kein neueres Modell, sie war weder jünger, dünner noch schöner gewesen als Marian. Lediglich anders. In jeglicher Hinsicht. Marian hatte von neun bis fünf in einem Büro gearbeitet – Tilda dagegen war ein kreativer Kopf, posierte tagsüber für Roses Vater und arbeitete nachts an ihrer eigenen Kunst. Marian war immer ordentlich angezogen und frisiert, sie war schlank und blond. Tilda war eine üppige Frau mit vielen Rundungen, die aussahen, als könne man sich vollkommen in ihnen verlieren. Rose war Tilda nie begegnet, und genau darum stellte sie sie sich als diese Sirene vor, als ein unwiderstehliches Wesen, das ihren Vater von seiner Familie weggelockt hatte. Er hatte sich nicht einmal mehr umgesehen. Hatte ihr Vater Marian ausgesaugt? Irgendwie schon, ging es Rose durch den Kopf, und sie spürte, wie ihr Magen sich beim Gedanken an ihre Mutter zusammenzog. Keine zehn Jahre, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, war sie gestorben.
»So was in der Art, ja«, sagte sie schließlich. Jenny schenkte ihr gerade eine weitere Tasse Tee ein.
»Und Sie gehen jetzt da hoch und stellen ihn zur Rede? Ich kann Sie gerne fahren. Das mache ich gerne, wenn Sie ein bisschen moralische Unterstützung brauchen. Oder auch nicht moralisch, mir ist das gleich.«
Maddie sah von ihrem Buch auf. »Wo gehst du hoch, Mum?«, fragte sie. »Wo sind wir noch mal?«
Rose fiel auf, dass Maddie seit ihrem überstürzten, verwirrten Aufbruch noch gar nicht richtig aus dem Fenster gesehen hatte.
Auf der Fahrt hierher hatte sie sich in den Schlaf geweint, und als sie ankamen, war es stockfinster gewesen. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie weit weg von zu Hause sie waren, was wahrscheinlich ein Vorteil war, denn das Wissen würde ihr nur Angst machen. Maddie war ein Kind, das nicht gerne weit weg war von allem, was sie kannte.
»Wir sind in Millthwaite«, antwortete Rose. »Wir machen hier ein bisschen Urlaub.«
»Und dann … Was dann?«, fragte Maddie verunsichert.
Rose musste an Johns letzte Worte an jenem Morgen denken, als sie auf der unteren Treppenstufe gesessen und er ihr einen Abschiedskuss gegeben hatte: »Bis bald.« Das war nur eine von vielen Lügen gewesen – und jetzt musste sie Maddie anlügen.
»Dann wird alles wieder gut«, sagte sie. Wie wollte sie das Maddie je erklären?
»Ich muss nur noch eben staubsaugen, dann habe ich Zeit«, bot Jenny wieder eifrig ihre Hilfe an.
»Nein danke, Jenny«, lehnte Rose entschieden ab. »Ich bin nicht hier, um mit ihm zu reden. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt je wieder mit ihm reden möchte.«
»Mit wem reden?«, fragte Maddie.
»Mit einem Mann, den ich von früher kenne und der hier ganz in der Nähe wohnt«, sagte Rose.
»Dein Vater«, sagte Maddie. Offenbar hatte sie die ganze Zeit zugehört. »Dein Vater wohnt hier in der Nähe, aber du willst ihn nicht sehen, weil er gemein ist.«
Maddie hatte die Gabe, sofort mitzubekommen, wenn etwas nicht stimmte. Als hätte sie mit ihren zarten sieben Jahren bereits begriffen, dass im Leben nicht alle Geschichten gut enden.
»Jedenfalls im Moment nicht«, sagte Rose und hoffte, damit der Wahrheit Genüge getan zu haben.
Just in dem Moment fing Roses Handy an zu klingeln, es schrillte unangenehm aus ihrer Tasche. Ohne überhaupt aufs Display zu gucken, wies Rose den Anruf ab und schaltete das Telefon dann aus.
»Aber irgendwann werden Sie ihn natürlich sehen und sprechen«, insistierte Jenny. »Schließlich hat Sie das Schicksal hierher verschlagen, oder etwa nicht? Ich meine, Sie tauchen mitten in der Nacht ohne ersichtlichen Grund hier auf und finden heraus, dass Ihr Vater, den Sie jahrelang nicht gesehen haben, hier lebt! Das ist doch Schicksal! Gott will Ihnen damit etwas sagen.«
»Schicksal.« Langsam wiederholte Rose das Wort. »Das klingt so, als hätte man keinen Einfluss darauf, was mit einem passiert, und daran glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich dem Schicksal die Führung überlassen hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ich bin hier, weil ich dem Schicksal trotzte.«
Jenny betrachtete sie eine Weile, während sie an ihrem Tee nippte. »Aber irgendwann werden Sie doch bestimmt zu ihm hochgehen, oder? Sie müssen dem alten Knurrhahn mal einen ordentlichen Schrecken einjagen!«
»Ich würde mir gerne Ihr Puppenhaus ansehen.« Zu Roses Erleichterung unterbrach Maddie Jennys Inquisition. »Ich mag gerne kleine Sachen.«
»Ach ja?«, sagte Jenny. »Das Puppenhaus ist aber nicht zum Spielen gedacht.«
»Warum nicht?«, wollte Maddie wissen.
»Weil es schon sehr alt und kostbar ist. Und weil es kaputtgehen könnte.«
»Dann hat also noch nie jemand damit gespielt?«, beharrte Maddie.
»Doch, schon. Ich, als ich noch klein war, und meine Haleigh hat es geliebt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es antik, Liebes.«
Maddie seufzte und betrachtete eine ganze Weile die Zimmerdecke. Dann wandte sie sich Jenny zu und fixierte sie mit ihrem ganz eigenen, ziemlich durchdringenden Blick.
»Wozu hat man denn ein Puppenhaus, wenn keiner damit spielen darf?«
Rose stand in dem winzigen Zimmer vor der offenen Kleiderschranktür und betrachtete sich mit finsterem Blick im daran befestigten Spiegel. Seit Jenny wusste, dass Rose John Jacobs’ verlassene Tochter war, spielte sie sich nicht mehr als strenge Vermieterin, sondern als hilfsbereite Ersatzmutter auf. Kaum hatte Rose geäußert, dass sie zum Pub gehen und mehr über den schottischen Kunsthändler herausfinden wollte, bestand Jenny auch schon darauf, ihr etwas Frisches zum Anziehen herauszusuchen.
»Ach, meine Sachen gehen doch noch einen Tag«, hatte Rose abgewinkt und dabei ihre Kleidung glatt gestrichen.
»Nein«, sagte Jenny. »Ich möchte nicht, dass meine Hausgäste wie Landstreicher aussehen, wenn sie in die Stadt gehen. Was sollen denn die Leute von mir denken? Ich habe einen ganzen Schrank voller Sachen, die Haleigh hier zurückgelassen hat und die Ihnen ganz hervorragend passen werden. Und was diese junge Dame hier angeht, für die werde ich bestimmt auch etwas finden, meine Enkel lassen immer so viele Klamotten hier liegen, wenn sie zu Besuch kommen. Sind allerdings alles Jungs. Aber das macht dir doch bestimmt nichts aus, oder, junges Fräulein?«
»Doch. Ich mag keine Jungs«, verkündete Maddie, aber das hörte Jenny schon gar nicht mehr, sie war bereits auf dem Weg, ihre Mission zu erfüllen.
Rose, die seit über zehn Jahren mit einem Arzt verheiratet war und sich angewöhnt hatte, stets Kleider oder hübsche Röcke und vernünftige Oberteile zu tragen und niemals Hosen, stand schließlich in einem Paar Hüftjeans mit einem Riss am Knie vor dem Spiegel. Hätte sie nicht ein etwas längeres schwarzes T-Shirt gefunden, dessen U-Boot-Ausschnitt ihr immer wieder über die eine Schulter rutschte, hätte man die untere Hälfte ihres Bauchs sehen können.
Rose war erst einunddreißig, und sie kannte viele Frauen ihres Alters, die sich so anzogen wie Haleigh und sich gar nichts dabei dachten. Und sie kannte auch ein paar – darunter zum Beispiel ihre Freundin Shona –, die sich wie moralbefreite Fünfzehnjährige kleideten.
Rose war aber schon immer konservativ gewesen oder zumindest, seit sie nicht mehr einfach nur Rose, sondern Mrs. Pritchard war. Richard hatte immer großen Wert darauf gelegt, dass sie nicht die falsche Art von Aufmerksamkeit auf sich zog, und ihr stets eingeschärft, dass an sie als seine Frau von der Umgebung gewisse Erwartungen gestellt würden. Und Rose, deren Jugendjahre so chaotisch und ein einziges großes Wirrwarr gewesen waren, hatte sich ihm gerne gefügt. Sie war ihm sogar dankbar gewesen. Durch die Heirat mit Richard war sie aus gleißender Hitze in eine wunderbare kühle Ruhe geraten. Rose besaß kein einziges Paar Jeans und schon gar keine Hüftjeans, und sie staunte nicht schlecht, dass die Sachen der neunzehnjährigen Haleigh ihr – wenn sie nicht temporärer geistiger Umnachtung anheimgefallen war, was unter den gegebenen Umständen nicht auszuschließen war – ziemlich gut standen.
Sie warf ihr langes Haar über die eine Schulter und drehte sich zu Maddie um, die sie vom Bett her beobachtete. Dem Mädchen war anzusehen, dass es mit der Jungs-Jeans, die Jenny ihr gegeben hatte, nicht zufrieden war. Das winzige pinkfarbene T-Shirt mit Las-Vegas-Aufdruck, das Rose in dem Haufen mit Haleighs Sachen gefunden hatte, stimmte sie aber wiederum ein wenig milde. Vor allem, dass der Schriftzug glitzerte, machte den Umstand, eine Jungs-Jeans tragen zu müssen, deutlich erträglicher. An Haleigh mochte Rose sich das Teil am liebsten gar nicht vorstellen, da es für ihren Geschmack viel zu viel Haut frei gelassen hätte, aber Maddie reichte es bis gerade so übers Knie. Sobald Rose sich wieder einigermaßen gefangen hatte, würde sie in die nächstgelegene größere Stadt fahren und ihnen beiden etwas zum Anziehen kaufen. Aber vorläufig würden diese gebrauchten Sachen es tun.
»Was meinst du?«, fragte Rose sie lächelnd und strich das schwarze Oberteil über ihren schmalen Hüften glatt. Maddie sah sie nachdenklich an.
»Daddy würde das nicht gut finden«, sagte sie.
»Ich weiß.« Rose wandte sich wieder dem Spiegel zu und zog den Ausschnitt des Oberteils so zurecht, dass beide Schultern züchtig bedeckt waren. Jedenfalls für ein paar Sekunden. »Aber Daddy ist ja nicht hier.«
»Mummy?« Rose sah ihrer Tochter im Spiegel in die Augen. »Mag Daddy mich noch?«
Rose biss sich auf die Lippe, wirbelte herum und schloss Maddie so heftig in die Arme, dass das Kind sich automatisch versteifte.
»Natürlich mag Daddy dich. Er liebt dich, mein Schatz.« Rose drückte Maddie einen Kuss auf die verzerrte Miene. »Du bist sein Augapfel, das weißt du doch.«
»Ich glaube nicht«, sagte Maddie. »Wer will schon einen Apfel in seinem Auge? Das tut doch weh.«
»Was ich damit meine, ist: Egal, was zwischen Daddy und mir vorgefallen ist, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht der Grund. Daddy liebt dich.«
Maddie wandte das Gesicht von Rose ab und presste die Lippen zu einem blassen, schmalen Strich aufeinander. Es fiel ihr offenbar schwer, das, was sie gesehen und gehört hatte, mit dem in Einklang zu bringen, was Rose über die Geschehnisse erzählt hatte, und Rose hatte keine Ahnung, was sie dagegen tun sollte. Sie wusste nur, dass Maddie sich auf keinen Fall schuldig fühlen durfte.
»Davon habe ich aber nicht viel gemerkt«, sagte Maddie. »Vorher … als … und als wir ins Auto gestiegen und hierhergefahren sind. Er war sehr, sehr wütend.«
»Ich weiß.« Rose strich Maddie den dichten Pony aus dem Gesicht. »Aber er war nicht wütend auf dich, sondern auf mich. Wegen etwas, das ich getan hatte.«
»Was denn?«, wollte Maddie wissen.
»Das ist unwichtig«, sagte Rose. »Wichtig ist nur, dass du weißt, dass Daddy dich liebt.«
»Werden wir denn … müssen wir denn zurück? Wenn wir nicht wieder zurückkommen, wird Daddy wieder sauer«, bohrte Maddie weiter.
Rose überlegte, wieder zu lügen, aber nur kurz. »Ich möchte Daddy eine Weile nicht sehen.«
»Und was machen wir stattdessen?« Maddies Stimme klang ängstlich. »Ich will ihn sehen! Am Samstag um Viertel vor drei wollen wir schwimmen gehen. Und Sonntag um eins gibt’s Mittagessen. Huhn mit Kartoffeln, und ich kriege immer die Brust ohne Haut. Als ich Daddy das letzte Mal gesehen hab, war er wütend. Was, wenn er immer noch wütend ist?«
»Ich weiß, mein Schatz, ich weiß.« Rose beobachtete Maddies angespannte Miene. »Ich bin mir sicher, dass wir beiden irgendwo hier in der Nähe schwimmen gehen können. Und wir können in einem Pub mittagessen. Da gibt es bestimmt Huhn. Und ich mache die Haut für dich ab.«
»Aber so machen wir das sonst nicht!«, protestierte Maddie. »Wir gehen zu Hause schwimmen, und du machst das Huhn. Du weißt, wie ich es am liebsten mag, die Soße darf es nicht berühren.«
»Jetzt hör mal zu, Maddie«, sprach Rose sanft auf ihre verstörte Tochter ein und setzte sich neben sie aufs Bett. Ihre Hände behielt sie ganz bewusst bei sich, um ihr nicht noch mehr Angst zu machen. »Unser Leben wird jetzt für eine Weile etwas anders sein als sonst. Aber das ist nicht schlimm, wirst schon sehen. Ich passe auf dich auf. Ich weiß, dass das schwer ist, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn Sachen plötzlich anders sind, aber glaub mir, ich werde nicht zulassen, dass dir etwas Schlimmes passiert.«
»Das hat Daddy auch gesagt«, brummte Maddie. »Und das war gelogen.«
»Ich hab noch mal drüber nachgedacht.« Jenny tauchte völlig unvermittelt in der Tür auf und zeigte auf Maddie. Rose fragte sich ein bisschen verärgert, wie lange sie wohl schon im Flur gestanden hatte. »Du hast recht, junge Dame, wozu hat man eigentlich ein Puppenhaus, wenn keiner damit spielen darf? Mein Urgroßvater hat es für seine Töchter gebaut. Als ich klein war, habe ich unglaublich viel damit gespielt, aber von meinen Kindern hat sich dann nur Haleigh dafür interessiert. Darum habe ich Brian gebeten, einen Glaskasten dafür zu bauen, damit ich es nicht jeden Tag abstauben muss. Hättest du Lust, damit zu spielen, während deine Mutter unterwegs ist? Ich kann die Vitrine für dich aufmachen.«
»Danke, aber …« Rose wollte Jenny gerade erklären, dass Maddie nicht gerne in der Obhut von Fremden blieb, aber ihre Tochter fiel ihr ins Wort.
»Ja, bitte, das würde ich sehr gerne, danke«, ließ sie äußerst wohlerzogen verlauten.
»Bist du dir sicher, mein Schatz?«, fragte Rose misstrauisch nach.
»Ja«, erwiderte Maddie selbstsicher. »Ich liebe kleine Sachen, stimmt’s nicht, Mummy? Und ich würde gerne etwas tun, bei dem ich nicht an zu Hause denken muss.«
»Sind Sie sich sicher?«, fragte Rose nun Jenny. »Ich meine, Babysitten gehört ja eigentlich nicht zu Ihren Aufgaben, oder?«
»Allerdings«, sagte Jenny in einem Ton, der klarstellte, wie unendlich entgegenkommend sie war. Dann wurde ihre Miene etwas weicher. »Aber wissen Sie, ich habe meine Enkel schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Haleigh lebt auf der anderen Seite der Welt und schreibt mir nur im Notfall mal eine E-Mail. Und ich weiß ja nicht, was mit Ihnen beiden los ist, aber ich kann es nicht haben, wenn ein Kind so verloren wirkt wie Ihres. Mir wird es guttun, mal ein bisschen Zeit mit jungem Gemüse zu verbringen. Und wenn Sie wiederkommen, können Sie mir haarklein erzählen, wie es gelaufen ist und wann Sie Ihren Vater besuchen und was Sie ihm sagen werden.«
Rose lächelte. Sie konnte Jennys offenkundige Neugier viel besser akzeptieren als ihre plötzliche überbordende Freundlichkeit, obwohl sie zugeben musste, dass Jenny wirklich freundlich war, außerdem machte sie sich offenbar Sorgen um Maddie, die sich inmitten eines Dramas befand, über das sie so gut wie gar nichts wusste.
»Alles gut, Mummy. Ich liebe kleine Sachen«, versicherte Maddie ihr. »Ich will nicht mit dir mitgehen. Ich glaube nicht, dass mir das gefallen würde.«
»Gut. Okay.« Rose fragte sich, ob sie ihre Tochter je verstehen würde. »Ich bin ja nur ein Stück die Straße runter. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich einfach an …« Rose musste an ihr Handy denken, das abgeschaltet in ihrer Tasche steckte. Sie hatte wirklich keine Lust, es wieder einzuschalten und zu sehen, wie oft Richard sie angerufen hatte, seine Nachrichten abzuhören oder seine SMS zu lesen. Er war ganz bestimmt stinksauer auf sie, und an allem, was passiert war, bevor sie mit Maddie aus dem Haus gestürzt war, würde er gnadenlos ihr die Schuld geben. Das Problem war bloß, dachte Rose, dass er damit vielleicht gar nicht so unrecht hatte.
»Liebchen«, sagte Jenny und fegte ihre Gedanken vom Tisch. »Zu Fuß sind es fünf Minuten zum Pub. Wenn ich Sie brauche, rufe ich Ted an, und der kann Ihnen Bescheid sagen.«
»Ted?« Rose stellte sich einen knorrigen alten Einheimischen vor, der seinen Stammplatz an der einen Ecke des Tresens hatte, wo er den lieben langen Tag an einem Bier nippte und sich die Pfeife stopfte.
»Der Mittlere von meinen dreien. Ist da der Barkeeper. Wohnt auch da. Eigentlich keine richtige Arbeit, aber er mag das. So hat er wenigstens immer genug Geld für Bier, während er an seiner Karriere als Rockstar feilt. Eines Tages wird auch er mal erwachsen, und dann wird ihm aufgehen, dass es im Leben nicht nur darum geht, Spaß zu haben. Obwohl, seinem Vater ist das bis heute nicht aufgegangen.«
»Ted.« Rose lächelte. »Ich werde nach ihm Ausschau halten.«
»Keine Sorge.« Jenny schürzte die Lippen und ließ den Blick von Kopf bis Fuß über Rose und ihr neues Outfit wandern. »Er wird im Handumdrehen bei Ihnen sein.«
Rose drückte die Eingangstür zu dem traditionellen Pub mit dem Steinfußboden, der uralt aussehenden Einrichtung und den nikotingelben Wänden auf. Es war Mittag und entsprechend ruhig im The Bull. Rose sah lediglich zwei Wanderer und eine alte Dame, die in einer Ecke saß und an einem Flaschenbier nippte. Über dem imposanten Kaminsims hing, genau wie Jenny es ihr erzählt hatte, eine weitere Reproduktion von John Jacobs’ Millthwaite aus der Ferne. Am Tresen lehnte ein junger Mann, vermutlich Ted, und blätterte in einer Zeitschrift.
»Ted?« Mit einem unsicheren Lächeln näherte sich Rose der Bar.
Ted sah auf und grinste breit. »Rose! Wo bist du bloß mein ganzes Leben gewesen?«
»Woher weißt du …?«
»Meine Mutter hat mir gesimst, dass du unterwegs bist«, erklärte er ihr. »Ich soll schön die Ohren spitzen und ihr berichten, was du mit Albie zu besprechen hast. Keine Sorge, mir ist es egal, weshalb du hier bist, es sei denn, du möchtest mich gerne auf einen Drink einladen, da würde ich glatt Ja sagen, übermorgen habe ich frei, habe allerdings einen Gig, aber du könntest gerne mitkommen und mein Groupie sein.«
»Wie bitte?« Rose musste lachen, war sich aber nicht sicher, ob er sie vielleicht bloß aufzog.
»Sorry.« Ted lächelte reumütig. »Ich wollte bloß witzig sein. Aber ich spiele wirklich in einer Band. Und übermorgen gibt es Live-Musik. Wenn du nichts vorhast, solltest du wirklich kommen und mich singen hören. Die Mädels liegen mir reihenweise zu Füßen, wenn sie mich erst mal singen gehört haben.«
Rose blinzelte ihn an.
»Versuche wieder, witzig zu sein«, sagte Ted. »Klappt offenbar wieder nicht.«
Ted sah wirklich ziemlich gut aus – und er war verdammt selbstbewusst. Rose schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Er hatte wie Jenny kupferbraunes Haar, das ihm immer in die braunen Augen fiel, und trug ein blütenweißes, nur bis zur Hälfte zugeknöpftes Hemd.
»Na ja, ich bin ja schon längst kein Mädchen mehr, von daher werde ich die freundliche Einladung wohl besser ablehnen«, sagte Rose, der es schwerfiel zu verbergen, wie sehr er sie amüsierte. »Und du bist in der Tat ganz schön witzig, aber vermutlich nicht so, wie du dir das vorstellst.«
»Autsch.« Ted grinste und presste sich die Hände aufs Herz. »Gut, okay. Die Abfuhr nehme ich hin. Bis auf Weiteres. Aber damit du’s weißt, liebste Rose, ich finde, du könntest durchaus noch als Mädchen durchgehen. Und du möchtest Albie sprechen, ja?«
»Ja, bitte.« Roses Herzschlag beschleunigte sich, als sie sich umsah. Unwillkürlich umschlossen ihre Finger das Handy in der Hosentasche. Vielleicht versuchte Richard jetzt gerade sie anzurufen. Vielleicht versuchte er herauszufinden, wo sie war, ob sie es irgendjemandem erzählt hatte. Ganz sicher war er außer sich vor Wut und grenzenlos frustriert darüber, dass sie außer seiner Reichweite war, sicher schäumte er, weil er die Kontrolle verloren hatte – über die Situation und über sie. Seltsamerweise bereitete es Rose tatsächlich ein gewisses Unbehagen, sich an einem Ort zu befinden, an dem Richard sie nicht erreichen konnte. Seit ihrem achtzehnten Geburtstag war kein Tag ohne ihn vergangen. Und jetzt stand sie in diesem Pub Hunderte von Kilometern von ihrem Mann entfernt und hoffte, mit dem einzigen Mann in Kontakt zu kommen, der bei ihrer ersten und einzigen und eher flüchtigen Begegnung so viele Gefühle in ihr ausgelöst hatte.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Rose.« Albie, ein athletisch wirkender Mann Ende fünfzig und so gar nicht das, was Rose sich unter einem Dorfschenk vorgestellt hatte, streckte ihr über den Tresen hinweg die Hand entgegen.
»Hat Jenny Sie auch schon informiert?« Lächelnd nahm Rose seine Hand.
»Die Gute ist nicht so aufgeregt gewesen, seit Mrs. Harkness’ Au-pair von Mr. Harkness geschwängert wurde«, erklärte Albie ihr mit einem trockenen Lächeln. »Die arme alte Jenny. Lechzt ständig nach dem neuesten Tratsch, dabei passiert hier doch so gut wie gar nichts.«
»Aber Ihnen ist etwas passiert«, sagte Rose. »Bei Ihnen kam einfach so ein Kunsthändler hereinspaziert und hat Ihnen zehntausend Pfund gegeben.«
»Er hat sie mir nicht einfach gegeben. Er hat dafür das Gemälde bekommen, das viel mehr wert war als zehn Riesen.«
»Hat Sie das aufgeregt?«, fragte Rose. »Als Sie hörten, für wie viel er es weiterverkauft hat?«
Albie schüttelte den Kopf. »Frasier – also, der Kunsthändler – hat mich gleich angerufen, nachdem er es verkauft hatte. Und hat mir noch fünf Riesen gegeben, Finderlohn. Er hat’s mir von sich aus angeboten, ich habe ihn nicht drum gebeten. Das fand ich schon verdammt anständig.«
Roses Herz machte einen Satz, als Frasiers Name so beiläufig in ihrem Gespräch fiel. Sie versuchte sich zu sammeln.
»Unbedingt … Und haben Sie seine Nummer? Die von diesem Frasier? Oder seine Adresse?«
»Klar.« Albie nickte und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Sie will, dass du sie ihr gibst, du Penner.« Ted verdrehte die Augen.
»Ach so. Ja klar. Kleinen Moment, bitte.«
Die Tür, die in den Raum hinter der Bar führte, war so niedrig, dass Albie sich ducken musste.
»Okay, was hat dieser Frasier, das ich nicht habe?«, fragte Ted lässig und rückte Rose etwas näher auf die Pelle. »Ich meine, abgesehen von jeder Menge Kohle und einem schicken Auto? Ach, und natürlich von Haaren, die aussehen, als würde er sie sich fachmännisch ondulieren lassen?«
»Du kennst ihn?«, fragte Rose fasziniert.
»Er ist ab und zu mal hier.« Ted zuckte die Achseln. »Hör mal, ich kenne ihn und ich kenne mich, und wenn du einfach nur einen Urlaubsflirt willst, dann bist du bei mir auf jeden Fall besser aufgehoben. Ich bin jünger. Ich habe mehr Ausdauer.«
»Du bist großartig«, lachte Rose. Sie fand diesen jungen übermütigen Mann sympathisch, dessen Augen verrieten, dass er ein Lachen unterdrückte. »Das Leben hier muss wirklich extrem langweilig sein, wenn du dich an so alte Frauen wie mich heranschmeißt. Oder ist das bloß deine Masche, um an zusätzliches Trinkgeld ranzukommen?«
»Ich gehe von der irrigen Annahme aus, dass mir keine Frau widerstehen kann.« Ted grinste sie an. »Ich will nicht lügen, meistens werde ich enttäuscht, aber ich bin jemand, für den das Glas immer halb voll ist. Und du bist nicht alt. Und du siehst klasse aus.«
»Es reicht!«, entfuhr es Rose. Sie wandte sich von ihm ab. Sein Blick war ihr plötzlich so unangenehm gewesen – eine Folge der vielen Jahre, in denen sie sich hatte angewöhnen müssen, selbst der geringsten Aufmerksamkeit von Männern auszuweichen.
»Tut mir leid!« Ted war etwas perplex angesichts ihrer harschen Reaktion und ihrem Unbehagen. »Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich wollte nur witzig sein. War blöd von mir. Ich bin ziemlich oft blöd, kannst jeden hier fragen.«
»Du hast mich nicht in Verlegenheit gebracht. Ich bin einunddreißig.« Rose ärgerte sich viel mehr über sich selbst und darüber, dass sie so überreagierte, als über ihn. Richard wurde immer so wütend, wenn er glaubte, andere Männer würden sich für sie interessieren, und richtig wild, wenn er auch nur den Verdacht hatte, ihr würde das gefallen. Die Angst, dabei gesehen zu werden, wie sie mit einem anderen Mann sprach, hatte sich über die Jahre derartig manifestiert, dass es Rose selbst jetzt, wo Richard nicht dabei war, schwerfiel, anders zu reagieren. Sie atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. »Ich bin nicht hier, um mit einem Jungen wie dir zu flirten, das ist alles.«
»Ich bin vierundzwanzig«, sagte Ted und neigte den Kopf zur Seite. Er war immer noch erstaunt über ihre heftige Reaktion. »Sieben Jahre Altersunterschied – das ist doch gar nicht so viel. Hör zu, tut mir leid. Ich bin dir ganz offensichtlich zu nahe getreten. Das war nicht meine Absicht. Ich bin kein schlechter Mensch, ehrlich. Ich bin ein ganz netter Kerl.«
»Glaub ihm kein Wort«, sagte Albie, als er mit einem Zettel in der Hand zurückkam. »Große Klappe, nichts dahinter. Ich warte immer noch darauf, dass er hier irgendwann verschwindet und sich eine richtige Arbeit sucht, aber irgendwie ist er immer noch hier.«
»Du liebst mich doch.« Ted grinste Albie an und tätschelte ihm den Rücken. »Und wenn ich und meine Band endlich nach London verschwinden, wird dein Umsatz in den Keller gehen.«
»Das Risiko nehm ich in Kauf«, entgegnete Albie fröhlich.
»Aber jetzt mal im Ernst«, wandte sich Ted wieder an Rose. Seine Augen funkelten vor lauter Charme, und er war sich dessen zweifellos bewusst. »Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, solange du hier bist – dir die Gegend zeigen, dir Leute vorstellen, mit dir ausgehen –, dann sag einfach Bescheid. Ich beiße nicht, versprochen. Es sei denn, du bittest mich darum.«
»Ich glaube kaum, aber danke für das Angebot.« Rose konnte überhaupt nicht verstehen, wieso Ted sich so sehr für sie interessierte.
»Hier, bitte schön.« Albie reichte Rose eine aus einem Notizbuch herausgerissene Seite, und Rose nahm sie mit zitternden Fingern entgegen. Neben ein paar Telefonnummern und einer E-Mail-Adresse hatte Albie geschrieben: »Frasier McCleod – Kunsthändler – Edinburgh«. »Sie brauchen aber übrigens nicht extra nach Schottland zu fahren, wenn Sie mit ihm reden wollen. Er wird in ein paar Tagen ohnehin bei Ihrem Vater sein.«
»Was?« Rose blinzelte, und die ganze Farbe, die Teds ungeschickte Flirtversuche ihr ins Gesicht gezaubert hatten, verschwand auf einen Schlag wieder.





























