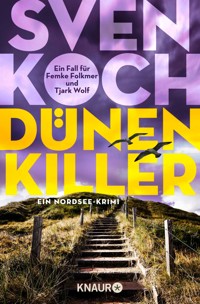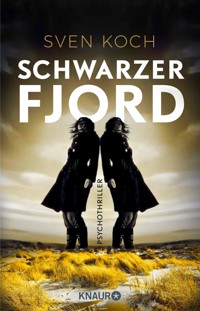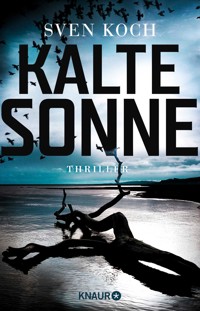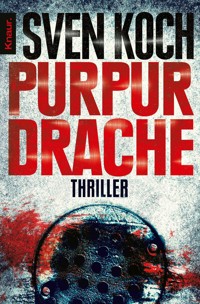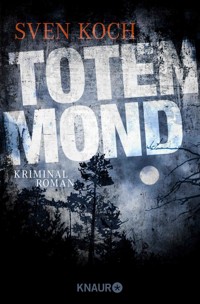9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Femke Folkmer und Tjark Wolf
- Sprache: Deutsch
Hoch-atmosphärische Krimi-Spannung aus Ostfriesland mit einer guten Portion Action Ein vermisstes Mädchen, Seemannsgarn und ein Serienmörder: »Dünengrab« ist der erste Küsten-Krimi der Dünen-Reihe von Sven Koch. Im dichten Küstennebel verschwindet nachts ein junges Mädchen aus dem Fischerdorf Werlesiel an der friesischen Küste. Femke Folkmer, die Chefin der kleinen Polizeiinspektion, ahnt schnell, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Vermisstenfall handelt. Den Schauergeschichten, die sich die Küstenbewohner über den Nebel erzählen, kann sie allerdings auch keinen Glauben schenken. Zur Verstärkung wird Femkes Team Kommissar Tjark Wolf zugeteilt, der unlängst als True-Crime-Bestseller-Autor für Aufsehen sorgte. Die Zusammenarbeit mit dem rauen Großstadt-Polizisten klappt überraschend gut – doch statt der Vermissten finden die Ermittler den versteckten Friedhof eines Serienmörders … Der perfekte Urlaubskrimi für alle, die es etwas düsterer und mit handfester Action mögen Der Auftakt einer hoch-spannenden Krimi-Reihe: Mit Kommissar Tjark Wolf hat Krimi-Autor Sven Koch einen kantigen, knallharten Ermittler erschaffen, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung zurecht »den ostfriesischen Bruce Willis« nennt. Mit der taffen Kommissarin Femke Folkmer an seiner Seite nimmt Tjark es auch mit den ganz schweren Jungs auf. Die Küsten-Krimis von Sven Koch sind die perfekte Urlaubslektüre für Ferien im Norden! Die Krimi-Serie von Sven Koch punktet mit viel Ostfriesland-Atmosphäre, actionreichem Thriller-Feeling und einer Prise augenzwinkerndem Humor. Harte Kerle und taffe Frauen bekommen es mit schrägen Typen zu tun, während ihnen eine steife Brise um die Nase weht. RTL+ verfilmt die Dünen-Reihe mit Hendrik Duryn und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen. Die actionreichen Nordsee-Krimis von Sven Koch sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Dünengrab (Grab am Strand) - Dünentod (Tödliche Falle) - Dünenkiller (Tod auf dem Meer) - Dünenfeuer (Falsches Spiel) - Dünenfluch (Die Frau am Strand) - Dünenblut (Schatten der Vergangenheit) - Dünensturm (Tödliche Geheimnisse) - Dünenwahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sven Koch
Dünengrab
Ein Nordseekrimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Im dichten Küstennebel verschwindet nachts ein junges Mädchen aus dem Fischerdorf Werlesiel an der friesischen Küste. Femke Folkmer, die Chefin der kleinen Polizeiinspektion, glaubt weder an einen normalen Vermisstenfall noch an die Schauergeschichten, die sich die Küstenbewohner über den Nebel erzählen. Zur Verstärkung wird ihrem Team Kommissar Tjark Wolf zugeteilt, der unlängst als True-Crime-Bestsellerautor für Aufsehen sorgte. Die Zusammenarbeit mit dem rauen Großstadtpolizisten klappt überraschend gut – doch statt der Vermissten finden die Ermittler den versteckten Friedhof eines Serienmörders …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
Nachwort und Danksagung
1.
Der Nebel kroch wie ein lebendiges Wesen von der See her in die Bucht. Innerhalb weniger Minuten schob er sich, unbemerkt von allen Schlafenden, lautlos über das schwarze Watt und den weißen Sand, glitt mühelos über den Deich und den mit Sanddorn und Hagebuttenbüschen undurchdringlich bewachsenen Küstenstreifen. Im Hafen schloss er die vor Anker liegenden Boote und Schiffe ein. Schließlich erfüllte er den gesamten Ort mit seinem eiskalten Atem und machte jeden Blick auf den sternklaren Himmel in dieser vormals warmen Juninacht unmöglich.
Jeder, der an der Küste lebt, weiß, wie der Nebel entsteht, dachte Fokko Broer. Warme Luft trifft auf kaltes Wasser oder kalte Luft auf warmes Wasser. Der Nebel taucht wie aus dem Nichts auf, und wer sich nicht auskennt oder im Watt ohne Kompass unterwegs ist, muss sich unweigerlich darin verirren. Priele, Schlickfelder oder Baggerlöcher sind lebensgefährliche Hindernisse. Immer wieder geschehen hier Unglücke, Sommer für Sommer. Einmal hat der Nebel spielende Kinder überrascht. Sie sind in einen der mäandrierenden Wasserläufe gestürzt, die im Wattenmeer bei Flut zu reißenden Strömen anwachsen. Der Junge hat überlebt. Seine Schwester nicht. Nordsee ist Mordsee, heißt es, und das Sprichwort hat seinen guten Grund. Aber man sagt auch, dass das Meer irgendwann alles zurückgibt, was es sich genommen hat. Und in der Werlesieler Gegend erzählt man den Kindern am flackernden Lagerfeuer in den Dünen oder in langen Winternächten am Kamin die Gruselgeschichte, wie mit dem Nebel das ertrunkene Mädchen käme und nach seinem Bruder suche. Ihr dünnes Haar hängt voller Seetang, die Augen sind weiß wie der Nebel selbst. Mit der verknöcherten, von Muscheln verkrusteten Hand klopft sie an die Fenster und ruft mit gurgelnder Stimme seinen Namen – um ihn mitzunehmen in die kalten Tiefen. Dann wird hinter dem Rücken auf Holz geklopft, um das Pochen der eisigen Hand zu imitieren: Klopf, klopf, klopf …
Fokko Broer fröstelte. Er stand mit bloßem Oberkörper am offenen Fenster seines reetgedeckten Hauses weit außerhalb von Werlesiel und hing seinen Gedanken nach. Er hatte sich eben einen Tee gekocht und einen ordentlichen Schluck Rum dazugegossen, oder besser: dem Rum ein wenig Teegeschmack hinzugefügt. Er trank einen Schluck und genoss das Brennen in der Speiseröhre als Kontrast zu der Kühle, die der Seenebel mit sich führte. Es war ein heißer Tag gewesen, und im Haus war es immer noch stickig und schwül. Ein Klima, in dem seine Schlaflosigkeit, die Krankheit vieler alter Männer, prächtig gedieh. Gegen Mitternacht hatte Fokko sich aufs Bett gelegt und sich von einer Seite auf die andere gewälzt. Schließlich war er eingenickt, um wenig später schweißgebadet aus einem wirren Traum zu erwachen. Der Wecker zeigte 1.20 Uhr an. Seither wanderte er wie so oft rastlos im Haus hin und her und hoffte, dass der Alkohol ihn endlich müde werden ließe.
Fokko sog ein Stück Kandis ein, lutschte daran, strich sich mit der Hand über den weißen, kurz gestutzten Bart und knackte den Zuckerklumpen mit den Backenzähnen. Es hörte sich unnatürlich laut an und dröhnte in seinem Kopf. Dann blickte er wieder nach draußen in das Nichts. Die Lampe der Außenbeleuchtung war nur noch als irrlichternder Schemen zu erkennen. In der Ferne röhrte ein Nebelhorn vom offenen Meer her. Als das Geräusch verklungen war, wurde es wieder grabesstill.
Fokko wollte sich gerade umdrehen, um zu sehen, ob etwas im Nachtprogramm lief, womit er sich ablenken konnte, als er ein Geräusch wahrnahm. Er stellte die Teetasse zur Seite und lauschte vergeblich in die Leere. Er beschloss, dass wahrscheinlich sein Kater Smutje draußen eine Maus jagte. Andererseits hatte Smutje eben noch unter dem Küchentisch gelegen, und die Haustür war verschlossen. Na ja, dachte Fokko, dann vielleicht eine andere Katze, oder es tappte ein Fasan durch das Gras.
Doch da war wieder etwas, und nun hörte Fokko sehr genau hin. Waren das Schritte? Ja, da waren Schritte, und sie klangen zu schwer und zu unregelmäßig, um von einem Tier zu stammen. Es klang so, als patschte etwas auf dem Bitumen der Küstenstraße, als schleppte sich jemand auf nassen Füßen voran. Die Schritte kamen näher und raschelten im Kies auf der Einfahrt. Zu dem Geräusch gesellte sich ein Keuchen und Wimmern.
Fokkos mit Altersflecken gesprenkelte Hände zitterten. Er erschauderte. Jemand war da draußen und wollte offenbar zu ihm, aber für einen Spontanbesuch war es weder die passende Uhrzeit noch das richtige Wetter. Niemand würde sich bei dem Nebel vor die Tür begeben, wenn es nicht unbedingt sein musste.
»Hallo?«, rief Fokko in die Nacht. »Ist da jemand?«
Als Antwort kam ein Stöhnen. Die Schritte wurden schneller, hatten nun die Einfahrt überwunden und klangen hohl und schleppend auf der Holztreppe, die zur Veranda führte. Wenig später kratzte etwas an der Haustür und pochte dagegen: Klopf, klopf, klopf …
»Bitte«, klang eine dünne Frauenstimme wie durch Watte. »Bitte«, flehte sie erneut und schniefte.
Fokko Broer wurde heiß und kalt. Was, zum Teufel, war da los? Er fasste nach dem Bademantel, der über einer Stuhllehne hing, warf ihn im Gehen über, eilte zur Tür und öffnete sie. Was er sah, verschlug ihm den Atem.
Vor ihm stand eine Frau. Sie mochte vielleicht zwanzig Jahre alt sein, taumelte an ihm vorbei und zog eine leichte Alkoholfahne hinter sich her. Sie trug ein kurzes rotes Kleid und war barfuß. Auf den Oberschenkeln zeichneten angetrocknete Blutrinnsale ein bizarres Muster, das auf der linken Seite an der Wade in eine Tätowierung überging. Die Oberarme waren ebenso wie der Ausschnitt von Hämatomen und tiefen Kratzern übersät. Das Haar fiel ihr wirr in die Stirn. Die Unterlippe war aufgeplatzt und ein Auge zugeschwollen. Aus dem anderen starrte sie ins Leere, stieß wie eine außer Kontrolle geratene Billardkugel mit der Hüfte gegen die Kante einer antiken Kommode sowie gegen einen Tisch und blickte anschließend zu Broer, ohne ihn wirklich anzusehen. Da brauchte es nicht seine Erfahrung als Arzt, um sofort zu verstehen, dass sie entweder unter Schock oder unter Drogen stand.
»Wo bin ich?« Die Fremde wollte sich eine schwarze Strähne aus dem Gesicht streichen, geriet aus dem Gleichgewicht und taumelte.
Fokko Broer fing die Frau auf, was sie grundlegend falsch interpretierte. Sie begann zu schreien und um sich zu schlagen. Ihr Hinterkopf traf ihn auf die Nase, die in einem grellen Schmerz zu explodieren schien. Er ließ sie los und hob beschwörend die Hände.
»Lass mich!«, schrie die Frau mit sich überschlagender Stimme. Sie schnappte sich einen Regenschirm von der Garderobe und hielt ihn wie einen Speer hoch, die Spitze auf Fokkos Kopf gerichtet. »Lass mich, du Schwein!«
»Ich will Ihnen doch nur helfen …«, stammelte Fokko und spürte, dass ihm etwas Warmes aus der Nase in den Bart lief.
Die Fremde hielt in der Bewegung inne und sah ihn verstört an. Ihr schneller Atem klang wie ein feuchtes Schnorcheln und ließ die Brust rasch ab- und anschwellen. »Sie müssen mir helfen«, sagte sie. Dann musterte sie den immer noch wie zur Lanze erhobenen Schirm verwundert, warf ihn achtlos zur Seite und schüttelte langsam den Kopf. Fahrig hob sie die Hand in die Luft. »Nein, ich bin hier falsch, das ist … nicht richtig …« Sie sah wieder zu Broer, wiederholte: »Nicht richtig«, und ging rückwärts zur Tür. »Lassen … Sie mich …« Wieder schüttelte sie den Kopf und machte eine abwehrende Geste.
Broer hob noch immer die Hände, um die Verwirrte zu beschwichtigen. »Beruhigen Sie sich bitte. Sie müssen …«
Weiter kam er nicht. Hinter der Frau grollte es wie aus der Brust eines Raubtiers, das mit den Krallen im Kies der Auffahrt scharrte. Die Frau drehte sich wie in Zeitlupe um und blickte nach draußen.
»Er ist gekommen«, sagte sie wie in Trance. »Er ist gekommen und wird mich mitnehmen, weil wir alle nichts dagegen tun können, denn es ist so, wie es ist, und …« Sie knickte etwas ein und hielt sich am Türrahmen fest.
»Kommen Sie wieder rein«, bat Fokko. Es erschien ihm, als bewege er sich in zähem Teig, während er einen Schritt nach vorne machte, um es noch einmal zu wagen, die Frau anzufassen, sie hereinzuziehen und die Tür zu schließen. Denn was immer da draußen sein mochte, es schien dafür verantwortlich zu sein, dass …
Wie von einer unsichtbaren Kraft wurde die Frau im nächsten Moment mit einem Ruck in den Nebel gerissen und von ihm verschluckt. Eine Sekunde später hörte Fokko ihr Kreischen, das sich zu einem Flehen und Brabbeln wandelte und in kehligem Brüllen unterging.
Broer zitterte am ganzen Körper. Er sackte auf die Knie und starrte durch die offen stehende Tür ins Freie – machtlos, die Schwelle zu überschreiten und der Frau zu Hilfe zu kommen. Er vernahm lautes Knirschen und blickte in zwei rotglühende Augen, die ihn fixierten und sagen zu wollen schienen: Bleib besser, wo du bist, denn wo Platz für eine ist, ist auch Platz für zwei.
Schließlich zog sich die Bestie fauchend zurück. Sie wirbelte Kies auf, der auf die Holztreppe prasselte und Fokkos Oberkörper wie mit kleinen Schrotkugeln beschoss. Schützend riss er sich die Arme vors Gesicht. Als er sie wieder senkte, sah er, dass die Frau verschwunden war und sich die glühenden Augen zunehmend von ihm entfernten. Als sie endgültig in der Dunkelheit verschwunden waren, faltete Fokko Broer die Hände und betete zum ersten Mal seit vielen Jahren zu einem Gott, der ihn längst verlassen hatte. Ihm war schwindelig, und es gelang ihm kaum, sich wieder aufzurappeln. Mit zitternder Hand griff er zum Türknauf, um sich daran hochzuziehen, und schwankte, als er endlich wieder stand. Fokko war sich nicht sicher, ob das am Schock oder am Rum oder an beidem lag. Aber eines war ihm völlig klar: Etwas Schreckliches war geschehen.
2.
Femke Folkmer trat in die Pedale. Die blaue Uniformhose hatte sie hochgekrempelt. Der kühle Morgenwind strich über die gebräunte Haut unter dem kurzärmeligen Hemd mit dem silbernen Stern auf der Schulter und ließ ihr zum Zopf gebundenes strohblondes Haar flattern. Der Nebel hatte sich mit der aufgehenden Sonne gelegt. Die Luft war klar und frisch, der Himmel wolkenlos. Nordseewetter. Nach dem schwülen Tag gestern eine wahre Erholung. Auf dem Gepäckträger ihres Citybikes klemmte ein roter Ordner mit den Unterlagen, die ihr den Wechsel zur Kripo ermöglichen sollten.
Femke bog am Buddelschiffmuseum gegenüber dem Edeka-Markt auf den Radweg an der Hauptstraße ein und winkte an der Tankstelle Jan Gerdes zu, der gerade einen Lkw mit dem Hochdruckreiniger bearbeitete. Am Ausstellungsgebäude der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger grüßte Hagen, der Postbote, mit einem kernigen »Moin«. Femke lächelte ihm zu und nahm Tempo auf. Sie passierte die alte Windmühle, eines der Wahrzeichen von Werlesiel, nahm eine Rechtskurve und radelte am Hafen vorbei.
Der Duft nach Salz und frischem Fisch stieg ihr in die Nase. Zahllose bunte Kutter lagen vor Anker. Die Krabbenfischer sortierten ihre Netze und verpackten den Fang von der Nacht in Styroporkisten. Die Werlesieler Flotte hatte Anfang der Woche die Arbeit nach einigen Streiktagen wieder aufgenommen, an denen gegen die Preispolitik und die Dumpingangebote aus den benachbarten Niederlanden demonstriert worden war – in dieser Zeit hatte es weder in Restaurants noch an Imbissbuden frische Nordseekrabben gegeben. Gut, dachte Femke, dass das jetzt ausgestanden war, denn was gab es Schöneres, als mit einer kalten Flasche Bier am Strand zu sitzen und Krabben zu pulen, sich den Wind ins Gesicht pusten lassen, die Füße im warmen Sand zu vergraben und den Möwen beim Kreisen über den Dünen zuzusehen, die eine weitere Sehenswürdigkeit von Werlesiel waren: Dünen gab es am Wattenmeer gewöhnlich nicht.
Hinter den Deichen erkannte Femke die orangeroten Funkmasten der Fähren, die jenseits des Fischereihafens zu den Inseln fuhren und in den Sommerferien Tausende Menschen täglich transportierten. Sie ließ die Hafenpromenade mit ihren Geschäften und Gastronomiebetrieben, von denen die meisten noch geschlossen waren, hinter sich und radelte am Fischerdenkmal vorbei – einer Bronzeplastik, die Werlesiel zum fünfhundertsten Gründungsjubiläum 1982 vom Landkreis Wittmund geschenkt worden war. Dann erreichte sie das alte Rathaus, den Sitz der Gemeindeverwaltung – ein Bau aus braunroten Klinkern, mit kleinen weißen Fenstern und Glockenturm. Wenige Meter dahinter schwang sie sich vom Sattel, rollte auf dem Pedal stehend, einige Meter aus und stoppte vor dem Fachwerkhaus, in dem sich die Polizeiinspektion befand.
Femke stellte das Fahrrad neben dem blau-silbernen Streifenwagen ab, verriegelte das Speichenschloss, nahm den Ordner vom Gepäckträger und ging hinein.
Mit zweiunddreißig Jahren leitete Femke die Polizeistation seit knapp drei Jahren. Darauf konnte man sich als Tochter eines Pensionsbesitzers und einer Bäckereifachangestellten schon etwas einbilden, und deswegen hingen einige Zeitungsausschnitte von ihrer Ernennung sowie ein Artikel aus einem Polizeifachmagazin gerahmt in ihrem Büro. Sie öffnete die Fenster und goss die Geranien, bevor sie ihren Rucksack auspackte und danach die Mappe mit den Unterlagen für die Aufnahmeprüfung bei der Kripo auf den Schreibtisch legte – direkt neben das True-Crime-Buch »Im Abgrund« von Mordermittler Tjark Wolf. Seit Femke beschlossen hatte, zur Kripo zu wechseln, war das Buch zu einer Art Bibel für sie geworden. Vom Coverfoto schaute Wolf mit dem kurz rasierten Bärtchen Femke wie jeden Morgen aus traurigen, harten Augen an. Er wirkte sportlich, hatte dunkle Haare, das Gesicht war markant. Ein orangeroter Aufkleber mit der Aufschrift »SPIEGEL-Bestseller« pappte auf seiner Brust.
Sie grüßte Frida, die für die Sekretariatsarbeiten zuständig war. Frida war Mitte fünfzig und fast so groß wie breit. Sie trug ein geblümtes Kleid, hatte die rot gefärbten Haare hochgesteckt und lauschte einem Schlager von Costa Cordalis, der aus dem Kofferradio auf ihrem Tisch klang. Daneben stand ein Bilderrahmen mit einem Foto von Fridas Mann Georg. Er arbeitete auf einer Bohrinsel vor Schottland.
»Moin«, antwortete Frida und schob Femke die Post aus dem Eingangskorb sowie die neueste Ausgabe des Wittmunder Echo herüber. Auf der Titelseite war ein Foto vom Matjesfest am Hafen vom vergangenen Wochenende. Unter dem Bericht stand, dass in einer Online Galerie noch mehr Fotos zu sehen seien. Der zweite Artikel der Titelseite befasste sich damit, dass die Bade- und Kurorte an der Küste sich auf die baldigen Sommerferien und damit auf die Hochsaison vorbereiteten. Femke faltete die Zeitung zusammen, legte die Briefe obendrauf und klemmte sich alles unter den Arm. Dann ging sie zur Wachstube, wo Torsten Nibbe gerade seinen Nachtdienst mit einem Kaffee und einem Fischbrötchen ausklingen ließ. Torsten war einer der drei weiteren Polizisten. Die der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund zugeordnete Werlesieler Station war auch für die Nachbarorte zuständig. Torsten stand auf, streckte sich und sah dadurch noch länger aus, als er ohnehin schon war. Seine Haare waren kurz geschnitten und so blond wie der Urwald auf den von der Sonne verbrannten Unterarmen. Die schmalen Wangen waren von roten Äderchen durchzogen – seine Augen wegen des nächtlichen Bereitschaftsdienstes ebenfalls.
»Moin.« Demonstrativ gähnte er und präsentierte dabei ein Stück Lachs in seiner Zahnlücke. Femke bedeutete ihm mit einer Geste, dass er das mal wegmachen sollte.
»Gab es etwa Besonderes?«, fragte sie und legte die Zeitung zusammen mit der Post auf den Tresen in der Wache.
»Jo«, antwortete Torsten und pulte sich zwischen den Zähnen. »Fokko Broer hat heute früh angerufen. Den Bericht habe ich aber noch nicht schreiben lassen.«
Schreiben lassen. Das war typisch. Torsten tat gerne so, als leite er den Laden höchstpersönlich.
Femke musterte ihn fragend. Dann zuckte sie mit den Achseln. »Und? Kommt da noch was, oder wollte er dir nur einen schönen Dienst wünschen?«
Torsten lutschte das Stück Fisch vom Finger und wischte die Hand an der Hose ab. »Er hat gesagt, eine hilfsbedürftige Person sei heute Nacht bei ihm gewesen.«
»Geht es etwas genauer?«
Torsten drehte sich träge zur Seite und griff nach einem mit Kugelschreiber ausgefüllten Vordruck. »Fokko hat gesagt, die Frau sei dem Anschein nach verletzt gewesen und habe womöglich unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Sie habe um Hilfe gebeten – und dann sei etwas Komisches passiert: Er hat von glühenden Augen und Brüllen gefaselt sowie von etwas, das die Frau mit sich gerissen habe.«
»Aha«, machte Femke und verzog das Gesicht.
»Hat wohl wieder mal einen über den Durst getrunken.« Torsten grinste.
Femke nickte langsam. Letzte Nacht hatte Seenebel geherrscht. Fokko Broers Haus lag außerhalb an der Küstenstraße. Er wohnte dort seit einigen Jahren ganz allein, nachdem er wegen dieser unseligen Sache seine Stellung an der Kinder- und Jugendmedizinischen Klink Aurich verloren hatte. Im Ort galt er als ein wenig verschroben, und er trank, wenngleich Femke ihn nicht als Alkoholiker bezeichnen würde. Vielleicht hatte sich eine Nachtschwärmerin im Nebel verirrt, war angefahren worden und hatte verletzt bei ihm um Hilfe gebeten. Sie fragte: »Ist schon jemand zu ihm rausgefahren?«
»Nein.«
»Meldungen über einen Unfall letzte Nacht haben wir nicht?«
»Nein.« Torsten warf das Papier zurück auf den Tisch. »Ein Notruf über die 110 ist eingegangen.«
Femke strich sich eine Strähne aus der Stirn, gab sich betont gefasst und faltete die Hände über der Post auf dem Tresen. »Was für ein Notruf genau, und wann ging er ein?«
Torsten rieb sich über die Stoppelhaare im Nacken und drückte auf eine Taste am Anrufbeantworter, um danach einen Blick auf das LCD-Display des Geräts zu werfen. »1.22 Uhr«, sagte Torsten. Dann fuhr er den Mitschnitt ab, und eine blechern klingende Frauenstimme erfüllte den Raum. Sie klang ängstlich, panisch, dann wieder tonlos und matt.
»Ich … Ich brauche Hilfe …«, sagte die Stimme.
»Wer ist denn da?«, hörte Femke Torsten auf dem Band.
»Ich … jemand verfolgt mich, und er … O Gott … Und ich habe all meine Sachen verloren …«
»Hallo, Sie müssen mir bitte sagen, wer Sie sind und wo Sie sind, was ist denn geschehen …«
»… es ist überall nur Nebel, und ich weiß nicht, wo meine Sachen sind … Er … Ich weiß nicht, aber ich glaube, er, ehm – hallo?«
»Hier spricht die Polizei. Wer ist denn da?«
Jetzt klang die Stimme nur noch wie ein Wimmern und Flehen. »Bitte, Sie müssen mir helfen …«
Damit brach das Gespräch ab. Torsten stellte den Anrufbeantworter wieder aus. »Was will man damit anfangen?«, fragte er und schob sich den Rest des Fischbrötchens in den Mund.
»Zum Beispiel die Nummer ermitteln und herausfinden, wer der Anschlussinhaber war«, sagte Femke und knetete ihre Knöchel. Als Kind hatte sie manchmal das Gefühl gehabt, als säße ihr ein kochend heißer Knödel im Magen, wenn sie etwas angestellt oder ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Der Kloß bedeutete Ärger. Und gerade fühlte es sich in ihrem Bauch so an, als habe sie eine frisch gekochte Kartoffel unzerkaut heruntergeschluckt. »Der Notruf und das Auftauchen dieser Frau bei Fokko Broer könnten zusammenhängen«, sagte sie. »Klang Fokko beunruhigt?«
»Jo, so hat der wohl geklungen. Möglicherweise hatte er aber wie gesagt …« Torsten tat so, als tränke er gerade ein Glas Schnaps auf ex.
»Ich glaube«, sagte Femke, »ich gucke da mal längs und frage ihn selbst.«
»Denn man tau.«
Femke nahm die Post und die Zeitung vom Tresen, klemmte sich alles wieder unter den Arm und ging in den Bereitschaftsraum. Sie hörte das Telefon klingeln, Torsten darüber stöhnen, dass er eigentlich schon Dienstschluss habe, und schließlich abnehmen. Es klang, als nehme er eine Anzeige auf, während Femke aus dem Spind ihren dunkelblauen Blouson und die weiße Mütze zog und auf einem Stuhl ablegte.
Ständig musste man Torsten alles aus der Nase ziehen. Statt dass er direkt mit dem Wichtigsten begann – aber nein, damit kam der feine Herr Polizeipräsident meist erst nach zahllosen Belanglosigkeiten daher. Sie schnallte sich den Gürtel um, an dem sich neben CS-Gas, Handschellen, einem Schlagstock und der Taschenlampe auch das Holster für die Dienstpistole befand. Sie schloss den Waffenschrank auf, nahm ihre Walther P1 heraus, schob ein Magazin ein und quittierte die Entnahme mit einer Unterschrift auf dem Protokollzettel. Sie steckte die Waffe in das Holster und legte die Sicherung um.
Es wurde Zeit, dass sie hier wegkam. Es war überfällig. Femke dachte an die rote Mappe auf ihrem Schreibtisch. Sollte ihr demnächst eine Stellenausschreibung in die Hände fallen, wäre sie optimal vorbereitet. Ihre Kollegen waren gute Polizisten, keine Frage. Femkes Leitungsjob hatte Prestige. Sie konnte stolz darauf sein, in Werlesiel etwas erreicht zu haben – doch, was war es denn am Ende? Sie leitete eine Provinzinspektion in ihrem Geburtsort. Da erwartete sie wahrlich mehr von sich. Aber wenn sie fortgehen würde, würde sie vieles zurücklassen müssen. Beim Gedanken an Justin wurde ihr das Herz schwer. Justin gehörte hierher wie der Wind.
Femke öffnete den kleinen Metallschrank an der Wand und nahm das Fahrtenbuch sowie den Schlüssel für den Streifenwagen heraus. Sie schloss das Schränkchen, blätterte kurz durch die Zeitung und warf sie dann mit der Post, bei der es sich lediglich um Werbung handelte, in den Abfall. Mit der Jacke in der Hand ging sie zurück in die Wachstube, wo Torsten gerade auflegte und Femke groß ansah.
»Das war eine Vermisstenmeldung.«
Femke verharrte in der Bewegung. »Aha?«
»Eine Vikki Rickmers aus Bornum.« Der Nachbarort Bornum war etwa acht Kilometer entfernt. »Sie ist seit gestern verschwunden«, las Torsten von einem Notizzettel ab. »Neunzehn Jahre alt, arbeitet im Sonnenstudio und gelegentlich im Club 69. Sie wohnt in einer Zweier-WG. Ihre Mitbewohnerin hat angerufen.«
Das 69 war ein Swingerclub an der Bundesstraße. Es war bekannt, dass sich freiberuflich tätige Prostituierte dort verdingten, gelegentlich Zimmer anmieteten oder als Callgirls im Internet auf sich aufmerksam machten.
Femke schnalzte mit der Zunge. »Kannst du mir die Personenbeschreibung kopieren? Dann frage ich Fokko danach.«
Torsten schlurfte zum Kopierer. Eine Frau war vermisst, überlegte Femke. Eine Frau hatte einen Notruf abgesetzt. Eine Frau war mit Verletzungen bei Fokko Broer aufgetaucht, hatte um Hilfe gebeten und war dann verschwunden. Solche Dinge geschahen für gewöhnlich nicht in Werlesiel, wo es allenfalls mal einen Verkehrsunfall aufzunehmen galt oder Streit zwischen Betrunkenen zu schlichten.
Torsten kam vom Kopierer zurück und reichte Femke zwei Blätter, die sie zusammenfaltete und in der Hemdtasche verschwinden ließ.
»Du hättest dich um die Sache kümmern müssen«, sagte sie knapp und ignorierte Torstens erstaunten Gesichtsausdruck. Sie wusste bereits, was kommen würde.
»Ja, Chefin«, antwortete Torsten mit einer hilflosen Geste, »soll ich eine Streife extra aus Aurich anfordern oder dich aus dem Bett klingeln, weil Fokko Broer Gespenster sieht und wirre Anrufe eingehen, die sich nicht zuordnen lassen?«
»Genau das, ja.«
Torsten blähte die Backen auf. »Wohin hätte ich die Streife denn schicken sollen?«
»Menschenskind, Torsten!«, blaffte Femke. »Dass jetzt noch eine Vermisstenmeldung eingeht, sagt doch wohl eindeutig aus, dass eine Reaktion von dir auf den Notruf sinnvoll gewesen wäre, oder?«
Torsten starrte auf seine Schuhe. »Das muss ja nicht zusammenhängen.«
»Nein. Muss es nicht. Aber wir sind beide lang genug dabei, um zu wissen, dass solche Sachen in so kurzer Folge in Werlesiel ganz gewiss nicht ohne Zusammenhang geschehen.«
»Aber aus der Situation heraus … Also, ich habe mir nichts vorzuwerfen.«
»Und ich«, sagte sie und setzte ihre Mütze auf, »habe kein gutes Gefühl bei alledem.« Die heiße Kartoffel in ihrem Magen war noch kein Stück abgekühlt.
Torsten legte das Gesicht in Sorgenfalten. »Hoffentlich hat der Dummbüddel nicht irgendeinen Mist …« Er ließ den Satz unvollendet.
»Mhm«, machte Femke. Das hoffte sie auch nicht. Dann legte sie die Finger zum Gruß an die Mütze, verließ das Gebäude und fuhr raus zu Fokko Broer.
3.
Tjark zündete sich eine Zigarette an, ließ das Zippo zuschnappen, steckte es in die Tasche und stieß den Rauch durch die Nasenlöcher aus. Er trat einen Schritt zurück unter die Markise des noch geschlossenen Asia-Shops, vor dem sein blauer BMW Z4 Roadster parkte. Der Regen lief von dem verblichenen Stoff in Bächen herab, und Tjark gedachte nicht, sich die teuren Schuhe oder die italienische Designer-Lederjacke versauen zu lassen. Er klemmte die Zigarette in den Mundwinkel, fummelte den zusammengeknüllten neongelben Windbreaker auseinander und zog ihn über. Fred stand neben ihm, biss in einen Döner und trank Kaffee aus einem Pappbecher. Ein ziemlich ekelhaftes Frühstück, aber Tjark hatte es aufgegeben, die Essgewohnheiten seines Partners und sein Übergewicht zu kommentieren. Fred machte, was Fred machte. So war das nun mal. Er trug ebenfalls eine Signalweste mit Polizeiaufdruck und beobachtete mit Tjark das Spektakel, das jederzeit außer Kontrolle geraten konnte.
Gegenüber dem Asia-Shop lag etwas abseits eine Kfz-Werkstatt, vor der eine Reihe fast schrottreifer Autos mit roten Preisschildern hinter den Windschutzscheiben abgestellt waren. Links und rechts flankierten vier Streifenwagen sowie zwei zivile Polizeifahrzeuge den Fuhrpark. Blaulicht spiegelte sich in den Pfützen. Im prasselnden Regen hockten Polizisten in Uniform und Schutzweste mit gezogenen Waffen hinter den Motorhauben ihrer Wagen und harrten der Dinge.
Zu der Werkstatt gehörte eine große Garage, deren rostige Metalltore verschlossen waren. Daneben standen leere Ölfässer sowie aufgebockte Motoren. Eine Handvoll schwarz gekleideter und gepanzerter Kollegen vom SEK bewegten sich auf das Tor zu, bezogen an dem Gerümpel Position und gingen in Deckung. Tjark sog an der Zigarette, inhalierte tief, behielt den Rauch einige Augenblicke in den Lungen und atmete dann langsam aus.
Auf der anderen Straßenseite geriet etwas in Bewegung. Ceylan kam zu ihnen herüber. Gegen den Regen hielt sie ihren Blouson mit dem »Polizei«-Aufdruck wie ein Zelt über dem Kopf und sprang in ihren vermutlich völlig durchweichten Allstars über die Pfützen. Wie eine Slalomläuferin wand sie sich um Tjarks Wagen herum. Dann kam sie triefend und schnaufend unter der Markise zum Stehen und nahm den Jackenkragen vom Kopf. Darunter kam das Gesicht einer persischen Prinzessin zum Vorschein, die als Polizeimeisterin im Taekwondo für den härtesten Schlag Norddeutschlands bekannt war. Sie blickte zu Tjark auf und reckte die spitze Nase nach oben. Ceylan war sehr klein und Tjark recht groß – größer, als die meisten Menschen annahmen, die ihn nur vom Titelbild seines Buchs kannten. Er schenkte seiner Kollegin den Hauch eines Lächelns.
»Du machst deinem Namen alle Ehre«, sagte Fred zu Ceylan und ließ die leere Dönerverpackung fallen.
»Bitte?«
»Ceylan heißt doch Gazelle.« Fred trank einen Schluck Kaffee.
Ceylan musterte ihn genervt: »Ist das eine Hundert-Euro-Frage beim Jauch gewesen? Weißt du daher so einen Mist?«
Fred zuckte nur mit den Schultern und tupfte sich die Mundwinkel mit einer Papierserviette ab.
»Was macht ihr hier?«, fragte Ceylan. »Das ist nicht eure Baustelle, und außerdem habe ich gedacht …«
»Richtig gedacht«, kürzte Tjark ab und zog an der Zigarette, bis deren Spitze glühte.
Er und Fred waren auf Eis gelegt, was jeder wusste. Sie waren bis auf weiteres zum Innendienst verdonnert, was zumindest Freds Frau gefiel, denn es bedeutete, dass er pünktlich nach Hause kam, um abends und am Wochenende auf der Baustelle zu stehen und Wände für sein entstehendes Eigenheim zu verputzen oder sich mit Handwerkern herumzuärgern. Fred gab sich alle Mühe, den Anschein zu erwecken, dass er froh darüber sei, mit dem Haus endlich voranzukommen. Tatsächlich dachte Tjark, dass der Palast Fred finanziell das Genick brechen würde. Abgesehen davon passte ein Eigenheim einfach nicht zu ihm. Fred und Tjark waren Straßenköter und keine Schoßhunde, und das war einer der Gründe, warum sie heute bei diesem beschissenen Wetter unter der Markise eines Asia-Shops herumstanden.
»Wir vertreiben uns die Zeit und sehen den Profis bei der Arbeit zu«, erklärte Fred.
Es war kaum zu übersehen, dass Ceylan Fred am liebsten eine verpasst hätte. »Das kann ich total gut gebrauchen, Leute, echt.«
»Hundert Euro«, sagte Tjark, schnippte die Kippe in den Regen und deutete mit dem Kinn in Richtung Werkstatt, »dass die Typen nicht da sind.«
»Hundert Euro«, sagte Ceylan, »dass du keine Ahnung hast, wovon du redest, Superbulle.«
Tjark lachte leise und zog die Augenbrauen hoch. Seit er das Buch geschrieben hatte, nannten ihn viele Kollegen so. Tjark schilderte darin einige Routinefälle – Morde, Selbstmorde, Totschlagdelikte –, und zwar genau so, wie sie geschehen waren, und nicht, wie sie in der CSI-Glanzwelt abgewickelt wurden. Offenbar wollten viele Menschen wissen, was wirklich da draußen los war: »Im Abgrund« war schnell auf die Bestsellerliste gekommen, Tjark wurde als Gast in TV-Shows eingeladen, gab Fernseh- und Zeitungsinterviews und bekam einen Verlagsvertrag für einen Folgeband. Nicht jedem Kollegen schmeckte das. Vor allem Berndtsen nicht, seinem Abteilungsleiter. Aber Berndtsen schmeckte zurzeit überhaupt nichts, das mit dem Label Tjark Wolf versehen war. Ganz und gar nicht.
»Wir haben die Scheißkerle einige Wochen lang überwacht und den Zugriff von langer Hand vorbereitet«, erklärte Ceylan und wischte sich etwas Regen aus dem Gesicht. Um ihre Füße bildete sich bereits eine ansehnliche Pfütze. »Die sind hundertprozentig da.«
»Ich bin mir nicht so sicher«, sagte Tjark.
»Sind sie nicht«, stimmte Fred ihm zu.
»Und wer sagt euch das?«
»Mein Spinnensinn«, erklärte Tjark.
»Was?«
»Spiderman hat diesen Spinnensinn, und der macht ihn nervös, wenn Gefahr in Verzug ist. Mein Spinnensinn ist jedoch völlig stumm.«
»Du und deine Comics«, sagte Ceylan genervt.
Fred lachte, was mehr nach einem Keuchen klang. »Superbullen haben auch Superfähigkeiten.«
Ceylan wandte sich zur Seite, um zu verfolgen, was an der Werkstatt vor sich ging. Tjark nahm an, dass das SEK in wenigen Augenblicken das Schloss der Garage mit einem Schrotgewehr aufschoss oder mit einer schweren Ramme zertrümmerte. Danach würde es das Vorstandszimmer des »Bad Coyote«-Motorradclubs stürmen, der mit Waffen, Drogen und Menschen handelte und auf dessen Konto der Tod von vier Mitgliedern der »Northern Riders« ging, die ebenfalls mit Drogen, Waffen und Menschen sowie Schriften der verbotenen »Aryan Nation« und anderem Nazi-Scheiß handelten. Die Leichen waren mit heruntergelassenen Hosen und Kopfschüssen auf der Toilette einer Autobahnraststätte gefunden worden.
Ceylan schien nervös. Ihr rechtes Lid zuckte. Sie bat um eine Zigarette. Tjark zog eine aus der Packung, steckte sie an und gab sie Ceylan. Sie paffte einige Male daran, nahm aber keinen Zug auf Lunge.
»Warum seid ihr euch so sicher, dass die ausgeflogen sind?«, fragte sie. »Wir haben einen V-Mann eingeschleust, der für heute eigens einen Deal eingefädelt hat. Er hat uns verlässlich bestätigt, dass die Kerntruppe da ist – jetzt, in diesem Augenblick.«
»Der V-Mann hat euch verarscht«, sagte Fred. Er spülte sich den Mund mit Kaffee aus.
»Die ›Bad Coyotes‹ sind ein Motorradclub«, ergänzte Tjark. »Die fahren dicke Maschinen, BMWs, Kawasakis, Moto Guzzis, richtig fette Kisten. Die stehen nicht auf ein Verdeck über dem Kopf. Die wollen die Freiheit nicht nur unter dem Hintern, sondern auch im Gesicht spüren.«
Ceylans Miene erhellte sich zu einem Grinsen. Die Besorgnis allerdings wich nicht. »Und?«, fragte sie.
Tjark deutete mit der Stirn in Richtung Werkstatt. »Siehst du irgendwo Motorräder?«
»Ich nicht«, sagte Fred, zerknüllte den Pappbecher und warf ihn zur Seite.
Ceylan sog an der Zigarette. Diesen Zug nahm sie auf Lunge. »Die stehen bestimmt in der Werkstatt.« Sie überspielte ihre Unsicherheit, indem sie ihr nasses Haar ausschüttelte. »Wegen des Regens«, ergänzte sie.
Tjark deutete achtlos auf den dunkelgrauen Himmel. »Das Wetter ist denen egal. Deren Motorräder sind Schwanzverlängerungen – die verstecken sie nicht. Die wollen, dass jeder sieht, was für harte Männer sie sind.«
»So wie die Fahrer von BMW-Roadstern?«, fragte Ceylan.
Tjark schmunzelte. »So in der Art. Aber«, er machte eine abwehrende Geste, »lass dich von uns nicht beeindrucken. Du hast die Kontrolle und den Durchblick. Vielleicht haben wir unrecht.« Tjark musterte Ceylan. Sie wog sicher gerade ab, was wäre, wenn die Biker wirklich nicht da wären, und zog ins Kalkül, dass sie tatsächlich von ihrem V-Mann hereingelegt worden waren oder dieser die letzte, entscheidende Nachricht nicht mehr hatte übermitteln können – nämlich, dass etwas dazwischengekommen war und der Zugriff verschoben werden musste.
Im nächsten Moment geschahen mehrere Dinge gleichzeitig: Das SEK brach die Tür der Werkstatt mit einer Ramme auf und stürmte ins Innere. Ceylan warf ihre Zigarette weg, beugte sich etwas vor und sah nach rechts, wo Lärm aufgekommen war. Tjark blickte ebenfalls in die Richtung und erkannte, dass zwei schwere Motorräder um die Ecke bogen, auf denen bärtige Kerle saßen, die sofort bei ZZ Top hätten einsteigen können. Über ihren Lederjacken trugen sie zerschlissene Westen.
Einer der Biker erkannte sofort, was los war. Er riss die Maschine auf regennasser Fahrbahn herum. Tjark sah auf dem Rücken der Kutte das Emblem der »Bad Coyotes«. Das Hinterrad brach aus, die Maschine kam zu Fall und begrub den Mann unter sich. Der andere stoppte, sah nach links und rechts und blieb mit dem Blick an Tjark, Fred und Ceylan haften. Er griff in die Innentasche seiner Jacke und zog einen langläufigen Revolver hervor.
»Scheiße«, sagte Tjark, packte den Kopf von Ceylan in einer schnellen Bewegung, drückte ihn nach unten und riss sie mit sich zu Boden. Mit der freien Hand fasste er sich ins Kreuz, zog die Dienstwaffe aus dem Gürtelholster und duckte sich selbst. Fred tat es ihm gleich und suchte Deckung hinter Tjarks BMW.
Eine Sekunde später krachten die ersten Schüsse. Wie Hammerschläge trafen sie das Blech des Roadsters. Tjark ließ Ceylans Hinterkopf los, nahm die Walther in beide Hände und presste sich in der Hocke mit dem Rücken an die Fahrertür, machte einen Ausfallschritt und sah, wie der Coyote das Motorrad wendete und mit durchdrehenden Reifen Gas gab. Tjark zog den Kopf wieder ein, als weitere Schüsse krachten und den BMW perforierten – dieses Mal allerdings mit Polizeikugeln: Die Kollegen auf der anderen Straßenseite hatten das Feuer eröffnet.
»Aufhören! Polizei!«, hörte er die sich überschlagende Stimme Ceylans. Er blickte über die Schulter um das Heck des BMWs herum und sah, dass der Biker nun Grip bekommen hatte und davonraste. Tjark dachte nicht nach. Er rannte los, dem Dreckskerl hinterher. Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass einige Polizisten den gestürzten Coyote eingekreist hatten. Dann sah er wieder nach vorne und fixierte den Flüchtigen.
Innerhalb weniger Sekunden war Tjark völlig durchnässt. Er sprang über eine Pfütze, wechselte vom Bürgersteig auf die Straße und sprintete dort weiter. Der Biker vor ihm gewann an Fahrt. Dann verlangsamte er das Tempo etwas, um in eine Seitenstraße abzubiegen.
Fehler, dachte Tjark, nutzte den Moment, bremste ab und schlitterte auf glatten Ledersohlen über den Asphalt. Als er zum Stehen kam, riss er die Dienstwaffe hoch und nahm das Motorrad in der Zielhilfe wahr. Die Chance war nicht groß, aber sie war da. Die Walther zuckte einige Male in Tjarks Hand. Mit lautem Bellen spie sie Kugeln in Richtung des Coyoten, von denen zwei in den Vergaser einschlugen, die dritte den Hinterreifen zum Explodieren brachte und eine vierte den Lederstiefel des Bikers durchbohrte. Das Motorrad machte einen Satz und warf seinen Fahrer wie ein bockendes Pferd kopfüber ab. Sofort sprintete Tjark los und war nach wenigen Augenblicken da, um dem am Boden liegenden Mann mit voller Wucht gegen das Handgelenk zu treten, worauf dessen Revolver in hohem Bogen in den Rinnstein flog. Der Coyote keuchte. Seine Augen waren nur halb geöffnet.
»Scheißtyp«, fauchte Tjark, packte den Kerl mit beiden Händen an den Aufschlägen der Lederjacke und zog ihn wie eine leblose Puppe zu sich heran. Tjarks Kopf schnellte nach vorne. Seine Stirn traf die Nase des Bikers. Es klang, als zerbräche man trockene Äste. Tjark ließ mit der Rechten das Revers los und holte aus. Bevor er zuschlagen konnte, griff ihm jemand von hinten in das Ellbogengelenk, um den Schwinger zu stoppen.
»Hör auf!«, rief Fred außer Atem und riss Tjark zurück, der den Biker nun vollends losließ und wieder aufstand. »Bist du bescheuert?« Fred stieß Tjark vor die Brust. Er taumelte einen Schritt zurück und hielt die Hände in einer abwehrenden Geste hoch. »Was soll die Scheiße! Krieg dich in den Griff!«
»Schon gut«, sagte Tjark.
Fred schubste Tjark noch einmal. »Willst du noch ein Verfahren an den Hals bekommen, du Idiot?«
»Okay, hab ich gesagt, alles ist okay, komm wieder runter.« Tjark trat beiseite, als einige Polizisten angelaufen kamen, um den Coyoten einzusammeln.
»Hey«, hörte Tjark die Stimme von Ceylan. »Alles klar?« Tjark nickte angestrengt. Er steckte die Pistole zurück. Ceylan gab ihm einen Knuff an den Oberarm. »Du hast was gut bei mir, Cowboy«, sagte sie.
»Ich komme darauf zurück.«
4.
Femke blinzelte trotz ihrer Sonnenbrille. Die grelle Sonne spiegelte sich in der Windschutzscheibe des Dienstwagens, als Fokko Broer mit zwei Gläsern Eistee auf die Veranda kam und ihr eines reichte. Sie dankte ihm, setzte das Glas an und trank es in einem Zug halb leer.
»Wirklich schön hast du es hier«, sagte sie und leckte sich einen Tropfen von den Lippen. Die weißen Fensterrahmen des Hauses wurden von leuchtenden grünen Läden eingefasst. An den rostroten Klinkern krochen Rosenbüsche bis an die Spitzen des Reetdachs. Es roch nach frisch gemähtem Gras. Eine Bank stand neben der Eingangstür, auf der sich Fokkos Katze räkelte. Die mit hellem Kies bestreute Zufahrt wurde von Apfelbäumen gesäumt, deren Kronen der Seewind geformt und verbogen hatte. Auf der anderen Seite der Bundesstraße ließ eine Brise die Sanddorn- und Hagebuttenbüsche rascheln, die den Uferstreifen befestigten. Dahinter waren in der Ferne die Silhouetten einiger Windräder zu erkennen. Femkes Häuschen, das sie von ihrer Oma geerbt hatte, war dem von Fokko nicht unähnlich. Die Windräder konnte man von dort aus nicht sehen, aus dem Dachfenster aber bei klarer Sicht Ozeanriesen am Horizont, die von Bremerhaven her oder aus der Elbmündung kamen.
Fokko trug khakifarbene Shorts und ein Polohemd, was ihn deutlich jünger als fünfundsechzig Jahre aussehen ließ. Die Hände waren feingliedrig und gepflegt. Die Hände eines Arztes, dachte Femke. Der Wind spielte in seinem weißen Haar. Seine Augen hatten dunkle Ränder. Er sah besorgt aus und schwieg. Eben hatte er Femke erzählt, was gestern Nacht geschehen war. Sie hatte ihm danach die Personenbeschreibung von Vikki Rickmers vorgelesen, und Fokko hatte geantwortet, es könne gut sein, dass diese Frau ihn um Hilfe gebeten habe und dann verschwunden war. Er sah besorgt aus, bekümmert. Sein Blick war unstet. »Ich wollte der Frau doch helfen«, sagte er. »Aber ich konnte ja nichts mehr tun.«
»Du hast etwas von glühenden Augen erzählt …«
Fokko lachte unsicher. »Ich stand unter Schock. Das waren sicher keine Augen.«
»Nein.« Femke stellte das Glas Eistee auf der Bank ab und stemmte die Hände in die Hüften. Sie betrachtete den Kies in der Auffahrt. Er sah wie von Reifen zerfurcht aus. »Das glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass hier ein Wagen rückwärts in die Einfahrt gesetzt hat und dann der Fahrer die Frau ins Auto gezogen und wieder fortgefahren ist. Was du gesehen hast, waren wohl die Rücklichter, und bei dem von dir beschriebenen Grollen hat es sich um das Brummen des Motors gehandelt.«
»Sicher.« Fokko zuckte mit den Achseln.
»Fokko, ich muss dich fragen, ob du gestern etwas getrunken hast.«
»Ja«, hörte sie ihn sagen. Es klang wie ein Seufzen.
Femke machte einen Schritt nach vorne und hockte sich hin, um die Reifenspuren zu begutachten. »Viel?«, fragte sie.
»Eigentlich nicht, aber ich fürchte …«
Femke verstand.
»Ich kann nachts oft nicht schlafen. Der Rum hilft manchmal dabei, müde zu werden.« Er machte eine Pause. »Ich wünschte, ich wäre nüchtern gewesen. Vielleicht hätte ich dann besser helfen können.«
»Du musst dich nicht rechtfertigen«, sagte Femke und strich mit der Hand über den Kies. Die Furchen sahen frisch aus, breit, jedoch hatte Fokko kein Auto. Jeder wusste, dass er Motorroller fuhr, eine leuchtend gelbe Honda, die Femke neben dem Haus hatte stehen sehen. Dann entdeckte sie einen roten Stofffetzen, der unter zwei Kieseln im Wind flatterte. Fokko hatte beschrieben, dass die Frau ein Kleid in dieser Farbe getragen hatte.
»Sag mal«, fragte sie und blickte sich nach hinten um, »hast du zufällig Gefrierbeutel im Haus?«
»Ja«, antwortete er und ließ es wie eine Frage klingen.
»Kann ich einen haben?«
Fokko nickte und kam kurz darauf mit einer kleinen Plastiktüte zurück. Sie nutzte einen flachen Stein, um den Stofffetzen in den Beutel zu schieben, verschloss ihn mit der Klemmlasche, faltete ihn zusammen und steckte ihn in ihre Brusttasche. Dann stand sie wieder auf, bedankte sich für den Eistee und sagte Fokko, er solle sich zur Verfügung halten, falls es weitere Fragen an ihn gäbe, wovon sie ausgehe.
Sie setzte sich wieder in den Streifenwagen, hob die Hand zum Gruß, ließ den Motor an und schaltete die Klimaanlage ein. Langsam fuhr sie über den knirschenden Kies und versuchte dabei, zwischen den Fahrspuren zu bleiben, die ein Unbekannter in Fokkos Einfahrt gefräst hatte.
Es gab zwei denkbare Szenarien: zum einen Unfallflucht. Jemand hatte die Frau angefahren, die zu Fuß im Nebel nach Hause gehen wollte. Die Verletzte war zur Seite geschleudert worden und hatte anschließend nach Hilfe gesucht und Fokko Broers Haus gefunden. Ihr Benehmen konnte eine Folge des Unfalls sein. Vielleicht litt sie an einer Gehirnerschütterung. Der flüchtige Fahrer hatte schließlich gewendet, nach ihr gesucht, um sie ins Krankenhaus zu bringen, und sie bei Fokko gefunden. Aber warum hätte er sie dann gewaltsam in den Wagen befördert? Um etwas zu vertuschen – und wenn ja, was?
Andererseits mochte der Fahrer ein Freier von Vikki gewesen sein. Im Wagen gab es Streit. Der Mann wurde gewalttätig. Vikki wollte ihm entkommen und sprang aus dem Auto. Sie suchte nach Hilfe, gelangte zu Fokkos Haus und hielt sich dort so lange auf, bis der Fahrer sie wieder in seine Gewalt brachte. Aber warum sollte er das tun?
Im einen wie im anderen Fall lief es auf dasselbe hinaus: Die Kripo war gefragt. Denn eine vermisste Person musste sie ohnehin melden, den Verdacht auf Fahrerflucht ebenfalls, ein mögliches Gewaltverbrechen erst recht.
Femke bog ab auf die Bundesstraße, setzte den Blinker aber nicht nach rechts Richtung Werlesiel, sondern fuhr einige Kilometer Richtung Bornum und suchte dabei die Fahrbahn nach Bremsspuren oder anderen Hinterlassenschaften eines Unfalls ab. Kurz vor Bornum wendete sie in einem Feldweg und kehrte um. Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang von Werlesiel fiel ihr etwas Buntes am Fahrbahnrand auf, das sie auf dem Hinweg noch nicht wahrgenommen hatte. Sie bremste, stieg aus und ließ den Wagen mit laufendem Motor stehen.
Im Straßengraben unter den Hagebutten lag ein hochhackiger roter Schuh – allerdings war der Absatz abgebrochen. Vorsichtig bewegte sie den Pumps und sah, dass er innen bräunlich verschmiert war. Es sah aus wie getrocknetes Blut. Sie sah sich weiter um. Der Wind rauschte in ihren Ohren. In etwa zehn Metern Entfernung war eine Bremsspur zu erkennen. Sie sah frisch aus. Und waren da Blutstropfen auf der Straße? Femke ging auf die Stelle zu und stemmte die Hände in die Hüften. Sie wusste von diversen Unfällen, wie Blut auf Asphalt aussah. Außerdem war es unwahrscheinlich, dass hier jemand im Vorbeifahren Rotwein vergossen hatte.
Femke suchte im Streifenwagen vergeblich nach einer Tüte, in der sie den Schuh verstauen konnte. Schließlich zog sie das Überbrückungskabel aus seiner Plastiktasche – nicht perfekt, aber es sollte reichen. Sie griff nach dem Warndreieck und einem Stück Kreide, mit dem sie für gewöhnlich Unfallspuren auf der Straße markierte. Dann zog sie ihr Handy aus der Hosentasche. Sie betrachtete es einige Augenblicke lang. An sich war sie schon zu weit gegangen. Sie hatte Spuren gesichert und den roten Stofffetzen an sich genommen, was nicht in ihrer Kompetenz lag. Und jetzt noch den Schuh? Femke dachte nach. Wie dem auch sei – sie konnte ihn nicht einfach so da liegen lassen.
Also machte sie kehrt, ging zum Fahrbahnrand und schoss mit dem Handy einige Fotos, bevor sie den Schuh in der durchsichtigen Tüte aus dem Kofferraum verstaute. Mit der Kreide zeichnete sie einen großen Kreis um die mögliche Blutspur, stellte das Warndreieck in dessen Mitte und machte davon ebenfalls einige Aufnahmen. Schließlich wählte sie die Nummer der Hauptstelle und verlangte in der Zentrale nach dem Kriminalkommissariat 11, das für Gewaltverbrechen und Tötungsdelikte zuständig war, nannte ihren Namen und Dienstgrad und erklärte in groben Zügen, was passiert war und dass sich jemand vor Ort umsehen sollte. Bevor sie in die Details gehen konnte, unterbrach sie der Kollege und erklärte, dass er das zwar aufnehmen würde, im Moment aber niemand kurzfristig abgestellt werden könne. Sie solle in einer anderen Dienststelle nachfragen. Femke entgegnete, dass sie sich hier nicht von Pontius zu Pilatus schicken lasse. Und so kam es, dass Femkes Ersuchen als Personenfahndung missverstanden und an das LKA in Hannover delegiert wurde, wo man nichts damit anzufangen wusste und es schließlich an die Zentrale Kriminalinspektion in Oldenburg statt nach Osnabrück weiterleitete.
5.
Der Polizeipsychologe hieß Dr. Kevin Schröder und sächselte leicht. Er saß Tjark in einem Korbstuhl gegenüber, der gelegentlich knarrte, wenn Schröder seine Position wechselte. Im Moment hatte er ein Bein untergeschlagen und die Hände auf den Sessellehnen ausgestreckt – wohl um Offenheit zu signalisieren. Er musterte Tjark, dem der Geruch nach Zitronengras aus der Duftlampe ziemlich auf die Nerven ging.
»Wann hat das begonnen«, fragte Schröder, »mit diesen Gewalttätigkeiten?«
»Gewalttätigkeiten«, wiederholte Tjark und starrte an die weiße Wand.
Schröder hob beide Hände, nahm seine Lesebrille ab und ließ sie am Bügel rotieren. »Wir reden über Michael Becker, der sich angeblich der Verhaftung widersetzt haben soll – zwei Schläge in den Magen, ein Kopfstoß ins Gesicht. Becker wurde außerdem vor die Wand geschleudert und hat sich dabei eine Rippe gebrochen.«
»Sagt Becker.«
»Seine Frau ist ebenfalls geschlagen worden.«
»Sagt seine Frau.«
»Ich glaube, so kommen wir nicht weiter.«
»Vielleicht stellen Sie die falschen Fragen.«
»Welche sollte ich denn stellen?«
»Die richtigen.«
Schröder sah Tjark schweigend an.
»Für den Anfang«, fügte Tjark hinzu, »würde ich die Provokationen unterlassen. Auf Provokationen reagiere ich meist mit Verschlossenheit. Ich gebe Ihnen gerne die Nummer meiner Ex-Frau. Sie wird das sicher bestätigen.«
»Womit provoziere ich Sie?«
»Sie stellen etwas als Tatsache dar, was zwei Verbrecher behaupten.«
»… die noch nicht verurteilt sind.«
»Diese Typen wollen meinen Partner Fred und mich reinreißen, nur darum geht es. Rache. Schlimm genug, dass sie auf offene Türen stoßen.« Tjark schnippte mit dem Finger. »Zack, schon werde ich an den Schreibtisch versetzt, weil mein Abteilungsleiter die Beschuldigung von Becker als Steilvorlage aufgreift.«
»Er mag Sie nicht?«
»Nein.«
»Und dieser andere«, Schröder malte zwei Anführungsstriche in die Luft, »Verbrecher vor drei Monaten hat seine Behauptungen ebenfalls erfunden?«
»Ich gehe davon aus.«
Der »andere Verbrecher«. Schröder spielte auf Waldemar Lang an. Lang hatte einige Monate lang Frauen mit Schockanrufen terrorisiert und behauptet, er sei Arzt, und die Kinder beziehungsweise Lebensgefährten der Frauen seien gerade nach einem schweren Unfall bei ihm eingeliefert worden. Die entsetzten Reaktionen hatten ihn aufgegeilt. Bei seiner Festnahme hatte Lang Tjark mit Drohungen überschüttet. Meist glitten derartige Beschimpfungen an Polizisten ab wie ein Tropfen Wasser vom Blatt einer Lotusblüte. Aber es war ein schlechter Tag für Blüten gewesen, und Lang hatte Tjarks Mutter übel beschimpft. Großer Fehler. Tjark hatte sich umgedreht, Lang eine reingehauen und sich danach entschieden besser gefühlt.
Die Sache mit Michael Becker und seiner Frau war vor etwa vierzehn Tagen geschehen. Das Ehepaar hatte mit jungen Drogensüchtigen Snuff-Videos für Fetischisten produziert, die auf Beinahe-Ertrinken abfuhren. Die Beckers hatten sich massiv der Verhaftung widersetzt – und irgendetwas hatte bei Tjark ausgesetzt, als er die gläsernen Wassertanks, Ketten und Wannen gesehen hatte, die die Kulisse für die Streifen bildeten.
Schröder schwieg eine Zeitlang und faltete die Hände, indem er die Fingerspitzen aneinanderlegte. Schließlich fragte er: »Fühlen Sie sich öfter als Opfer und haben das Gefühl, manchmal dazwischenhauen zu müssen, um wieder Oberwasser zu gewinnen?«
Tjark setzte sich etwas nach vorn und stützte sich mit den Ellbogen auf den Knien ab. »Sie wissen, was diese Beckers getan haben?«
»Natürlich. Und auf so etwas reagiert man schon mal emotional als Polizist. Kann ich mir vorstellen.«
»Das kann passieren.«
»Man möchte denen sicher mal die Schnauze polieren.«
»Das Leben ist kein Wunschkonzert.«
»Andererseits: Da haben Sie doch schon schlimmere Dinge bei Verhaftungen erlebt, oder? Dagegen waren die Sache mit den Beckers und der andere Vorfall doch eher Peanuts?«
Tjark antwortete nicht. Da war etwas dran.
»Aber natürlich«, ergänzte Schröder, »stehen Sie unter Druck. Druck sucht sich seinen Weg. Wir sind wie eine Zahnpastatube – man weiß nicht, wo sie aufplatzt, wenn man drauftritt. Man redet über Ihr Buch und Ihre Popularität, über das schnelle Auto, das Sie fahren – und man fragt sich, wie Sie sich das alles auf einmal leisten können. Und Sie fühlen sich sicher manchmal wie in Ihrem BMW, Vollgas gebend, die Handbremse angezogen – und dann irgendwann«, Schröder klatschte in die Hände und pustete über die Innenflächen, »löst sich die Bremse.«
Tjark verzog das Gesicht. »Mein Auto ist heute perforiert worden und steht in der Garage der Spurensicherung.«
»Worauf man sicher ebenfalls emotional reagiert.«
»Ja«, sagte Tjark und lehnte sich wieder zurück. »Vor allem, wenn man beinahe selbst erwischt worden wäre.«
»Man oder Sie?«
»Ich – und meine Kollegen ebenfalls.«
»Mhm. Was macht das mit Ihnen?«
»Das macht mich extrem sauer. Es gefällt mir nicht, wenn auf mich geschossen wird. Das waren Schüsse aus einer .357er. Ich kann von Glück sagen, dass der Scheißkerl nur die Türen, Fenster und Seitenverkleidungen und nicht den Motorblock getroffen hat.«
»Nach solchen Erlebnissen und allem, was da noch droht wegen der anhängigen Verfahren – möchten Sie manchmal gerne abtauchen und sich eine Decke über den Kopf ziehen?«
Nein, dachte Tjark, der Typ für die Decke war er nicht. In der Tat gab es allerdings Momente, in denen er genug hatte. Genug von allem. Momente, in denen er am liebsten auschecken und den Neustartknopf drücken wollte – und weil das nicht ging, tendierte er wahrscheinlich zu Überreaktionen. Das Auschecken war deswegen nicht möglich, weil die Arbeit seinen Motor am Laufen hielt und ihn von all den Dingen ablenkte, die ihm seit der Diagnose im Kopf umherschwirrten. Abgesehen davon wurden die Beckers und Waldemar Langs dieser Welt allenfalls mit Bewährungsstrafen und Geldstrafen abgespeist. Das Verbrechen endete nicht, bloß weil man ein paar Perverse eine Zeitlang aus dem Verkehr zog. Es ging immer wieder von neuem los, und ein paar aufs Maul war das mindeste, das sie verdienten. Die Einstellung war weder politisch noch rechtlich oder moralisch korrekt, aber er war nicht der einzige Polizist, der so dachte. Natürlich gab es einen Unterschied zwischen Denken und Handeln. Genau deswegen hockte Tjark hier rum. Dennoch hatte er keine Lust, Schröder diese Einsichten auf die Nase zu binden.
Er sagte stattdessen: »Ich habe nicht das Bedürfnis, mich zu verkriechen.«
Schröder brummte und warf einen Blick auf seine Notizen. »Interessant, dass Sie vor allem über das Auto sprechen und nicht über Ihre Ängste bei dem Schusswechsel.«
»Das Auto hat es erwischt. Mich nicht.«
Schröder schrieb etwas auf. »Was kostet so ein Z4?«
»Mehr als ein Polo.«
»So gut verdienen Sie aber eigentlich nicht, oder?«
»Ich lebe sparsam und lege mein Geld gut an. Außerdem ist es ein Gebrauchtwagen.«
»Sie müssen nicht für Ihre geschiedene Frau zahlen?«
»Wir haben uns anders geeinigt. Nicht jede Frau will ihrem Ex die Hosen runterziehen – zumal sie es ohnehin vorgezogen hat, das bei einem anderen zu tun.«
Schröder lächelte schwach. »Hat Sie das gekränkt?«
»Gekränkt ist nicht das richtige Wort.«
»Was wäre das richtige Wort?«
»Das muss erst noch erfunden werden.«
»Sie haben dieses Hobby, Superhelden, oder?«
»Ich sammle alte Comics als Wertanlage.«
»Was mögen Sie daran?«
»Den ewigen Kampf des Guten gegen das Böse. Es spiegelt die Realität ganz gut wider.«
»Superman löst seine Probleme mit der Faust.«
»Superman mag ich nicht.«
»Warum?«
»Wenn Superman sich in sein Alter Ego Clark Kent verwandelt, dann setzt er sich lediglich eine Brille zur Maskerade auf und wuschelt sich ein wenig durch die Haare. Ich halte das aber für unglaubwürdig. Jeder würde ihn sofort erkennen. Ich mag den Silver Surfer.«
»Der hat doch sicher auch besondere Kräfte, nicht?«
»Er beschützt die Welt vor der Vernichtung, wird aber immer wieder enttäuscht. Das macht ihn einsam.«
Schröder musterte Tjark und spielte mit seiner Lesebrille. Dann setzte er sie wieder auf. »Machen wir nächstes Mal weiter.«
»Okay.« Tjark stand auf und ging grußlos auf den Flur. Er zog am Automaten einen Kaffee und schlug den Weg zu seinem Büro ein, um sich dort mit dem Krempel zu befassen, den der Innendienst für ihn vorsah.
Auf halber Strecke kam ihm Hauke Berndtsen entgegen. Sein preiswerter beigefarbener Sommeranzug wirkte eine Spur zu groß. Durch das weiße Hemd schimmerte der Ansatz eines Unterhemds. Darüber war eine bunt gemusterte Krawatte gebunden. Berndtsens Haut hatte die Farbe von Teig. Sein Haar war schütter, und das Feuermal am Mundwinkel sah aus wie ein Preiselbeerfleck, den der Abteilungsleiter des Kommissariats 11 vergessen hatte wegzuwischen.
»Tjark Wolf!«, rief Berndtsen und kam im Stechschritt auf ihn zu. »Ich bin stinksauer!«
Die Information über Berndtsens Gemütszustand interessierte Tjark wenig, überraschte ihn aber nicht. Garantiert hatte er von der Sache heute Morgen Wind bekommen. Berndtsen hatte Tjark von Anfang an nicht gemocht, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Seit er die Abteilung übernommen hatte, war er streng darauf bedacht, dass alles akkurat ablief, das Berichtswesen penibel befolgt, Zielvereinbarungen erfüllt und Leistungspläne übertroffen wurden sowie das Ansehen des Kommissariats, seines Kommissariats, nach außen stets tadellos war. Daran gab es im Grunde nichts auszusetzen. Nur passte es ganz und gar nicht in Berndtsens Bild, als ein Buch mit dem Titel »Im Abgrund« erschien. Ein Buch, das in laxem Umgangston geschrieben war, in dem ein Ermittler Einblicke hinter die Kulissen gewährte und bei der Talkshow von Radio Bremen oder im Frühstücksfernsehen von RTL Dinge erzählte, die sich jeglicher Kontrolle von Berndtsen entzogen und für die dieser Ermittler eine Aufmerksamkeit erhielt, die in Berndtsens Augen dem Chef gebührte: Berndtsen selbst.
Tjark nahm den Kaffeebecher in beide Hände. »Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Aber ich konnte nichts dafür«, sagte er mit einem entschuldigenden Schmunzeln.
Berndtsens Blick verwandelte sich in den eines feuerschnaubenden Dämons aus dem siebten Kreis der Hölle. Er hob den Finger drohend. »Dieses Grinsen …«
»Ja?«
»… ist völlig unangemessen! Nicht nur, dass ihr euch in einen Einsatz eingemischt habt, obwohl meine Dienstanweisungen in dieser Hinsicht absolut eindeutig waren. Du hast dich auch noch vom Einsatzort verzogen, ohne dass irgendein Bericht oder eine Darstellung des Tathergangs …«
Tjark hob abwehrend die Hände. »Ich hatte einen Termin beim Psychologen. Ich nahm an, die Einhaltung meiner Verabredungen mit Schröder ist dir sehr wichtig. Einen Bericht kann ich immer noch schreiben.«
»Und zwar plötzlich!« Berndtsen nahm den Finger wieder runter.
Tjark trank einen Schluck Kaffee. »Hauke, wir sind da ganz zufällig reingeraten. Der Typ hat angefangen, auf uns zu schießen. Was sollten wir denn machen? Uns abknallen lassen?«
»Ihr hättet gar nicht erst da herumstehen dürfen. Dafür kann ich dir eine Abmahnung verpassen.«
Tjark sah Berndtsen schweigend in die Augen. Sein Vorgesetzter setzte einen Gesichtsausdruck auf, der vermutlich vermitteln sollte, dass er Tjark nun endgültig bei den Eiern hatte. Was gar nicht mal so falsch war.
»Fred und ich«, sagte Tjark mit einem Schulterzucken, »mussten einfach mal raus.«
»Ich sage dir was«, erklärte Berndtsen und nickte zu seinen eigenen Worten, »ich sage dir was, Wolf. Wenn ihr zwei euren Hintern nicht auf dem Schreibtischsessel lassen könnt, dann macht euch wenigstens nützlich und nichts kaputt.« Er reichte Tjark einen Zettel.
Tjark überflog die Zeilen. »Was soll das denn sein?«
»Eine vermisste Person, Ermittlungsersuchen aus Werlesiel. Fahr mit Fred hin und klär das.«
Tjark strich sich mit der flachen Hand über den Kinnbart. In einer Vermisstensache am Arsch der Welt ermitteln – genauso gut hätte er Fred und ihn losschicken können, um im Streifendienst Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen.
Berndtsens Feuermal zuckte, und der Mund daneben setzte ein zufriedenes Lächeln auf. »Wird dir mal ganz guttun, Basisarbeit zu machen und dich daran zu erinnern, dass es nicht nur die Crema auf dem Kaffee, sondern auch den Bodensatz gibt.«
Tjark blickte in seinen Becher und überlegte, ob Berndtsen wohl früher auf dem Schulhof ständig verprügelt worden war und sich nur deswegen an eine leitende Position in der Nahrungskette vorgearbeitet hatte, um es allen heimzahlen zu können. Dann fragte Tjark: »Werlesiel? Ist das überhaupt unser Zuständigkeitsbereich?«
»Jetzt schon«, sagte Berndtsen.
6.
Vikki Rickmers glitt von einer in die nächste Schwärze, als sie die Augen öffnete. Ihre erste Reaktion war Panik. War sie blind geworden?
Die Panik wurde von einem schrecklichen Schmerz, Schwindel und Übelkeit abgelöst. Sie fühlte sich wie nach einer schnellen Karussellfahrt. Alles drehte sich. Ihr Kopf schien in einen Schraubstock eingespannt worden zu sein. Ein Stöhnen kam ihr über die Lippen, das sich zu einem Husten wandelte und ihren ganzen Körper schüttelte. Das war schlecht, denn ihr Schädel schien nun endgültig zu platzen. Sie wollte nach ihrem Kopf fassen, aber das ging nicht. Die Beine ließen sich ebenfalls nicht bewegen. War sie nicht nur blind, sondern auch noch gelähmt? Schließlich kippte Vikki wie ein nasser Sack zur Seite – und wurde von einem heftigen Schlag getroffen, der ihr durch sämtliche Glieder fuhr.
Minuten, vielleicht Stunden später kam sie wieder zu sich und erbrach sich im Liegen. Nach einer Weile ließen die Krämpfe im Magen nach. Dafür zuckten Arme und Beine, als habe sie Schüttelfrost. Wenigstens, dachte Vikki, deutete das darauf hin, dass sie nicht gelähmt war, denn dann würde sie ihre Extremitäten nicht spüren können. Sie spuckte einen Schwall bittere Galle aus, und im nächsten Moment verstand sie, dass sie doch nicht blind war. Da war ein Licht.
Sie versuchte, den Kopf etwas zu bewegen, was nur leidlich gelang, denn irgendetwas war um ihren Hals gebunden. War das das Leuchten, von dem einige Menschen nach Nahtoderlebnissen sprachen? War sie in einer Art Vorhölle gelandet? Wie durch einen Schleier sah sie, dass das Licht etwas anstrahlte. Eine Person, deren Gesicht entstellt und wie zerquetscht aussah.
»Du bist mein«, sagte das Wesen. »Wir zwei werden schrecklich viel Spaß haben. Zumindest für eine Weile.«
Vikki wollte etwas sagen, brachte aber nur ein Röcheln zustande.
Das Wesen hob die Hand. »Erspar mir dumme Fragen und Gejammer. Ich will von dir lediglich eine Antwort auf eine einfache Frage.«
»W-w…« Vikkis Lippen formten wie von selbst Laute. Blutiger Speichel rann ihr am Kinn herab und troff auf den Boden. »W-w…?«
Das Wesen legte den Kopf schief. Es schien amüsiert zu sein und lachte. »Ich will nur eines wissen«, sagte es dann und wurde wieder ernst. »Liebst du mich?«
7.
Tjark wachte auf und schnappte nach Luft wie ein frisch an Land gezogener Karpfen nach Wasser. Mit tiefen Atemzügen sog er Sauerstoff in die Lungen, strich sich über den klatschnassen Oberkörper und begriff erst nach einigen Augenblicken, dass es nur kalter Schweiß war. Er versuchte, sich zu orientieren, und verstand, dass er in seinem Schlafzimmer war – nicht mehr tief unter Wasser in einem namenlosen Abgrund, in dem sich schwarze Algen wie Tentakel um seine Gliedmaßen geschlossen hatten. Durch den Vorhang schien die Morgensonne und zeichnete Muster auf das Parkett, mit dem das gesamte Loft ausgelegt war.