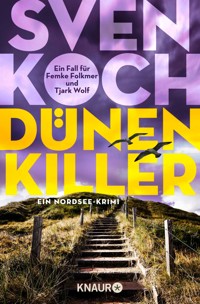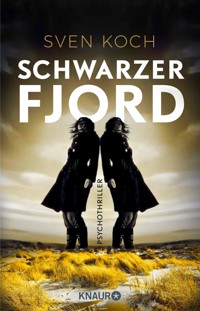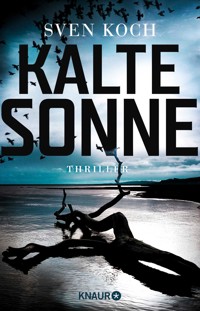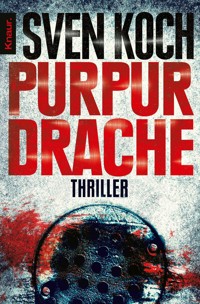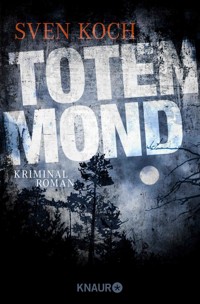9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Femke Folkmer und Tjark Wolf
- Sprache: Deutsch
Actionreich, hochspannend und mit viel Nordsee-Atmosphäre: »Dünentod« ist der 2. ostfriesische Küsten-Krimi um die Kommissare Tjark Wolf und Femke Folkmer Ein Mann ohne Fingerabdrücke, ein Raum voller Leichen – die Polizei jagt einem Phantom nach, einem Wahnsinnigen, der ein Arsenal von Waffen und Sprengstoff an sich gebracht hat und ein Massaker plant. Bevor die Polizei den Gesuchten fassen kann, entführt er eine voll besetzte Nordseefähre, um sie in die Luft zu jagen. Ermittler Tjark Wolf schafft es in letzter Sekunde, an Bord zu gelangen. Ein perfides Spiel beginnt: Der Attentäter gibt Tjark eine Stunde Zeit, dann will er die Fähre in die Luft jagen… Die Küsten-Krimis von Sven Koch sind die perfekte Urlaubslektüre für Ferien im Norden! Mit Kommissar Tjark Wolf hat Krimi-Autor Sven Koch einen kantigen, knallharten Ermittler erschaffen, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung zurecht »den ostfriesischen Bruce Willis« nennt. Mit der taffen Kommissarin Femke Folkmer an seiner Seite nimmt Tjark es auch mit den ganz schweren Jungs auf.Der perfekte Urlaubskrimi für alle, die es etwas düsterer und mit handfester Action mögen. Die Krimi-Serie von Sven Koch punktet mit viel Ostfriesland-Atmosphäre, actionreichem Thriller-Feeling und einer Prise augenzwinkerndem Humor. RTL+ verfilmt die Dünen-Reihe mit Hendrik Duryn und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen. Die actionreichen Nordsee-Krimis von Sven Koch sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Dünengrab (Grab am Strand) - Dünentod (Tödliche Falle) - Dünenkiller (Tod auf dem Meer) - Dünenfeuer (Falsches Spiel) - Dünenfluch (Die Frau am Strand) - Dünenblut (Schatten der Vergangenheit) - Dünensturm (Tödliche Geheimnisse) - Dünenwahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sven Koch
Dünentod
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Mann ohne Fingerabdrücke, ein Raum voller Leichen – die Polizei jagt einem Phantom nach, einem Wahnsinnigen, der ein Arsenal von Waffen und Sprengstoff an sich gebracht hat und ein Massaker plant. Bevor die Polizei den Gesuchten fassen kann, entführt er eine voll besetzte Nordseefähre, um sie in die Luft zu jagen. Ermittler Tjark Wolf schafft es in letzter Sekunde, an Bord zu gelangen, wo ein perfides Spiel beginnt: Der Attentäter gibt Wolf eine Stunde, um ihn zum Aufgeben zu bewegen…
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
Nachwort und Dank
1.
Das Meer hatte die Farbe von Schiefer. Unter dem diesigen Himmel wirkte es geschwollen und stark. Schwere See. Fünf Meter hohe Wogen preschten gegen den Bug der schneeweißen Autofähre, ließen die Gischt zerstäuben und gegen das Glas des Steuerhauses klatschen. Dahinter saß Kapitän Maxim Ferner, genannt Charon. Charon wie der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Seelen der Verstorbenen über den Fluss Styx in die Unterwelt bringt. Heute standen die Chancen gut, dass er seinem Namen alle Ehre machen würde. Das Schiff war mit knapp zweihundert Autos beladen, fasste achthundert Passagiere und war nicht für die Belastungen gebaut, denen es nun ausgesetzt war. Ganz und gar nicht.
Die Fähre fuhr mit voller Kraft voraus und pflügte frontal durch die Dünung. Ferner starrte nach vorne, wo sich der Bug schwerfällig aufbäumte, um kurz darauf tief in die Wellentäler zu stürzen. Wenn der Sturm weiter zunahm, wäre das Schiff in diesen Wasserbergen bald nicht mehr zu steuern. Der Wind würde es in Längsrichtung zu den Wellen drehen, die dann ungebremst auf die Seiten der Fähre aufträfen und so ihre volle Kraft entfesselten. Durch die Wucht könnten die Autos aus den Verankerungen gerissen werden, und von einem Moment auf den nächsten würden sich mehr als hundert Tonnen Gewicht umverteilen. Was dann geschah, lag nicht mehr in des Fährmanns Hand.
Doch es gab noch etwas anderes, das Kapitän Maxim Ferner Sorgen bereitete. Große Sorgen. Er hielt in direktem Kurs auf etwas zu, das auf dem Radar bislang nur ein roter Punkt gewesen war. Der Punkt hatte die Kennung VRCC29 und war nicht größer als ein Stecknadelkopf. Das, was er symbolisierte, war hingegen dreihundertvierzig Meter lang, sechsundvierzig Meter breit, mehrere Stockwerke hoch und erschien nach einem weiteren Wellental wie ein Leviathan aus der Tiefe. Der Rumpf des Großcontainerschiff Shanghai Star glich einer Wand, dachte Ferner. Nein, einem Wohnblock. Einer ganzen Stadt aus Stahl.
Ferner zwang sich, Ruhe zu bewahren, obwohl das Signal für den Kollisionsalarm hektisch zu blinken begann. Und nun meldete sich auch der Kapitän der Shanghai Star unter dem Codenamen »Ocean11«. Er herrschte Ferner an, sofort den Kurs zu wechseln, denn die See war zu rau und der Frachter viel zu schwerfällig für eine rasche Reaktion. Ferner erwog seine Möglichkeiten. Er konnte das Tempo reduzieren, um die Shanghai Star passieren zu lassen. Doch dann würde das Meer vollends die Kontrolle über seine Fähre übernehmen, und es war aus. Er könnte auch den Kurs ändern und das Tempo beibehalten. Aber das machte im Grunde keinen Unterschied, denn es würde unweigerlich bedeuten, dass die Wogen nicht mehr im spitzen Winkel gegen den Bug der Fähre schlugen, sondern längs gegen den Rumpf, wo sie bedeutend mehr Energie entwickeln würden. Zu viel Energie. Sie würden das Schiff umwerfen.
Aber es gab eine dritte Möglichkeit. Der Ozeanriese müsste die Dünung wie ein Wellenbrecher bremsen. Im seitlichen Windschatten des riesigen Schiffes wäre das Meer ruhiger. Wie im Auge eines Hurrikans. Das gewaltige Kielwasser an den Schrauben der Shanghai Star dürfte außerdem für Verwirbelungen sorgen und die Wogen zerteilen. Seitlich der Shanghai Star könnte er also navigieren. Dann knapp am Rumpf des Stahlgiganten vorbeifahren und danach sofort den Kurs abändern, dabei das Kielwasser durchfahren und wieder mit voller Kraft gegen den Wind steuern. Das Risiko war enorm. Aber es gab keine andere Chance.
Deswegen hielt Ferner weiter mit voller Kraft auf den Frachter zu. Er ignorierte das Schimpfen des Kapitäns der Shanghai Star und verfolgte, wie der riesige Rumpf immer näher kam. Schließlich sah Ferner nichts anderes mehr vor sich als roten Stahl und die darauf lackierten haushohen Buchstaben der Reederei. Er dachte an die zahllosen Menschen an Bord seiner Fähre. Männer, Frauen, Kinder. Sie hatten keine Ahnung, was da auf sie zukam. Jedes einzelne Leben, jedes Schicksal, lag nun allein in Ferners Händen.
Im nächsten Moment traf er eine neue Entscheidung.
Er nahm die Hände von der Steuerung und legte sie auf den Oberschenkeln ab. Er zählte leise, schloss die Augen und lächelte. Es plärrte weiter im Funkverkehr.
»Ocean11 to Charon! You fucking idiot! That’s suicide! Bastard!«
Wenige Sekunden später zerschellte die Fähre an der Shanghai Star. Die Autos auf den Decks wurden aus den Verankerungen gerissen, verrutschten und brachten das Schiff in Schlagseite. Sie stürzten über Bord und wurden von der Nordsee verschlungen wie die Passagiere, die der Aufprall aus der wie eine Sardinenbüchse aufgerissenen Fähre schleuderte.
Eine andere Stimme vermischte sich mit der von »Ocean11«.
»Maxim?«
Maxim nahm das Headset ab und antwortete: »Ja, Mama!«
»Kommst du essen, Bärchen?«
Bärchen. Nun war er bald dreißig Jahre alt, und sie nannte ihn immer noch so.
»Ja!«, rief er und loggte sich aus der Online-Schifffahrtsimulation aus, ohne sich bei »Ocean11« zu entschuldigen, wie es eigentlich die Etikette verlangt hätte. Er legte das Headset auf der Verpackung mit dem »Ferry Extreme«-Erweiterungspack ab, das er vorhin installiert hatte, und überlegte, dass Suicide, Selbstmord, nicht ganz der richtige Ausdruck dafür war, dass er gerade achthundert Menschen gekillt hatte. Zumindest virtuell.
Maxim stand auf, ließ den Blick über die Schiffsposter an den Wänden in seinem Zimmer schweifen. Dann stellte er den PC aus.
»Bärchen!«
Mama klang ungehalten. Sie sagte Dinge nicht gerne zwei Mal. Also setzte sich Maxim in Bewegung, ging die Treppe hinunter und freute sich über den Duft, der den Flur erfüllte. Es gab Hackbraten.
2.
Ich bin ein sehr gefährlicher Mann, dachte Maxim. Er betrachtete sein Spiegelbild in einer Glasscheibe in der Tiefkühlabteilung des Supermarktes. Ich bin ein gefährlicher Mann. Deutschlands gefährlichster Mann.
Natürlich sah er nicht danach aus. Das taten die wenigsten. Niemand ahnte auch nur ansatzweise, wozu er imstande war. Die Frau an der Tiefkühltruhe neben ihm beispielsweise hatte keinen Schimmer, wer sich ihr gerade näherte.
Ein berauschendes Gefühl.
Seit Maxims Entschluss, der gefährlichste Mann Deutschlands zu sein, hatte sich einiges an seiner Einstellung zum Leben grundlegend gewandelt. Früher wäre er niemals einfach so auf eine solche Frau zugegangen. Seine Körperhaltung hatte sich verändert. Er ging sehr viel aufrechter. Die Schritte waren raumgreifend, die Bewegungen gezielt, die Stimme klang selbstsicher. Es war, als habe sich sein Ego wie ein Ballon aufgebläht. Das war gut, aber auch riskant. Er musste vorsichtig sein, damit niemand den Wandel bemerkte, Fragen gestellt wurden und hinter seinem Rücken getuschelt. Das konnte er nicht gebrauchen. Es würde die Mission und damit seine Vorteile im Krieg gegen den Rest der Welt gefährden.
Die Frau an der Gefriertruhe war ihm aufgefallen, weil sie eben genau dort stand, an der Gefriertruhe, und nach vornübergebeugt darin herumwühlte. Maxim mochte die Kälte, ganz besonders an einem sonnigen Juli-Tag wie heute. Die Frau trug Jeans-Hotpants und Flipflops, jede Menge Modeschmuck und war recht attraktiv. Er schätzte sie auf Anfang vierzig, also älter und erfahrener als er selbst, der in wenigen Tagen erst seinen dreißigsten Geburtstag feiern würde. Er kannte sie nicht, sie ihn sicher auch nicht. Also hatte sie keinen Vergleich zwischen seiner neuen männlichen Aura und der blassen davor. Geringes Risiko mit vielleicht großem Gewinn, dachte Maxim.
Er näherte sich der Frau von der Seite und strich mit der Hand über die kühlen Glasflächen, unter denen sich zahllose bunte Verpackungen befanden, blieb neben ihr stehen und beobachtete einen Moment ihre Suche nach etwas, das sie offenbar nicht fand. Sie roch nach einer Mischung aus Sonnenöl und Chlor. So, als komme sie gerade aus dem Freibad.
Maxim sagte: »Bei der Hitze möchte man sich dort am liebsten gleich ganz hereinlegen.« Seine Stimme säuselte ein wenig, was an dem Gebiss lag. Es war nicht das allerbeste.
Die Frau schreckte hoch und schlug sich fast den Kopf an der Gefriertruhe an.
»Was?«, erwiderte sie.
Ihr Top war etwas hochgerutscht, was Maxim einen Blick auf ihre Hüften erlaubte. Üppig. Jetzt zog sie es wieder nach unten, was fast verschüchtert wirkte, und sah Maxim irritiert an. Musterte ihn. Warf einen Blick auf die Batterie-Packungen und die Rolle mit dem Klebeband in Maxims Händen und hatte natürlich nicht die geringste Ahnung, wozu das gut sein sollte.
Maxim lächelte freundlich. Einen Moment schwieg er, hörte der Hintergrundmusik zu und überlegte, was die Frau wohl von ihm dachte. Sie sah einen bleichen jungen Mann, der deutlich größer war als sie und ein wenig füllig, weswegen er von seiner Mama den Spitznamen »Bärchen« bekommen hatte. Die schwarzgefärbten Haare waren gescheitelt und kurz geschnitten wie sein akkurater Oberlippenbart. Er trug ein hellblaues Kurzarmhemd mit scharfen Bügelkanten. Es war bis oben hin zugeknöpft und steckte im Bund einer bis zum Bauchnabel hochgezogenen hellen Sommerhose. An den Füßen trug er blassbraune Sandalen und dünne, beige Socken. Eigentlich war es heute zu warm dafür, aber Maxim mochte es nicht, wenn man seine verwachsenen Fußnägel sehen konnte. Eine Herrentasche aus braunem Leder baumelte am Handgelenk. Sein ständiger Begleiter. Sie enthielt außer seinem Telefon zwei kleine Dosen Eisspray. Immer eine angebrochene und eine volle zur Reserve.
Die Frau glaubte sicher, dass er sie anmachen wollte. Was nicht falsch war. Aber bestimmt wurde sie normalerweise von anderen Männern angesprochen. Gutaussehenden Typen mit Gel in den Haaren, zerrissenen Jeans und offenen Hemden. Braungebrannte Kerle, die gerne schnell Auto fuhren, viel tranken und sich die Wochenenden in Discos oder auf dem Fußballplatz um die Ohren schlugen.
Maxim lächelte etwas breiter und wiederholte: »An einem so heißen Tag wie heute möchte man sich am liebsten in die Gefriertruhe legen.«
Die Blondine schwieg weiter und hielt sich mit beiden Händen am Einkaufswagen fest. Maxim sah darin einige Mikrowellengerichte, eine kleine Packung Toast, Handcreme, Käse, Kartoffelchips – kein Familieneinkauf, eher der für einen Singlehaushalt. Dann wendete sie sich mit einem verstört wirkenden Gesichtsausdruck ab. Verstört davon, dass einer wie er sie ansprach. Dass einer wie er dachte, er könne bei einer wie ihr landen.
»Ja«, sagte die Frau und klang spöttisch. »Ganz schön warm draußen.«
»Ich würde Sie gerne auf ein Eis einladen.«
Für einen Moment mochte Maxim kaum glauben, was er gerade gesagt hatte. Er konnte sich nicht erinnern, jemals ein weibliches Wesen um ein Date gebeten zu haben. Andersherum war er selbst auch noch nie nach einem gefragt worden.
Die Frau stieß ein Lachen aus, das mehr wie ein Husten klang. »Ähm, nein«, antwortete sie, ließ die Entgegnung wie eine Frage klingen und ergänzte mit einem ungläubigen Kopfschütteln: »Sie sollten sich vielleicht wirklich in die Truhe legen, um abzukühlen.« Dann ging sie.
»Ich bin übrigens Charon«, rief er ihr hinterher.
Maxim sah noch, dass sie die Hand zu einer abwehrenden Geste hob und schließlich im Gang mit den Waschmitteln verschwand.
»Charon, der Fährmann«, ließ er leise folgen.
Tja, dachte Maxim. Satz mit X, das war wohl nix, wie Mama immer sagte. Aber nichts auf dieser Welt funktionierte sofort und auf Knopfdruck. Vor allem nicht, wenn man schlecht vorbereitet war. Planung war alles. Abgesehen davon, dachte er und sah sich unauffällig nach Überwachungskameras um, war die Frau nicht besonders nett gewesen. Mit einer, die nicht nett war, wollte er gar kein Eis essen gehen.
Der Gedanke daran, dass die Frau sich noch schrecklich wundern würde, verschaffte ihm eine gewisse Genugtuung. Später würde sie sich gewiss an die Begegnung erinnern und damit protzen, dass sie mit dem gefährlichsten Mann Deutschlands geredet hatte. Dass er sie sogar hatte einladen wollen. Ihre Freundinnen würden staunen und große Augen machen – zumindest, falls Maxim sich dafür entschied, die Frau am Leben zu lassen anstatt sie zu sich zu holen und einige Dinge an und mit ihr auszuprobieren. Was er eigentlich nicht vorhatte. Aber er könnte, wenn er wollte. Kein Zweifel.
Wie großartig und privilegiert, dachte Maxim und atmete tief durch, solche Entscheidungen treffen zu dürfen. Leben oder sterben lassen. Innerhalb von Sekundenbruchteilen ein Urteil zu fällen, das das Schicksal der Frau extrem beeinflussen würde. Vielleicht hätte sie schon morgen keine Arme oder Beine mehr. Oder wäre eine einzige unversorgte Brandwunde.
Andererseits durfte er sich nicht von Nebenkriegsschauplätzen ablenken lassen und dabei Charons Mission aus den Augen verlieren. Bloß nicht. Deswegen ließ Maxim die Frau am Leben und ging zur Kasse, um die Batterien und das Klebeband zu bezahlen, und scherte sich einen Teufel um die blonde Schlampe.
3.
Ceylan presste sich den Kolben fest an die Schulter und legte die Wange auf das abgenutzte Holz der Maschinenpistole. Sie mochte keine Waffen, vertraute als niedersächsische Polizeimeisterin im Taekwondo lieber auf den eigenen Körper und den damit verbundenen Überraschungseffekt. Sie war kaum über einen Meter sechzig groß und erfüllte damit hauchdünn die Mindestanforderung für den Polizeidienst. Niemand erwartete von einer kleinen, zierlichen Frau mit dunklen Mandelaugen einen Schlag, der Knochen brechen konnte, und ihr waren die körpereigenen Waffen lieber als welche aus Metall. Trotz ihrer Abneigung kannte sie sich natürlich gut damit aus. Als Leiterin der neuen Sonderkommission für Organisierte Kriminalität des LKA Niedersachsen hatte sie in den letzten Monaten viel über Makarow-Pistolen, AK-47-Schnellfeuergewehre, tschechische Skorpion-MPs, Kampfmesser, Schlagringe, Keulen und sowjetische Handgranaten lernen müssen. Mit solchen Dingen handelten die Bad Coyotes und die rechtsradikalen Northern Riders. Zur Ware der beiden rivalisierenden Motorradclubs zählten außerdem Drogen und Menschen. Einige führende Coyotes saßen im Knast. Ceylan arbeitete daran, dass es der Führung der Riders bald ähnlich erging.
Das Gewehr mit dem Holzkolben war sehr leicht. Leichter als eine MP5, die die Polizei verwendete. Die MP5 hatte dreißig Schuss im Magazin und war hochflexibel. Sie verschoss Neun-Millimeter-Patronen, die auch für die Dienstpistolen benutzt werden konnten. Sehr praktisch. Der Rückstoß war kaum nennenswert. Sie war kurz, effizient, instinktiv zu bedienen und hatte sich seit Jahrzehnten bewährt. Das galt ohne Zweifel auch für die Waffe, mit der Ceylan nun ihr Ziel fixierte.
Ceylan blendete alle Geräusche um sich herum aus. Scharfschützen warteten den Zeitpunkt zwischen zwei Herzschlägen ab, um den Abzug zu drücken. So geübt war sie nicht, aber sie konzentrierte sich auf ihren Atem, sog die Luft durch die Nase ein, ließ sie durch den Mund wieder nach außen dringen – und schließlich war der richtige Augenblick gekommen. Sie krümmte den Finger und feuerte einen wahren Geschosshagel aus der Waffe. Als das Magazin leer war, senkte sie den Lauf und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Langsam drangen die Umgebungsgeräusche wieder in ihr Bewusstsein. Musik, Kreischen, Gelächter, Sirenen – ein Gewirr von Klängen. Sie legte die Waffe vor sich ab und verfolgte, wie der Mann auf sie zukam. Sein Gesicht war pockennarbig. Er trug ein kariertes Hemd. Die Haare waren mit Pomade seitlich an den Schädel geklatscht. Er hatte zwei Gegenstände in der Hand und reichte ihr den ersten. Ein Viereck aus festem Karton, wenig größer als ein Bierdeckel. Ceylan grinste. Sie hatte den roten Stern sauber und ohne Rückstände aus der Zielscheibe herausgefräst.
»Glückwunsch«, sagte der Mann und ließ den zweiten Gegenstand folgen. Es war ein roter Teddy, der an Elmo aus der Sesamstraße erinnerte und ziemlich hässlich war. So hässlich, dass Ceylan ihn unbedingt hatte gewinnen wollen.
Femke stand neben ihr an der Schießbude und schwieg. Ceylan hielt ihr die Elmo-Figur vor die Nase und wackelte damit hin und her.
»Küss mich«, sagte Ceylan.
»Niemals.« Femke schüttelte den Kopf.
»Ich bin ein verwunschener Backstreet Boy.«
Jetzt steckte sich Femke spielerisch den Finger in den Hals und machte Würgegeräusche.
Ceylan sah ihrer Kollegin dabei zu, wie sie sich eine strohblonde Haarsträhne hinters Ohr schob und mit den wasserblauen Augen rollte. Femke Folkmer. Sie war heute ungeschminkt, was ihr gut stand, und trug eine helle Chino und eine Jeansjacke, was im Gegensatz zu Ceylans quietschbuntem Top ein bisschen bieder und spröde wirkte. Femke konnte ganz sicher weitaus mehr aus sich machen und war viel zu hübsch für so langweilige Sachen, fand Ceylan – eine friesische Schönheit mit einem kleinen Makel: Ihr fehlte ein Teil vom Zeigefinger der rechten Hand, was auf einen Reitunfall zurückzuführen war.
Ceylan reagierte mit gespieltem Entsetzen auf Femkes Würgen. »Ey, hallo? Robbie Williams war auch mal in einer Boygroup …«
»Ja und?«
Jetzt verdrehte Ceylan die Augen und gab ein genervtes Stöhnen von sich. Sie dachte, dass Femke ein verwunschener Kriminalhauptkommissar namens Tjark Wolf bestimmt lieber wäre als Robbie – und, wenn sie ehrlich war, ihr selbst ebenfalls. Leider wusste niemand, wo Tjark steckte. Vielleicht saß er in Indien irgendwo auf einem Berg und meditierte mit einem Guru. Vielleicht hing er in Las Vegas herum und besuchte von morgens bis abends Comicläden. Er sammelte alte Hefte als Wertanlage, wie Ceylan wusste. Sie hielt das jedoch für eine Ausrede und glaubte, dass Tjark einfach auf Superhelden stand.
Seit fast einem Jahr war Tjark in der Versenkung verschwunden. So umfassend abzutauchen war nicht leicht, wenn man Polizisten als Kollegen hatte, die sich mit dem Sichtbarmachen auskannten. Er hatte sich eine Auszeit vom Kriminalkommissariat genommen, nachdem im Job alles über ihm zusammengebrochen war. Unter anderem hatten sie ihn wegen unangebrachter Gewaltanwendung im Dienst am Wickel gehabt. Die Verfahren waren mittlerweile eingestellt, aber der letzte Fall an der Küste war ziemlich heftig gewesen, und dann war auch noch Tjarks Vater gestorben. Alles gleichzeitig, zu viel auf einmal. Trotzdem seltsam. Tjark hatte immer wie ein ziemlich abgebrühter Kerl gewirkt. Einer, an dem alles abperlte wie an einem Lotusblatt und der immer geradeaus ging, in dessen Weg es keine Schlenker gab. Auf der anderen Seite umgab ihn eine Aura der Einsamkeit. Er konnte empfindsam sein, aber auch aggressiv und kaltblütig, unvernünftig wie ein kleiner Junge. Eine ziemlich unwiderstehliche Mischung, wie Ceylan fand. Was sie für sich behielt.
Ceylan hakte Femke unter und wich einer Familie mit zwei Kinderwagen aus, die abends noch auf dem Rummel unterwegs war. Und was für ein Rummel: Hier in Wilhelmshaven tobte wie jeden Juli das »Wochenende an der Jade«, das Stadt- und Hafenfest. Rund um den großen Hafen lagen alle möglichen Schiffe mit Ballons und Fahnen an den Kais, Dreimaster, alte Schoner, Rettungsboote und Kriegsschiffe der Bundeswehr, die in der Stadt ihr großes Arsenal vorhielt. Auf dem Wasser glitzerten die bunten Lichter, auf den Wegen reihte sich Bude an Bude, auf den Plätzen gab es jede Menge Bühnen und Karussells. Inzwischen war es dunkel geworden.
Ceylan und Femke gingen eine Weile schweigend nebeneinander her. Femke aufrecht und mit dem gelassenen Schritt eines Clint Eastwood, Ceylan federnd und schwungvoll mit der hässlichen Elmo-Figur unter den Arm geklemmt. Ihr Rhythmus passte nicht zusammen, Femke war größer als Ceylan und hatte längere Beine, aber ihr Weg war der gleiche. Er führte in Richtung Südstrandbühne, wo heute Abend ein bekannter Soulsänger auftrat, und sie überlegten, ob sie ein Shuttleboot nehmen sollten. Wilhelmshaven war weitläufig, flach gebaut und die Hafenbecken groß. Die Stadtverwaltung hatte für den Pendelverkehr zwischen den Veranstaltungsorten an den verschiedenen Kais eine der Spiekeroog-Fähren rekrutiert.
»Wir haben uns irre lange nicht mehr gesehen. Hast du mal was von Tjark gehört?«, fragte Ceylan unvermittelt, inhalierte den Duftmix aus gebratenen Zwiebeln, Zuckerwatte und Mandeln, genoss die warme Luft und die vollen Straßen, die sie irgendwie an Istanbul am Abend erinnerten.
Femke schüttelte den Kopf. »Nein, gar nichts. Vielleicht schottet er sich ab, weil er ein neues Buch schreibt.«
Das konnte sein. Mit »Im Abgrund«, einem True-Crime-Buch über die Polizeiarbeit, hatte Tjark vor etwas über zwei Jahren einen Bestseller gelandet.
Ceylan buffte Femke an den Oberarm: »Ey, vielleicht kommen wir dieses Mal auch drin vor.«
»Besser nicht.«
»Wieso das denn nicht?«
Femke betrachtete im Gehen ihre Schuhe. »Ich würde das lieber alles vergessen.« Sie spielte auf die Geschehnisse in Werlesiel an.
Es wunderte Ceylan nicht, dass Femke daran immer noch zu knabbern hatte. Deswegen wechselte sie das Thema: »Vielen Dank noch mal für die Einladung. Das mit den vielen Schiffen ist wirklich klasse, die können wir in Oldenburg nicht aufbieten beim Stadtfest. Fühlst du dich inzwischen wohl hier?«
Femke wirkte zunächst unentschlossen, sagte dann aber: »Ich habe mich eingelebt. Vom Fenster aus kann ich die Möwen kreischen hören und den Schiffen zusehen. Es gibt allerdings einen qualitativen Unterschied zwischen Fischkuttern und Bundeswehrzerstörern oder Containerschiffen.« Sie rang sich ein Lächeln ab. »Na ja, es gibt auch einige Segelboote.«
Ceylan nickte. Femke hatte bis vor einem Jahr eine kleine Polizeiinspektion geleitet und war dann zur Kripo gewechselt. Sie hatte sich zunächst auf eine frei werdende Stelle in Oldenburg beworben – ohne zu wissen, dass das Tjarks Stelle war. Nachdem sie es dann erfahren hatte, zog sie die Bewerbung zurück und war bei der Kripo in Wilhelmshaven gelandet. Die Stadt wirkte mit ihren geraden Straßen wie ein am Reißbrett entworfener und auf Funktionalität angelegter Ort, geprägt von gesichtslosen und gleichförmigen Wohnquartieren aus den fünfziger und sechziger Jahren. Vermutlich waren die Häuser und Hafenanlagen im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach in Windeseile wieder aufgebaut worden. Ceylan kannte den großen Jade-Weser-Port mit seinen riesigen Kränen vom Sehen und wusste, dass Wilhelmshaven ein wichtiger Öl- und Marinehafen war. Ansonsten wusste sie nur, dass Femke hier jetzt arbeitete und Werlesiel fluchtartig den Rücken gekehrt hatte – obwohl sie dort ein Haus besaß, das kleine Reetdachhaus ihrer Oma, und der Ort gerade mal dreißig Kilometer entfernt lag.
»Und der Job?«, fragte Ceylan. »Alles so, wie du es dir vorgestellt hast?«
Femke blähte die Backen ein wenig auf und rieb sich mit dem Daumen über die Lippen. »Doch, ist okay.«
»Okay?« Ceylan stutzte. Letztes Jahr hatte Femke noch gewirkt, als sei es ihr allergrößter Traum, zur Kripo zu gehen. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven war der zentralen Direktion in Oldenburg zugeordnet und immerhin auch für den ganzen Landkreis Friesland zuständig, in dem fast zweihunderttausend Menschen lebten.
Femke sagte: »Nein, natürlich mehr als okay. Aber es ist nicht so leicht. Früher war ich Chef, jetzt nicht mehr. Früher habe ich allein entschieden. Jetzt läuft alles im Team. Ich habe mit Richtern zu tun, Staatsanwälten. Das ist alles etwas anders, mehr nicht. Gewöhnungssache.« Sie rang sich ein Lächeln ab. »Kürzlich haben wir eine Marihuanaplantage hochgenommen. Achtzig Pflanzen in einer leerstehenden Gewerbehalle, kannst du dir das vorstellen?«
»Wow«, machte Ceylan, um Femke nicht zu enttäuschen, denn natürlich konnte sie sich das vorstellen. Das eine oder andere Mal wäre sie froh gewesen, es bloß mit Gras zu tun zu haben statt mit Crystal Meth, das immer stärker auf den deutschen Markt drang. Methamphetamin galt als Kokain für Arme, das sofort süchtig machte. Der Vorteil – oder besser Nachteil – von dem Zeug war, dass es jeder Dummkopf aus zum Teil handelsüblichen Substanzen selbst herstellen konnte. Unter dem Namen Pervitin war es in den dreißiger Jahren in Deutschland erfunden und als Wachhaltemittel an die Wehrmacht verabreicht worden. Die Vorstellung war schon ein wenig irre, dass Hitlers Armee auf Speed unterwegs gewesen war und viele abhängig von der »Panzerschokolade« gewesen waren. In den Siebzigern hatten die Hells Angels es in den USA vor allem an der Westküste etabliert. Inzwischen stellten zahllose Süchtige ihren Stoff selbst her, und die Drogenfahndungsbehörde DEA nahm jährlich deutlich mehr als zehntausend private Drogenküchen hoch. Irgendwann schwappt jeder Trend über den Großen Teich. Häufig kam das Meth aus Osteuropa, Tschechien beispielsweise. Aber es gab bereits einige Meth-Küchen in Deutschland – versteckt auf dem Land in abgelegenen Scheunen. Im Norden handelte vor allem der Motorradclub Northern Riders damit und lieferte sich Revierkämpfe mit den konkurrierenden Bad Coyotes. Blutige Kämpfe, denn wo es Meth gab, gab es auch Waffen.
Ceylan und Femke stoppten an einer Bühne, auf der eine Bluesband spielte. Viele standen davor. Einige tanzten. Andere drängten auf dem Weg zur Bierbude an Ceylan und Femke vorbei und rempelten sie dabei an. Hinter der Band hing ein Banner, auf dem stand »Schlicktown Bluesband«. Blues war nicht unbedingt Ceylans Ding. Sie stand mehr auf House, Black Music und Techno. Aber die Jungs auf der Bühne machten ihre Sache gut.
Femke neigte sich zu Ceylan. »Weißt du, was Schlicktown ist?«, fragte sie die Musik übertönend.
Ceylan zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Hat das was zu bedeuten? Ich dachte, das sei ein Witz.«
»Sie nennen Wilhelmshaven auch Schlicktown.«
»Matschestadt?«
»Es ist eine Retortenstadt, gerade mal vor hundertfünfzig Jahren von Preußen als Kriegshafen mit Häusern für das Marinepersonal aus dem Boden gestampft worden. Viele Soldaten aus Wilhelmshaven waren damals in Tsingtau stationiert und haben ihrem Heimatort den Spitznamen Schlicktau verpasst. Daher kommt das.«
»Aha.« Ceylan nickte. »Was ist denn Tsingtau?«
»Das war im Kaiserreich eine Provinz in China.«
»China war mal deutsch?«
»Nicht wirklich.«
Ceylan machte eine abwehrende Geste. »Ey. Bleib mir mit Geschichte und solchen Sachen vom Hals.«
Femke lachte und begann, in ihrer Handtasche zu wühlen.
»Von Geschichte«, redete Ceylan weiter, »habe ich null Ahnung. Ich interessiere mich mehr fürs Heute, und …«
Ceylan stockte. Ein Mann drängte sich in einigem Abstand vor ihr durch die Menge und sah sie an. Trotz der Dunkelheit trug er eine Sonnenbrille auf der breiten Boxernase. Seine Statur war bullig, der Schädel rasiert und die Arme von oben bis unten tätowiert. Außerdem hatte er einen buschigen Walrossschnäuzer, der fast bis zum Kinn reichte. Das Modell war ein Kennzeichen der Aryan Brotherhood, einer gefürchteten US-Gefängnis-Gang. Sie wusste, wer der Mann war. Im inneren Zirkel der Northern Riders nannten sie ihn »Amon 88«. Amon war die Anspielung auf einen brutalen KZ-Kommandanten. Die Zahl bezeichnete den achten Buchstaben des Alphabets und war ein allgemeiner Code für »Heil Hitler«. Sein richtiger Name war Hark Seiler. Er gehörte zur Führungscrew des Chapters Nord der Riders. Dann war er in dem Gewühl wieder verschwunden.
Im nächsten Moment spürte Ceylan einen heftigen Druck im Rücken. Hatte sie da jemand angerempelt oder war ihr mit einem Kinderwagen ins Kreuz gefahren? Dem Druck folgte ein heftiges Brennen. Es fühlte sich an, als sei ihre Hüfte mit kochendem Wasser übergossen worden. Ceylan öffnete den Mund, um etwas zu sagen, brachte aber nur ein Keuchen zustande und fasste mit beiden Händen hinter sich. Ihr Hosenbund war klatschnass. Ihr Shirt ebenfalls. Schlagartig tanzten weiße Sterne vor ihren Augen. Ihr wurde schwindelig.
»Ceylan?«, hörte sie Femke sagen, die jetzt einen Labello in der Hand hielt und die Handtasche wieder schloss. Ceylan griff nach vorne, um sich an Femkes Schultern festzuhalten. Und jetzt kreischte Femke regelrecht. Das war kein Wunder, denn Femkes Jacke war auf einmal voller Blut. Ceylans Hände ebenfalls. Wie kam all das Blut dahin? Sie musste darüber nachdenken. Sich nur kurz etwas hinlegen, denn ihre Beine gaben nach. Ihr war schlecht, kotzübel, und es war eiskalt. So kalt. Die hässliche Elmo-Figur fiel zu Boden. Kurz darauf sah Ceylan die Welt von unten. Beine, Schuhe, Füße, Zigarettenkippen, zertretene Plastikbecher, Femkes Mund, der Worte formte. Alles kreiste wie in einem Wirbel um sie herum. Nur kurz die Augen schließen, dachte Ceylan, nur ganz kurz, und darüber nachdenken, was wohl passiert war.
4.
Der Rettungswagen raste in Richtung Klinikum durch die Innenstadt. Das Martinshorn gellte durch die Straßen. Drinnen hörte Femke alles wie durch Watte. Ein Sauerstoffgerät rauschte. Der Notarzt bemühte sich, Ceylans Kreislauf stabil zu halten. Spritzenverpackungen wurden aufgerissen. Geräte piepten. Gelegentlich wurde Femke in den Sitz gepresst, wenn der Wagen mit hohem Tempo eine Kurve nahm. Gurtverschlüsse klapperten – Femkes Zähne ebenfalls.
Sie fröstelte und hielt sich mit den Armen umfangen. Ihre Hände waren rostrot von Ceylans Blut verfärbt, ihre Kleidung verschmiert. Es war, als gehörten die Sachen überhaupt nicht zu ihr, selbst die Hände nicht. Sie fühlte sich wie betäubt, paralysiert, ferngesteuert. Irgendjemand anders musste in dieser Körperhülle stecken und miterlebt haben, dass Ceylan niedergestochen worden war. Weil er selbst lieber nach einem Fettstift für die Lippen gesucht hatte, statt die Augen offen zu halten und die Tat zu verhindern.
Es hatte endlose Minuten gedauert, bis Hilfe gekommen war. Die Menschen hatten einen Kreis um die am Boden liegende Ceylan und die bei ihr kniende Femke gebildet und sie beide angestarrt, als seien sie von einer tödlichen Krankheit infiziert, die in jedem Moment überspringen könnte – offen stehende Münder, entsetzte Blicke, Bier in Plastikbechern. Zunächst hatte niemand Anstalten gemacht, zu helfen. Erst, als der Körper namens Femke die Gaffer angebrüllt hatte, dass sie Polizistin und hier eine weitere Polizistin schwer verletzt worden sei und sie jeden persönlich wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen werde, der nicht sofort irgendetwas unternahm, war Bewegung in den Kreis gekommen. Schließlich war eine junge Arzthelferin durch die Menge gedrungen und hatte Femke dabei geholfen, Ceylan in Seitenlage zu halten und die Elmo-Figur wie einen Druckverband auf die stark blutende Wunde an der Hüfte zu pressen. Eine gefühlte Ewigkeit später waren zwei Sanitäter erschienen, kurz darauf der Notarzt und zwei Kollegen von der Polizei.
Die Puppe klemmte jetzt zwischen Femkes Knien. Ihr Fell war verkrustet und hart. Möglicherweise hatte das hässliche Ding Ceylans Leben gerettet. Möglicherweise auch nicht, denn wie der Notarzt meinte, stünden die Chancen infolge des hohen Blutverlusts nicht allzu gut, aber das Klinikum sei nicht weit.
Es ruckte heftig, als der Rettungswagen zum Stehen kam. Die Türen wurden aufgerissen. Helfer schoben die Liege mit Ceylan aus dem Fahrzeug. Femke sprang hinterher. Sie sah ein Schild mit der Aufschrift »Städtische Kliniken« und zwei Ärzte in weißen Kitteln, die mit dem Notarzt sprachen. Einer fragte Femke nach den Geschehnissen, die sie wie in Trance wiederholte. Ihr selbst, kommentierte sie einen besorgten Blick auf ihre blutverschmierten Sachen, gehe es gut. Nur aus den Augenwinkeln bekam sie mit, wie Ceylan durch eine Schleuse in Richtung OP geschoben wurde. Der Arzt, der gerade noch mit ihr geredet hatte, ließ sie grußlos stehen und lief hinterher.
Dann nahm Femke wahr, dass ein Streifenwagen an der Schleuse parkte. Zwei uniformierte Kollegen kamen auf sie zu und sagten, sie würden gerne mit ihr zur Wache fahren, um ihre Aussage aufzunehmen. Femke zog ihren Dienstausweis und hielt ihn den verdutzten Kollegen vor die Nase und sagte, dass sie einen Scheiß tun werde und wie das Opfer eines Bombenanschlags aussehend auf die Wache mitkommen würde.
»Wir machen nur unseren Job. Immerhin wurde eine Polizistin niedergestochen.«
»Ach, tatsächlich?«, blaffte Femke.
Der Polizist machte eine abwehrende Geste und sagte: »Frau Folkmer, bitte, beruhigen Sie sich.«
Sie schwieg einen Moment, nickte, steckte ihren Ausweis wieder ein und fragte: »Kann ich Ihnen nicht hier schildern, was passiert ist, und für meine amtliche Zeugenaussage morgen früh in die Wache kommen?«
»Natürlich.«
Sie erklärte den Kollegen den Hergang aus ihrer Sicht und bat sie anschließend, sie mit dem Streifenwagen nach Hause zu fahren.
Wenig später hielt der Wagen vor einem großen Mehrparteienhaus am Bontekai. Es stammte noch aus der Gründerzeit, war modern saniert worden und von außen rot verklinkert. Femke stieg aus und schloss die Tür auf. Sie nahm die Treppen bis ins obere Geschoss und betrat ihre Wohnung – ein Dreizimmer-Appartement mit Balkon, das sie möbliert gemietet hatte. Sie zog sich im Wohnzimmer aus und zuckte zusammen, als es von draußen mehrmals dumpf krachte. Bunte Sterne erschienen am nächtlichen Himmel und spiegelten sich wie die Lichter der Kirmes im schwarzen Wasser des Innenhafens – ein Feuerwerk.
Femke nahm ihre Schuhe, die Jacke, Hose und das Shirt in die Hand und ging damit ins Bad. Sie warf die Sachen in die Badewanne und ließ die Unterwäsche folgen. Schließlich ging sie in die Duschkabine und stellte sich unter den heißen Wasserstrahl. Die Duschtasse färbte sich sofort rot. Femke lehnte sich an die Fliesen und betrachtete den Strom verdünnten Blutes, der an ihr herablief, sich um ihre Beine schlängelte, von ihren Fingern troff und in einem Wirbel im Abfluss verschwand. Die Kraft wich ihr aus den Beinen. Langsam rutschte sie an den Kacheln herab und kam in der Hocke zum Sitzen. Es fühlte sich an, als würde ihr Verstand ebenfalls in dem Abfluss verschwinden und ihre Seele einsam zurücklassen. Kraftlos umschlang sie die Beine mit den Armen und konnte nicht verhindern, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Schließlich begann sie zu zittern, bis ihr ganzer Körper in einem Weinkrampf durchgeschüttelt wurde.
Einige Minuten später wurden ihre Gedanken wieder klarer. Sie stellte die Dusche aus, trocknete sich ab und überlegte, dass sie die anderen benachrichtigen sollte. Fred würde es wohl im Präsidium erfahren und sich bei ihr melden. Vielleicht wusste er es sogar schon. Aber Femke musste einen Weg finden, Tjark zu verständigen. Außerdem hatte Femke das Gefühl, dass sie selbst irgendein Netz brauchte. Jemanden, der sie auffing. Und es fiel ihr niemand anderer ein als Tjark.
5.
Der Ringköbing-Fjord war kein Fjord, wie man ihn sich gemeinhin vorstellte. Es gab keine tiefen Felsschluchten. Vielmehr war er eine Art flacher See – ein ziemlich großer allerdings, der größte Dänemarks. Er lag auf Jütland. Eine über dreißig Kilometer lange Nehrung grenzte ihn von der Nordsee und ihren Stränden ab. Sie trug den Namen Holmsland Klit und war an der schmalsten Stelle nur wenige hundert Meter breit. Einige kleine Fischerorte mit roten Holzhäusern lagen am Fjord. In den Gärten konnte man Wäscheleinen sehen, an denen Trockenfisch aufgehängt war. Im Nordosten lag Ringköbing, eine große Hafenstadt, jedenfalls für dänische Verhältnisse. Söndervig war eine weitere Stadt, und direkt an der Küste lag Hvide Sande – ein Tor zwischen dem Fjord und dem Meer, das von der Fischereiindustrie und dem Tourismus geprägt war. Der ganze Holmsland Klit war gepflastert mit Ferienhäusern. Von den Siedlungen aus gelangte man rasch an den viele Kilometer langen Strand. Wie überall im Westen Jütlands war er mit alten Wehrmachtsbunkern gepflastert. Sie sollten im Zweiten Weltkrieg eine alliierte Invasion im Norden verhindern und waren somit im historischen Kontext zu nichts nutze gewesen. Das waren sie auch heute nicht – wenn man davon absah, dass Liebespärchen darin knutschten, Strandspaziergänger hineinpinkelten oder man obenauf in der Sonne rösten konnte.
Es waren viel zu viele, und sie waren viel zu stabil gebaut, um sie alle zu sprengen. Also hatte die dänische Regierung entschieden, sie als Randnotiz der Geschichte stehen zu lassen und einige der Marine für Zielübungen und andere Künstlern zur Gestaltung überlassen.
Tjarks Lieblingsbunker standen unweit der kleinen, am Hvide Vej liegenden Ferienhaussiedlung. Der eine war hellblau angemalt. Über dem Eingang stand: »Wann wird dieser Bunker ein Teil des Himmels?« An dem anderen Bunker war ein rostiges Schild angebracht. Eines, das man vom Aussehen her im amerikanischen Mittelwesten erwarten würde. Darauf stand »Motel«. Und nichts anderes war diese Welt: eine Bleibe auf Zeit. Ein vorübergehender Ort für die Menschen auf der Suche nach ein wenig Glück – oder für solche, die auf der Flucht vor sich selbst waren.
Tjark stand am Geldautomaten, um sich dreihundert Kronen zu ziehen. Er trug ein T-Shirt mit einem modisch verblassten Werbeaufdruck. Die dünne Army-Jacke hielt er in der freien Hand. Mit der anderen schob er die EC-Karte in das Gerät. Der Wind spielte in seinem verwuschelten dunklen Haar und schien die auf dem rechten Oberarm tätowierten blauen Wogen anzupeitschen. Das Motiv war von Katsushika Hokusais Farbholzschnitt »Die große Welle vor Kanagawa« aus dessen Zyklus »36 Ansichten des Berges Fuji« inspiriert und stand für Tjarks besondere Beziehung zum Meer. Manche hatten ein Problem mit Höhe, er hatte eines mit der See.
Die grelle Sonne stand Tjark im Rücken und sorgte dafür, dass er die Zahlen auf dem Automatendisplay nicht gut erkennen konnte. Er musste stark blinzeln, als er seine Geheimzahl eintippte, und schaute in den verkratzten Spiegel über dem Bildschirm, um sich die Bearbeitungszeit seiner Anforderung zu verkürzen. Vom hellen Licht suchte sich eine kleine Träne den Weg durch die Verästelungen, die sich in den letzten vierzig Jahren in die Haut an den Augen mit dem traurigen Ausdruck gegraben hatten. Der gepflegte Kinnbart zeigte erste graue Spuren.
Schließlich ratterte der Automat und spuckte die Kronen aus. Tjark steckte die Geldscheine ein und trat durch die Schiebetüren in das Foyer des Einkaufszentrums, wo ein kleines Internetcafé mit zwei PCs aufgebaut war. Er warf eine Münze in den dafür vorgesehenen Schlitz. Tjark wartete, bis der Browser die Startseite geladen hatte, und sah derweil durch die Panoramafenster hinaus. Vor dem Parkplatz erstreckte sich die Landstraße wie ein mit dem Lineal gezogener Bleistiftstrich in der gleißenden Sonne. Über dem Asphalt flirrte die Luft. Der Himmel war eine einzige blaue Fläche. Das gelbe Gras bog sich wie die Kronen der Kiefern in den Böen. Irgendwo dahinter waren die Dünen und das Meer. Zwei Autos standen vor dem Supermarkt. Ein alter Volvo 850 und ein schwarzes BMW-Z4- Cabrio – sein Wagen, der mit Staub von den unbefestigten Wegen überzogen war. Vor etwa einem Jahr hatte Tjark ihn neu lackieren lassen müssen und sich dafür entschieden, die Farbe gleich mit zu ändern. Irgendwie, dachte er, ähnelte der BMW in Schwarz dem Batmobil. Das gefiel ihm.
Tjark tippte die Adressen zweier Börsenseiten in die Google-Suchleiste ein und überflog die Kursentwicklungen der letzten Tage. Er hatte immer noch einige Investments laufen, und die Aktien standen gut. Dann rief er die Homepage seiner Bank auf, loggte sich ein und warf einen flüchtigen Blick auf die Umsätze. Er blieb an einer Zahl hängen, die er sich im ersten Moment nicht erklären konnte. Der zweite Moment machte es nicht besser. Er überflog die Zeilen erneut, aber es änderte sich nichts an den Ziffern und daran, dass vor drei Tagen ein Guthaben von zehn Cent darauf verbucht und als Verwendungszweck eine längere Nummer sowie der Vermerk »Dringend« angegeben war. Das alles sagte ihm nichts. Der Name der Frau, die ihm die zehn Cent überwiesen hatte, sagte ihm allerdings etwas, und zusammengenommen mit der Nummer und dem Betreff war es eine Nachricht.
Tjark atmete tief ein und wieder aus. Neben dem PC lag ein Block der Ringköbing Landobank und ein Kuli mit Werbeaufdruck. Er notierte die Nummer, riss den Zettel vom Block und faltete ihn zusammen. Einige Augenblicke später steckte er ihn in die hintere Hosentasche, warf die olivfarbene Nesseljacke in einen Einkaufswagen und ließ kurz darauf zwei Sixpacks Tuborg, etwas Wurst, Lakritze, eine Rolle Kekse, Knäckebrot und Frischkäse folgen. Am Haushaltswarenregal blieb er stehen und griff nach einigen Rollen durchsichtigem Klebeband und Draht. Das Windschott am Eingang des kleinen Ferienhauses, das er auf unbestimmte Zeit gemietet hatte, musste dringend repariert werden. Es war ein älteres Haus. Kein WLAN, kein Telefon. Beides waren ausschlaggebende Gründe gewesen, es zu nehmen. Was das Windschott anging, hätte er in der Zentrale der Gebäudeverwaltung Bescheid geben können, aber es tat ihm gut, mit den eigenen Händen tätig sein zu können. Schließlich bewegte er sich im Takt einer Easy-Listening-Version von »Girl from Ipanema« zur Kasse.
»Hej«, sagte er zu der Kassiererin, die Signe hieß, und stellte die Einkäufe auf das Förderband.
»Hej«, antwortete Signe, sog die Unterlippe ein und ließ die mit Gel modellierten Fingernägel über die Tastatur der Kasse fliegen. Sie hatte die Augen eines Huskys, war blond und braungebrannt und wog sicher an die siebzig Kilo. Signe gehörte zu den Frauen, denen etwas Übergewicht gut stand. Neben der Kasse lag ihr Smartphone. Der Facebook-Chat war eingeschaltet.
»Deine Sachen sind gekommen«, sagte sie.
Signe sprach wie alle hier ein wenig Deutsch. Sie griff nach unten und holte zwei in Plastik eingeschweißte Kartons hervor, so groß wie Pralinenschachteln. Darin befanden sich jeweils zwölf Tuben Acrylfarbe für Hobbymaler. Signe scannte den Preis und steckte die Verpackungen zu Tjarks Einkäufen in die Plastiktüte.
»Danke«, sagte er und zahlte.
Wieder sog Signe die Unterlippe ein. »Hast du gehört? Heute ist am Fjord ein Festival. Es spielen drei Reggaebands. Der Erlös ist für den Naturpark gedacht.« Sie deutete auf ein Plakat hinter der Kasse. Sie gab Tjark das Wechselgeld.
Tjark steckte das Geld ein und nahm die gelbe Plastiktüte in die Hand. Er schmunzelte und fragte: »Ist das eine Einladung?«
Signe sah ihn an und blinzelte. So, als habe sie ihn nicht richtig verstanden oder als habe er etwas gesagt, was unmöglich sein Ernst sein konnte. Dann lachte sie und meinte: »Nein, das war nur ein Tipp. Ich dachte, dir wäre vielleicht langweilig. Wenn ich mit dir dahingehe, glauben ja alle, mein Vater bringt mich vorbei.«
Tjarks Lächeln gefror, aber er ließ sich das nicht anmerken. »Außerdem«, sagte Signe, »würde meinem Freund das sicher nicht gefallen.«
Tjark hob die Hand, winkte und sagte: »Danke für den Tipp, aber Reggae ist sowieso nicht meine Musik. Viel Spaß.« Er griff nach der Jacke und ging ins Freie. Gegen die Helligkeit kniff er die Augen zusammen. Seine Haut spannte. Er wuchtete die Einkäufe auf den Beifahrersitz, zog den Zettel aus der Jeanstasche und warf ihn hinterher.
Zehn Cent, dachte Tjark und öffnete die Fahrertür. Der Vermerk »Dringend« und eine Telefonnummer. Alles abgeschickt von Femke Folkmer. Tjark hatte sie letztes Jahr in Werlesiel kennen- und schätzen gelernt, als sie nach einer Vermissten gesucht und den Friedhof eines Serienmörders gefunden hatten. Eine ambitionierte Polizistin, praktisch veranlagt, ein unkompliziertes Mädchen vom Land, das gerne alles unter Kontrolle hatte – vor allem sich selbst. Eine, die mit beiden Füßen im Leben stand, auch dann noch, als der Boden unter ihr weggebrochen war. Hübsch, immer auf Harmonie bedacht – und clever. Sie hatte ihn also aufgetrieben und ihm über sein Konto eine Nachricht zugeschickt. Darauf musste man erst mal kommen.
Tjark stieg in den Wagen, ließ den Motor an, bog vom Parkplatz auf die Hauptstraße und schob dabei die selbstgebrannte CD ein, auf die er mit einem Edding »Motown« geschrieben hatte. Lieber noch als CDs mochte er Kassetten. Sie erinnerten ihn an die gute alte Zeit, in der die Dinge noch eine Seele hatten und Mixtapes Liebeserklärungen sein konnten. Aber das Wagenradio konnte keine abspielen, und jetzt sangen Martha Reeves and the Vandellas »Jimmy Mack, when are you coming back«.
Tjark überlegte, dass es kein Problem gewesen sein konnte, über die Buchhaltung seine Kontonummer herauszufinden. Und wenn er sich nicht bei Femke meldete, würde sie sicher einen Schritt weiter gehen, der zwar nicht ganz sauber, aber möglich wäre: seine Abbuchungen einsehen und damit präzise wissen, wo er sich gerade aufhielt. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn aufspüren und ihm ernsthaft auf die Pelle rücken würde. So lange könnte er die Nachricht ignorieren, Pinsel, Farben und die Staffelei nehmen, sich in die Dünen stellen und weiter an seinem Bild arbeiten. Mit etwas Glück würde es nur das zweitschlechteste werden, das bislang von der dänischen Nordseeküste gemalt worden war. Das schlechteste hatte er kürzlich erst produziert. Die Malerei war eine nette Abwechslung zum Schreiben. Er hatte bereits an einigen Kapiteln für den Nachfolger von »Im Abgrund« gearbeitet, kam aber nicht voran. Und wenn er ehrlich war, hatte er auch gar keine Lust dazu, sich mit Polizeiangelegenheiten zu befassen. Er war hierhergekommen, um Abstand dazu zu gewinnen – und nicht, um sich gedanklich darin zu vertiefen.
Andererseits, dachte Tjark, würde sich Femke keine solche Mühe machen, wenn es nicht wirklich etwas Wichtiges gäbe, und das Wort »Dringend« herausstellen. Sie war kein Mensch, der so etwas leichtfertig tat, und hatte ihm vor einem Jahr versprochen, dass sie ihn finden würde, wenn sie ihn finden müsste. Vielleicht war dieser Zeitpunkt nun gekommen. Vielleicht war Tjark aber nicht bereit dafür.
Tjark fuhr auf der Küstenstraße und tippte mit den Fingern im Takt der Musik auf dem Lenkrad. Dann bremste er abrupt, steuerte in eine mit Kies bestreute Einfahrt und setzte den BMW knirschend auf die Gegenspur und fuhr zurück zum Supermarkt. Tjark besaß kein Handy mehr. Aber Signe hatte eines neben sich liegen gehabt.
6.
Signe hatte Tjark das Telefon für einen Anruf ausgeliehen. Jetzt stand er draußen auf dem Parkplatz und wartete ab, bis der Müllwagen die Altglascontainer geleert hatte. Als das erledigt war, zündete er sich eine Zigarette an und lehnte sich an den Kühler des Roadsters. Dann nahm er den Zettel zur Hand, tippte die Vorwahlkennung für Deutschland in das Handy und ließ die Nummer in der Betreffzeile der Überweisung folgen. Es dauerte nicht lange, und Femke ging dran.
»Folkmer?«
Tjark inhalierte tief und stieß den Rauch in einem feinen Strahl aus. Eine dicke Kumuluswolke schob sich vor die Sonne. Sie sah aus, als habe sie ein Maler auf den stahlblauen Himmel getupft. Ein weitaus besserer Maler als er.
Tjark fragte: »Was ist passiert?«
Am anderen Ende der Leitung herrschte einen Moment lang Schweigen. Schließlich meldete sich Femkes Stimme zurück. »Tjark?«
»Höchstpersönlich.«
Sie keuchte und klang so, als sei eine immense Last von ihr abgefallen. Irgendetwas war nicht in Ordnung, dachte Tjark. Ganz und gar nicht in Ordnung.
»Gott sei Dank«, sagte Femke.
»Ziemlich clever, das mit der Überweisung.«
»Deine Telefonnummer existiert nicht mehr. Du hast deine E-Mail-Adresse geändert. Ich habe nach deiner Bankverbindung gefragt, weil ich dachte, dass du sicher regelmäßig dein Konto überprüfst – Fred hat mir mal von deinen Börsengeschäften erzählt.«
Fred war sein früherer Partner. Wer weiß, dachte Tjark, was Fred noch so alles erzählt hatte. In jedem Fall schien die Buchhaltung keinen besonderen Wert auf Datenschutz zu legen.
Femke sagte: »Es war ein Versuch. Niemand weiß, wo du steckst, und das schon seit fast einem Jahr. Wo bist du denn?«
»Du hast mich nicht erreichen wollen, um mich das zu fragen.«
»Das stimmt.«
»Ich bin in Dänemark.«
»Dänemark?«
»Ja. In einem Haus am Meer.«
Femke schwieg eine Weile. Dann sagte sie: »Das wundert mich.«
»Was wundert dich?«
»Beides.«
»Lass mich raten: Fred hat dir davon erzählt.«
»Ja. Deswegen ist es … Es wundert mich. Dänemark und das Meer.«
Femke spielte auf sein Problem mit der See an. Und auf sein Problem mit Dänemark. Tjarks Mutter war auf einer Fährüberfahrt von Jütland nach Göteborg ertrunken. Die Umstände konnten nie genau geklärt werden. Wahrscheinlich ein Unfall – ein Unfall, der nie geschehen wäre, wenn Tjark seinen Eltern die Reise nicht zum Hochzeitstag geschenkt hätte. Er hatte lange darüber geschwiegen und Fred zuletzt davon erzählt, kurz bevor er zu seiner Auszeit aufgebrochen war.
Er sagte: »Es gibt keinen besseren Ort, um sich seinen Dämonen zu stellen, als den, an dem sie wohnen.«
»Hilft es?«
Tjark sparte sich die Antwort und fragte: »Warum willst du mich so dringend erreichen?«
Femkes Atem rauschte über das im Telefon eingebaute Mikro. Es klang, als halte sie ihr Handy mitten in den Wind. »Es ist etwas mit Ceylan passiert.«
Tjarks Körpertemperatur schien um einige Grad Celsius zu fallen. Gleichzeitig steigerte sich sein Puls. Das lag am Adrenalin, ein Stresshormon, das in gefährlichen Situationen sehr schnell Energiereserven aktivierte, um durch Kampf oder Flucht das Überleben zu sichern. Oder bei Schock.
»Was ist passiert?«
Wieder klang es, als stünde Femke mitten in einem Orkan. Sie zögerte – nicht, um ihrer Antwort mehr Gewicht zu verleihen, dachte Tjark. Femke hatte ihm vor drei Tagen die Nachricht zukommen lassen und einige Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie und wie sie es sagen würde. Aber es war eine Sache, sich die Worte zurechtzulegen, und eine andere, sie auszusprechen. Was bedeutete, dass es nicht leicht für Femke war. Tjarks Körpertemperatur schien um einige weitere Grade zu fallen.
»Tjark«, sagte Femke schließlich, »Ceylan liegt mit einer schweren Stichverletzung im Krankenhaus. Jemand wollte sie wohl umbringen. Ich stand genau daneben und konnte es nicht verhindern.«
Tjark sog an der Zigarette und stieß den Rauch durch die Nase aus. Wie ein Drache kurz vor dem Feuerspeien. Jemand hatte eine Unberührbare berührt. Eine persische Prinzessin, ein Mitglied der Fantastic Four, wie Tjark letzten Sommer die Ermittlergruppe aus Ceylan, Femke, Fred und sich selbst getauft hatte. Niemand vergriff sich an seinen Leuten. Niemals.
Er fragte: »Wie ernst ist es?«
»Ceylan wurde von einem Messer in den Rücken getroffen – in der Nierengegend und sehr tief. Sie ist in ein künstliches Koma versetzt worden und hat viel Blut verloren, aber auch Glück gehabt: Innere Organe wurden zwar verletzt, doch ihr Zustand ist inzwischen stabil. Die Ärzte meinen, sie hat eine gute Chance.«
Gute Chance. Tjark starrte ins Nichts. Dort sah er blinkende Anzeigen, Schläuche und Kanülen, Lebenserhaltungssysteme. Ein weißes Zimmer, ein weißes Bett und darin liegend ein mit Pflastern und Verbänden beklebtes Etwas, das ebenso bleich war. Die sonst dunkelbraune Haut jetzt grau, das schwarze Haar verfilzt, Ringe unter den geschlossenen, von langen Wimpern umkränzten Augen, die Lippen aufgesprungen.
»Wie ist das passiert?«, fragte er.
Femke erzählte von Wilhelmshaven und dem Hafenfest. Tjark stutzte nur kurz, denn er hatte angenommen, dass Femke auf seine Stelle in Oldenburg nachgerückt war. »Ich weiß nicht«, erzählte sie, »wie es genau passiert ist. Ceylan ist direkt neben mir gestanden. Ich habe gerade in meiner Handtasche nach etwas gesucht. Im nächsten Moment hat sie sich schon an mir festgehalten. Ihr Gesicht war weiß wie Kreide. Alles war voller Blut. Dann ist sie zusammengebrochen und hat das Bewusstsein verloren. Es hat eine Weile gedauert, bis die Sanitäter alarmiert waren und sie in der Menschenmenge abtransportieren konnten. Es hat weiter viel Zeit gekostet, bis sie sich mit dem Rettungswagen durch die gesperrte und vollkommen überfüllte Innenstadt gepflügt hatten. Im Klinikum haben sie eine Not-OP gemacht.«
»Hat jemand den Täter gesehen?«
Femke lachte schwach auf. »Tausende – und keiner. Der Platz war voller Menschen, aber niemand konnte sich verlässlich an irgendetwas erinnern. Es war … schrecklich.«
Tjark schnippte die Zigarette in hohem Bogen von sich. Sie landete funkenstiebend auf dem grauen Asphalt. »Habt ihr irgendetwas in der Hand?«
»Nein. Keine Videos von Überwachungskameras. Keine Fotos. Keine Worte von Ceylan.«
»Seid ihr am Ball?«
»Alle sind am Ball. Sie denken von morgens bis abends an nichts anderes.« Tjark konnte sich das gut vorstellen. Jemand hatte versucht, eine Polizistin umzubringen. »Insbesondere ich«, fuhr Femke fort, »denke an nichts anderes, weil ich mich frage, warum ich es nicht verhindern konnte und warum ich nichts gesehen habe. Außerdem sind mir die Hände gebunden, ich stehe außen vor.«
Natürlich, überlegte Tjark. Femke war eine unmittelbare Zeugin und Freundin des Opfers und persönlich involviert. Damit war sie raus aus den Ermittlungen, aber würde gewiss aus denselben Gründen von den Kollegen auf dem Laufenden gehalten. Inoffiziell.
Femke ergänzte: »Es gibt noch keinen konkreten Verdacht.«
»Blödsinn«, sagte Tjark.
»Blödsinn?«
»Natürlich habt ihr einen Verdacht.« Er schloss die Augen und massierte sich den Nasenrücken.
»Nein. Ja.« Femke seufzte tief. »Es ist schwierig. Über die Tat wurde überall berichtet, auch im Fernsehen. Wir haben Hunderte von Zeugenaussagen, aber nichts Brauchbares. Einige behaupten, sich an einen Mann erinnern zu können. Allerdings reichen die Beschreibungen von klein, um die vierzig Jahre alt und kahlköpfig bis hin zu groß, Mitte zwanzig und langhaarig. Die Leute haben natürlich alle zur Bühne gesehen oder sich unterhalten. Niemand hat auf einen Messerstecher geachtet, weil niemand dort einen Messerstecher erwartet hat. Der muss das ganz nebenbei gemacht haben – wie sich halt so jemand an dir vorbeidrängt bei einem Stadtfest. Ich selbst kann mich an überhaupt nichts erinnern, obwohl ich genau danebenstand, und es hat auch einige Momente gedauert, bis ich überhaupt kapiert habe, was gerade passiert ist. Bis die anderen Zeugen das realisiert hatten, ist noch mehr Zeit vergangen, und da war der Täter längst schon in der Masse wieder untergetaucht. Es war … einfach furchtbar.«
Tjark ging nicht auf Femkes Bemerkung ein. Er hatte bereits in einen analytischen Modus geschaltet, in dem Emotionen nichts zu suchen hatten, weil Emotionen wie Kleister waren, die das Wesentliche verdeckten.
Er überlegte, dass der Täter Femke und Ceylan die ganze Zeit über beobachtet haben und ihnen gefolgt sein musste. Er wusste, wen er erwischen wollte und wie, und hat nur auf den richtigen Moment gewartet, um in der Menschenmenge schnell auf- und sofort wieder abzutauchen.
Tjark fragte: »Woran hat sie zuletzt gearbeitet?«
»An den Northern Riders.«
»Mist.«
Tjark bedauerte, dass er die Zigarette bereits weggeworfen hatte. Er legte das Handy auf der Kühlerhaube ab und zündete sich eine neue an. Im vergangenen Jahr hatten er und Fred bei einer Razzia zugesehen, die Ceylan geleitet hatte. Es war dabei um die Bad Coyotes gegangen, und ein V-Mann hatte Ceylans Crew hängenlassen. Es war zu einer Schießerei gekommen, die damit geendet hatte, dass die Führungsgruppe der Coyotes festgenommen werden konnte und in U-Haft wanderte. Es ging um eine Reihe von Delikten – allen voran den dringenden Verdacht, Morde an Mitgliedern der rivalisierenden Riders angewiesen zu haben. Die Coyotes waren nach seinen letzten Informationen kaltgestellt. Aber diese Informationen waren Monate alt. Er hatte keine Ahnung, wie es um die Riders bestellt war.
Tjark nahm das Handy wieder ans Ohr und hörte Femke erklären: »Bei uns im Norden sind die Gangs am aktivsten. Das LKA hat eine Sonderkommission für Organisierte Bandenkriminalität ins Leben gerufen. Ceylan hat den Leitungsjob bekommen, weil sie sich gut auskennt.«
Respekt, dachte Tjark.
»Fred arbeitet jetzt mit ihr zusammen.«
Also nichts mit dem ruhigen Bürojob. Fred war wieder an der Front, und wahrscheinlich würde er wegen der Sache mit Ceylan zurzeit Napalm speien.
Tjark sog an der Zigarette und blickte in den Himmel. »Ich kann mir vorstellen, dass der Messerstich ein Denkzettel sein sollte. Ihr müsst euch die Riders vornehmen und sie fertigmachen.«
»Das ist einfacher gesagt als getan.«
»Es gibt immer eine Schwachstelle.«
»Tjark, die Kollegen sind alle nicht untätig, aber wir haben überhaupt nichts gegen die Riders in der Hand und können sie deswegen auch nicht fertigmachen.«
Ihr vielleicht nicht, dachte Tjark. Jemand, der sich außerhalb des Systems bewegt, schon.
Femke deutete sein Schweigen richtig. »Tjark, ich wollte dir nur sagen, was los ist. Ich wollte dich nicht in die Sache hineinziehen, okay?«
Tjark antwortete nicht. Die Schweine hatten sich an Ceylan vergriffen und damit auch Femke getroffen. Und Fred. Und Tjark selbst. Alle vier. Die Scheißriders hatten ihm den Krieg erklärt.
Femke sagte: »Ich kann deine Wut verstehen. Was meinst du, wie ich mich fühle. Ich habe seit drei Nächten nicht geschlafen und zerbreche mir ständig den Kopf, ob ich nicht vielleicht doch etwas gesehen habe – und warum ich es nicht verhindern konnte.«
»Die Schuld daran trägt jemand anders.«
»Bitte, Tjark: Du bist noch nicht wieder bei der Polizei. Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Vielleicht lässt sich ja etwas arrangieren, vielleicht kannst du die Auszeit verkürzen und die Suspendierung aufheben lassen, damit du wieder im Boot bist, ich weiß nicht … Ich habe dir versprochen, dass ich dich zurückholen werde und werde mein Möglichstes tun. Aber nicht, damit du …« Femke suchte nach Worten. »Versprich mir, dass du nichts Dummes und Unüberlegtes tust.«
»Versprochen«, antwortete er. Das konnte er guten Gewissens. Er würde nichts Dummes oder Unüberlegtes tun, sondern etwas sehr Überlegtes.
Sie verabschiedeten sich. Tjark gab Signe das Telefon zurück und bedankte sich. Dann stieg er in den Wagen und fuhr zum Ferienhaus, um einige Sachen zusammenzupacken. Er tauschte seine Jeans und das T-Shirt gegen eine eng geschnittene dunkle Anzughose, ein helles Hemd und die schwarze Kalbslederjacke. Etwa zwei Stunden später passierte er die deutsche Grenze bei Flensburg.
7.
Femke steckte das Telefon wieder ein. Vom Großen Hafen her blies ihr der Wind entgegen und blähte ihre Jacke auf wie einen Ballon. Sie schloss einige Knöpfe und wendete der Wiesbadenbrücke den Rücken zu, wo gerade ein Containerschiff entladen wurde. Vor ihr lag die Fassade des Kulturzentrums Altes Pumpwerk, weiß mit Verzierungen aus rotem Backstein, das früher einmal für die Entwässerung zuständig gewesen war und heute Raum für bis zu achthundert Zuschauer bot. Wolfgang Niedecken sollte dort demnächst gastieren. Und auch Reinhold Beckmann mit seiner Band. Femke hatte keine Ahnung gehabt, dass der TV-Moderator Musik machte. Im Sommer gab es regelmäßig Open-Air-Veranstaltungen – zuletzt beim »Wochenende an der Jade«, dem Hafen- und Stadtfest vor einigen Tagen.
Und genau hier war es geschehen.
Femke fasste sich in den Nacken, von wo aus sich ein Verspannungsschmerz bis zu den Schläfen hin ausbreitete, um die Muskeln zu massieren. Sie wusste, dass das nicht viel bringen würde und sie eine Ibuprofen-Tablette einwerfen müsste. In den letzten Tagen hatte sie die Dinger geschluckt wie Drops.
Sie ließ ihren Blick über den Platz schweifen. Dort drüben war die Bühne gewesen, davor Bier- und Bratwurststände. Dicht an dicht hatten die Menschen gestanden – bis weit über die Grenzen des Platzes hinaus. Irgendwo dazwischen sie und Ceylan, nach Femkes Einschätzung in etwa hier, wo sie nun stand und versuchte, sich an irgendetwas anderes zu erinnern als an Ceylan in einer Blutpfütze, Ceylans leeren Blick und ihre eigene Hilflosigkeit.
Von Tjark hatte sie eben nicht die Worte gehört, die sie sich insgeheim erhofft hatte. Tröstende Worte. Gut, er hatte gesagt, dass das alles nicht ihre Schuld sei und er nachvollziehen könne, wie sie sich fühlte. Phrasen. Wahrscheinlich hatte sie zu viel erwartet. Sicher war er zu sehr damit beschäftigt gewesen, seine eigenen Gefühle und Gedanken zu sortieren. Femke überlegte, ob es klug gewesen war, ihn zu verständigen, denn in ihrem Bauch fühlte es sich nun an, als habe sie eine heiße Kartoffel verschluckt. Das verspürte sie immer, wenn etwas nicht in Ordnung war oder etwas in der Luft lag. Viele Polizisten kannten solche Vorahnungen. Bei manchen kribbelte es im Nacken. Anderen schoss der Speichel in den Mund. Tjark nannte das Gefühl seinen »Spinnensinn«, in Anlehnung an Spiderman.
Femke fürchtete, dass Tjark etwas unternehmen könnte – was auch immer. Er hatte sich vom Dienst und allem anderen zurückgezogen, weil ihm ab und zu mal eine Sicherung durchbrannte und er die Sache in den Griff bekommen wollte. Nun, das Telefonat eben hatte bei Femke nicht den Eindruck hinterlassen, als hätte er große Fortschritte gemacht. So oder so würde er sich auf den Weg machen, um nach Ceylan zu sehen. Die Bande zwischen ihm und ihr waren dicht geknüpft. Den Grund dafür kannte Femke nicht. Aber der Gedanke daran versetzte ihr einen leichten Stich.