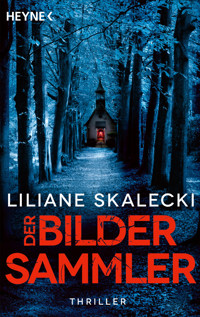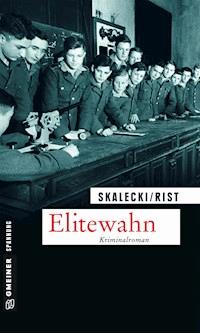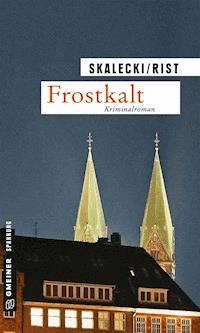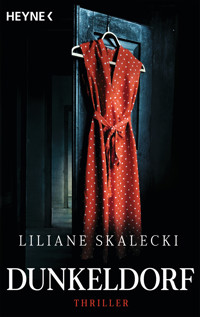
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit ist ein dunkler Fleck in deiner Vergangenheit
Der bekannte Autor Niklas Westphal kehrt aus einem traurigen Anlass an den Ort seiner Kindheit zurück: die Beerdigung seiner kürzlich verstorbenen Mutter. Kaum im einstigen Elternhaus angekommen suchen Niklas beunruhigende Träume heim. Die Bilder scheinen mit einem ähnlich heißen Sommer in der Vergangenheit zusammenzuhängen, an dessen Ende nicht nur drei Menschen sterben, sondern auch eine geheimnisvolle junge Frau verschwindet. Als dann die Leiche eines seit langer Zeit vermissten Mädchens entdeckt wird, ahnt Niklas, dass sich hinter seinen Traumgespinsten eine dunkle Geschichte verbirgt. Auf eigene Faust beginnt er, Ermittlungen anzustellen – doch die Dorfbewohner schweigen hartnäckig. Einzig seine frühere Schulfreundin Tessa steht ihm bei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Ein grob behauener Sandsteinblock fiel Niklas ins Auge. Aus dem oberen Bereich war eine Taube herausgemeißelt worden, die mit schräg gelegtem Köpfchen auf das Grab blickte. Ein schöner, außergewöhnlicher Grabstein. Fast wie ein Findling, aber von Menschenhand behauen. Auf dem Stein waren zwei Namen eingraviert. Moritz Römer * 1932 † 1995. Darunter stand Julia * 1973 – Gott möge dich beschützen. Kein Sterbedatum. Das Mädchen, das von der Disco nach Hause wollte und nie dort angekommen war. Das musste so vor dreißig Jahren gewesen sein. Julia war älter gewesen als er. Die ganze Gegend war damals durchkämmt worden. Sein Vater hatte sich dem Suchtrupp angeschlossen. Alles, was Beine hatte, war unterwegs gewesen. Die Jägerschaft Thöninghausen hatte jeden Mann mobilisiert, mit bestens ausgebildeten Jagdhunden hatten sie die Gegend durchkämmt. Nichts ließ man unversucht, Julia zu finden. Aber sie blieb verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt.
Erneut fröstelte Niklas trotz der Hitze, die die Blumen auf dem Grab der Familie Römer vor seinen Augen verdorren ließ.
Die Autorin
Liliane Skalecki ist Kunsthistorikerin und Archäologin und widmet sich in ihren Kriminalromanen gerne Themen aus diesen spannenden Bereichen. Beim Stöbern in Antiquariaten und dem Eintauchen in die Vergangenheit entdeckt sie so manches Rätsel, das sie, auch unter Pseudonym, mithilfe ihrer Figuren in packenden Fällen löst. Sie lebt mit ihrer Familie in Bremen und Südfrankreich. Ihre Homepage: liliane.skalecki.info
LILIANE SKALECKI
DUNKELDORF
Thriller
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 05/2024
Copyright © 2024 by Liliane Skalecki
Copyright © 2024 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Sandra Lode
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design,unter Verwendung von Shutterstock (Lava 4 images / Jurga Jot)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-28411-4V001
www.heyne.de
Personen, Orte und die Auszüge aus den Romanen der fiktiven Autorin Julia von Mondragon sind der Fantasie der Autorin entsprungen.
Prolog
Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Wie lange schon war sie in der Kiste eingesperrt? Trotz der unsäglichen Schmerzen, die ihr zugefügt worden waren, war ihr Lebenswille ungebrochen.
Nachdem sie in der Dunkelheit wieder zu sich gekommen war, hatte sie einen kurzen Moment lang gehofft, man würde sie wieder herausholen. Aber im tiefsten Inneren wusste sie es besser. Sie versuchte, die Glieder, die eng an ihren Körper gepresst waren, irgendwie zu lockern, um sich aus dem Gefängnis zu befreien. Ihre Hände reichten bis an die Wände aus Holz, ihre Finger ertasteten die Fugen, wo die einzelnen Bretter aufeinandertrafen, versuchten, sie zu durchdringen, voneinander zu lösen, bis ihre Nägel nach kurzer Zeit abbrachen, ihre Fingerspitzen blutig waren. Zwischen ihren Bemühungen, sich zu befreien, lauschte sie auf jeden Ton, der von außen an ihre Ohren drang, würgte, wenn sie trotz des Knebels in ihrem Mund versuchte, sich bemerkbar zu machen. Und plötzlich ein bekanntes Geräusch: das Bellen eines Hundes. Sie konnte die Entfernung nicht einschätzen. Doch wo ein Hund war, da war ein Mensch nicht weit. Noch einmal sammelte sie die ihr verbliebenen Kräfte. Doch ihrer Kehle entwich nur ein dumpfes Stöhnen.
*
Der Hund hatte Witterung aufgenommen. Die Nase auf dem Boden, verfolgte er die Spur. Er lief den Weg entlang des Feldes und hinein in den dichten Tannenwald nicht zum ersten Mal. Mindestens einmal pro Woche trabte er bis zum Hochsitz, saß eine Zeit lang unten, wartete ab, dann ging es weiter, mit der Nase am Boden, in der Luft, je nachdem, aus welcher Richtung seine feinen Riechzellen gereizt wurden.
Er zog mit Nachdruck an der langen Schleppleine, nur ganz selten wurde seine Nase von etwas Neuem abgelenkt. Die Köttel einer Karnickelfamilie, eine tote Maus, ein Geruch, der seine empfindliche Nase störte oder auch erfreute. Je nachdem. Doch er wusste, was er zu tun hatte.
Der Befehl Such ertönte in seinen Ohren. Und er suchte. Die Fährte war nicht mehr die frischeste, jeder andere Hund hätte sie vielleicht verloren, doch nicht er. Er kam seinem Ziel immer näher, wurde schneller, hechelte, blieb stehen und setzte sich hin. Habe ich das nicht gut gemacht? Die braunen Hundeaugen blickten nach oben, fast schien es, als lächele der Hund. Doch das sah nur so aus. Wenn er hechelte, zog er die Lefzen über die Zähne.
Geduldig saß er da, wartete auf irgendeine Reaktion. Gut gemacht, ein Streicheln über den Kopf, etwas Leckeres aus der Tasche. Erwartungsvoll wanderten seine Augen zu der Hand, die sich in die Jackentasche schob. Doch nichts passierte. Ob er vielleicht Laut geben sollte? Das funktionierte eigentlich immer, wenn er den Eindruck hatte, man schenkte ihm nicht genügend Aufmerksamkeit.
Der Hund hob den Kopf, bellte einmal kurz und laut. Und nun? Wo ist meine Belohnung? Geht’s jetzt weiter? Das kehlige Bellen, das die Stille durchbrach, konnte alles bedeuten. Der durchdringende Geruch hatte seine empfindliche Nase erfüllt. Er war am Ziel. Er bellte noch einmal, kurz, auffordernd.
*
Sie hörte den Laut des Hundes nun deutlicher. Vergeblich versuchte sie, auf sich aufmerksam zu machen, öffnete den Mund zu einem Schrei, der in ihrer Kehle stecken blieb. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Bitte Hund, bleib da! Hier bin ich, hier! Eingesperrt in diese verdammte Kiste. Sie versuchte erneut, sich durch Klopfen bemerkbar zu machen, zog die Beine, soweit es die enge Kiste erlaubte, an, und stieß die Füße an die hintere Wand ihres hölzernen Gefängnisses. Zwei, drei Mal. Das Geräusch, das sie erzeugte, war dumpf, kaum hörbar. Ihre Hände berührten das Holz, das, was von ihren Fingernägeln übrig war, schabte darüber.
Der Hund bellte wieder.
Entfernte sich der Laut? Lief der Hund weg?
Nein, bitte nicht!
*
»Weiter.«
Der Hund verstand überhaupt nichts mehr. Warum gingen sie zurück? Sie waren doch am Ziel. Ein Zug an der Leine sagte ihm, er solle weiterlaufen. Er bellte ein letztes Mal und marschierte los.
Kapitel 1
Der Bus hielt mit quietschenden Bremsen. Ein ähnlich armseliges Geräusch gab die Tür von sich, als sie sich gemächlich öffnete. Als würde das Fahrzeug unter der Hitze, die wie ein dampfendes Tuch über den Dörfern, Feldern und Wegen lag, stöhnen.
Er stellte seinen Rollkoffer in den Gang, sehr zum Missfallen der Fahrgäste, die nach ihm einstiegen, sich die Schienbeine daran stießen oder fast darüber stolperten. Als wären die Bewohner der umliegenden Dörfer mit Blindheit oder zumindest einer ausgeprägten Kurzsichtigkeit geschlagen. Er entschuldigte sich immer wieder, nahm die missbilligenden Blicke in Kauf und ließ den Koffer stehen. Gepäcknetze gab es keine, und das Ungetüm auf den Sitz neben sich zu stellen, wäre ihm äußerst unhöflich erschienen.
Der Bus musste uralt sein. Die Sitze waren zum Teil zerschlissen und die Haltegriffe an den Stangen unter dem Dach dunkel und speckig. Konnte das immer noch das Fahrzeug sein, das zwischen den Ortschaften hin und her pendelte, als er noch ein Jugendlicher gewesen war, der zur Disco in das fünfzehn Kilometer entfernte Städtchen fuhr? Er reckte den Hals, um auf das zweite Fenster vorne links zu spähen. Mit einem Taschenmesser hatte er vor ewigen Zeiten versucht, ein Herz hineinzuritzen. Die Schandtat war ihm nicht gut bekommen. Er erinnerte sich noch lebhaft an die Ohrfeige, die seine Mutter ihm verpasst hatte. Weniger an den Schmerz als an das Geräusch, als ihre Hand mit Wucht seine Wange traf. Doch es war kein Herz auszumachen. Entweder hatte man die Scheibe ausgetauscht, oder, was eher zu vermuten war, es war doch nicht sein alter Bus, sondern ein neueres Modell.
Neuer, aber noch längst nicht modern. Es gab keine Anzeige, die ankündigte, wann er sein Ziel denn nun erreichen würde. Alles kam ihm fremd vor. Die Landschaft hatte sich verändert. Wo noch vor Jahren Vieh weidete und Weizenfelder golden im Schein der Sommersonne glänzten, hatte die Monokultur ihren Siegeszug angetreten. So weit seine Augen blickten, wuchs nur Mais, uniforme Anbauflächen, die ihm keinerlei Anhaltspunkt dafür gaben, wo er sich befand. Früher führte der Weg zwischen den Schwarzbunten von Bauer Dietrich ins Dorf. Kühe als Landmarke. Wann hatte dieser Wandel stattgefunden?
Er tippte einer jungen Frau, die vor ihm saß und keinen unangenehmen Zusammenstoß mit dem Corpus Delicti, sprich Rollkoffer, gehabt hatte, auf die Schulter. Sie drehte sich um, zog die Stöpsel, die ihr Handy mit den Ohren verbanden, aus denselben und schaute ihn fragend an.
»Die nächste Haltestelle ist doch Thöninghausen?«
Sie nickte und gab sich wieder der Musik hin, die für einen Moment auch für ihn hörbar aus dem Handy drang. Überrascht zog er die Augenbrauen hoch. Er hatte alles erwartet, nur nicht Mahlers Auferstehungssinfonie.
Erneut tippte er ihr auf die Schulter, nickte anerkennend, als sie sich umdrehte, und hob seinen Daumen. Alle Achtung, hätte nie gedacht, dass die Jugend von heute Mahler hört, sollte das bedeuten. Sie quittierte seine Anerkennung mit einem genervten Augenrollen. Erst da entdeckte er den Geigenkasten, der neben ihr auf dem Sitz lag. Peinlich berührt lehnte er sich zurück und starrte aus dem Fenster, bis unvermittelt in der Ferne die Turmspitze der Martinskirche von Thöninghausen hinter einem Maisfeld auftauchte. Hatte man die schon immer von der Straße aus gesehen? Oder lag es daran, dass er im Bus einfach nur sehr viel höher saß als im Auto oder auf dem Fahrrad? Oder hatte er es einfach nur vergessen?
Wenige Minuten später hatte er sein Ziel erreicht. Das alte Wartehäuschen war fast gänzlich verschwunden. Nur noch der Mülleimer, der an einem Mauerrest hing und wohl kürzlich einem Brandanschlag zum Opfer gefallen war, zeugte zusammen mit den bröckelnden Steinen von ehemals besseren Zeiten.
Er stieg aus und setzte seinen Koffer auf dem staubigen Boden ab. Die Hitze, die ihn außerhalb des Vehikels erwartete, raubte ihm fast den Atem. Wie eine Wand stand sie vor ihm. Wenn er jetzt einen Schritt machte, würde er entweder an dieser Wand abprallen, oder, wenn er die Wand durchdringen würde, wie eine Motte, die einer Kerzenflamme zu nahe gekommen war, verglühen.
Das brummende Motorengeräusch des anfahrenden Busses riss ihn aus seinen Fantastereien. Der Fahrer hatte noch kurz an der Haltestelle gewartet, da er eine Minute zu früh angekommen war. Allerdings fand sich niemand ein, um zuzusteigen, und so fuhr der Bus pünktlich wieder ab, bereit, seine Fahrgäste im sechs Kilometer entfernten Butzigheim auszuspucken oder Butzigheimer, die nach Trutstadt oder noch weiter wollten, aufzunehmen. Er stieß als Abschiedsgruß eine dunkle Rußwolke aus dem Auspuff und verschwand hinter der nächsten Kurve.
Kein Lüftchen regte sich, und die Blätter der dicht nebeneinanderstehenden, hoch aufgeschossenen Maisstauden hingen schlapp herab. Er zog sein Jackett aus, quetschte es in seinen Rollkoffer und krempelte die Ärmel hoch. Lautlos schwirrte eine Pferdebremse auf ihn zu, setzte sich auf seinen linken Unterarm und stach gnadenlos zu.
»Mistvieh.« Er war eben dabei, seine Sonnenbrille aus einem Etui zu kramen, das in der Außentasche des Trolleys steckte, hielt in seiner Bewegung inne und schlug zu. Hämisch grinsend, da war er sich sicher, düste das große Insekt davon, verschwand im Schutz der Maisstauden, die fast bis zum Straßenrand wuchsen und dabei den Wegweiser, der die Richtung nach Thöninghausen zeigte, fast gänzlich verbargen. Der Arm juckte bereits und schwoll an, eine zentimetergroße Quaddel bildete sich. Als Kind hatte er immer Spucke darauf gerieben. Es hatte nie etwas genutzt, aber ihm das Gefühl gegeben, etwas gegen das Gift unternommen zu haben. Walter hatte sogar einmal eine solche Stelle mit dem Taschenmesser angeritzt und ausgesaugt. Hatte aber auch nicht gegen den Juckreiz geholfen.
Er setzte die Brille auf und machte sich mit seinem Rollkoffer, den er wie ein trotziges Kind, das keine Lust zum Laufen hatte, hinter sich her zerrte, auf den Weg zum Ort seiner Kindheit und Jugendjahre. Von der Landstraße aus hatte er einen knapp zwei Kilometer langen Fußmarsch auf dem unbefestigten landwirtschaftlichen Fahrweg vor sich. Er war ihn wohl schon tausendmal gelaufen. Wenn er Glück hatte, fuhr vielleicht ein Auto oder ein Traktor in seine Richtung. Er lauschte, doch das Fahrzeuggeräusch, das er gehört hatte, kam von der Landstraße und blieb auf der Landstraße.
Es war Ende Juni, der offizielle Sommer war schon ein paar Tage alt und bot bereits alles auf, was einen echten Sommer ausmachte. Höchsttemperaturen von fünfunddreißig Grad, Schlagzeilen in der Tagespresse, die verkündeten, das Mineralwasser in den Getränkemärkten werde bereits knapp, Empfehlungen, vor allem an alte Menschen, genügend zu trinken – Dehydrierung war das Gefahrenwort.
Nach kaum hundert Metern brach ihm der Schweiß aus allen Poren. Er war einundvierzig Jahre alt, hatte eine sportliche Figur und eine gute Kondition, joggte bei Wind und Wetter, bei Minusgraden und rekordverdächtigen Temperaturen, die ihm eigentlich nie zu schaffen machten. Doch diese Hitze war eine andere, eine seltene, eine, die es nur in diesen Gefilden gab. Thöninghausen lag, wie seine Nachbardörfer, in einem Talkessel, in dem sich hohe Luftfeuchtigkeit breitmachte und nicht mehr weichen wollte.
Das Geräusch knirschender Steine hinter ihm ließ ihn anhalten und sich umdrehen. Auf einem schwarzen Fahrrad näherte sich in gemächlichem Tempo eine alte Frau mit einem geblümten altmodischen Kopftuch, eine Kopfbedeckung, gleichermaßen Sonnen-, Regen- und Windschutz, wie er sie noch von seiner Großmutter Emilie kannte. Auf dem Gepäckträger war ein Korb befestigt, in dem eine prall gefüllte Plastiktüte lag. Die Frau verlangsamte ihre Fahrt, als sie ihn passierte, warf ihm einen kurzen Blick zu, nickte und strampelte weiter. Kein Gruß, keine Frage, keine Neugierde. So waren die Menschen in Thöninghausen. Eher wortkarg, was Fremde betraf, dabei jedoch nicht unhöflich, aber reserviert. Nur war er kein Fremder.
Hätte Elisabeth Tümmler ihn erkannt, immerhin war ihre Schwiegertochter eine entfernte Cousine seiner Mutter, hätte sie ganz sicher haltgemacht und das Wort an ihn gerichtet. Trotz der Hitze lief ihm ein kalter Schauder über den Rücken. Er hatte sich als kleiner Knirps vor der Frau furchtbar gegruselt.
Zuletzt war er vor mehr als elf Jahren in seinem Heimatdorf gewesen. Sein bester Freund aus der Jugendzeit Hartwig hatte geheiratet und ihn gebeten, Trauzeuge zu sein. Er hatte die Feier über sich ergehen lassen, ebenso wie die vielen Fragen, die ihm gestellt wurden, und war froh gewesen, als er wieder in sein Auto hatte steigen und Thöninghausen den Rücken kehren können.
Apropos Auto. In vier Wochen würde er seinen Führerschein wiederhaben. Der Lappen war für zwei Monate weg. Plus zweihundertvierzig Euro weniger auf dem Konto und zwei Punkte mehr in Flensburg. Ein Abstandsmesser auf einer Autobahnbrücke zwischen Mannheim und Stuttgart war ihm kurz hinter Heilbronn zum Verhängnis geworden. Eigentlich war es kein großes Drama, die meisten Reisen erledigte er sowieso mit dem Zug. So wie diese. Doch nach der recht angenehmen Bahnreise hatte er in die Straßenbahn wechseln müssen, dann in den Bus und zuletzt dieser Fußweg. Ein echter Bequemlichkeitsabstieg. Natürlich hätte er auch mit dem Taxi fahren können. Er hätte sein Ziel eindeutig komfortabler und vor allem schneller erreicht. Aber wollte er es überhaupt schnell erreichen? Und da war auch noch dieser Hauch eines Gefühls von Nostalgie gewesen, als er sich entschieden hatte, den Überlandbus zu nehmen.
Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn und seufzte, zwei Drittel der Wegstrecke hatte er geschafft. Die kleine Antoniuskapelle lag nun rechts von ihm. Der Mais hielt sich artig daran, die Kapelle nicht zu sehr zu bedrängen. In einem winzigen Augenblick des Selbstmitleids empfand er nach, was Jesus auf dem Kreuzweg hatte erdulden müssen. Er schalt sich selbst einen Idioten, straffte die Schultern und marschierte weiter seinem Ziel entgegen. Der Rollkoffer holperte und sprang hinter ihm her, der Griff war mittlerweile schweißnass, und er wechselte ihn von der linken in die rechte Hand.
Ein Motorenbrummen ließ ihn erneut stehen bleiben. Diesmal kam das Fahrzeug von vorne. Er trat zur Seite, um den Wagen passieren zu lassen. Noch ehe er ihn sah, kündeten Staubwolken vom unmittelbaren Herannahen des Autos. Ein roter Ford, der kein Schlagloch ausließ, bretterte geradezu in seine Richtung. Hoffentlich sah der Fahrer ihn auch. Er quetschte sich mit seinem Koffer in das Maisfeld und wartete, dass der Wagen an ihm vorüberbrauste. Doch der Fahrer hatte ihn entdeckt, bremste ab und hielt direkt neben ihm. Das Beifahrerfenster wurde heruntergekurbelt, und ein wuscheliger Lockenkopf, dessen braune Haarpracht von grauen Strähnen durchzogen war, spähte heraus.
»He, Mann. Da bist du ja schon. Elisabeth hat gesagt, du würdest dich nass geschwitzt mit deinem Koffer abrackern. Ich wollte dich abholen, aber das lohnt sich jetzt wohl nicht mehr. Schön, dass du da bist.« Der Fahrer des Fords war kein geringerer als Hartwig, dessen Trauzeuge er gewesen war. Hartwig nieste, als ihm der aufgewirbelte Staub in die Nase stieg.
»Ich hätte mich gefreut, wenn wir uns unter anderen Umständen wiedergesehen hätten. Elf Jahre sind eine lange Zeit. Aber so ist das nun mal. Hochzeiten und Beerdigungen sind die Ereignisse, die einen zusammenführen. Beim letzten Mal war es eine Hochzeit, und nun eine Beerdigung.«
Hartwig redete wie ein Wasserfall, so war er schon immer gewesen. Er quatschte, ohne Luft zu holen, ohne Punkt und Komma.
»Ähm, ja, stimmt, elf Jahre sind eine lange Zeit«, erwiderte er, nur um überhaupt einen Ton von sich zu geben.
»Lattwich hat sie extra kühl gehalten. Der Sarg ist auch noch nicht geschlossen. Du hast Glück. Als ich damals endlich vom Bund loskam, konnte ich meinen Vater nicht mehr sehen. Deckel drauf, und gut war’s. Ich hatte es einfach nicht eher geschafft. Na, wenigstens hat es bei dir zeitig geklappt. Lattwich hat sie sehr schön zurechtgemacht. Apropos Lattwich. Du kannst dich ja hoffentlich noch an Lattwichs Tochter Eva erinnern«, Hartwig lachte, als hätte er einen besonders lustigen Scherz gemacht, »sie bringt dir heute Abend was zu essen vorbei, falls du nicht auswärts essen möchtest. Sie arbeitet bei Gernot im Halben Hahn. Seit ein paar Jahren ist sie mit Rüdiger verheiratet. Den musst du noch von der Jugendfeuerwehr kennen. Der von Butzigheim. Die beiden haben das Haus von Evas Oma umgebaut. Ganz schön teuer geworden. Jetzt muss die Eva zusätzlich arbeiten.«
Er nickte nur aus dem Maisfeld heraus, versuchte erst gar nicht, Hartwigs Redeschwall zu unterbrechen, bis dieser in einer Art plötzlicher Eingebung zu der Erkenntnis kam, dass er den Freund aus Kindertagen kaum hatte zu Wort kommen lassen.
»Entschuldige. Ich rede und rede und rede. Mein Beileid zum Heimgang deiner lieben Mutter. Ich fahre dann mal weiter. Wenn ich sowieso schon unterwegs bin, steure ich eben mal noch den Getränkemarkt an. Sehen wir uns heute Abend? Auf ein Bier? Ich würde mich freuen. Wie lange kannst du überhaupt bleiben? Bis nach der Beerdigung? Wenigstens noch ein paar Tage in der alten Heimat?«
Sein Gegenüber nickte. »Ja, ich denke schon. Drei, vier Tage dürften drin sein. Dann muss ich wieder los. Ich habe eine …«
Weiter kam er nicht. Hartwig schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Fast hätte ich’s vergessen. Der Pfarrer lässt fragen, ob du nicht ein paar Worte am Grab sagen möchtest, und der Grewenig Björn will wissen, ob er drei Bläser aus seiner Jägertruppe für die Beisetzung schicken soll. Ist immer sehr festlich. Also, überleg’s dir und sag einfach rechtzeitig Bescheid. Na, bis denn.« Hartwig tippte sich mit zwei Fingern an die Stirn, eine Art militärischer Abschiedsgruß, kurbelte das Fenster wieder hoch, und der rote Ford entschwand hupend in einer weiteren Staubwolke.
Hatte die alte Elisabeth ihn also doch erkannt. Und gleich alle informiert. Seine Ankunft musste sich wie ein Lauffeuer im Dorf verbreitet haben. Und binnen weniger Minuten hatte man begonnen, ihn, Niklas Westphal, wieder in die dörfliche Gemeinschaft zu integrieren.
Seine Mutter, Sigrid Febronia Westphal, war am Sonntag verstorben. Er war zur Beerdigung gekommen – zurückgekommen. Der Haushalt musste aufgelöst werden. Da waren vier Tage denkbar knapp. Je näher er Thöninghausen kam, desto stärker beschlich ihn das unbehagliche Gefühl, das Dorf würde bereits jetzt beginnen, ihn wieder als einen der Seinen aufzunehmen.
Die ersten Häuser kamen in Sicht. Er hielt für einen Moment inne und atmete tief durch. Erst jetzt fiel ihm auf, wie still es war. Die Hitze erstickte alle Geräusche.
Kapitel 2
30 Jahre zuvor
Das Gewitter hatte die Temperaturen binnen einer Stunde in den Eiskeller stürzen lassen. Zumindest kam es ihr so vor. Noch trockenen Fußes war sie von der Disco der Landjugend Trutstadt zur Bushaltestelle aufgebrochen. Ihre Eltern kannten da nichts. Elf Uhr bedeutete elf Uhr und keine Sekunde später. Der Überlandbus verließ Trutstadt in Richtung Thöninghausen um 22.30 Uhr. Ankunft Thöninghausen 22.56 Uhr. Ihr Vater erwartete sie an der Bushaltestelle.
Mit Engelszungen hatte sie versucht, ihre Eltern zu überreden, ausnahmsweise bis Mitternacht die Disco im ehemaligen Kinosaal Scala besuchen zu dürfen.
»Immerhin werd ich im September siebzehn«, hatte sie argumentiert. »Ich bin die Einzige, die schon vor elf zu Hause sein muss, alle anderen dürfen länger bleiben. Ich mach mich doch lächerlich. Silvia ist ein halbes Jahr jünger als ich, und ihre Mutter erlaubt ihr, bis halb eins zu bleiben.«
»Wer ist denn bitte schön alle?«, polterte ihr Vater. »Und was Silvias Mutter angeht, kann man von so einer ja wohl nichts anderes erwarten. Silvia kommt ganz nach ihr. Immer nur ans eigene Vergnügen denken, das ist typisch für die beiden. Erika soll sich mal nicht wundern, wenn ihre Tochter sie demnächst zur Großmutter macht. Und damit Ende der Diskussion! Elf Uhr, oder du bleibst zu Hause!«
Mit diesen Worten hatte sich ihr Vater mit einem Bier vor den Fernseher verzogen. Irgendein Europapokalspiel. Ihr war es egal. Fußball interessierte sie nicht die Bohne. Regelmäßig besorgte sie bei Schreibwaren Weber den Kicker für ihren Vater. Sie hatte das Heft einmal durchgeblättert, da ging es tatsächlich nur um Fußball. Überflüssig wie ein Kropf, und für so was auch noch Geld ausgeben.
Ihre Mutter hatte ihr noch fünf Mark zugesteckt und sie ermahnt, keinen Alkohol zu trinken. Mit einem Papiertuch hatte sie ihr noch über die Lippen gewischt. Kind, das ist doch viel zu viel. Sie konnte von Glück sagen, dass sie vorher nicht noch drauf spuckte, wie sie es früher gemacht hatte, wenn sie ihr Dreck aus dem Gesicht wischte.
Dann hatte ihre Mutter ihr die Hüfthose mit mega Schlag, die sie nur mit sehr viel Überredungskunst hatte bestellen dürfen – Sammelbestellung aus dem Sommerkatalog von Neckermann über Rita, die beste Freundin ihrer Mutter – fast bis unters Kinn gezogen und das Jeanshemd bis über den Hintern. Ihr Einwand »Mama, das ist eine Hüfthose« verlor sich im Nichts.
Mit der Aussicht, wenigstens ein paar Stunden unter der glitzernden Partykugel zu tanzen und sich mit Robby – sie liebte ihn, sie liebte ihn, sie liebte ihn – noch ein wenig verdrücken zu können, war sie gut gelaunt mit ihren Freundinnen zur Bushaltestelle gelaufen, hatte sich die Hose wieder bis auf ihre knochigen Hüften heruntergezogen, das Hemd unter der Brust verknotet, sich die Lippen nachgeschminkt und ihre Haare aus dem Haargummi befreit.
Die männliche Jugend aus Trutstadt war schon seit Stunden im alten Kinosaal zugange, um ihn mit den Kumpels der Landjugend von Thöninghausen und Butzigheim für den Abend discomäßig aufzupeppen. Bis auf die Entfernung der Bestuhlung war im Scala, nachdem es seine Bestimmung als Kino verloren hatte, nichts verändert worden. Die Wände waren oberhalb einer dunklen Holzvertäfelung mit einem mittlerweile verblichenen roten Stoff bespannt, tütenförmige Wandlampen spendeten ein wunderbar schummeriges Licht. Vor Jahren war der letzte Film über die große Leinwand geflimmert. Gremlins – Kleine Monster. Das Filmplakat im Foyer erinnerte noch daran. Jemand hatte irgendwann dem Kuschelmonster eine Brille und einen Zylinder aufgemalt.
Die Zeit war wie im Flug vergangen. Sie hatte sich Blasen oberhalb der Fersen eingehandelt, die goldfarbenen Riemchen ihrer Plateausandalen mit der Korksohle hatten gnadenlos an ihren verschwitzten Füßen gescheuert. Drei Cola mit Schuss, ein Zug an Silvias Zigarette, der ihr einen Hustenanfall beschert hatte, heiße Küsse mit Robby, seine Hand in ihrem Jeanshemd und ein Knutschfleck am Hals, als Beweis seiner Liebe, waren das Ergebnis des knapp vierstündigen Discovergnügens gewesen. Eva und Silvia hatten noch versucht, sie zum Bleiben zu überreden, Barbaras Bruder würde sie alle gegen halb eins abholen.
Kurz hatte sie überlegt, es ihren Eltern mal zu zeigen, sich einfach über das Gebot der beiden alten Tyrannen hinwegzusetzen. Doch die Konsequenzen, die auf sie zukämen, würden zwei Stunden mehr Tanzen und Fummeln nicht aufwiegen. Hausarrest für vier Wochen, Verbot des Reitunterrichts, der ihrer Mutter sowieso ein Dorn im Auge war – Pferdehaare in der Waschmaschine –, für genauso lange. Das war es nun auch wieder nicht wert.
Mit glühendem Gesicht und einem leichten Flimmern vor den Augen, den Lichtreflexen der Discokugeln geschuldet, hatte sie sich alleine auf den Weg zur Haltestelle gemacht, die, wenn sie schnell ging, sieben Minuten vom alten Kinosaal entfernt war. Schon als sie sich mit Küsschen von ihren Freundinnen verabschiedet hatte, war das Grollen des herannahenden Gewitters zu vernehmen gewesen.
Sie musste sich beeilen, hoffte, ohne in einen Regenguss zu geraten, das Haltestellenhäuschen zu erreichen. Doch sie war noch keine zweihundert Meter vom Scala entfernt, als das Unwetter losbrach, von dem im Wetterbericht keine Rede gewesen war. Der leichte Wind entwickelte sich binnen einer Minute zu einem Sturm, der die Blätter von den Bäumen und Sträuchern riss. Sie spielte mit dem Gedanken, ins Kino zurückzulaufen. Doch wie hätte sie ihren Vater erreichen sollen?
Sie rannte los, doch die Sandalen rieben schmerzhaft über die blutigen Blasen. Sie hielt an, zog die Schuhe aus – Scheiße, wo war das Fußkettchen? –, lief barfuß weiter. Es schüttete mittlerweile wie aus Kübeln. Nach wenigen Metern war sie nass bis auf die Haut. Das Wasser rann ihr von den Haaren ins Gesicht, in den Nacken, ließ das Jeanshemd wie eine zweite Haut am Körper kleben. Der Schlag der Hose schlotterte schwer wie ein Putzlappen um ihre Knöchel.
Noch dreihundert Meter bis zur Haltestelle. Seitenstiche zwangen sie, erneut stehen zu bleiben und durchzuatmen. Die Nacht war schwarz, der Regen peitschte, kaum konnte sie die eigene Hand vor Augen sehen. Die funzelige Straßenbeleuchtung kurz vor der Bushaltestelle schaffte es nicht, mit ihrem kümmerlichen Licht bis zu ihr durchzudringen. Sie drückte eine Faust in die Rippen, doch der Schmerz blieb.
Scheiße, was war das denn? Hinter ihr ertönte das satte Brummen eines großen Fahrzeugs. Der Bus. Er war doch viel zu früh. Sie würde das verdammte Drecksding nicht kriegen. Mit den Sandalen in der Hand wedelte sie in Richtung Straße. Doch der Bus raste an ihr vorbei, die Scheibenwischer schafften es kaum, dem Regen, der wie eine Wand aus Tausenden von Tropfen an das Glas klatschte, Herr zu werden. Die Räder durchpflügten eine riesige Pfütze, eine dreckige Brühe ergoss sich auf ihre Hose und das Hemd.
»Arschloch!« Wütend schrie sie hinter dem Bus her, schwenkte ihre Arme. Vergeblich. Innerhalb weniger Sekunden sah sie nur noch die Rückleuchten, dann verschwand der Bus hinter einer Kurve. Sie seufzte. Ihr blieb wohl nichts anderes übrig, als zurückzugehen und mit Barbaras Bruder nach Thöninghausen zu fahren. Ihre Eltern würden ihr nie und nimmer abnehmen, dass der Bus einfach zu früh dran gewesen war. Sie würden steif und fest behaupten, sie hätte das mit Absicht gemacht. Um weiterzufeiern.
Oder, noch schlimmer, ihr Vater würde in fünfundzwanzig Minuten an der Haltestelle stehen, sich dann, nachdem sie nicht im Bus war, auf den Weg machen und sie vollends der Lächerlichkeit preisgeben, wenn er sie höchstpersönlich vor dem Kino abholte. Wahrscheinlich würde er hupen, hundertmal hintereinander, damit sie rauskäme. Schließlich konnte sie ja bei dem Scheißwetter nicht vor der Tür warten.
Nein, es war keine gute Idee, zum Scala zurückzulaufen. Bis zum Wartehäuschen war es nicht so weit. Dort würde sie Schutz finden, und ihr Vater musste schließlich dran vorbeifahren, wenn er sie einsammeln wollte. Und welchen besseren Beweis, dass sie tatsächlich den Bus hatte nehmen wollen, gäbe es, als die Tatsache, sie an der Haltestelle aufzugabeln.
Nass, verdreckt und stinksauer erreichte sie das Wartehäuschen, dessen linke Glaswand mit irgendetwas beschmiert war. Wenigstens war die Bank sauber. Sie setzte sich, rieb ihre Füße und bereitete sich schon einmal auf den Krach mit ihrem Vater vor. Er würde wahrscheinlich, wenn sie nicht aus dem Bus stieg, sofort losfahren. Vielleicht würde er aber auch zu spät von zu Hause aus starten. Das war auch schon passiert, wenn er beim Fernsehen einnickte, weil er ein Bier zu viel intus hatte. Scheiße. Was, wenn er so besoffen war, dass er nicht mehr fahren konnte?
Sie lehnte sich zurück, die kalte Glasrückwand hinterließ durch das nasse Jeanshemd ein unangenehmes Gefühl auf ihrer Haut. Sie schloss die Augen. Und wenn sie ein Auto anhalten würde, das in Richtung Thöninghausen fuhr? Wenn sie Glück hatte, könnte sie noch vor dem Bus ankommen, und ihr Vater würde es noch nicht einmal merken. Andererseits, wenn rauskäme, dass sie getrampt war, würde das eine Arrest- und Verbotswelle ungeahnten Ausmaßes nach sich ziehen. Wahrscheinlich bis Ende des Jahres kein Ausgang, kein Stall, nichts. Nur Schule, ihrer Mutter im Garten und im Haus helfen, samstags das Auto waschen. Kein Besuch von Freundinnen, von der Disco zum Erntedankfest im Herbst, dem absoluten Highlight der Saison, ganz zu schweigen.
»Scheißbus!« Sie schrie ihren ganzen Frust in die schwarze Nacht hinaus. Mittlerweile hatte der Regen nachgelassen, der Wind war abgeflaut, und vom Sommergewitter blieb nur noch der Geruch nach feuchter Erde. Sie stand auf, zupfte an ihrem Hemd, um das unangenehme Gefühl auf ihrer Haut loszuwerden, und schlüpfte in ihre Sandalen. In der ganzen Zeit war, außer dem Drecksbus, kein einziges Fahrzeug vorbeigekommen. Sie fröstelte.
Plötzlich durchbrach ein Motorengeräusch die Stille. Das konnte noch nicht ihr Vater sein. Außerdem kam es aus der entgegengesetzten Richtung. Und wenn sie doch ein Auto anhielt? Sie würde vielleicht immer noch zeitgleich mit dem Bus ankommen. Es würden null Konsequenzen drohen. Noch während sie unentschlossen mit sich rang, ob sie nun den Daumen ausstrecken sollte oder nicht, wurde der Wagen langsamer und hielt direkt neben ihr. Sie trat einen Schritt zurück, als die Fensterscheibe der Beifahrertür herunterfuhr.
»Sag mal, was machst du denn so mutterseelenallein hier an der Haltestelle? Ich dachte, ihr feiert alle im alten Kino. Du bist ja klatschnass geworden. Ach herrje, hast wohl den Bus verpasst.«
Sie nickte, und eine Woge der Erleichterung durchströmte sie. »Der war viel zu früh dran. Papa wollte mich an der Haltestelle eigentlich abholen.«
»Na, dann steig mal ein. Du kannst ja an der Haltestelle aussteigen. Dein Vater wird gar nicht merken, dass du nicht im Bus gesessen hast. Hopp, nach hinten mit dir. Du siehst aus wie eine Katze, die man ins Wasser geworfen hat.«
»Super, vielen Dank. Das erspart mir wahrscheinlich ne Menge Ärger.«
Noch ehe sie die Tür zum Fond öffnen konnte, wurde diese, wie von Geisterhand, aufgestoßen. Sie hatte in ihrer Erleichterung gar nicht bemerkt, dass hinten noch jemand saß.
Kapitel 3
Auszug aus dem Roman von Julia von Mondragon: Wind in den Cevennen. Bestseller im Jahr 2007
Knapp tausend Kilometer in einem Rutsch. Und nun stand sie da, inmitten einer Landschaft, die ihr den Atem raubte. Gestartet war sie morgens um halb fünf, und Muckel, eine der letzten Enten, die 1990 vom Band geflattert waren, hatte sie in elf Stunden wohlbehalten nach Canourges gebracht, das heißt, vier Kilometer vor den kleinen Ort inmitten der Cevennen.
Alice schälte sich aus dem Wagen und tätschelte liebevoll das Dach ihres froschgrünen Citroën 2CV. Ihr Blick glitt über einen Himmel, der blauer nicht hätte sein können. Es war Anfang Juli, und die unbekannten betörenden Düfte streichelten sich in ihre Nase. Ein Greifvogel kreiste über ihrem Kopf und stieß einen Schrei aus. Sonst war nichts zu hören.
Alice ließ ihr Gepäck in Muckels Obhut, schnappte sich ihren Rucksack und kramte die Schlüssel hervor, die ihr Dr. Noethgen mit einer hoheitsvollen Geste vor einer Woche überreicht hatte. »Viel Glück, Alice. Ich freue mich, dass Sie das Erbe des alten Paul angenommen haben. Als er bei mir war, um sein Testament in meine Hände zu geben, hat er zum Ausdruck gebracht, wie überglücklich er sein würde, Ihnen sein geliebtes Haus in den Cevennen anvertrauen zu dürfen.« Alice hatte vor Rührung nur stumm genickt und die Schlüssel wie einen Schatz in ihre Faust geschlossen.
Sie hatte den Brief des Notars zwischen zwei Rechnungen gefunden und ihn zunächst mit bangem Gefühl geöffnet. Was wollte ein Notar von ihr? Hatte sie sich etwas zuschulden kommen lassen? Sie war Erzieherin in einem Kindergarten, siebenundzwanzig Jahre alt, ihr Leben verlief in geregelten Bahnen. Geregelt, das hieß ohne Hochs und Tiefs, ohne größere Aufregung, wenn man von dem harmlosen Sturz des kleinen Patrick von der Schaukel absah, der ihm einen blauen Fleck auf der Stirn beschert hatte.
Noch ehe sie weiter darüber hätte nachdenken können, ob vielleicht doch etwas geschehen war, was einen Vater, eine Mutter gegen sie hätte aufbringen können, las Alice mit Staunen, dass man sie in einer Erbschaftsangelegenheit erwartete. Testamentseröffnung Paul Lejeune.
Tränen traten ihr in die Augen, als sie an den alten, liebenswürdigen Mann dachte, den sie einmal in der Woche im »Haus Sonnenschein« besucht hatte. Paul war der Schachpartner ihres Großvaters Richard gewesen, und nachdem ihr Opa verstorben war, hatte sie Paul weiter besucht, der, soweit Alice wusste, niemanden hatte. Keine Kinder, keine Enkel, er war ein einsamer alter Mensch. Spaziergänge, Gespräche, Pauls grüne Augen leuchteten, wenn Alice kam. Sie hatte versucht, die Vergangenheit des gebürtigen Franzosen zu ergründen. Wie und warum war er nach Deutschland und zuletzt ins »Haus Sonnenschein« gekommen? Mehr, als dass er vor sieben Jahren zu seiner Schwester, die in Deutschland verheiratet war, gezogen war, hatte ihr Paul nie verraten.
Sie ließ das aus Bruchstein gemauerte Haus mit dem grauen Dach und den geschlossenen Fensterläden auf sich wirken. Jemand schien sich um den Garten vor dem Haus gekümmert zu haben, denn die Oleander wirkten gestutzt. Rosen blühten in allen Farben, dazwischen reckten sich lila Lavendelköpfchen zur Sonne, die vom Himmel brannte. Alice zog ihre dünne Jacke aus, die sie über dem duftigen geblümten Baumwollkleid trug, und legte sie sich über den Arm.
Ein Holzbrett war an einem der Pfosten, zwischen denen das Gartentor etwas windschief hing, angebracht. »Mas des Roses«. Ein romantischer Name. Langsam trat sie auf ihr neues Heim zu, als plötzlich etwas vor ihr durch den Garten flitzte und skrupellos einen der Rosenbüsche überrannte. Alice traute ihren Augen kaum. Es war eine weiße Ziege mit schwarzem Hinterteil, die meckernd ihren Weg kreuzte, um das Haus herumrannte und … verschwunden war sie.
»Sacre bleu, Nicole, arrète!«
Eine männliche Stimme. Alice musste schmunzeln. So viel verstand sie. Die Ziege hieß Nicole, und sie sollte stehen bleiben. »Sacre bleu« war wohl ein Fluch oder Ähnliches. Da kam auch schon Nicoles Verfolger um die Ecke. Abrupt bremste er ab, als er Alice entdeckte. Blaue Augen, die den Himmel über ihr widerzuspiegeln schienen, schauten sie fragend an. Das Gesicht des Mannes war braun gebrannt, Lachfältchen um seine Augen und ein Dreitagebart verliehen ihm etwas Romantisch-Verwegenes. Alice hielt den Atem an. Dann streckte sie die Hand aus.
»Bonjour, je suis Alice Schreiner.« Sie suchte nach Worten, um dem Typen zu erklären, wer genau sie war und warum sie überhaupt mit einem Schlüssel in der Hand vor dem Haus von Paul stand. Unsicher legte sie los. »Paul m’a donné la maison. Paul est mort.« Sie wusste nicht weiter.
Der Mann ergriff ihre Hand und hielt sie einen Augenblick fest. »Ich bin Frédéric. Ich weiß Bescheid.« Er lächelte.
»Oh, Sie sprechen Deutsch.«
»Ein wenig. Ich war als Soldat in Donaueschingen stationiert.«
Donaueschingen. Aus dem Mund von Frédéric klang dieses Wort in Alices Ohren fast wie Musik. Noch ehe sie antworten konnte, galoppierte Nicole erneut um die Ecke, besann sich allerdings eines Besseren und blieb vor ihrem Herrn und Meister stehen. Mit neugierigem Blick schaute sie aus hellgrünen Augen nach oben, die, wie Alice verwundert bemerkte, rechteckige, quer stehende, schmale Pupillen hatten. Dann stupste Nicole Alice mit dem Kopf, auf dem sie nach hinten gebogene Hörner trug, sanft an. Alice bückte sich ein wenig und kraulte die Ziege zwischen den Ohren.
»Ich glaube, Nicole mag Sie«, sagte Frédéric mit sanfter Stimme. Das Funkeln in seinen Augen ließ Alices Herz so laut schlagen, dass sie glaubte, Frédéric müsse es hören.
Kapitel 4
Von den ersten Häusern am Ortseingang bis zur Kirche Sankt Martin waren es knapp dreihundert Meter. Niklas hatte damit gerechnet, auf diesem Weg in unzählige Gespräche verwickelt zu werden, doch weit gefehlt. Als wäre Thöninghausen ein Kaff in Südeuropa, hatten sich die Menschen vor der Gluthitze des Tages offenbar in ihre Häuser zurückgezogen. Einsam wanderte er mit seinem nach wie vor unwilligen Rollkoffer durch die Hauptstraße, die merkwürdigerweise Bahnhofstraße hieß, obwohl es seines Wissens in Thöninghausen nie einen Bahnhof gegeben hatte.
Über seinem Kopf stieß ein Raubvogel einen heiseren Schrei aus. Auf der staubigen Dorfstraße gab es nichts zu holen, und so flog der Habicht, oder was es auch war, weiter in Richtung Maisfeld, wo er wahrscheinlich hoffte, auf eine unvorsichtige Maus zu stoßen. In diesem Moment kam Niklas sich vor wie der einsame Rächer, der in einem Western à la John Wayne durch die menschenleere Stadt reitet, um ein Revolverduell mit seinem Erzfeind auszutragen. Es fehlten in Thöningshausens Flaniermeile nur noch diese merkwürdigen runden Gestrüppe, die in jedem Film zwischen Saloon und Sheriffbüro die Szenerie vervollständigten.
Das erste menschliche Wesen, das er erblickte, war ein junges Mädchen, das gerade aus Uschi’s Cut and go trat, die Haare raspelkurz geschnitten und weißblond gefärbt. Sie hatte ihn zuerst ignoriert, und als er sie mit einem extra lauten »Hallo« grüßte, etwas Undeutliches wie »selber Hallo« gemurmelt.
Er seufzte und fühlte sich in seiner Weltbetrachtung der Jugend von heute, die so gar keinen Anstand mehr kannte, bestätigt. Und darin, dass die deutsche Sprache dabei war, unterzugehen. Allein dieser falsch gesetzte Apostroph. Uschi’sCut and go. Ja, was denn sonst? Uschi würde Augen machen, wenn die Kunden und Kundinnen bleiben würden. Früher hatte Carmen den Salon betrieben. Friseursalon Carmen. Das waren noch Zeiten.
Da es auf Mittag zuging, hatten die paar Läden, die es noch im Dorf gab, mittlerweile geschlossen. Punkt vierzehn Uhr konnte man wieder hinein. Lediglich der Halbe Hahn hatte durchgehend geöffnet. Hähnchengeschnetzeltes in Pilzrahmsoße mit Fritten oder Bandnudeln stand mit Kreide geschrieben auf einer alten Schultafel vor dem Lokal. Niklas hatte damals seinen Augen nicht getraut, als er feststellen musste, dass Gernot seiner altehrwürdigen Eckkneipe tatsächlich einen neuen Namen verpasst hatte. In seiner Jugend war es einfach der Halbe Hahn gewesen.
Als er zu Hartwigs Hochzeit nach Thöninghausen gereist war, hatte der Halbe Hahn sich bereits zum Mezzo Pollo gemausert. Gernot Kessler hatte es für an der Zeit gehalten zu modernisieren. Zumindest durch eine Namensänderung. Es gab zwar weder Pizza noch Gerichte, die einer italienischen Trattoria würdig gewesen wären, aber der Name sollte als ein Fanal zum Aufbruch in neue Zeiten verstanden werden. Doch die waren ausgeblieben.
Der Inhaber des Lokals war und blieb Gernot Kessler, im Winter war die Erbsensuppe mit Bockwurst immer noch der Renner, im Sommer alles, was zwei Beine und Federn hatte, und die Kneipe nannte niemand anders als Halber Hahn. So hatte es ihm seine Mutter noch im Februar belustigt erzählt, als sie ihn in Mannheim besucht und alle Neuigkeiten aus Thöninghausen zum Besten gegeben hatte.
Die Treffen mit Sigrid – seitdem er fünfzehn war, nannte Niklas seine Mutter beim Vornamen – waren von einem strengen Rhythmus geprägt: im Februar zu seinem Geburtstag, im Mai zu Sigrids Wiegenfest, im Juli, um gemeinsam eine Woche am Gardasee zu verbringen, im Herbst, um ihn zu einem dreitägigen Wanderurlaub in den Vogesen zu nötigen, schließlich im Dezember, um mit ihrem einzigen und besten Sohn das Weihnachtsfest zu verbringen und ihm kurz vor ihrer Abreise nach Thöninghausen wie immer ans Herz zu legen, doch endlich im nächsten Jahr Ausschau nach einer Frau zu halten, sie sei ja wohl nicht mehr ewig für ihn da.
Und nun war sie tatsächlich nicht mehr da. Eine Frau hatte Niklas allerdings noch nicht gefunden. Es hatte ihm nie an Gelegenheiten gemangelt. Aber er war wählerisch, seine Mutter hatte es immer »schnäkig« genannt.
Vor der Kirche blieb er stehen und betrachtete die Bekanntmachungen in dem Glaskasten, der links von der breiten hölzernen Eingangstür an der buckeligen Wand angebracht war. Viel stand da nicht. Zeiten, wann die Gottesdienste stattfanden, ein Hinweis auf einen Buchbasar in zwei Wochen und auf einem schwarz umrahmten Zettel die Ankündigung der Beisetzung Sigrid Febronia Westphals, geborene Almering. Rosenkranz am Tag vor der Beerdigung.
Niklas starrte weiter in den Kasten, sah sein eigenes verschwitztes Gesicht. Er schob seine Sonnenbrille auf den Kopf, rieb sich über die Augen, bis der Schweiß in ihnen brannte. Dann setzte er die Brille wieder auf und trat ein paar Schritte zurück. Die Kirche, ein für die Größe des Ortes erstaunlich mächtiger spätgotischer Bau mit einem Turm, dessen Schieferhelm in der Sonne schimmerte, bewachte den Dorfplatz. Schon bei Hartwigs Hochzeit hatte Niklas festgestellt, wie sich in dem alten Gotteshaus die wenigen Kirchgänger Thöninghausens mittlerweile verloren.
»Niklas, mein Junge. Wie schön, dass du endlich da bist. Mein herzliches Beileid. Wie geht es dir? Deine selige Frau Mutter hat uns alle überrascht. Gestern sah sie noch aus wie das blühende Leben und jetzt … Sie hat sich schon so auf den Gardasee gefreut.«
»Hallo, Pfarrer Berg.« Niklas schüttelte dem alten Priester, der ihn schon getauft hatte, die Hand, die sich wie ein welkes Blatt anfühlte. »Ja, ihr Tod kam für mich völlig überraschend. Sie hat vielleicht mal über Herzrasen geklagt. Aber Sie kannten ja meine Mutter. Hat nie groß Aufhebens um sich gemacht. Ich weiß noch nicht mal, ob sie deswegen überhaupt zum Arzt gegangen ist. Im Mai war ich mit ihr über ihren Geburtstag in Straßburg, da ging es ihr bestens.«
Es hörte sich in seinen Ohren wie eine Entschuldigung an. Hätte er sich mehr kümmern müssen? Öfter nachfragen, wie es ihr ging?
»Sie war beim Arzt. Dr. Wiesner hat es mir gesagt. Pumperlgesund war sie da noch, sagte Wiesner. Das war im Februar. Im Frühling wusste sie dann, dass sie unheilbar krank war. Und dass es schnell gehen würde. Sie hat es dir also nicht erzählt?« Ein leichter Vorwurf schwang in Bergs Stimme mit. Weil seine Mutter nichts gesagt hatte, oder weil er über ihren Gesundheitszustand nicht auf dem Laufenden gewesen war? »Du hättest dich ruhig öfter hier blicken lassen können.« Nun war der Vorwurf unüberhörbar.
Niklas zuckte hilflos mit den Schultern. »Das war Sigrids Entscheidung. Ich habe erst im Krankenhaus erfahren, dass es Bauchspeicheldrüsenkrebs war. Sie hat es genossen, ein wenig zu reisen, und wenn es nur bis nach Mannheim war.«
»Entschuldige, mein Junge. Du hast natürlich recht. Sie hat immer von den Besuchen bei dir erzählt und davon geschwärmt, was du alles mit ihr unternommen hast und wie schön du wohnst. Wobei, dein Elternhaus ist ja auch sehr ansehnlich. Eines der prächtigsten Häuser von Thöninghausen. Weißt du schon, was du damit machst? Wirst du es verkaufen?«
»Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Plan. Nach der Beerdigung werde ich wohl den Haushalt auflösen, dann sehe ich weiter.«
Die Sonne stand mittlerweile im Zenit und brannte gnadenlos auf sie herab. Niklas setzte seine Sonnenbrille, die er, höflich, wie er war, während des Gesprächs mit Pfarrer Berg abgenommen hatte, wieder auf. Berg zog ein kariertes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und faltete es zur Größe einer kleinen Tischdecke auseinander. Niklas hatte ein Déjà-vu. Sein Vater hatte diese gestärkten und gebügelten Taschentücher immer dabeigehabt. Nur selten putzte er sich damit die Nase, aber wenn es sehr heiß war, zwirbelte er die vier Ecken zusammen und legte es sich auf den Kopf. Als Kind hatte er das immer witzig gefunden.
Der Priester wischte sich mit dem Minitischtuch über die Glatze. »Ich muss aufpassen. Im letzten Jahr bin ich wegen Hautkrebs behandelt worden. War nicht dramatisch, aber wehret den Anfängen. Doch genug geschwatzt. Du willst sicher deine Mutter sehen. Wenn du möchtest, begleite ich dich zu Lattwich. Er hat ja nicht mehr so viel zu tun. Gestorben wird zwar immer, aber hier in Thöninghausen nicht mehr so oft. Von den Alten ist kaum noch jemand da, die Generation deiner Mutter hält sich noch ganz gut, und die Jungen sind eben die Jungen, die sterben nicht so einfach. Gott sei Dank. Da gab’s hier mal ganz andere Zeiten, in denen Lattwich ganz schön viele Särge zimmern lassen musste.«
Eigentlich wäre Niklas lieber zum Haus seiner Mutter, zu seinem Haus, weitergegangen. Koffer abstellen, kalt duschen und sich einfach mal für eine Stunde oder so aufs Ohr legen. Doch er nahm das Angebot des Pfarrers dankend an. Wenn er ehrlich zu sich war, hatte es ihm schon die ganze Zeit im Magen gelegen, seine Mutter aufgebahrt zu sehen, auch wenn der Bestatter, wie Hartwig meinte, sie sehr schön zurechtgemacht hatte. Und bei diesem schweren Gang Pfarrer Berg an seiner Seite zu haben, erleichterte Niklas den Weg zu Lattwich ungemein.
»Pfarrer Berg, wie heißt Lattwich eigentlich mit Vornamen? Solange ich denken kann, nennen ihn alle nur bei seinem Nachnamen. Sogar seine Frau und Eva.«
Pfarrer Berg schmunzelte. »Ich glaube, jeder hier kennt ihn nur unter diesem Namen. Verrate aber niemandem, dass ich es dir gesagt habe. Er heißt Adolf. Vor Jahrzehnten hat er wohl versucht, seinen Vornamen offiziell abändern zu lassen. Erwin Lattwich, wie sein Großvater, aber ob das je genehmigt worden ist, weiß ich gar nicht. Na, jedenfalls, wenn er sich mal mit seinem Vornamen meldet, nennt er sich Erwin. Sei’s drum.«
Vom Kirchplatz zum Bestatter waren es nur wenige Gehminuten. Letzte Ruhe, so der Name, den schon Lattwichs Vater dem Geschäft gegeben hatte, prangte in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund auf dem Schild über dem Eingang, darüber irgendwelche Ranken. In der Schaufensterauslage ein geöffneter Sarg aus hellem Holz mit hellblauem glänzendem Innenfutter, wohl ein extra zu Ausstellungszwecken gefertigtes Modell, da es Niklas ziemlich klein vorkam. Daneben drei unterschiedlich große Urnen, davor war etwas drapiert, das er für ein Totenhemd hielt, mit Perlmuttknöpfen und überall dazwischen jede Menge künstlicher Blumen.
Berg drückte die Klinke herunter, doch die Tür war geschlossen. Er klingelte.
»Hat Eva nicht hier mitgearbeitet? Sie sei jetzt bei Gernot, habe ich gehört.«
Der Pfarrer nickte. »Ja, macht sie immer noch. Die Buchhaltung. Das andere erledigt ihr Vater alleine, Helene packt auch noch mit an. Eva hat den Job im Halben Hahn angenommen wegen der Schulden beim Hausumbau. Und so viel kann ihr Vater ihr auch nicht zahlen.«
»Ich weiß, sie haben das Haus von Else umgebaut.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, ein Glöckchen bimmelte, und Lattwich, der nicht Adolf genannt werden wollte, ließ die beiden eintreten.
Der Bestatter hatte sich überhaupt nicht verändert, fand Niklas, als er dem großen hageren Mann die Hand schüttelte.
»Gut, dass du da bist«, brummte Lattwich, nachdem er gebührend sein Beileid ausgedrückt hatte. »Die vierundsiebzig Jahre sah man deiner Mutter ja nicht an, jetzt wirkt sie noch jünger.« Stolz schwang in seiner Stimme mit, und Niklas fragte sich, was Lattwich wohl mit Sigrid angestellt hatte. »Wenn du sie gesehen hast, mach ich den Deckel drauf. Sie steht zwar schön kühl, aber trotzdem.«
Was meinte er mit trotzdem? Veränderte sich der tote Körper in den drei Tagen so sehr, dass es besser war, den Deckel draufzumachen, wie der Bestatter meinte? Niklas hatte sich mit der Frage, wie schnell sich ein gekühlter Körper zersetzte, noch nie intensiv beschäftigt.
Mit etwas wackeligen Beinen und einem aufmunternden »Na denn« von Pfarrer Berg begleitete er Lattwich in den Kühlraum, in dem es gar nicht so kalt war. Je drei Kerzen auf riesigen Leuchtern brannten links und rechts des Sarges.
»Habe ich extra für dich angezündet. Elisabeth hat gesagt, du wärst im Anmarsch. Kann die Kerzen ja nicht unbeaufsichtigt lassen«, sagte Lattwich, als er Niklas’ Blick bemerkte. Der nickte und schritt langsam auf den Sarg zu. Seine Arme hingen schlaff an seinem Oberkörper herunter, während Berg seine Hände gefaltet hatte und ein Gebet murmelte.
Der Anblick seiner toten Mutter war nicht so schlimm, wie Niklas befürchtet hatte. Er atmete hörbar auf, verschränkte nun ebenfalls die Finger. Sie schien kleiner als noch im Mai. Helene Lattwich, so vermutete Niklas, hatte Sigrid ein dunkelgrünes Kostüm von Coco Chanel, ihr Lieblingskleidungsstück, angezogen, an den Füßen trug sie flache braune Pumps. Die Haare wirkten wie frisch onduliert, lagen in einer leichten Welle auf ihrem Kopf. Die Augen waren, Gott sei Dank, geschlossen. Die Wangen schienen rosig, der Mund war dezent geschminkt, und die Falten im Gesicht waren fast gänzlich verschwunden. Die am Hals konnte Niklas nicht beurteilen, ein Seidentüchlein verbarg sie geschickt.
»Sie sieht aus, als sei sie noch nicht einmal sechzig.«
»Mhm, vielen Dank, Lattwich. Das habt ihr sehr schön gemacht«, flüsterte Niklas wie zur Bestätigung.
»Danke. Wir haben für das Gesicht ein ganz neuartiges Gel benutzt. Es glättet die Haut, als hätte man Botox reingespritzt. Und dann alles mit einer Wachsschicht überzogen«, flüsterte Lattwich zurück.
Niklas wurde plötzlich übel. Eigentlich hatte sich Sigrid ihrer Falten nie geschämt. Sie sind die Zeichnungen meines Lebens. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war zornig und manchmal am Ende meiner Kräfte. Das alles kannst du hier ablesen. Sie hatte ihr Gesicht gezeigt und mit dem Zeigefinger auf die feinen Linien getupft. Jetzt hatte sie keine Vergangenheit mehr. Weggegelt, weggewachst.
»Ich glaube, wir lassen dich jetzt mit Sigrid alleine, mein Junge. Komm, Lattwich. Ich warte draußen auf dich, Niklas, falls du noch reden oder mit mir wegen der Beisetzung sprechen möchtest.« Pfarrer Berg klopfte ihm auf die Schulter, fasste den Bestatter am Arm und zog ihn aus dem Kühlraum.
Was sollte er nun tun? Seiner Mutter einen letzten Kuss geben? Er konnte sich nicht dazu überwinden. Ein Gebet sprechen? Niklas murmelte das Vaterunser vor sich hin. Dann sagte er schlicht: »Mama, ich werde dich vermissen«, beugte sich leicht über den Sarg und streichelte zärtlich die Hände seiner Mutter. »Nun bin ich also Vollwaise«, murmelte er. »Ein erwachsener Vollwaise. Grüß Papa von mir.«
Sein Vater war gestorben, als er zwölf gewesen war. Nur ein paar Tage nach seinem einundfünfzigsten Geburtstag. Plötzlich und unerwartet, wie es so hieß. Niklas konnte sich noch an die ausgelassene Geburtstagsfeier erinnern. Der letzte glückliche Moment der Familie Westphal zu dritt. Die ältere Schwester seiner Mutter, Röschen, war noch in Thöninghausen und blieb für die nächsten beiden Wochen, um Sigrid und ihn zu versorgen. Seine Mutter hatte kaum noch Kraft gehabt, aus dem Bett aufzustehen. Sie hatte eines der vielen Gästezimmer der Villa bezogen, unfähig, die Leere neben sich im Ehebett zu ertragen, hatte Tante Röschen ihm erklärt. Röschen war nun auch schon seit sieben Jahren nicht mehr da. Krebs. Genau wie seine Mutter. Heimtückischer Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wenn man ihn diagnostizierte, war es meist zu spät. Seine Mutter hatte ihre Erkrankung für sich behalten. Typisch. Nie wollte sie ihn mit irgendetwas belasten.
Die Apotheke in Trutstadt, die sie mit Edwin, seinem Vater, betrieben hatte, war bereits vor fünfzehn Jahren, nach drei Generationen in der Familie, in die Hände eines Nachfolgers gegeben worden. Seitdem war Sigrid gereist, hatte ihn besucht und das Leben genossen. Das war auch mit der Grund, weswegen er so selten in Thöninghausen weilte. Wenn es einmal bei ihm gepasst hätte, war Sigrid im Nordmeer unterwegs oder badete in der Karibik.
Niklas seufzte tief und verließ den Raum. Im Büro erwartete ihn Lattwich.
»Alles in Ordnung?«
Niklas nickte. »Ja, aber es kommt mir alles so unwirklich vor.«
»Warst du schon zu Hause?«
»Nein, ich bin direkt mit Pfarrer Berg hierher. Ich werde nach der Beisetzung noch ein paar Tage bleiben. Du kannst mir die Rechnung vorbeibringen, oder ich hol sie bei dir ab und zahle dann umgehend.«
Niklas registrierte, dass das Büro schon bessere Zeiten gesehen hatte. Der Aufbahrungsraum war untadelig, aber hier wie auch im Schaufenster war irgendwie die Zeit stehen geblieben.
»Danke, das ist nett von dir. Es ist alles nicht mehr so einfach. Man hört allenthalben in unserem Metier: Gestorben wird immer. Das stimmt schon, aber da hat Thöninghausen seine besten Zeiten hinter sich. Wir haben gerade noch knapp tausend Einwohner. Viele der Alten sind weggestorben, entschuldige bitte, so hab ich das jetzt nicht gemeint.« Lattwich wurde rot, aber Niklas zuckte nur mit den Achseln. »Tja, und die nächste Generation ist noch nicht so weit. Wer stirbt schon mit vierzig, fünfzig oder sechzig?«
»Edwin, mein Vater. Er war knapp über fünfzig.«
»Stimmt. Aber das waren andere Zeiten. Da sind die Leute noch eher in dem Alter gestorben. Heute rennt jeder zur Vorsorge. Ein schwaches Herz, eine Prostatageschichte, Arterienverkalkung, das meiste wird, Gott sei Dank, rechtzeitig entdeckt, und man hat noch ein paar schöne Jährchen. Vor zwanzig, dreißig Jahren war das nicht so. Im Leben nicht wären die Männer auf die Idee gekommen, zum Arzt zu gehen, mich zwickt es hier, mich zwackt es da. Und bums, war es vorbei. Wie bei Edwin. Er war übrigens einer meiner ersten Toten, die ich selbstständig versorgen durfte. Mein Vater hatte ihn mir alleine anvertraut. Da war er schon sehr eigen, hat mir lange nichts zugetraut. Aber da hat er gestaunt. In dem Jahr hatte ich auch den Unfall von Jörn Hartmann. Zerquetscht in der Papierwalze in der Fabrik in Rodenstein. Der war mein Meisterstück.«
Bevor Lattwich noch ins Schwärmen geraten konnte und Details zum Besten gab, die Niklas gar nicht hören wollte, verabschiedete er sich eilig und verließ die Letzte Ruhe.
Draußen wartete Pfarrer Berg samt Rollkoffer auf einer Bank unter der Linde am Dorfbrunnen, aus dessen eisernem Ausguss das Wasser in das rechteckige Bassin plätscherte.
Kapitel 5
Pfarrer Berg hatte Niklas noch bis nach Hause begleitet und ihm unterwegs den Ablauf der Beisetzungszeremonie erläutert. Am Abend davor würde der Rosenkranz um halb sechs gebetet. Von der Kirche gehe es in einem gemeinsamen Trauerzug zum Friedhof am Ortsrand von Thöninghausen. Hier würden die Sargträger mit Siegrids sterblichen Überresten warten. Bereits am Vormittag würde Lattwich den Sarg in die Aussegnungshalle bringen lassen, dort könnten auch Kränze und Blumen abgelegt werden. Ob er, Niklas, sich bereits um einen Kranz gekümmert habe? Im Dorf gäbe es ja keinen Blumenladen mehr, seitdem Marlies gestorben war.
Niklas hatte sich natürlich um Blumenschmuck gekümmert. Er hatte bis vor Kurzem gar nicht gewusst, dass Marlies und ihr Laden nicht mehr existierten. Vor allem hatte es ihn gewundert, es nicht von seiner Mutter erfahren zu haben. Als er unter der Nummer von Marlies’ Blumenladen versucht hatte, die Floristin zu erreichen, gab es keinen Anschluss mehr. Henriette Sievers, Sigrids Zugehfrau, hatte es ihm dann gesagt. Daraufhin, wie wahrscheinlich alle im Ort, hatte er den Kranz aus weißen Lilien und gelben Rosen im Bouquet du Fleur in Rodenstein geordert, einem Laden, dessen Inhaber, ein begnadeter Florist, angeblich sogar die Sträuße für den Ministerpräsidenten band, die dieser an die Gattinnen seiner Gäste weiterreichte.
Berg und er verabschiedeten sich vor dem hohen schmiedeeisernen Tor. Die Villa stand zusammen mit zwei anderen imposanten Häusern am einzigen Hügel von Thöninghausen, dem Sickerberg, von dem man eine schöne Aussicht über den Ort und das Tal hatte. Bevorzugte Wohnlage würde wahrscheinlich ein Makler diese Ecke nennen. Tatsächlich hatten die drei ursprünglichen Besitzer der herrschaftlichen Villen zu den betuchten Einwohnern von Thöninghausen gehört.
Familie Westphal mit der Apotheke, Frau Schumacher, die mit ihren Katzen auf der einen Seite in dem viel zu großen Haus wohnte, war die Witwe des Bauunternehmers, dessen Vater die Gebäude errichtet hatte. Auf der anderen Seite lebte, wie ihm seine Mutter im letzten Sommer berichtet hatte, neuerdings ein IT-Berater mit seiner Frau und vier Kindern. Sie waren aus München hergezogen, da die Frau Chefärztin der Gynäkologie im Heiligen Marien-Stift in Rodenstein geworden und es ihrem Mann egal war, wo man lebte, da er von überall arbeiten konnte.
»Nette Kinder, vielleicht ein wenig laut, aber anständig und höflich. Ich war schon zweimal zum Kaffee nebenan«, hatte Sigrid kundgetan.
Er hatte sich gefreut, dass Sigrid so nette Nachbarn bekommen hatte. Vielleicht konnten die sogar ein Auge auf seine Mutter haben, schließlich kam sie in die Jahre, hatte er noch gedacht. Und jetzt … Bestimmt würde er die Leute kennenlernen. Er würde sie auch zum anschließenden Leichenschmaus, den Pfarrer Berg im Gemeindehaus neben dem Pfarrhaus organisiert hatte, einladen. Niklas war gespannt, was es für Menschen waren. Die alte Frau Schumacher kam sicherlich auch mit. Sie und seine Mutter hatten allerdings, trotz der Jahrzehnte der Nachbarschaft, in den letzten Jahren kein inniges Verhältnis zueinander gehabt. Schuld waren die Katzen, die sich sämtliche Fische aus Sigrids geliebtem Teich geholt hatten.
Das Tor quietschte in den Angeln, als Niklas es aufschob. Die Villa war ein hässlicher Kasten aus den Zwanzigerjahren. Ein wenig Gotik, ein wenig Renaissance, auf jeden Fall ein ziemlich misslungener Mischmasch. Je ein Türmchen an den Ecken, ragte das Haus trutzig auf einem Sockel aus großen Quadersteinen empor. Eine Freitreppe führte zur Haustür, die überdimensioniert wirkte und eher zu einem Schloss gepasst hätte. Sie war aus massivem Holz, in das Ranken und Blumen geschnitzt waren. Sigrids Vater hatte das Haus nach dem Ersten Weltkrieg errichten lassen, quasi keine Sekunde zu früh, denn kurz darauf hätte die Hyperinflation sein Geld pulverisiert. Bertram Almering hatte die Apotheke bereits von seinem Vater übernommen, der als Großherzoglicher Apotheker zu Ehre und Geld gekommen war. Warum er sich dann gerade in Thöninghausen niedergelassen hatte, wusste niemand so recht.
Im Haus roch es nach gar nichts. Niklas wusste nicht, was er erwartet hatte. Dass es abgestanden oder muffig riechen würde? Oder sogar nach Tod? Er schüttelte sich. Er musste unbedingt Henriette, die Zugehfrau, anrufen. Wenn er wieder in Mannheim war, musste sich Henriette weiter um alles kümmern, bis er wusste, was mit dem Haus zu geschehen hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, selbst wieder hier einzuziehen, aber fremde Leute? Nein, das konnte er sich auch nicht vorstellen. Noch nicht.
Die Haushälterin musste wohl erst kürzlich da gewesen sein. Nirgendwo lag Staub auf den dunklen Möbeln, die blau-weißen schachbrettartig verlegten Fliesen im Eingangsbereich wirkten wie frisch gewienert. Er ließ seinen Rollkoffer stehen, ging in die Küche und ließ Leitungswasser in ein Glas laufen. Gierig leerte er es in einem Zug. Dann öffnete er den Kühlschrank. Bier war kalt gestellt, ein eingeschweißter Ring Fleischwurst lag da, Tomaten in einer Tüte, ein Päckchen Butter, sechs frische Eier. Damit kam er am ersten Tag über die Runden. Aber war nicht die Rede davon gewesen, Eva würde was zu essen vorbeibringen? Am liebsten wäre es ihm allerdings, man ließe ihn in Ruhe. Auch wenn es nett gemeint war.
Das Wohnzimmer besaß immer noch den Charme, oder besser gesagt den Stempel, den sein Großvater ihm aufgedrückt hatte. Schwere Möbel, Ledersofa, Ledersessel, ein riesiger offener Kamin, in dem man sogar ein mittelgroßes Schwein hätte braten können. Im Anschluss lag hinter einer von innen gepolsterten Tür das Herrenzimmer in der gleichen etwas martialischen Art. Es war abgeschlossen. Doch Niklas wusste, dass seit dem Tod seines Vaters darin nichts verändert worden war. In der Ecke stand diagonal ein Schreibtisch, darauf ein großer Aschenbecher aus Kristallglas, ein Humidor, eine Zigarrenschere. Sein Vater war leidenschaftlicher Zigarrenraucher gewesen. Seine Mutter hatte nichts entsorgt, was seinem Vater gehört hatte.
Das eheliche Schlafzimmer war ebenfalls abgeschlossen worden, die Kleider hingen immer noch im Schrank, vermutete Niklas. Aus der Bar, die in einem riesigen Globus ihr Dasein fristete, war nie auch nur ein Schluck Cognac oder Whiskey entnommen worden. Zugemacht, abgesperrt, Finger weg. Sigrid hatte ihre eigene kleine Bar im sogenannten Boudoir, einem hellen freundlichen Raum. Darin, vor dem von cremefarbenen Samtgardinen umrahmten Fenster, ein mit Brokatstoff bezogenes Sofa mit rosafarbenen Kissen. Auf einem zierlichen Servierwagen standen eine Flasche Sherry, ein Orangenlikör und eine Flasche Calvados.
Niklas nahm eins der eleganten Gläschen aus Kristall und goss sich nacheinander drei üppige Portionen des goldenen Apfelschnapses aus der Normandie ein. Er brannte ein wenig in seiner Kehle, doch Niklas fühlte sich mit einem Mal etwas leichter. Im Herzen und in den Beinen.
Jetzt endlich schleppte er seinen Koffer über die geschwungene Treppe nach oben. Sein altes Kinder- und Jugendzimmer. Hier war ebenfalls nichts verändert worden. Sein Bett war allerdings abgezogen, aber die Wäsche mit den aufgedruckten Motorrädern und den Fußballclubemblemen lag noch immer säuberlich gefaltet im Schrank. Er hatte Sigrid immer wieder gebeten, doch nicht so an dem alten Kram zu hängen, er selbst hätte sich doch längst davon verabschiedet. Von den vielen Matchboxautos, die in einem Karton lagen, von den Fußballschuhen, in denen er so manches Tor für den Turn- und Rasensportverein TURA Butzigheim gehalten hatte, von den Bravo