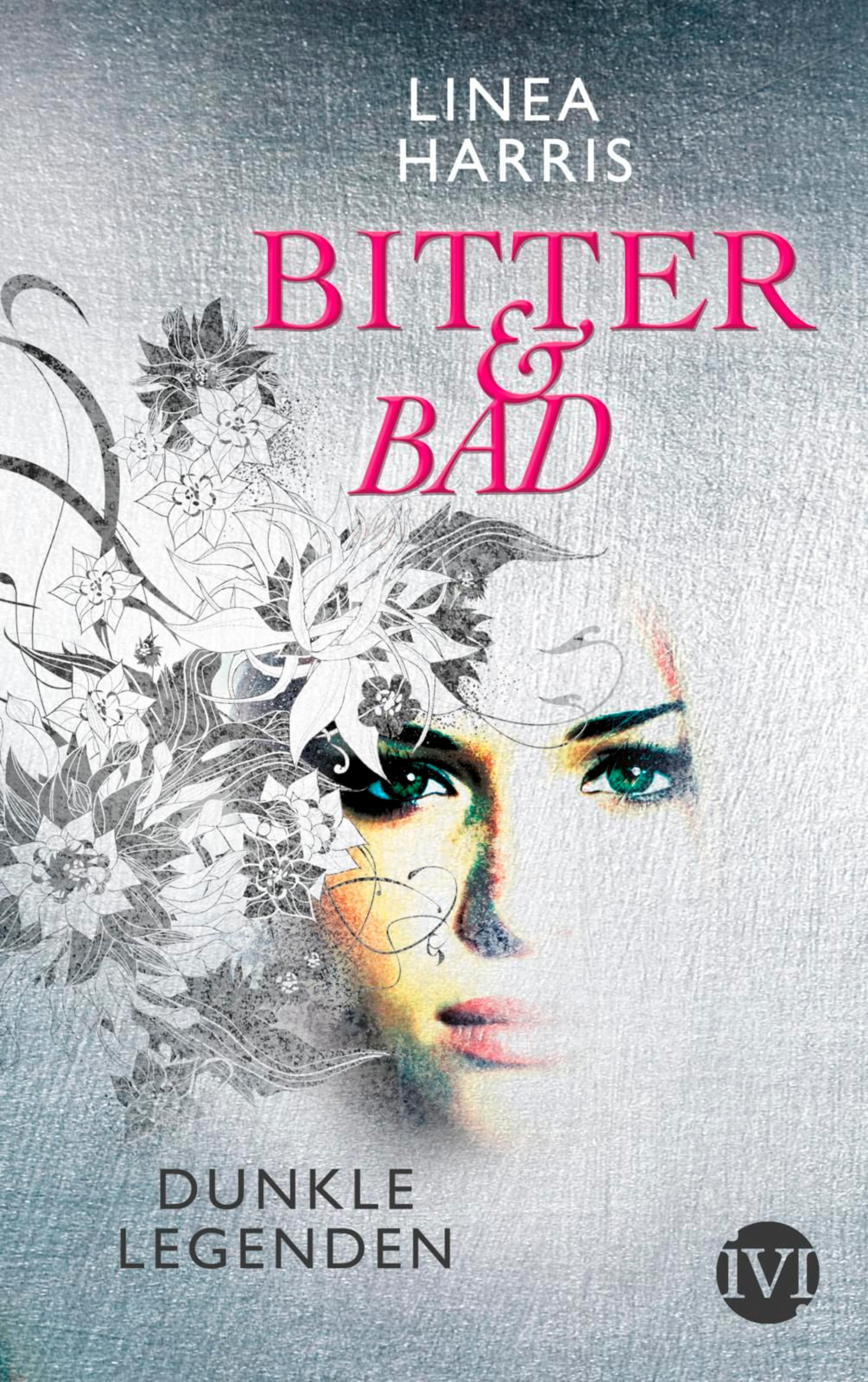
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jill arbeitet seit drei Jahren als Dämonenjägerin, doch in letzter Zeit laufen all ihre Aufträge schlecht. Sie hat ihre Magie nicht mehr unter Kontrolle und bei ihren Einsätzen ist es mehrmals zu Unfällen gekommen. Auch die Vampire und Werwölfe in ihrem Umfeld verhalten sich seltsam. Etwas scheint die Lebensenergie der übernatürlichen Wesen zu beeinflussen. Als Jill herausfindet, dass einige Vampire dem Wahnsinn verfallen sind und einen grausamen Mord begangen haben, macht sie sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei kommt sie einer vergessen geglaubten Legende auf die Spur und stößt auf einen Feind, der gefährlicher ist als alles, was Jill bisher gekannt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lesen was ich will!www.lesen-was-ich-will.de
ISBN 978-3-492-97829-3
© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Für meine Mutter – die das Unmögliche möglich macht
Prolog
Als Henry Cole in sein Büro kam, schwirrte ihm der Kopf. Erschöpft ließ er sich in seinen Drehsessel fallen und stützte die Stirn auf die Hände.
Was für ein Tag. Langsam spürte er das Alter in den Knochen, dabei war er nicht einmal fünfzig. Die Papiere unter seinem Ellenbogen raschelten, doch er würde die Berichte später einsehen. Für heute hatte er genug, was ihm Kopfzerbrechen bereitete.
Diese Konferenz, in der er eben gewesen war, war mehr als nur aufschlussreich gewesen. Tagelang hatte sein Team sich darauf vorbereitet, einen waschechten Dämon zu beschwören. Und das mitten in der Verborgenenorganisation in London. Vor ein paar Jahren noch wäre so etwas nicht denkbar gewesen. Die Verborgenenorganisation, kurz VO, war so etwas wie die zentrale Verwaltung aller Angelegenheiten übernatürlicher Wesen und nahm gleichzeitig eine Funktion ähnlich der Polizei der Normalsterblichen ein. Man kümmerte sich um kleinere und größere Verbrechen von Hexen, Werwölfen und Vampiren. Zudem schützte man die Menschen vor den gefährlichen Halbdämonen, den Mairas. Aber einen Dämon direkt ins Haus holen? Man hatte das Ritual bis ins kleinste Detail erforscht und durchgezogen, denn ein einziger Fehler konnte verheerende Auswirkungen haben. Die besten Männer hatte er um sich geschart, zusammen mit einigen Professoren in weißen Kitteln, die mit ihren Messinstrumenten nach Informationen gegiert hatten. Es war eine kleine Sensation gewesen, in die man nur eine ausgewählte Handvoll Leute eingeweiht hatte.
Und dann war der Dämon in dem Beschwörungskreis aufgetaucht, zugegeben anders, als Henry ihn sich vorgestellt hatte. Der Mann hatte einen Anzug getragen und war so kultiviert dahergekommen, dass Henry fast auf ihn hereingefallen wäre. Lackschuhe und Krawatte, also wirklich. Wen wollte er damit täuschen? So schnell würde Henry nicht vergessen, zu was diese Dämonen fähig waren.
Umso entsetzter war er darüber gewesen, wie seine Berater auf den Vorschlag des Dämons reagiert hatten – nämlich durchaus positiv.
Die Integration der Dämonen aus der Unterwelt in die Realität. Das war doch lächerlich! Doch er würde ihnen schon den Kopf waschen. Er war der Leiter der Verborgenenorganisation, sie unterstanden ihm alle. Eine Veränderung dieser Art kam nicht infrage. Die Dämonen sollten bleiben, wo der Pfeffer wächst. Hexen, Werwölfe und Vampire in Schach zu halten und zu gewährleisten, dass ihre Existenz vor den Normalsterblichen verborgen blieb, war kein leichtes Unterfangen. Es erforderte genug Energie, Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit – alles Dinge, die ihm in die Wiege gelegt worden waren und ihm seit zehn Jahren den Posten des VO-Leiters sicherten.
Allerdings konnte man die Vorteile, die der Dämon aufgezeigt hatte, nicht von der Hand weisen. Dämonen konnten mit Hexen Kinder bekommen. Bisher gab es nur einen einzigen ihm bekannten Fall eines Halbdämons – Jillian Benett. Den Dämonen den Weg in die Realität zu ebnen, würde auf Dauer dazu führen, dass sich die Blutlinien vermischten. Das wiederum würde eine Stärkung der Spezies bedeuten. Ein äußerst interessanter Punkt, wie er fand. Außerdem waren Dämonen, die unter seinem Kommando standen, eine sehr wirksame Waffe.
Der Dämon hatte ja nicht davon gesprochen, sofort eine Pforte zu öffnen, die es allen Dämonen möglich machte, aus der Unterwelt zu fliehen. Man hatte von vereinzelten Dämonen gesprochen, einer kleinen Auswahl an Männern und Frauen, die sich über die Jahre hinweg bewährt hatten und denen der Dämonenfürst Baal vertraute. Dämonen, die sich Henrys Befehlen beugen würden. Konnte das gut gehen?
Womit er wieder bei der Frage war, was er von Baal halten sollte. Henry erinnerte sich noch gut daran, was vor drei Jahren passiert war, als einer seiner Mitarbeiter dem falschen Dämon vertraut hatte. Baals Konkurrent Leviathan war mit einer Armee von Dämonen in die Realität gedrungen und hatte halb London in Schutt und Asche gelegt, bis die VO sie besiegte.
Doch hatte der Dämon Baal nicht dabei geholfen, London zu retten? Zudem war er Jillians Vater, sie vertraute ihm. Und hatte er selbst nicht Jillian Benett in seinen Diensten, die eine seiner vertrauensvollsten Mitarbeiterinnen war? Allerdings war sie nur ein Halbdämon und in der Realität aufgewachsen. Man konnte ihr Gemüt nicht mit dem eines richtigen Dämons vergleichen.
Wie er es auch drehte und wendete, es blieb ein zu großes Risiko, sich mit einem Dämon einzulassen, egal ob er behauptete, auf der guten Seite zu stehen. Dämonen waren gefährlich. Sie waren unberechenbar. Und sie waren skrupellos.
Kapitel 1
Der Eisregen fühlte sich an wie kleine Nadelstiche auf der Haut. Ich zog die Kapuze meines Mantels tiefer ins Gesicht und verschränkte die Arme, während ich an der Hausmauer gegenüber einer heruntergekommenen Bar lehnte und den Blick zu dem nachtschwarzen Himmel wandern ließ. Irgendwo unter dieser undurchdringlichen, grauen Wolkendecke musste der Mond aufgegangen sein.
Ich hasste den Vollmond. Er bedeutete nichts als Ärger. Vor nicht einmal zehn Minuten hatte mich mein Chef, Henry Cole, angerufen und zu diesem Auftrag geschickt. Seufzend ignorierte ich die Kälte, die in meine Knochen fuhr, und wartete schweigend. Außer dem entfernten Geräusch von Motoren und dem Prasseln der Regentropfen auf meiner Haut war nicht viel zu hören. Die Straße war abgelegen und nur eine Laterne spendete sanftes Licht. Zu viele Schatten. Es war keine gute Gegend, um sich nachts allein aufzuhalten. Doch ich wusste mich zu wehren und spürte nicht den geringsten Anflug von Nervosität.
Jeden Moment musste eine Gruppe Werwölfe um die Ecke kommen, die gerade erst die Kneipe hinter sich ließ, in der sie randaliert hatte. Ein Gast hatte gehört, in welche Bar sie als Nächstes ziehen wollte, und prompt hatte man mich dazu genötigt, sie dort festzunehmen. Vor genau dieser Bar stand ich nun, müde und frierend. Aus der heruntergekommenen Spilunke ertönte gedämpfte Musik, doch durch die verhangenen Fenster ließ sich nicht viel erkennen.
Je schneller die Werwölfe auftauchten, damit ich sie festnehmen konnte, umso besser war es. Ich wollte endlich nach Hause und meinen Feierabend genießen.
Wieder warf ich dem versteckten Vollmond einen grimmigen Blick zu. Es war jedes Mal dasselbe. Die runde Scheibe strahlte am Himmel und schon spielten alle verrückt. Werwölfe wurden aggressiv und unruhig, Vampire durstiger und Hexen mächtiger. Keine gute Grundlage, unsere Existenz weiterhin vor den Normalsterblichen zu verbergen.
Wir Übernatürlichen lebten wie normale Menschen, gingen anständiger Arbeit nach und integrierten uns in die Gesellschaft. Meistens jedenfalls. Wie auch bei den Normalsterblichen gab es unter den Verborgenen einige, die aus der Reihe tanzten und es schwer machten, unsere Existenz geheim zu halten. Für solche Fälle war die Verborgenenorganisation, die Polizei der Übernatürlichen, unter der Leitung von Henry Cole zuständig. Und hier kam ich ins Spiel, denn seit drei Jahren arbeitete ich für ihn, wenn auch normalerweise mit aufregenderen Aufträgen als diesem.
Dass ich ausgerechnet eine Dämonenjägerin geworden war, hatte einen nicht unerheblichen Hauch von Ironie. Eine Zeit lang hatte ich mich zu den Hexen gezählt. Mittlerweile wusste ich jedoch, dass ich gar keine Hexe war, sondern ein Halbdämon. Meine Mutter war eine Hexe gewesen, mein Vater einer der einflussreichsten Dämonenfürsten der Unterwelt.
Dämonen waren Gott sei Dank in der Unterwelt gefangen, mein dämonischer Vater eingeschlossen, auch wenn ich ihn tatsächlich ins Herz geschlossen hatte. Das hieß aber nicht, dass ich in meinem Job als Dämonenjägerin nichts zu tun hatte. Denn obwohl die Realität für die Bewohner der Unterwelt verschlossen war, hatten sie einen Weg gefunden, uns das Leben schwer zu machen.
Umso mehr ärgerte es mich, dass man mich mal wieder zu einem dieser ungeliebten Aufträge gerufen hatte. Ich hätte irgendwo dort draußen in den Wäldern sein müssen, um Mairas zu jagen. Sie waren todbringende, Albtraum verursachende Kreaturen, die sich von Blut und Angst ernährten. Die Jagd auf Mairas war eine ehrenvolle und gefährliche Sache, der ich mein Leben verschrieben hatte. Doch stattdessen wurde ich in Londons Straßen vom Eisregen durchnässt und musste ein paar halbstarke Werwölfe festnehmen, die einen über den Durst getrunken hatten. Was für ein Sprung in meiner Karriere.
Ein Kälteschauer durchzog meinen Körper und ich verlagerte das Gewicht. Wenn ich noch länger hier stehen musste, würde ich festfrieren. Um mir die Zeit zu vertreiben, bereitete ich mich auf die Festnahme vor. Ich würde Magie verwenden müssen, darauf lief es meistens hinaus. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf mein Inneres.
Wie üblich spürte ich das Pulsieren der Magie in meiner Brust. Alle Lebewesen besaßen eine Prana, die Lebensenergie. Bei Normalsterblichen war sie kaum vorhanden, bei Vampiren dagegen bewirkte sie Stärke und Schnelligkeit sowie einen kaum zu bändigenden Blutdurst. Bei den Mondkindern, den Werwölfen, verursachte die erhöhte Menge an Prana, dass sie nicht nur schnell und wendig waren, sondern auch einige tierische Eigenschaften annahmen. Die Hexen waren die Einzigen, die ihre Prana in Form von Magie nutzen konnten. Und ich als Dämon natürlich auch.
Vor meinem inneren Auge sah ich das Geflecht aus wild durcheinanderwirbelnden Energiesträngen, die mitternachtsblau aufleuchteten und wie flüssige Bindfäden in meinen Adern tobten. So durcheinander und gelöst störten sie mich nicht, waren aber auch zu nichts zu gebrauchen.
Mit einem kleinen Gedankenstoß brachte ich sie dazu, sich zu ordnen und zu einer einzigen, leuchtenden Kugel zusammenzufließen. Die damit geschaffene Energiequelle brannte warm in meiner Brust und erfüllte mich mit Macht.
Man konnte diesen Vorgang mit einfacher Elektrizität vergleichen. Wäre ich eine gewöhnliche Hexe gewesen, hätte ich diese Energiequelle wie eine Steckdose anzapfen können, um meine Gedanken zu verstärken. Als Hexe hatte man nur ein magisches Spezialgebiet. Manche Hexen konnten Dinge gefrieren lassen, andere einen Wind heraufbeschwören oder die Telekinese einsetzen. Wieder andere konnten das Feuer beherrschen, oder auch die Elektrizität. Als Halbdämon hatte ich den Vorteil, auf sämtliche Spezialgebiete zurückgreifen zu können. Außerdem brachte meine Herkunft mit sich, dass ich diese pure Energie direkt nutzen konnte, was in etwa dem Spiel mit Strom gleichkam. Nur dass es kein Strom war, der in mir pulsierte, sondern die viel mächtigere Magie.
Die Luft knisterte. Ich war bereit.
Aus der Kneipe drangen Stimmen, lauter als zuvor. Ich runzelte die Stirn und konzentrierte mich wieder auf meinen Auftrag. Die Mondkinder hätten schon längst hier sein müssen. Hatten sie sich am Ende für eine andere Bar entschieden, um ihrer Zerstörungswut freien Lauf zu lassen, oder . . .
»Verdammt«, fluchte ich leise, als ich schweres Poltern aus der Bar vernahm, gefolgt von zornigen Stimmen. Ich war zu spät gekommen, sie waren bereits hier. Statt sie festzunehmen, hatte ich hier draußen gewartet.
Schnell rannte ich über die Straße, während der Klang meiner Stiefel auf Kopfsteinpflaster laute Geräusche zwischen den Häusern widerhallen ließ. Meine kalten Muskeln protestierten, doch ich war gut trainiert und noch bevor ich die Bar erreicht hatte, erfüllte mich kribbelndes Adrenalin. Ich öffnete die Tür und hielt einen Moment inne, um die Situation zu erfassen.
Die Luft war stickig und es stank nach Bier und Rauch. Ich blinzelte einen Moment, um in dem gedämpften Licht etwas zu erkennen. Drinnen herrschte bereits das reinste Chaos. Einige Tische und Stühle waren umgeworfen, Scherben über den Boden verteilt und ich sah gerade noch, wie die Barfrau hinter den Tresen flüchtete. Einige junge Männer waren damit beschäftigt, sich die Köpfe einzuschlagen und lauthals zu beschimpfen. Es waren mehr, als ich angenommen hatte.
Der Geruch nach nassem Hund ließ mich das Gesicht verziehen und wieder einmal meinen Job verfluchen. Ich versuchte zu erfassen, wie viele der Gäste zu den Normalsterblichen gehörten. Glücklicherweise war die Kneipe bis auf die ungebetenen Besucher weitestgehend leer, nur ein Vampirpaar hielt sich am Rande und beobachtete die Szene stillschweigend. Ich erkannte sie an der bleichen Haut und den tiefschwarzen Augen.
Ich räusperte mich lautstark, doch bis auf die beiden Vampire schien mich niemand zu bemerken. Ein abgebrochenes Stuhlbein flog dicht an meinem Gesicht vorbei. Also schön, dann eben doch auf die harte Tour.
Ich schloss für einen winzig kleinen Moment die Augen und sammelte mich. In nur dem Bruchteil einer Sekunde war mein Körper erfüllt von der knisternden Prana. Leichte blaue Funken umspielten meine Finger und tropften zischend zu Boden. Es kostete mich nicht einmal einen Wimpernschlag, den Raum mit einem eisigen Wind zu füllen, der die Tischdecken von den Plätzen wehte. Augenblicklich kehrte Stille ein und die Raufbolde wandten sich zu mir um.
»Schön, das mit der Aufmerksamkeit wäre also geklärt«, sagte ich lächelnd und schickte einen unschuldigen Augenaufschlag in die Runde. Für einen Moment sah es so aus, als wollten sie meine Anwesenheit ignorieren und sich weiter ihrer sinnlosen Schlägerei hingeben, doch einer der Männer zögerte und kniff die goldgelben Augen zusammen.
»Dämon«, zischte er leise und ballte die Hände zu Fäusten. Die anderen horchten auf und starrten mich an. Ich behielt sie vorsichtig im Auge. Scheinbar war der Dunkelhaarige, der mich zuerst erkannt hatte, ihr Anführer, denn einige Männer warfen ihm immer wieder fragende Blicke zu. Er fletschte die Zähne und ich stöhnte innerlich auf. An seinem Hals sprießte bereits etwas Fell, die Verwandlung stand kurz bevor. So gerne ich auch eine Strafpredigt gehalten hätte, dass Werwölfe die Pflicht hatten, sich zum Vollmond aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, die Zeit drängte und ich musste sie hier wegschaffen, bevor sie doch noch ein Normalsterblicher zu Gesicht bekommen konnte.
Die Männer waren sichtlich hin- und hergerissen. Sie hatten mich erkannt, wussten, wer ich war. Ihr Instinkt sagte ihnen, dass sie es mit einem Gegner zu tun hatten, gegen den sie keine Chance hatten, und dieser Instinkt rang mit dem Drang, mir die Kehle aufzureißen. Wie gesagt, ich hasste den Vollmond.
»Du hast mich also erkannt«, sagte ich mit einem freundlichen Lächeln, das so gar nicht zu meinen schwebenden Haaren und der knisternden Prana an meinen Händen passte. Um die Lage zu verdeutlichen, schob ich meinen Mantel auseinander, damit die blitzende Marke der VO zum Vorschein kam, ebenso wie einige Schwerter und Dolche, die ich grundsätzlich zusammen mit meinem ledernen Kampfanzug trug. Die Blicke der Männer verdüsterten sich. Das Bad-Girl-Image war so gar nicht mein Stil, doch wenn es mich vor einem Kampf mit den Mondkindern bewahren konnte, zog ich es durch.
Um die Situation etwas zu entschärfen, stoppte ich den Pranafluss in meinem Inneren und die blauen Funken verschwanden.
»Warum schickt die VO gleich ihren einzigen Dämon, um ein paar Mondkinder festzunageln?«, knurrte der Anführer und seine goldenen Augen glühten auf.
Diese Frage stelle ich mir auch, schoss es mir durch den Kopf.
»Weil ich es kann«, gab ich knapp zurück. »Wenn ihr klug seid, folgt ihr mir, ohne noch mehr Aufsehen zu erregen, dann geht das ganze ohne Verletzungen vonstatten.«
Ich fing den Blick der Bardame auf, die mich mit aufgerissenem Mund anstarrte. Sie war eine Vampirin, doch scheinbar hatte sie keine Ahnung, wer ich war. Es musste seltsam für sie aussehen, wie ich mich zwölf ausgewachsenen und mit der Beherrschung kämpfenden Werwölfen entgegenstellte.
Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte ich eine Bewegung. Eines der Mondkinder spannte sich an, der Jüngste von ihnen mit der aufgeplatzten Lippe. Ich schnellte herum und ließ meine türkisen Augen gefährlich blau erstrahlen, ein nützlicher Trick, den mir mein Vater beigebracht hatte. Ich wusste, dass sie glühten.
Es zeigte die gewünschte Wirkung und der Junge wich knurrend zurück. Was war nur los mit ihnen? Selbst zu Vollmond konnte man Werwölfe zur Vernunft bringen, aber diese Gruppe schien geradezu von etwas angestachelt zu werden.
»Gehen wir«, sagte ich knapp in einem Ton, der keine Widerrede duldete. Je schneller wir hier weg und die Werwölfe über Nacht in eine Zelle kamen, umso besser war es. Danach waren sie nicht mehr mein Problem. Ich zückte mein Handy und drückte die Schnellwahltaste. Mit wenigen Worten hatte ich einige Wagen geordert, die uns abholen würden.
Ich trat einen Schritt zur Seite und bedeutete den Randalierern mit einem Kopfnicken, die Bar zu verlassen.
»Wenn auch nur einer von euch aus der Reihe tanzt, werde ich ihm bei lebendigem Leib das Blut gefrieren lassen«, zischte ich, als sie an mir vorbeischritten. Einer der Jungen erbleichte sichtlich. Ich vermied es, ihn aufzuklären, dass ich es im Grunde genommen gar nicht tun durfte, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Aber vielleicht reichte schon die Androhung.
Draußen atmete ich die eiskalte Luft ein, froh darüber, dem stickigen Raum entkommen zu sein.
»Dort entlang«, wies ich die Werwölfe an und deutete auf eine dunkle Nebenstraße. Obwohl die Bar abseits von bewohntem Gebiet lag und nur wenige Normalsterbliche den Weg hierherfanden, war es besser, so unbemerkt wie möglich zu bleiben.
»Keine Handschellen?«, spottete der Anführer, doch ich zuckte nur mit den Achseln.
Um genau zu sein, hätte ich ihnen welche anlegen müssen, aber zum einen hatte ich nicht mit mehr als fünf Mondkindern gerechnet und zum anderen war immer noch meine Magie der Teil, auf den ich mich am meisten verließ. Wenn sie fliehen wollten, würde ich sie einfach damit umhauen.
In der unbeleuchteten Straße wies ich sie an, sich an die Wand zu stellen. Sofort teilte sich die Gruppe nach rechts und links, wobei sie sich finster anstarrten. Ich hatte schon so etwas vermutet, doch ihr Verhalten bestätigte, dass es sich um Mitglieder zweier verschiedener Banden handelte.
»Du fühlst dich toll, was?«, keifte ein blonder Werwolf mit langer Narbe im Gesicht, scheinbar der Anführer der Gruppe links.
»Kann nicht klagen«, antwortete ich genervt. »Bisschen kalt vielleicht.«
»Hältst du dich für was Besseres, weil du anderen überlegen bist? Dämonenbrut!«
Ich wusste, dass er mich nur provozieren wollte. Dennoch trafen mich seine Worte. Wie gerne hätte ich ihm gesagt, dass ich sofort mit jeder normalen Hexe getauscht hätte? Wie oft war ich jetzt schon solchen Reaktionen ausgesetzt gewesen? Ich hatte aufgehört zu zählen.
Ich verschränkte die Arme und blickte finster zwischen den beiden Gruppen hin und her. Wo zum Henker blieben die Einsatzwagen?
Die Werwölfe wurden unruhig. Ihre Augen huschten durch die Schatten, um einen Ausweg zu suchen. Ein jüngerer Werwolf krümmte sich und zitterte. Ich versuchte, sein Stöhnen zu ignorieren, als die Verwandlung einsetzte. Die älteren waren beherrschter, sie zuckten nicht einmal mit der Wimper, als das Fell begann, aus ihrer Haut zu sprießen. Ich konnte die Anspannung in ihren Gesichtern erkennen. Obwohl ich die monatliche Verwandlung der Werwölfe nun schon oft miterlebt hatte, erfüllte mich noch immer Unbehagen dabei. Es hatte etwas Intimes, ihnen dabei zuzusehen.
Aus Höflichkeit blickte ich die Straße hinunter und ließ mir nichts anmerken. Als die menschlichen Laute immer mehr zu einem Knurren und Fletschen wurden, konnte ich mich schließlich nicht mehr davon abhalten, die Männer genauer im Auge zu behalten. Werwölfe mochten zwar berechenbar sein, aber nicht selten gingen ihre tierischen Instinkte mit ihnen durch, wenn der Vollmond am Himmel stand. Sie wurden wilder, animalischer. Die meisten Mondkinder zogen sich zu dieser Zeit zurück. Es war verboten, sich während dieser Phase auf öffentlichen Straßen aufzuhalten.
Ich blinzelte verdutzt und starrte die Männer an. Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück.
»Was zum Teufel . . .?«, brachte ich hervor, bevor ich mich wieder unter Kontrolle bekam. Die Verwandlung hatte nicht einmal fünf Minuten gedauert. Vor mir standen zwölf vollständig verwandelte Werwölfe in gebückter Haltung. Fell sprießte ihnen an Hals, Armen und Gesicht. Die Schnauzen waren lang gezogen und mit Reißzähnen besetzt, während die goldenen Augen in der Dunkelheit glühten. Aus den Händen waren messerscharfe Klauen geworden.
Ich fing mich schnell wieder und brachte meine Gefühle unter Kontrolle. Nach meinen Kenntnissen dauerte eine vollständige Verwandlung mindestens zwei Stunden, aber vielleicht hatte ich mich auch getäuscht. Das Letzte, was ich jetzt tun durfte, war, Nervosität zu zeigen. Ich zwang mich dazu, nicht ein weiteres Mal nach der Verstärkung der VO Ausschau zu halten. Noch standen die Männer an ihren Plätzen, mit dem Rücken zur Wand, doch ich konnte spüren, wie unruhig sie waren.
Aus reinem Selbstschutz ließ ich wieder meine mitternachtsblaue Prana über die Haut meiner Hände wandern, um die Männer daran zu erinnern, mit wem sie es zu tun hatten.
In der Ferne ertönte eine Polizeisirene und ich atmete kaum merklich auf. Wurde ja auch Zeit. Doch noch bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte, beanspruchte ein Fauchen meine volle Aufmerksamkeit. Ich schluckte, weil ich bereits wusste, was mich erwartete.
»Macht keine Dummheiten«, sagte ich mit ruhiger und fester Stimme, während ich die Hände beruhigend hob. Die Männer schienen meine Worte kaum zu vernehmen.
Plötzlich bildeten sie einen Halbkreis um mich. Sie schlichen in geduckter Haltung und mit blitzenden Augen um mich herum. Bedrohliches Knurren entfuhr ihren Kehlen. Der Zwist zwischen den beiden Gruppen schien vergessen zu sein und man hatte sich auf mich als Feindin geeinigt.
Unwillkürlich wurde ich zurückgedrängt, mit dem Rücken an eine kalte, feuchte Steinmauer.
»Was ist nur los mit euch?«, bellte ich und wurde von einer Welle der Wut überschwemmt. Legten sie es tatsächlich darauf an?
Ich hatte keine Angst, denn ich wusste, dass ich es locker mit ihnen aufnehmen konnte, ohne mich auch nur im Geringsten zu verausgaben. Doch ich hasste es, immer wieder den Dämon heraushängen lassen zu müssen, um ernst genommen zu werden. Dennoch bereitete ich mich gedanklich darauf vor, meine innere Energie zu einer Kugel zu formen und diese notfalls auf die Werwölfe abzuschießen. Ich konnte die Unruhestifter innerhalb von Sekunden für mindestens eine Stunde außer Gefecht setzen. Um es zu verdeutlichen, ließ ich den blauen Pranaball durch meine Venen bis in meine Hand gleiten, wo er lautlos und hell leuchtend vor mir schwebte, bereit, abgefeuert zu werden. Die blau knisternde Energie spiegelte sich in den glühenden Augen der Werwölfe, doch anstatt zurückzuweichen, wie ich es erwartet hatte, wurden sie nur noch mehr angestachelt. Wieder wurde ich angefaucht. Ich runzelte die Stirn. Hatten diese Männer keinen Instinkt, der sie vor Gefahren schützte? Das Ganze kam mir eigenartig vor.
»Kommt schon, ihr werdet allerhöchstens eine Nacht in der Zelle verbringen und vielleicht mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Das ist es doch nicht wert, von mir gegrillt zu werden!«
Ich versuchte, an den menschlichen Teil in ihnen zu appellieren. Doch sie schienen meine Stimme kaum noch wahrzunehmen. In ihren Augen glänzte Mordlust. Als der Erste auf mich zusprang, reagierte ich blitzschnell und drehte mich um die eigene Achse, damit ich ihm meinen Fuß in den Magen rammen konnte. Noch bevor die anderen seinem Beispiel folgen konnten, schoss ich den Energieball in meiner Hand ab. Er setzte vier von ihnen außer Gefecht. Sie sanken bewusstlos zu Boden, überzogen von blauer Prana.
Zwei weitere Energiebälle genügten, um auch den Rest von ihnen schachmatt zu setzen. Ich atmete schwer und strich mir über die Augen. Es war ja nicht so, als hätte ich sie nicht gewarnt. Ich überlegte, ob ich sie aus dem Schneematsch der Straße herausziehen und an eine trockenere Stelle legen sollte, entschied mich aber dagegen. Sie hatten ihre Bewusstlosigkeit selbst provoziert.
Die Sirenen waren bereits näher gekommen. Ich legte den Kopf in den Nacken und schaute zu den Häusern herauf. Henry würde mich umbringen, wenn schon wieder ein Normalsterblicher meine Energiebälle gesehen hatte.
Glücklicherweise war die Seitenstraße verlassen, die wenigen Fenster blieben dunkel. Was für ein trostloser Ort. Der Schneeregen wandelte sich zu dicken Flocken, die sich kühl auf meinem Gesicht niederließen.
Doch gerade, als ich mich entspannen wollte, weil der Feierabend immer näher rückte, stellten sich meine Nackenhärchen auf. Das Gefühl von Gefahr ließ mich alle Muskeln anspannen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Ich sah zu den Werwölfen, doch sie lagen noch immer am Boden und rührten sich nicht. Trotzdem kam ich mir beobachtet vor. Die Sirenen waren verstummt und Stille hüllte mich ein. Ich schärfte meine Sinne, doch das war gar nicht nötig.
Ich hörte ein dunkles Grollen und wirbelte herum. Aus den Schatten einer weiteren Gasse ertönte leises Scharren, dann ein Bellen, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich kannte diesen Laut, doch er gehörte nicht in diese Welt. Die Schatten bewegten sich. Blau glühende Augen leuchteten im Schwarz der Nacht und fixierten mich. Erst ein Paar, dann zwei weitere.
Ich stolperte zurück und fiel beinahe über einen bewusstlosen Werwolf. Es war einfach unmöglich. Diese Wesen hatten überhaupt keine Möglichkeit, in unsere Welt zu gelangen, sie hätten ebenso wie die Dämonen in der Unterwelt eingesperrt sein sollen. Trotzdem stand ich hier mitten in London drei Höllenhunden gegenüber. Und die waren weitaus gefährlicher als ein Rudel Werwölfe.
Kapitel 2
Wie konnten sie hierhergelangen?, war der erste klare Gedanke, den ich fassen konnte, bevor ich nach Fluchtmöglichkeiten Ausschau hielt. Es war eine Sache, es mit zwölf Werwölfen zu tun zu haben. Eine Sache, der ich mich nach jahrelangem Training gewachsen fühlte. Drei Höllenhunde, Zerberusse, waren jedoch etwas ganz anderes und es stand definitiv nicht auf meinem Tagesplan, von ihnen zerfleischt zu werden.
Ich konnte in die Straße mit der Bar flüchten und war drauf und dran, die Beine in die Hand zu nehmen, als mir die bewusstlosen Werwölfe in den Sinn kamen. Ich konnte sie unmöglich hier liegen und dem Schicksal seinen Lauf lassen. Sie würden den Dämonenhunden zum Opfer fallen. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis ich meine Fluchtgedanken beiseitewarf. Also tat ich das Einzige, was mir übrig blieb. Ich griff in meinen Mantel, zog ein Schwert hervor und stellte mich den Kreaturen aus der Unterwelt zitternd entgegen.
Was tat ich hier? Hatte ich den Verstand verloren?
Die Höllenhunde schlichen aus den Schatten heraus, geduckt und bereit, anzugreifen. Sie sahen genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Äußerlich hatten sie nur wenig Ähnlichkeit mit einem süßen, kuscheligen Hund. Sie hatten die Größe eines Pferdes und waren von einem schleimigen Knochenpanzer geschützt, an dem einige Hautfetzen klebten. Schwarzes, widerspenstiges Fell lugte zwischen den Rippen hervor. Der lang gezogene Hundeschädel war mit messerscharfen Zähnen bestückt, die in alle Richtungen abstanden. Die langen, mit Stacheln besetzten Schwänze zuckten angespannt, als die Zerberusse auf mich zukamen.
Ich überlegte fieberhaft, wie ich aus der Situation lebend herauskommen konnte. Jede einzelne Zelle meines Körpers war angespannt, als ich die Prana in meinem Inneren sammelte. Mit der rechten Hand umklammerte ich das Schwert, die Linke war bereit dazu, pure Energie auf die Hunde abzufeuern. Ich fühlte mich, als stünde ich kurz vor dem Zerbersten. In mir wirbelte die Prana wie eine tosende Brandung, bereit, auszubrechen. Meine Angst verstärkte die Kraft nur noch. Der Zerberus in der Mitte war kaum noch zehn Schritte von mir entfernt und duckte sich zum Sprung. Noch ehe er vorschnellen konnte, drängte ich die Prana in meinem Inneren mit aller Kraft durch meine freie Hand und schleuderte sie ihm entgegen.
Ein heller, blauer Blitz erhellte die Umgebung für einen Moment, während ein scharfes Brennen durch meine Hand schoss. Ich keuchte, als die Macht meinen Körper verließ. Mein Energieball traf den Zerberus mitten in der Brust und er wurde nach hinten geschleudert. Mit einem ohrenbetäubenden Knacken krachte er gegen eine Hauswand, überzogen mit der Dämonenmagie, die ihn umschloss wie eine knisternde zweite Haut. Als er an der Mauer herabrutschte, sog ich zischend die Luft ein. Der Stein war unter dem schweren Körper der Bestie geborsten, zurück blieb eine schwer beschädigte Hausmauer.
Hatte ich so viel Energie verwendet? Mir blieb keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Ich wandte mich den beiden verbliebenen Höllenhunden zu. Zu meinem Erstaunen zogen sie sich zähnefletschend und knurrend zurück, ohne mich aus den Augen zu lassen. Ich wagte es nicht, mich zu rühren. Seit wann rannten Dämonenwesen davon?
Als sie genug Abstand hatten, drehten sie sich um und verschwanden in der Dunkelheit. Ich atmete schwer und kleine Wölkchen bildeten sich vor meinem Mund. Die Kreaturen kamen nicht zurück.
Meine Erleichterung hielt nur kurz an, dann wurde mir bewusst, wo wir uns befanden. Zerberusse mitten in London! Bevor ich mich versah, hatte ich den Wintermantel abgeworfen und rannte ihnen hinterher. So gern ich auf Verstärkung gewartet hätte, ich konnte sie keine Sekunde länger in der Realität herumstreifen lassen. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie auf Normalsterbliche treffen würden.
Ohne den schweren Mantel konnte ich mich besser bewegen. Der lederne Kampfanzug lag wie eine zweite Haut auf meinem Körper und war leicht und dehnbar. Mein Atem kam stoßweise, als ich den Höllenhunden in die Dunkelheit folgte. Sie lockten mich weiter, tiefer in die verwinkelten Gassen Londons hinein. Ich ließ nicht nach, rannte schneller und schneller, ohne darauf zu achten, wohin mich der Weg führte.
Bitte, Herr, lass uns nicht auf Menschen treffen.
Die Bestien waren schnell. Trotz meines Ausdauertrainings verlor ich sie immer wieder aus den Augen und schnappte bereits nach Luft. Ich kam an eine Gabelung, bei der ich nicht weiterwusste. Keuchend kam ich zum Stehen und sah in beide Richtungen. Links führte die Gasse auf eine belebtere Straße, auf der einige Nachtschwärmer unterwegs waren. Da sie nicht hysterisch schrien und augenscheinlich noch am Leben waren, ging ich davon aus, dass die Dämonenhunde den anderen Weg eingeschlagen hatten.
Ich lief wieder in die Dunkelheit hinein. Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf. Höllenhunde gehörten in die Unterwelt. Sie konnten nicht einfach so in der Realität auftauchen. Anders als die Mairas, die in diese Welt hineingeboren wurden, mussten Zerberusse mit viel Tamtam beschworen werden, und selbst dann waren sie in einem Beschwörungskreis gefangen, bis sie jemand freiließ.
Der kalte Wind und die plötzliche Stille um mich herum holten mich zurück in die Wirklichkeit. Das einzige Geräusch, was die Stille durchbrach, war das Quietschen meiner Stiefel auf dem Asphalt. Um mich herum standen verlassene Lagerhäuser. Ich konnte die Themse riechen. Der Fluss konnte nicht weit entfernt sein. Mir war gar nicht aufgefallen, wie nah wir uns am Ufer befanden. Mein Herzschlag kam mir beinahe verräterisch laut vor, als ich ziellos weiterging und die Ohren spitzte.
Ich landete in einer Sackgasse, eingeschlossen von drei hohen Gebäuden, deren dunkle Fenster zu mir herabstarrten. Ich war fast vollkommen von der Dunkelheit eingehüllt, die dicken Wolken am Himmel verschluckten jegliches Mondlicht. Von den beiden Höllenhunden gab es keine Spur. Wenn ich ihnen auf dem richtigen Weg gefolgt war, hätte ich spätestens hier auf sie treffen müssen. Ich hatte sie verloren und wusste nicht im Geringsten, was sie mittlerweile für Schaden in der Stadt anrichteten. Ich schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch, um meinen rasenden Puls zu beruhigen und mich auf das vorzubereiten, was in der Verborgenenorganisation auf mich warten würde. Nämlich gewaltiger Ärger.
Da hörte ich es. Es war kaum ein Schnauben, vielmehr ein schwerer, keuchender Atem. Sofort verfiel ich wieder in Alarmbereitschaft. Ich drehte mich im Kreis, suchte die Sackgasse und die Dunkelheit ab, jeden Moment damit rechnend, dass sich ein Zerberus auf mich stürzte. Doch nichts geschah. Der leise Atem glich dem eines verschreckten Tiers.
Stirnrunzelnd wartete ich ab, dann kam mir ein schier unglaublicher Gedanke. Versteckten sich die Biester vor mir? Was zur Hölle war hier los? Am Rand der Sackgasse entlang der Lagerhäuser standen zahlreiche Kisten, Container und Paletten, die scheinbar achtlos gestapelt und der Witterung überlassen worden waren. Angestrengt versuchte ich, die Richtung auszumachen, aus der ich das Geräusch gehört hatte. Ich hätte wegrennen sollen. Ich hätte mein Handy zücken und Verstärkung rufen sollen.
Stattdessen konzentrierte ich mich auf einen Stapel Gerümpel und brachte ihn mithilfe meiner Gedanken und der Telekinese dazu, auseinanderzubersten. Noch bevor die Trümmerteile den Boden berührten, erfüllte ein grollendes Bellen die Stille und hallte von den Wänden wider.
Ehe ich mich fangen oder meine Waffe in Position bringen konnte, wurde ich von etwas Gewaltigem umgerissen. Der Zerberus landete direkt auf meiner Brust und presste den Atem aus meiner Lunge. Geistesgegenwärtig hob ich Beine und Arme an, nutzte den Schwung des Höllenhunds und rollte ihn über meinem Körper ab. Sofort sprang ich auf die Beine und wandte mich ihm zu, doch der Zerberus war schnell. Sein klaffendes Maul schnappte nach mir und biss in die Luft, als ich gerade noch rechtzeitig den Arm wegzog. Seine Klaue dagegen traf mich am Oberschenkel und zerriss das Leder meines Kampfanzugs, während die Krallen das Fleisch aufritzten.
Ich biss die Zähne zusammen und reagierte blitzschnell. Als das Tier an mir vorbeiglitt, holte ich mit dem Schwert aus und stach zu. Ich hatte beabsichtigt, ihm die Klinge zwischen die Rippen zu stoßen, doch der knöcherne Panzer verhinderte, dass ich ihm ernsthafte Verletzungen zufügen konnte. Dennoch hatte ich bewirkt, dass der Zerberus zurückwich und mich mit glimmenden Augen beobachtete. Ich hatte ihn in die Ecke gedrängt, hinter ihm war nur noch die Mauer der Sackgasse. Wir funkelten uns an, gespannt und jederzeit dazu bereit, wieder den Kampf aufzunehmen, als ich hinter mir ein weiteres bedrohliches Knurren vernahm. Mist!
Nun war ich diejenige, die in der Falle saß, denn der einzige Ausgang aus dieser Sackgasse wurde von dem zweiten Zerberus versperrt. Die Biester hatten mich in eine Falle gelockt und ich war geradewegs darauf hereingefallen.
»Schön ruhig, Hundchen«, flüsterte ich, während mir kalter Schweiß den Nacken herablief. Angespannt drehte ich mich so, dass ich beide Höllenhunde im Auge behalten konnte, indem ich den Kopf hin- und herdrehte. Sie liefen auf und ab, versuchten, sich meinem Blickfeld zu entziehen. Die Zeit verstrich quälend langsam. Und doch griffen sie nicht an. Sie warteten wie ich darauf, dass der jeweils andere den ersten Schritt machte. Würden sie es akzeptieren, wenn ich mich langsam und vorsichtig an die seitliche Mauer zurückzog? Würden sie die Gelegenheit nutzen und abhauen? Aber was dann? Sollte ich flüchten und es riskieren, die Dämonenhunde auf Londons Bevölkerung loszulassen? Das konnte ich nicht. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, und das bedeutete, dass ich angreifen musste.
In meiner Brust hatte sich die Energiequelle wie von selbst gebildet, die Kraft strömte durch meine Adern und erfüllte jede Zelle meines Körpers. Meine Haare schwebten in einem unsichtbaren Wind.
Die Höllenhunde knurrten warnend. Sie nahmen die Veränderung wahr. Doch solange ich zwischen den beiden stand, konnte ich nicht den einen angreifen, ohne dem anderen den Rücken zuzukehren. Also entschied ich mich für ein Ablenkungsmanöver. Ich sandte meine Gedanken aus und entzündete im Geist die Paletten und Holzkisten an den Wänden. Ein lautes Krachen erfüllte die Luft und Hitze schlug mir entgegen. Es sollte ein kleines Feuer werden, das die Wachsamkeit der Hunde auf sich zog. Stattdessen hatte ich eine kleine Explosion heraufbeschworen. Brennende Trümmerteile fielen vom Himmel herab und ließen mich in Deckung gehen. Das war wohl etwas zu viel des Guten gewesen.
Bevor ich mich darüber wundern konnte, hielt ich nach den Höllenhunden Ausschau und hatte bereits einen Pranaball in meiner Hand gesammelt. Ich sah den ersten der Hunde nur vier Meter von mir entfernt und schleuderte ihm meine geballte Energie entgegen. Sie traf die Bestie mitten in der Brust. Der Zerberus jaulte auf und sackte in sich zusammen.
Lediglich ein dunkler Schatten warnte mich davor, dass der verbliebene Höllenhund sich auf mich stürzte. Ich rollte mich zur Seite und entging so den Klauen, die sich in den Asphalt bohrten. Ich schrie auf und hechtete nach hinten, als der Zerberus einen weiteren Sprung machte. Abermals schnappten Zähne nach mir und ich schwang das Schwert. Die Klinge bohrte sich in das Maul des Zerberus und blieb im Oberkiefer stecken, was ihn jedoch keineswegs zu Fall brachte. Ich hatte ihm lediglich eine Maulsperre verpasst. Mit der einen Hand am Griff des Schwerts, legte ich die andere an den Hals des Tiers, während das Monstrum mit seinem ganzen Gewicht auf mich fiel und mich zu Boden riss.
»Genug gespielt«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und wandelte die Energie in meinem Inneren um. Aus der Hand, die die schleimige Haut des Dämonenhunds berührte, schoss dieses Mal keine pure Energie. Stattdessen strömte langsam und unaufhaltsam Kälte aus ihr heraus. Ich konzentrierte mich mit aller Gewalt auf die Kryokinese, das Gefrierenlassen von Dingen mittels meiner Gedanken. Eine dünne Schicht aus glitzernden Kristallen ging von meinen Fingern aus und bedeckte den sich windenden Körper des Zerberus. Ich spürte, wie meine Hand an dem Eis festklebte, das das Biest nun umschloss. Seine Bewegungen wurden langsamer, der Atem kam rasant und stoßweise. Mit aller Kraft zog ich an dem Schwert, das im Rachen des Zerberus steckte, und rammte es ihm in den Hals, um ihn von seinem Leiden zu erlösen.
Das Monstrum zerfiel zu Asche, die sich im lauen Wind zerstreute, während die Last des Tiers von mir gehoben wurde und ich wieder frei atmen konnte. Ächzend stand ich auf und ignorierte meine schmerzenden Glieder, als ich zu dem letzten verbliebenen Zerberus hinkte. Meine Prana bedeckte seinen Körper, doch er begann bereits, sich wieder zu bewegen. Ohne zu zögern, erlöste ich auch ihn von dem Dasein in der Realität und ließ mich ächzend auf den Boden sinken, um durchzuatmen. Dann blickte ich an mir herab. Der nagelneue Kampfanzug war an einigen Stellen gerissen. Blut lief mir den Oberschenkel herab, doch die Wunde war nicht allzu tief. Schneematsch bedeckte meine Kleidung und nachdem sich mein Pulsschlag beruhigt hatte, spürte ich auch wieder die Kälte.
»Warum musstet ihr auch unbedingt heute auftauchen?«, knurrte ich die letzten verbliebenen Aschepartikel an, bevor sie mit dem Schnee verschmelzen oder durch den Wind davongetragen werden konnten. »Ich hatte gerade Feierabend, verdammt noch mal!«
Ein paar brennende Trümmer flackerten noch vor sich hin. Ich löschte sie und machte mich stöhnend auf den Rückweg. Hoffentlich hatten die Männer der VO wenigstens auf mich gewartet, nachdem sie die Werwölfe in die Wagen verladen hatten. Den zurückgelassenen Zerberus hatten sie sicher schon getötet. Er hatte so viel Energie abbekommen, dass es einen ganzen Drachen weggehauen hätte. Der Rückweg kam mir schier endlos vor, doch endlich sah ich das Blaulicht der Einsatzwagen zwischen den Häuserwänden. Als ich am vereinbarten Treffpunkt ankam, mitgenommen und zerrissen, erwarteten mich bereits sechs Mitarbeiter der Verborgenenorganisation mit verschränkten Armen.
Meine Güte, sie taten ja fast so, als hätte ich sie Stunden warten lassen. Einer der Männer, Jeremy, hob fragend die buschige Augenbraue, doch ich hatte gerade nicht das Bedürfnis, dem Werwolf eine Erklärung abzuliefern. Ich würde sowieso alles bis ins kleinste Detail in der VO berichten müssen, wozu also die Mühe? Außerdem konnte ich ihn nicht leiden.
»Sorry, war beschäftigt«, war das Einzige, was ich ihm zumurmelte. Sein Gesicht verfinsterte sich und etwas von meiner Anspannung kehrte zurück. Jeremy war ein Werwolf. Nur dank jahrelangem gezielten Konzentrationstraining bei der VO konnte er seine Verwandlung trotz des aufgegangenen Vollmonds noch hinauszögern, vermutlich bis zum Morgengrauen. Er erschauderte. Machte ihm die Unterdrückung der Wandlung mehr zu schaffen, als er sich anmerken ließ?
Nein, Jeremy war in so ziemlich allen Disziplinen Klassenbester, er hatte sich im Griff. Aber hätte er nicht eigentlich zufrieden sein müssen, dass ich ein Dutzend Randalierer festgenommen hatte? Ich zögerte.
»Habt ihr die Mondkinder schon verladen?«, fragte ich sicherheitshalber und schielte zu den vier Einsatzwagen.
»Mondkinder?«, dröhnte Jeremy mit seiner tiefen Stimme und seine goldenen Augen verengten sich zu Schlitzen. »Meinst du die, die du allein zurückgelassen hast und die sich aus dem Staub gemacht haben, bevor wir ankamen?«
Ich starrte ihn an.
»Was?«, brachte ich schließlich hervor und Jeremy packte mich am Arm, um mich zu der Stelle zu führen, an der sie gelegen hatten. Ich sah noch einige Fußspuren im Schneematsch.
»Das kann nicht sein!«, stieß ich aus und sah Jeremy fest an. Dann blickte ich auf mein Handy und kontrollierte, wann ich den Anruf an die VO getätigt hatte.
»Ich war nicht einmal zwanzig Minuten weg! Sie haben eine Pranaladung von mir abbekommen, die sie für eine ganze Stunde hätte außer Gefecht setzen müssen!«
Hatte ich mich so verschätzt?
»Hat sie aber nicht!«, blaffte Jeremy mich an. »Vielleicht hättest du einfach bei ihnen bleiben sollen! Was hast du getan? Einen Kaffee getrunken?«
Wortlos sah ich an mir herab.
»Sehe ich aus, als hätte ich einen Kaffee getrunken?«, keifte ich zurück, doch dann fiel mir ein, dass er vielleicht noch gar nichts von den Höllenhunden wusste.
»Und was ist mit dem Zerberus? Ist der auch weg?«
Jeremy sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren und beantwortete damit meine Frage. Überflüssigerweise sah ich zu der Stelle, an der der Zerberus gegen die Hausmauer gekracht war und ein Loch hinterlassen hatte. Der Dämonenhund war verschwunden.
»Was auch immer du hier veranstaltet hast, das wird Konsequenzen haben«, knurrte der Werwolf schließlich, fuhr sich durch die braunen Haare und winkte seine Männer zurück zu den Einsatzwagen.
Ja, das würde es wohl, dachte ich zerknirscht und folgte ihnen missmutig.
Kapitel 3
Ich überredete Jeremy, mich zu Hause abzusetzen, bevor er brummend zurück zur VO fuhr. Ich winkte ihm nicht mal zum Abschied, denn ich wusste, dass er sich insgeheim freute, dass ich schon wieder einen Auftrag vermasselt hatte. Sein Feixen erinnerte mich an das eines Wiesels.
So ließ er mich im Stadtteil Royal Borough of Kensington and Chelsea raus. In der Cromwell Road reihten sich die Backsteinhäuser dicht aneinander, doch hätte ich mir die Wohnung am Ende der Straße niemals selbst leisten können. Glücklicherweise stellte die VO Wohnungen für ihre Mitarbeiter. Von hier aus war es nicht weit bis zum Hauptgebäude der Verborgenenorganisation und auch der Hyde Park befand sich ganz in der Nähe.
Ich sah zu unserer Wohnung hinauf, doch in den Fenstern brannte kein Licht. Alissa war sicher schon schlafen gegangen. Ally und ich waren unzertrennlich, seit wir uns vor sechs Jahren an der Winterfold Akademie kennengelernt hatten. Die Telekinese-Hexe war der quirligste und liebevollste Mensch, den ich kannte. Sie war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich konnte mich glücklich schätzen, sie meine beste Freundin nennen zu können.
Offiziell wohnten wir beide allein hier, doch unsere Wohnung war stillschweigend zu einer Vierer-WG geworden. Alissa teilte sich das Zimmer mit meinem Bruder Chaz, der zwar ebenfalls ein Halbdämon war, aber mehr Dämonen- als Hexenblut in sich trug und daher bei unserem Vater in der Unterwelt aufgewachsen war. Auch jetzt verbrachte er die meiste Zeit aus geschäftlichen Gründen dort, was seiner Freundin Alissa ziemlich zu schaffen machte.
Ryan, mein Vampirfreund, hatte eine eigene Wohnung in London, die einst seinen Eltern gehört hatte, als sie noch am Leben gewesen waren. Doch ich konnte mich kaum noch daran erinnern, wann er das letzte Mal nicht bei uns übernachtet hatte.
Zu unserer Truppe gehörten noch Derek und Don, zwei sehr gute Freunde, die sich aber seit einigen Monaten auf Forschungsreise befanden.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht bemerkt hatte, wie ich regungslos vor der Wohnungstür verharrte. Wann hatte ich das Treppenhaus durchquert?
Ich riss mich zusammen, steckte den Schlüssel ins Schloss und landete in einem schmalen Flur. Unsere Wohnung war groß und geräumig, alles war vor unserem Einzug renoviert und modern gestaltet worden.
Die Tür zu Alissas Zimmer war geschlossen. Kurz reizte es mich, ebenfalls einfach in meinem Zimmer gegenüber zu verschwinden. Aber aus dem Wohnzimmer drangen die leisen Stimmen des Fernsehers. Es war schon komisch, dass ich Erleichterung verspürte, dass Ryan offensichtlich noch hier war. Eigentlich sollte man in einer Beziehung nicht Angst haben müssen, dass der Partner vielleicht eines Tages nicht mehr auf einen wartet. Und dass ich diese Angst verspürte, war kein gutes Zeichen.
Ich atmete einmal tief durch und stellte mich in den Türrahmen. Das Wohnzimmer war wie der Rest unserer Wohnung ziemlich groß und in einem Stil eingerichtet, den ich nicht benennen konnte. Ryan und ich mochten es elegant, was sich in den schwarz-weißen Möbeln widerspiegelte, die gut zu dem dunklen Parkettboden passten. Dennoch hatten wir uns nicht gänzlich gegen Alissa durchsetzen können und so hatte sie bei unserem Einzug einfach ihre geblümten Decken, knallbunten Kissen und Vorhänge sowie leuchtende Vasen an jeder freien Stelle drapiert. Im Nachhinein musste ich zugeben, dass es mir sogar gefiel. Es hatte etwas Eigenes, etwas Verrücktes, das gut zu uns passte.
Ich blieb unschlüssig in der Tür stehen und fragte mich, wieso ich mich so unbehaglich fühlte. Ryan stand am Fenster und starrte hinaus in die dunkle Nacht. Als ich eintrat, drehte er den Kopf und seine dunklen Augen musterten mich eindringlich.
»Bist du verletzt?«, fragte er emotionslos und ich schüttelte zögernd den Kopf.
»Nicht der Rede wert«, gab ich leise zurück.
»Gut.«
Er ging zum Sofa und wandte sich dem Fernsehprogramm zu. Ich schluckte den Kloß im Hals herunter und ging zurück in den Flur und ins Bad. Dort schloss ich die Tür hinter mir und lehnte mich für einen Moment dagegen. Kein »Wie war dein Einsatz?« oder »Hast du die Verbrecher klargemacht?«. Nichts. Vollkommenes Desinteresse. Unsere Situation war momentan angespannt, was mich stark belastete.
An was hatte er gedacht, als er aus dem Fenster gesehen hatte? Hatte er auf mich gewartet? Er sah in letzter Zeit immer wieder so nachdenklich aus. So verschlossen.
Ich schälte mich aus dem Kampfanzug und ließ mich auf dem Badewannenrand nieder, um die Wunde an meinem Oberschenkel zu säubern. Das Desinfektionsmittel brannte scharf und trieb mir die Tränen in die Augen. Jedenfalls redete ich mir ein, dass es daran lag.
Wann war die Situation zwischen mir und Ryan so außer Kontrolle geraten? Wir waren seit unserer gemeinsamen Zeit an der Winterfold Akademie ein Paar und das Erlebte hatte uns unzertrennlich werden lassen. Seit drei Jahren lebten wir nun in London. Ich hatte immer geglaubt, dass nichts und niemand sich je würde zwischen uns stellen können. Ich liebte ihn. Er war düster und geheimnisvoll und so voller Leidenschaft, dass es mir noch immer den Atem raubte, wenn er mich küsste. Doch Ryans größtes Problem waren seine Selbstzweifel. Ich hatte lange gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, dass er kein Monster war, nur weil er Blutdurst verspürte.
Ryan und ich waren füreinander geschaffen, wir waren eine Einheit, ein Team. Und dennoch stand seit einigen Monaten etwas zwischen uns. Seit unserem gemeinsamen Einsatz, um genau zu sein.
Ryan war einer der besten Jäger der Verborgenenorganisation und man hatte uns gemeinsam mit einigen anderen in die Wälder Londons geschickt, in denen Mairas gesichtet worden waren. Wir hatten die Halbdämonen schnell aufgestöbert und es war zu einem Kampf gekommen, bei dem wir zwei Jäger verloren hatten. Und bei dem ich Ryan und den anderen das Leben gerettet hatte. Seitdem hatte ich das Gefühl, dass er sich vor mir zurückzog. Ich hatte das Gespräch mit ihm gesucht, doch er bestritt vehement, dass dieser Einsatz etwas mit seinem Verhalten zu tun hatte.
Leise seufzend wickelte ich einen Verband um meinen Oberschenkel und trat an das Waschbecken, um mir den Schmutz der Straße abzuwaschen. Im Spiegel begutachtete ich mich. Lange, braune Locken, ein Nasenpiercing in dem schmalen Gesicht mit hohen Wangenknochen und leuchtend türkise Augen, die mich als Dämon kennzeichneten. Ich hatte es schon vor Jahren aufgegeben, mich verstecken zu wollen und meine Augenfarbe durch die Biokinese in das normale Hexengrün zu ändern.
Ich war durchtrainiert und schmal, aber mein Körper war übersät von Narben. Vorsichtig ließ ich die Finger über die größte von ihnen gleiten, eine dreispurige Narbe auf meiner Schulter, die ich bei meinem ersten richtigen Kampf mit einem Maira davongetragen hatte. Lächelnd erinnerte ich mich daran zurück, dass es auch mein erster Kampf an Ryans Seite gewesen war. Ob es zwischen uns jemals wieder so werden würde wie früher?
Nach dem Zähneputzen überlegte ich kurz, ins Wohnzimmer zurückzukehren, mich einfach neben Ryan zu setzen und mich an ihn zu kuscheln, ein bisschen von dem Gefühl zurückzuholen, das mir Halt und Kraft gab. Stattdessen ging ich geradewegs in mein Zimmer.
Der Abend war nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich fühlte mich ausgelaugt und verletzlich. Eine Zurückweisung von ihm hätte ich jetzt nicht ertragen.
Auf meinem Kopfkissen hatte sich Conchobhar, unser Kobold, zusammengerollt und schnarchte leise. Er kam aus Irland und war mir vor ein paar Jahren sozusagen zugelaufen wie ein Hund, auch wenn er es hasste, wenn man ihn mit einem Haustier verglich.
Cox war nicht länger als mein Unterarm, grasgrün und hatte riesige Fledermausohren. Er ähnelte einem kleinen Drachen, doch sein Verstand war messerscharf und er nahm nur selten ein Blatt vor den Mund. Außerdem machte er gerne Dummheiten, wobei ihm die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, durchaus zugutekam. Allein deshalb war ich froh, dass Cox zu meinen Freunden zählte. Mit einem Kobold sollte man es sich nie verscherzen.
Ich schob ihn sanft beiseite und lächelte, als er im Schlaf grunzte. Cox liebte es, in meinem oder Alissas Bett zu schlafen, solange unsere Freunde nicht dabei waren. Dann verließ er das Zimmer meist mit angewiderten Geräuschen und nahm mit der Couch vorlieb.
Heute störte mich seine Anwesenheit nicht, im Gegenteil, es hatte etwas Beruhigendes, seinem sanften Atem zu lauschen. Trotzdem konnte ich nicht einschlafen.
Im Dunkeln starrte ich an die Decke und versuchte, den leeren Platz neben mir zu ignorieren, den selbst Conchobhar nicht vollends ausfüllen konnte. Es war nicht selten, dass Ryan nachts nicht ins Bett kam. Vampire brauchten nur wenig Schlaf. Doch ich wusste, dass es nicht an der fehlenden Müdigkeit lag, dass er nicht bei mir war. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er mir stundenlang beim Schlafen zugesehen und mich im Arm gehalten.
Wieder seufzte ich und zwang mich dazu, die Augen zu schließen. Ich hatte heute nicht mehr die Kraft, mich mit Ryan auseinanderzusetzen. Viel zu viele Gedanken rasten durch meinen Kopf.
Was war heute schiefgelaufen? Wie hatte es passieren können, dass die Werwölfe einfach wieder aufgestanden und verschwunden waren? Hatte ich mich so in der Dosierung meiner Magie verschätzt? Andererseits hatte ich ja auch beinahe ein Loch in die Mauer gesprengt, als ich den Zerberus damit beschoss. Also lag es nahe, dass ich eher zu viel statt zu wenig Magie verwendet hatte. Das schien mir in letzter Zeit öfter zu passieren. Ich musste dringend an meinen Fähigkeiten arbeiten. Vielleicht sollte ich wieder damit beginnen, ein wöchentliches Magietraining zu absolvieren.
Und wo waren die Höllenhunde hergekommen? Jemand aus der Realität musste sie beschworen haben, aber welcher Grund trieb einen Menschen zu solch einer Tat? Wer hatte es nötig, Dämonenwesen auf die Realität loszulassen? Außerdem stellte sich die Frage, was mit dem letzten verbliebenen Zerberus geschehen war? Als die VO eingetroffen war, war er bereits verschwunden. Streifte er noch immer durch London? Ich betete, dass dem nicht so war.
Dieser Abend war eine einzige Überraschung gewesen, nicht nur durch den unangekündigten Besuch aus der Unterwelt. Die Werwölfe hatten sich heute besonders aggressiv verhalten, mal abgesehen davon, dass sie sich in nur wenigen Atemzügen vollständig verwandelt hatten. In dieser Nacht waren so einige Dinge seltsam gelaufen, für die ich morgen bei der Verborgenenorganisation würde geradestehen müssen. Ich hasste den Vollmond.
Am nächsten Morgen fühlten sich meine Augen zugeklebt an und ich spürte deutlich die Abschürfungen und Prellungen vom Vorabend, als ich verschlafen den Bademantel überzog. Vor meinem Fenster dämmerte es bereits und die Dächer Londons zeichneten sich vor dem tristen Grau des Himmels ab. Ich trat barfuß hinaus auf den kleinen Balkon und atmete tief die eiskalte Morgenluft ein, um meine müden Geister zu wecken und mich für den Tag zu rüsten.
Cox schlief noch, was nicht unüblich für den kleinen Kobold war. Ich schlurfte in die Küche, aus der ein Sinne erweckender Kaffeeduft drang. Ally und Chaz saßen bereits auf den Barhockern am Tresen, jeder eine Schüssel Cornflakes vor sich und damit beschäftigt, hitzig über den Sinn und Zweck von Fußball zu diskutieren. Sie gingen so wahnsinnig vertraut miteinander um, dass es mir warm ums Herz wurde und ich sie für einen Moment unbemerkt von der Tür aus beobachtete.
»Bis vor ein paar Jahren wusstest du nicht einmal, dass es diesen Sport gibt«, lachte Alissa. Sie spielte darauf an, dass Chaz in der Unterwelt aufgewachsen war und die Realität erst vor etwa fünf Jahren kennengelernt hatte. Es war manchmal urkomisch, wie er sich für die verschiedensten, alltäglichen Dinge begeistern konnte.
»Ein Grund mehr, zu diesem Spiel zu gehen«, hielt Chaz dagegen. »Der verlorene Junge muss seine verlorene Kindheit aufholen.« Ally schnaubte belustigt und er strich ihr liebevoll eine der rostroten Ringellöckchen aus der Stirn. Ich räusperte mich vernehmlich, peinlich berührt, dass ich sie in diesem intimen Augenblick beobachtete.
Ally drehte sich mit strahlend grünen Augen zu mir um und lächelte über das ganze Gesicht, als ich eintrat. Ihre Sommersprossen verschwanden kurzzeitig, als sie rot anlief.
»Guten Morgen, Prinzessin«, grinste Chaz, wie üblich gekleidet in coole Lederjacke und Jeans. Obwohl wir Geschwister waren, hatten wir kaum Ähnlichkeit miteinander. Niemand aus der Realität außerhalb unseres Freundeskreises wusste, dass Chaz ebenfalls ein Dämon war, und so änderte er seine dämonisch blauen Augen während der Zeit in der Realität zu normalem Hexengrün. Sein feines, blondes Haar war wie immer lässig verwuschelt und fiel ihm fast bis in die Augen.
Ende der Leseprobe





























