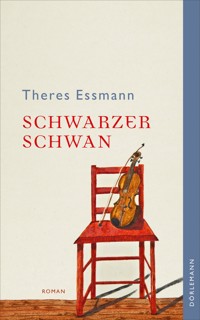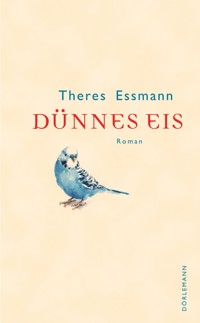
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurz vor ihrem hundertsten Lebensjahr wird Marietta von einer seltsamen Unruhe ergriffen. Dabei macht sie sich nicht viel aus den Geburtstagen, vielmehr beschäftigt sie, was in ihrer Umgebung passiert. In das Zimmer ihrer Heimnachbarin Gisela ist Herr Tacke eingezogen, mürrisch und ein alter Nazi, wird gemunkelt. Und in der Flüchtlingsunterkunft nebenan lebt ein kleiner Junge, der sie an ihren Sohn erinnert, der vor vielen Jahrzehnten die Flucht aus den Ostgebieten nicht überlebt hat.Nach und nach melden sich die Geister der Vergangenheit und fordern sie auf, sich endlich dem schmerzhaftesten Ereignis ihres Lebens zuzuwenden, das sie jahrzehntelang in ihrem tiefsten Inneren vergraben hatte. Durch eine Begegnung findet sie den Mut, sich ihrer dunkelsten Stunde zu stellen.Ein berührender Roman, der eindringlich von den Wunden des Krieges erzählt und von der Kraft der Versöhnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Theres Essmann
Dünnes Eis
Roman
DÖRLEMANN
Die Autorin dankt dem Förderkreis der Schriftsteller : innen in Baden-Württemberg sowie dem Land Baden-Württemberg für die Förderung der Arbeit an diesem Buch. Für Giesela Gaedegeboren 1927, gestorben 2022 Alle Rechte vorbehalten © 2023 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Illustration von Maria Stezhko/Shutterstock Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-902-7www.doerlemann.ch
Inhalt
1
Schlag zwölf, als ihr einhundertstes Lebensjahr beginnt, liegt sie im Bett und schläft nicht. »Himmel«, sagt sie, als die Kirchturmuhr verstummt, sie sagt es in die Stille und die Dunkelheit hinein und macht Licht. Durch die offene Tür sieht sie den Umriss des Schreibtisches. Bis dahin ist es ein Weg. Sie tastet nach dem Bettknopf, der Verbindung zum Willen des Wesens unter ihr, es hebt seinen Kopf und sie, Kopf und Rücken, gleich mit, dann folgt das Rutschen, das Schieben und Robben der Füße zum Bettrand und darüber hinaus und hinab zum Boden, so langsam, als ließe sie zwei Senkbleie in ein Wasser und lotete seine Tiefe aus.
Da ist der Stock und hier der Bettgriff. Ein kleines Schwungholen, ein Abstützen und Hochstemmen. Es sind die Übergänge, an denen es hakt. Aber wenn sie erst einmal steht, dann geht’s. Auch ohne Stock. Wie jetzt am Kleiderschrank vorbei durch die Tür und dann die Bücherwand entlang. Von oben links Aurel über mittig Musil bis unten rechts Zweig. Ihr ganzes Leben entlang und das all der anderen dazu, die ihr durch die Abertausenden Seiten die Hand gereicht haben.
Sie bleibt stehen, fährt mit der flachen Hand über die Bücher, es kitzelt. »Hübsch«, hatte Gisela gesagt, »gefiederte Bücher«, und meinte damit die Streifen bunten Papiers, die oben aus den Seiten ragen wie Schwanzfedern. Aber jetzt im Dunkeln, das durch die offene Schlafzimmertür vom Licht der Bettlampe kaum noch erreicht wird, verschwimmen die Bücher zu einer farblosen Einheit, als rückten sie schweigend noch enger zusammen, wie Tannen es tun, wenn einer am Waldrand geht in der Nacht.
Giselas Schal. Sie nimmt ihn von der Lehne des Schreibtischstuhls, hüllt sich hinein. Greift mit den Fingern um die Schreibtischkante. Wappnet sich für den nächsten Übergang, den kurzen freien Fall, bis sie aufgefangen wird und sitzt.
Sie zieht den Schal um ihre Schultern enger. »Ich stricke dir zu Weihnachten einen Schal, Marietta«, hatte Gisela gesagt. »Aber keinen grauen.« Da saß sie vor ihr im Sessel, während einer der Teestündchen, ihr Haar wie Zuckerwatte aufgetürmt, weiß und mit viel Luft dazwischen, und ihr Kleid: ein kunterbuntes Blumenbeet. Über die Schultern hatte sie wie jeden Tag einen ihrer Schals gelegt, einen gelben, grünen, blauen oder pinken. Einmal hatte eine Tür von Giselas Kleiderschrank offen gestanden, und da lagen die Schals wie ein zusammengefalteter Regenbogen. »Ja, bring ruhig einen Farbtupfer in mein Grau«, hatte sie geantwortet, denn Gisela zog sie damit immer auf, mit ihrer Vorliebe für Grau: »Ich wusste gar nicht, dass es so viele Abstufungen gibt.« Und: »Grau kommt von Grauen.« Wenn Gisela sie jetzt sehen könnte. Wie sie hier sitzt, im silbergrauen Schlafanzug, um ihre Schultern den pinken Schal.
Sie knipst die Schreibtischlampe an. Vor dem Fenster und auf dem Balkon ist es Nacht. Sie weiß, ihr Fenster ist nicht das einzige unter den vielen der Residenz, das erleuchtet ist, weil hinter ihm jemand nicht schläft. Mit beiden Händen zieht sie die Schublade auf, sie ist randvoll mit Leben. Fotos über Fotos, wahllos hineingeworfen. Und wie wahllos nimmt sie nun eines und noch eines und noch eines heraus, jedes mit dem Bild nach unten, so muss es sein, und legt sie vor sich auf das Holz. Als es genug sind, schließt sie erst die Schublade und dann ihre Augen. Mischt mit vorsichtig wischenden Handflächen das Blatt dieser Nacht. Und dann eilen ihre Finger los, sie laufen über die Papiere wie ein Tierchen auf der Suche nach etwas. Da, dieses besonders stark gewölbte Papier, das erkennen sie wieder. Oder diesen scharf gezackten Rand, den auch. Und die auffällige Glattheit, die ist auch verräterisch. Weiter, ihre Finger eilen weiter. Halten inne. Dieses Papier, das erkennen sie nicht. Wie eine Wünschelrute schlägt etwas in ihr aus. Wer wird sie überraschen, wem wird sie begegnen? Die Finger fassen das Bild, drehen es um. Marietta öffnet die Augen.
Johann. Im Arm hält er stolz seinen Brummel. Wie hatte er sich einen Teddybären gewünscht, einen großen. Der Weihnachtsbaum dagegen hinter ihm auf der Kommode war mickrig ausgefallen, sie hatte ihn mit Strohsternen, goldenen und roten Kugeln behängt, Kerzen hatte sie nicht; zum Vorlesen der Weihnachtsgeschichte zündete sie die Stumpen aus dem Vorjahr an. Das spärliche Licht einer Kriegsweihnacht. Und das Strahlen auf Johanns Gesicht. Dieser flüchtige Moment, den ein Foto festhält. Johanns ungetrübte Freude. Und zugleich ihr Herz, in dem der Tod sich längst ausgebreitet hatte wie ein schwarzer Klecks in einem Aquarell.
Der russische Winter hatte ihren Heinrich verschluckt. Sie stellte sich damals vor, wie ein Engel seine Flügel um ihn legte und mitnahm, wohin auch immer. Das andere Bild ertrug sie nicht, sein Körper auf der hart gefrorenen Erde, die sich nicht erweichen ließ für ein Grab, nicht einmal durch sein warmes, für den Führer vergossenes Blut. Sie hatte es Johann noch nicht gesagt. Sie hatte nur aufgehört, ihm von Heinrich zu erzählen, aufgehört, diese Leerstelle in seinem vier-, fünfjährigen Leben mit etwas zu füllen, das ein Vater war. Heinrichs Foto im Rahmen auf seinem Nachttisch ließ sie stehen. Es war ihre letzte Weihnacht in Königsberg. Und die letzte Weihnacht ihrer Stadt, bevor die Bomben der Briten sie zerstörten.
Aber davon weiß das Foto nichts.
Weihnachten dreiundvierzig. Da hatte sie schon geplant, mit Johann zu den Großeltern zu gehen, sich gleich im neuen Jahr für eine Zeit in das sicherere Umland zu begeben. Jetzt fällt es ihr ein, es hatte einen Streit mit Vater gegeben, an diesem Heiligen Abend. »Glaub mir, bis Königsberg kommt der Feind nicht!«, hatte er gesagt. Da wusste sie schon nicht mehr, ob es sein Glaube an den Führer war oder die Hoffnung des Ostpreußen, irgendwie außer Reichweite zu sein.
Sie nimmt Johanns Foto in die Hand, fährt mit dem Finger über sein Haar, seine dunklen Locken, in denen sie versinken kann. Streicht ihm über das Gesicht. Mama, hat das Christkind dem Teddy schon einen Namen gegeben, lässt sie ihn sagen und dann gleich weiterreden: Brummel, bestimmt heißt er Brummel.
Sie schließt die Augen, schickt ihre Finger noch einmal los, gespannt, über welchem Bild sie diesmal innehalten.
Gisela. In ihrem geblümten Ohrensessel. Zwischen den großen Blüten ragt ihr weißes Köpfchen heraus wie eine Pusteblume. Auf dem Beistelltisch steht eine Vase mit Tulpen. Ihr Sohn. Michael. Er brachte Blumen mit, wann immer er sie besuchen kam, einmal im Monat war das, und immer machte er ein Foto von seiner Mutter, wie sie im Sessel saß, neben ihr seine Blumen. Und auf jeder Rückseite wurde das Datum notiert. »Keine Ahnung, was er damit will«, sagte Gisela. »Dokumentieren, wie ich schrumpfe und schrumple?«
Nachdem sie Gisela beerdigt hatten, hörte Marietta ihn in ihrer Wohnung nebenan räumen, ging hinüber und fragte nach den Fotos, ob sie eines bekommen könne, als Erinnerung. Am nächsten Tag hielt er ihr eine Schachtel hin. »Greifen Sie zu«, sagte er. Wie ein Los aus einer Tombola hatte sie dieses Foto gezogen, und auch heute Nacht ist es ihr Los. Dieses Foto. Auf der Rückseite: 20. 7. 2001. Vielleicht sitzt er ja auch da wie sie, wann immer ihm seine Mutter fehlt, legt die Fotos vor sich aus, anders als sie mit dem Bild nach oben, und versucht, sie in eine Zeitreihe zu bringen, und erst am Ende dreht er sie um und kontrolliert die Daten. Wie bei den LÜK-Kästen aus den Sechzigern.
2001. Da war Gisela noch gesund. Und Erich noch lebendig. Auf der Fensterbank steht sein Käfig. Sie kann den Wellensittich noch hören, sein Brabbeln, Zwitschern, Kreischen. In Giselas Wohnzimmer war es selten still. Und wenn Erich einmal den Schnabel hielt, hüpfte er hin und her, und man hörte die Landungen seines kleinen Gewichts auf der Stange. Zur Nacht breitete Gisela ein Tuch über den Käfig. »Dann ist schlagartig Ruhe«, hatte sie Marietta erzählt, und auch, wie sie sich nachts vorstellte, Erich hüpfe in ihrem Schädel zwischen zwei Stangen hin und her. Hin und her. Besser als Schäfchen zählen sei das.
Oft saßen sie einfach zu zweit da, redeten nicht, tranken Tee und schauten ihm zu. »Sittich gucken«, nannte Gisela das. Erich bearbeitete mit seinem Schnabel das runde Spiegelchen, gurrend und vor- und zurücktrippelnd. »Im Bad«, sagte Gisela, »wenn ich mich wasche, da rede ich mit meinem Spiegelbild. Machst du das auch, Selbstgespräche führen?«
Seit Gisela nicht mehr ist, erscheint sie ihr manchmal morgens im Spiegel. Schönen guten Morgen, sagt Gisela dann. Oder: Selbst der Kopf schrumpft, findest du nicht? Und jetzt, aus ihrem Ohrensessel auf dem Foto heraus, sagt sie: Glückwunsch. Neunundneunzig. Das schaffen die wenigsten.
Sie schicken jemanden von der Lokalzeitung.
Benimm dich.
Himmel, hatten sie damals darüber gelacht. Über die Sache mit dem Blatt. »Die anderen Hochbetagten«, hatte der Journalist zu Marietta gesagt, »die anderen, die mir ihr Leben erzählt haben, haben einen Satz für die Nachwelt darauf geschrieben, die Essenz ihres langen Lebens.« Genauso hatte er es ausgedrückt. Die Essenz. Er zeigte ihr die Fotos der anderen. »Liebe ist alles«, hielt eine Frau vor ihren Kugelbauch. Und die Sätze der anderen waren auch nicht besser. »Mein Leben eignet sich nicht für ein Kalenderblatt«, hatte sie zu ihm gesagt. »Ich bin erst 85«, hatte sie geschrieben und dann doch die Rückseite in die Kamera gehalten. Eine weiße Fläche. »Sagt doch alles«, hatte der Journalist es hingebogen, »das letzte Wort ist bei Ihnen noch nicht gesprochen.«
Während des Interviews hatte er seinen Stuhl nah an ihren gerückt, bei jeder Frage schob er seinen Kopf weit vor wie eine Schildkröte, sie hätte ihn mit ihrem Knie unterm Kinn erwischen können. »Ich höre noch gut«, hatte sie gesagt. »Würde des Alters – so soll es heißen, Ihr Buch?« Ja, sie sei Lehrerin gewesen, hatte sie ihm geantwortet, und ja, doch, dass im Königsberg von 1930 auch Frauen studierten, und nein, dass sie kein Problem habe mit der heutigen Jugend. Rousseau hatte er nicht gelesen. Sie hatte überlegt, ob sie den Émile holen sollte, aus ihrem Regal, Rousseau habe der Kindheit und Jugend ihre Würde zurückgegeben, hatte sie ihm erklärt, und dass doch der Mensch jederzeit seine Würde verlieren könne, nicht nur im Alter. Obwohl sie es in der Resi mit der Würde sicher leichter hätten als anderswo. »Wobei – Residenz mit Herz. Gehobenes Wohnen im Alter. Ziemlich bescheuerter Name, finden Sie nicht?«, hatte sie ihn gefragt.
Die anderen Bewohner sprachen tatsächlich von ihrer Residenz. Gisela und sie sagten Resi. Residieren, das taten Fürsten und Monarchen. »Ich hab hier noch niemanden mit Kutsche vorfahren sehen«, hatte Gisela einmal bemerkt. »Ich seh hier nur Rollatoren.« Für die Neuen war das immer ein Schock, die vielen geparkten Rollatoren, die Gänge entlang oder im Rudel vor der Flügeltür zum Veranstaltungsraum. Bei aller Spötterei war Gisela jedoch froh, dass die »Residenz mit Herz« auch eines für Tiere hatte, für Kleintiere. Hamster, Vögel, Wohnungskatzen. »Bei uns sind auch die kleinen Freunde unserer Gäste willkommen.« So stand es im Prospekt, das in der Sitzecke der Empfangshalle auslag. Dort, auf dem Tisch mit den Prospekten und Illustrierten, hatten sie irgendwann den Bildband entdeckt. »Würde des Alters«.
Gisela hatte sich sofort hingesetzt, das Buch aufgeschlagen, vor- und zurückgeblättert. »Ich finde dich nicht. Hat der Journalist sich eigentlich noch einmal bei dir gemeldet?«
Marietta schüttelte mit dem Kopf. »Der hat schon beim Abschied so rumgedruckst.«
»Mach dir nichts draus«, sagte Gisela. »Mich hat er ja nicht mal gefragt. Vermutlich war ich zu jung.«
Vorm Fenster steht schwarz die Nacht. Sie schiebt im Schein der Lampe die Fotos auf dem Schreibtisch nebeneinander, Gisela in ihrem Ohrensessel neben Johann mit seinem Brummel.
Ihre älteste Tote. Und Johann, ihr jüngster.
Giselas Foto lehnt sie an die Schreibtischlampe. Johann und alle anderen legt sie in die Schublade zurück. Gesicht nach unten.
Sie hat alle überlebt.
Die Welt da draußen schläft. Nur in einigen der Flüchtlingscontainer ist noch Licht. Seit ein paar Wochen sieht sie es nachts vom Schreibtisch aus durch die Baumkronen schimmern. Die Menschen, die dort schlafen oder wach liegen, sie haben es herübergeschafft, über das Meer. Andere nicht, sie ertrinken, beim Umsteigen vom Zubringer auf den Fischkutter. Im Deutschlandfunk haben sie das gestern gesagt. Sie fallen ins Wasser, können nicht schwimmen. Sie werden zwischen den Bootsrümpfen zerquetscht. Zerquetscht. Da hatte sie ihr Marmeladenbrötchen weglegen müssen. Eine Frau aus Syrien hatte im Radio weinend davon erzählt, wie ihre kleine Tochter es nicht auf das Mutterboot geschafft hatte. Ein Kutter aus Holz, hatte der Reporter ergänzt, nicht mehr als eine Nussschale für Dutzende, die es damit über das Mittelmeer schaffen wollten.
Sie fasst in die weiche Wolle von Giselas Schal, hält ihn sich ans Gesicht, während sie nach drüben zu den Flüchtlingsunterkünften schaut. Sicher sind viele von denen, die jetzt dort in den Containern untergebracht sind, auch über das Meer gekommen. Für sie muss die Resi mit den aufragenden langen Fensterreihen in der Nacht aussehen wie ein Kreuzfahrtschiff, das mitten im Park angelegt hat. Mutterboot. Eigentlich ein schönes Wort. Muttermilch. Mutterliebe. Viele Kinder werden beim Umsteigen von ihren Familien getrennt, sagte der Reporter. Mutterboot – ein zynisches Wort.
Der Weg zurück zum Bett wird ihr lang. So müde ist sie. Bis sie endlich im Bett liegt und das Kopfteil sie vorsichtig hinunterlässt wie eine zerbrechliche Kostbarkeit. Sie denkt an Gisela, die in ihren letzten Wochen im Bett lag und immer hilfloser wurde, ihr weißes Haar so dünn und kurz, nicht mehr als ein Flaum, und ihr Gesicht, auch das immer kleiner und kleiner. Gisela, die zu schrumpfen schien, als wollte sie als Däumling zwischen den Blumen, die auf ihrer Bettwäsche blühten, verschwinden. Marietta saß an ihrem Bett, gab ihr mit der Schnabeltasse Wasser, las ihr vor, hörte, was sie noch zu sagen hatte, bis Gisela die Augen schloss, auf diese Art, die einen bang warten ließ auf ihren nächsten Atemzug. Erst dann ließ sie sie hinunter ins Liegen, so vorsichtig, als wäre sie ein Säugling und das Kopfteil die Hand einer Mutter, mit der sie ihr Baby stützt, während sie es in die Wiege legt.
Wiege. Mutterboot.
Kinder werden von ihren Müttern getrennt. Zwischen Bootsrümpfen zerquetscht. Ein zynisches Wort. Mutterboot.
Die Zwei-Uhr-Glocke hört sie noch.
Und dann nichts mehr.
Und dann das Eis, es knurrt, bevor es reißt, vor ihren Füßen frisst ein dünner Riss sich hindurch, sie muss ganz still stehen, unter ihr ist die See, ein dunkler Schlund. Das Eis bricht, ihr Herz rast, als wollte es davonlaufen aus ihrem Körper. Sie atmet und wartet. Ist wieder im Zimmer. Horcht in den Raum, durch die Wände hindurch zu den anderen hin. Die Resi ist kein Kreuzfahrtschiff. Die Resi ist ein Walfisch. Ein Walfisch, durch dessen Rachen sie alle gekrabbelt, in dessen Bauch sie alle geflüchtet sind. Ein riesiger, gestrandeter Walfisch.
2
Marietta liegt und lauscht. Mit einem Aufflattern in der Brust hört sie, wie die Morgenamsel singt. Jetzt ist sie wieder ein Mädchen. Die Amsel singt, und sie hört zu, während Großmutter unten in der Küche klappert. Vor dem offenen Fenster räkelt sich der Morgen. Die Luft ist noch kühl, doch im Bett ist ihr wohlig warm. Nach dem Frühstück wird sie in eine Decke gehüllt in der Hängematte unter den Kirschbäumen liegen. Ferien. Die Amsel ruft und fragt. Sie antwortet ihr in die Pausen hinein, die der Vogel lässt. Sie fragt auch etwas zurück. »Alle Tiere reden«, sagt Großmutter. »Wenn man zuhört.«
Ihr Tag schält sich nur langsam heraus.
Sie denkt an den Traum und an das Eis. Wie dünn es an manchen Stellen immer noch ist. Und wie nah in ihr alles beieinanderliegt.
Heute ist ihr Geburtstag.
Neunundneunzig.
Das schaffen die wenigsten.
Ungefähr so sagt es auch Frau Meier, während sie vom Blutdruckgerät Traumwerte abliest. »Fit für Ihren Ehrentag. Und gleich kommt die Presse.« Sie zieht die Manschette vorsichtig vom Arm. »Sie werden noch eine unserer Hundertjährigen!«
»Sofern ich den Tag heute überlebe. Den ganzen Budenzauber. Ich geh heute nicht raus.«
»Müssen Sie ja auch nicht«, sagt Frau Meier und zündet die Geburtstagskerze an. Ansonsten ist alles wie immer. Ein weißes Brötchen, Butter und Marmelade, Kaffee in der Thermoskanne. Sie ist noch im Morgenmantel. Das Kleid hat sie schon rausgelegt.
Frau Meier hilft ihr mit dem Reißverschluss. Streicht mit der Hand den Stoff glatt und den Rücken hinab. Sie schließt die Augen, für diese Berührung, dieses Streicheln, das sie dem Tun einer Pflegerin abluchst.
»Hübsch sehen Sie aus, in diesem Kleid, immer noch so schlank. Die Zeitung macht sicher auch ein Foto.« Sie schaut auf Mariettas Füße. »Die Wollstrümpfe bleiben an.« Es ist eher eine Feststellung als eine Frage.
»Ich zieh sie mir ja nicht über den Kopf«, antwortet sie und denkt wieder an das Eis in ihrem Traum.
Vor der Tür steht Frau Kühn aus der Verwaltung. Sie hat ein Klemmbrett in der Hand, wie immer, wenn die Resi in die Zeitung kommt. Neben ihr ein Mädchen.
Mädchen, das Wort kommt ihr so.
»Frau Stein, unsere Neunundneunzigjährige«, sagt die Kühn.
Als sie im Wohnzimmer sind, stellt das Mädchen den Rucksack ab, ein schwarzes Plastikding. Die Haare hängen ihr in verfilzten, dicken Strähnen ins Gesicht.
»Herzlichen Glückwunsch!« Sie reicht ihr forsch die Hand, aber dann fällt der Druck doch zaghaft aus, wie gebremst. »Frau Bern, ich bin Volontärin beim Wochenblatt.«
»Drücken Sie ruhig zu. Meine Knöchelchen sind noch nicht morsch«, sagt sie.
Frau Kühn legt dem Mädchen die Hand auf die Schulter. »Ich lass Sie dann mal allein.«
Also geht Marietta zum Tisch, sie hat alles gerichtet, zwei Tassen und auf dem Stövchen ihre Kanne aus Glas. »Möchten Sie Tee?«
Das Mädchen nickt, setzt sich, zieht den Rucksack heran und beugt sich darüber, die Filzlocken fallen wieder nach vorn übers Gesicht. Sie nimmt eine Kamera und noch ein schwarzes Teil heraus, legt beides auf den Tisch. Dazu Block und Stift.
Marietta pustet in ihren Tee. Die Wärme der Dampfwölkchen legt sich auf ihre Wangen, verbreitet den Duft von Jasmin. Jetzt schaut das Mädchen sich um. Ein Gesicht wie bei Botticelli, die Haut ist sehr hell und sehr rein. Umrahmt vom stumpfen Haar wie von einem Widerspruch. Ihr Blick wandert vom Schreibtisch zur Couch, weiter zum Bücherregal. Bleibt dort hängen. Wandert zurück zu ihr.
»Und?«, fragt Marietta. »Ich meine, was sehen Sie hier – im Wohnzimmer einer Greisin?«
»Jede Menge Bücher. Keine Fotos.« Sie greift zum Block, tippt mit dem Finger auf die Notizen. »Ich hab Fragen dabei.«
»Meine Fotos sind da drüben. In der Schreibtischschublade.«
»Wollten Sie gar keine aufhängen? Oder aufstellen?«
»Nein. Man muss Erinnerungen auch wieder weglegen können.« Marietta stellt ihre Tasse zurück auf den Tisch. »Sind das Ihre Fragen? Oder die vom Chef?«
Das Mädchen schüttelt den Kopf, was nicht wirklich eine Antwort ist. »Meine Wohnung hängt voll mit Fotos. Meinen Fotos.«
»Ihren Fotos?«, fragt Marietta.
»Ich fotografiere viel.« Mit dem Handrücken streicht sie sich eine ihrer Haarsträhnen aus der Stirn. »Also, nicht nur für die Redaktion. Für mich.«
»Was denn?«
»Menschen.«
»Aha.«
»Normale Menschen.«
Marietta lacht. »Da sind Sie bei einer Neunundneunzigjährigen aber falsch.«
»Meinen Sie?« Der Blick des Mädchens wandert jetzt zur Kamera auf dem Tisch, verharrt dort. Gedankenverlorene Stille. Und ein Ausdruck im Gesicht – wieder fühlt sie sich an Botticellis Engel erinnert. »Mein Vater ist Fotograf«, sagt das Mädchen schließlich, »hauptsächlich für Designermode. Sein Atelier hängt voll mit seinen …« Kurz legt sie den Kopf in den Nacken, schaut zur Decke, dann wieder zu ihr. »Mit seinen Tussis.«
»Und Ihre Wohnung hängt voll mit …?«
»Wohnungslosen. Müllmännern. Sehr gebrechlichen …«
»Alten?«
»Die auch«, sagt das Mädchen. Wie klar und geradeheraus ihr Blick dabei ist. Freimütig, denkt Marietta, und dann denkt sie an Gisela und ihren Sohn. Und dann an die alte Frau und die Queen.
»Das erinnert mich an ein Erlebnis mit der Queen.«
»Der Queen?« Das Mädchen greift zum Stift, schlägt ein neues Blatt Papier auf. »Der Königin von England?«
»Genau der. Auf einem der Ausflüge, die man hier für uns Alte veranstaltet. Früher habe ich die manchmal mitgemacht. Einmal ging es mit dem Bus zu einer Waldbühne. Götz von Berlichingen. Sagt Ihnen der etwas?«
Achselzucken.
»Goethe. Egal. Zwischen Parkplatz und Bühne mussten wir zu Fuß durch ein kleines Dorf. Und dort, auf einer Bank direkt an der Straße, dort saß Queen Elizabeth.«
Den Stift hält das Mädchen jetzt regungslos in der Luft, während sie Marietta skeptisch anschaut.
»Eine Skulptur. Lebensgroß und täuschend echt. Mitsamt Täschchen und Hut und weißem, onduliertem Haar. Natürlich war dann kein Halten mehr. Jeder ließ sich mit der Queen fotografieren. Einer drückte ihr sogar einen Kuss auf die Wange. Nicht, dass ich keinen Fotoapparat dabeihatte. Aber ich fand das …«, Marietta schüttelt mit dem Kopf, »… irgendwie kindisch. Zum Glück hab ich die alte Frau auf der anderen Straßenseite entdeckt, auf einer Bank sitzend, im Kittel und das Haar streng zu einem winzigen Dutt gestrafft.«
»Auch aus Plastik?«, fragt das Mädchen.
»Nein. Die war echt. Sie saß da und schaute uns zu. Also bin ich rüber und hab mich zu ihr gesetzt.«
Die Teekanne ist fast leer, aber für eine Tasse reicht es noch. Sie gießt sich nach. Pustet. Nippt. Dagegen hat das Mädchen seinen Tee noch nicht angerührt, in ihrem Blick liegt nun etwas Ratloses. Also fährt sie fort. Dass sie ein paar Minuten schweigend dem Treiben auf der anderen Straßenseite zuschauten. Bis die Frau – die wirklich uralt zu sein schien, so runzlig war ihr Gesicht –, bis sie schließlich sagte: Ich sitze hier auch jeden Tag. Aber mich hat noch nie jemand fotografiert.
Sie fand, dass das traurig klang. Also holte sie ihre Kamera aus der Tasche und stand auf. Bitte lächeln, bat sie die Frau.
»Und das tat sie. Zahnlos. Und zeitlos. Ein zeitloses Strahlen.«
»Bestimmt ein cooles Foto.« Endlich nimmt das Mädchen doch einen Schluck aus ihrer Tasse. »Meine Mutter hat mich kürzlich gefragt, warum ich eigentlich nie schöne und junge Menschen fotografiere.« Die Tasse umfasst sie nun mit beiden Händen, als suchte sie Wärme, dabei ist der Tee vermutlich schon kalt. »Sie ist … war mal ein gefragtes Model.« Das Mädchen stellt ihre Tasse wieder ab. »Über dem Esstisch meiner Eltern hängt ein riesiges Foto von ihr. Von früher.« Mit einem Finger streicht sie über den Block. Rauf und runter. Von links nach rechts. Im Kreis herum. Wie kindlich das wirkt, dieses Nachdenken mit der Hand. Und ihr Plappern über die Eltern. Warum erzählt sie ihr das? Sie ist also Tochter eines Modefotografen und eines Models. Und ihre Familienmahlzeiten waren überstrahlt von der Schönheit der Mutter. Schweigsame Mahlzeiten, stellt Marietta sich vor.
»Sprechen Sie mit den Menschen, bevor Sie sie fotografieren?«, fragt sie. »Ich meine, lernen Sie sie kennen?«
»Meistens erst nachher«, antwortet das Mädchen. »Ich möchte zeigen, was ich sehe. Ich meine, was ich sehe, ohne viel zu wissen über die Person. Und ohne zu urteilen. Und bevor die Leute anfangen, etwas darstellen zu wollen.«
»Bewerten wir nicht immer?«, fragt Marietta. »Weil wir gar nicht anders können?«
Darauf antwortet sie nicht. Ihr Finger mäandert jetzt wieder über das Papier. Das Mädchen hat etwas an sich, das schwer zu greifen ist und Marietta neugierig macht. Etwas kindlich Unbefangenes und gleichzeig sehr Bewusstes. Mit ihrem Wunsch, vorurteilsfrei zu bleiben. Was ja hieße, alles auf eine nahezu unpersönliche Art zeigen zu wollen: Armut. Alter. Dreck.
Wie jung sie dabei noch ist. Und wie ich das Gespräch genieße, denkt Marietta.
Jetzt schaut das Mädchen sie wieder an. »Eigentlich möchte ich auch Fotografin werden.«
»Eigentlich?«
»Keine Ahnung, ob jemand meine Fotos sehen will.«
»Mich haben Sie neugierig gemacht.«
»Ja?« Das Mädchen nimmt die Kamera vom Tisch, hält sie hoch vor ihr Gesicht. »Darf ich? Sie bleiben einfach sitzen. Und trinken Tee.«
Jetzt bin ich gespannt, denkt Marietta und nickt.
Wie eine Katze schleicht das Mädchen um sie herum, immer die Kamera vor dem Gesicht. Geht in die Hocke, fotografiert von unten hoch, was auch immer von dort aus zu sehen ist. Steht auf. Streicht herum. Schaut durch die Kamera. Nimmt sie wieder herunter. Schleicht weiter. Schaut hindurch. Sieht. Sie. Mit dem Auge der Kamera. Kann ein Blick wärmen? Wie ein Sonnenstrahl? Herr Paul fällt ihr ein, und was er erzählt hat. Wie er sich jeden Samstag in der Kabine fotografieren lässt. Sie wissen schon, der Automat für die Passfotos, gleich neben der Residenz-Apotheke. Warum er das mache? Einfach so. Und nein, die Fotos hebe er nicht auf, darum gehe es ja nicht. Worum es denn gehe, hatte sie ihn gefragt und keine Antwort bekommen. Vielleicht empfand Herr Paul es ja ähnlich wie sie gerade: Sie genießt es, fotografiert zu werden. So viel Aufmerksamkeit für eine verschrumpelte Greisin. Unbefangene Aufmerksamkeit. Unbefangen und neutral. Wie ein Automat. Obwohl sie das dem Mädchen nicht ganz abnimmt.
Die schaut mittlerweile nach unten, die Kamera vor sich wie ein Buch, die Zungenspitze erscheint zwischen den Schneidezähnen.
»Sind die Bilder da schon zu sehen?«
»Ja.«
Sie blättert also. Blättert in den Augenblicken, die nun herausgehoben sind aus der Zeit.
»Darf ich?« Schon nimmt das Mädchen ihre Hand. Legt sie behutsam auf den Tisch, drapiert sie wie einen kostbaren Gegenstand. Und dabei sieht ihre Haut doch aus wie mit brauner Soße bekleckertes Pergamentpapier. Hauchdünn. Aber das Mädchen sieht dort wohl etwas. Macht sich lang wie zum Sprung, das Auge der Kamera hoch über dem Tisch. Als sie sie wieder absetzt, begegnen sich für einen Moment ihre Blicke. »Ich heiße übrigens Julia.« Und schon hebt sie die Kamera erneut vors Gesicht. Ein bisschen forsch ist das Mädchen ja schon, hat scheinbar nur ihre Fotos im Kopf. Aber vielleicht braucht sie das ja, um so hinzusehen, wie sie es für richtig hält. Um zu bezeugen. Zu bezeugen. Das Wort kommt von weit her. Tief in ihr beginnt eine Sehnsucht zu flattern, wie ein Falter, der schon zu lange im Spinnennetz hängt. Wie von selbst wandern ihre Hände zu ihren Unterschenkeln, an denen die Strümpfe ein wenig heruntergerutscht sind. Sie zieht sie wieder hinauf bis zu den Knien.
»Die Strümpfe«, sagt sie, »die Wollstrümpfe können Sie ruhig auch festhalten. An den Füßen wurde mir nie wieder warm.«
»Ach ja?« Das Mädchen kniet sich vor ihr auf den Teppich, beugt sich nach vorne, sodass ihr Gesicht vollends hinter den Haarsträhnen verschwindet. Marietta sieht es vor sich. Wie sie zu Tisch sitzen. Ein Vater, der mit seiner Kamera Tussis als Sternchen an den Modehimmel zaubert. Eine Mutter, die auch einmal weit oben gestrahlt hat und jetzt nur noch auf einem Foto über dem Esstisch. Und zwischen ihnen sitzt ihre Tochter. Julia. Ein Botticelli-Engel, der entschieden hat, sich nicht mehr zu kämmen. Ein Mädchen, das weiß, was es will. Eigentlich.
Julias Haare berühren jetzt fast ihre Hand.
Und dann ist Julia fort. Marietta liegt auf der Couch, die Augen geschlossen. Den Rücken hinunter spürt sie den Reißverschluss ihres Kleids und dann eine Hand. Elias. Wenn sie sich zur Begrüßung umarmten, wenn er ihr erst seine Hand in den Nacken legte und dann langsam hinunterstrich, manchmal bis zum Po, all die ungezählten Male eingesunken in eine einzige Spur, eine einzige Erinnerung. Nur eine Erinnerung. In einer der letzten Nächte hat sie wieder von ihm geträumt. Elias stand neben ihrem Bett, schweigend stand er da und regte sich nicht. »Fass mich an«, sagte sie. »Fass mich bitte an.« Sie wurde wach, die Worte hingen noch in der Luft, die Laute in ihrem Hals, sie musste es laut gesprochen haben. »Fass mich bitte an.«
An den Händen spürt sie den kratzigen Wollstoff der Couch. Der grau karierte Stoff, der nun auch schon zwanzig Jahre alt ist, so alt wie ihr Leben in der Resi. Darunter die Polsterung, die noch älter ist und erhalten blieb, und mit ihr – das stellt sie sich so vor, als hätte die Couch einen verborgenen Kern – mit ihr als das, was Elias’ Patienten unter den Augen ihres Analytikers ausgegraben und freigelegt hatten.
Sie streicht mit der Hand über den Stoff.
Auslese hatte sie es genannt. Als sie die zweihundert Quadratmeter Wohnfläche in der Waldstraße auf fünfundvierzig Quadratmeter Resi eindampfte. Auslese halten. Wie wenig ihr Herz an den meisten Dingen hing. Oder wie sehr an nur wenigen. An ihren Büchern. Ihrem Schreibtisch. Den Fotos. Von Elias’ Dingen schafften es nur ein paar aus seinem Sprechzimmer bis hierher: die Couch, die gesammelten Bände Freud, der völlig zerlesene Ferenczi, die Mitscherlichs. Als bliebe Elias ihr gerade dort nah, wozu sie zu seinen Lebzeiten nur eingeschränkten Zutritt hatte, in seinem Sprech- und Wartezimmer, aus dem er nachmittags zu ihr in die Küche kam. Mit diesem verhangenen Blick, in der kurzen Zeit zwischen zwei Patienten oder auch, wenn er das hatte, was er ein Loch im Kalender nannte. Wenn er dann wortlos mit Teekanne und Butterbrot in der Tür stand, kam er ihr vor wie ein Tier, das Futter in seine Höhle zerrt. »Hauptsache, du findest heute Abend wieder heraus«, sagte sie dann, bevor er wieder in seiner Praxis verschwand, im Anbau, der über ihren Hausflur erreichbar war.
Hätte sie die alte Balgenkamera mitnehmen sollen? So wie sie auf einem dreibeinigen Holzstativ am Fußende der Couch gestanden hatte, konnten Elias’ Patienten sich zweifach gesehen fühlen, vom Auge ihres Analytikers und von dem der Kamera.
Später fragte sie sich auch, warum die Couch und nicht seinen Sessel.
Wenn sie sich wie jetzt zur Mittagsruhe auf die Couch legt, ist ihr manchmal, als säße Elias in seinem Sessel hinter ihr, als wachte er aus dem Hintergrund über sie, wie Analytiker es eben tun. Aber heute ist da das Mädchen mit dem besonderen Blick. Unter ihren geschlossenen Lidern spürt sie Julia, als schliche die noch immer durchs Zimmer, die Kamera vor dem Gesicht. Und dabei war sie ja nicht gekommen, um endlos zu fotografieren, sondern um Fragen zu stellen, um etwas für die Zeitung zu schreiben. »Ich habe Sie noch gar nichts gefragt«, hatte Julia gesagt, als sie schließlich neben dem Rucksack gekniet und die Kamera vorsichtig hineingelegt hatte. »Ich könnte Ihnen erzählen, wie es ist, so alt zu sein«, hatte Marietta ihr vorgeschlagen und gleich weitergeredet, und Julia war aufgestanden und hatte zum Stift gegriffen. »Mein Verfallsdatum ist ja längst abgelaufen«, sagte sie lachend, aber das Mädchen lachte nicht mit. »Das Leben schmeckt mir noch immer, trotzdem, mit neunundneunzig bist du nun einmal überfällig. Übrig geblieben. Als ob du allein auf einer Parkbank sitzt, du hast dort eine Verabredung mit dem Tod, er verspätet sich. Du sitzt da, Stunde um Stunde, und du weißt: Jeden Moment steht er vor dir, aber du siehst ihn nicht kommen.«
»Wow«, sagte Julia. »Das zitiere ich.«
Marietta fröstelt. Sie zieht die Decke bis zum Kinn, sie fühlt sich matt und sehr wach zugleich. Sie hatten sich eigentlich schon verabschiedet, als Julia noch einen Blick aus dem Fenster warf: »Seit wann stehen die da, die Flüchtlingscontainer?« Und dann die Parkbank entdeckte. Und noch einmal Wow sagte. »Das perfekte Motiv zu Ihrem Zitat. Schaffen Sie es hinunter? Wir gehen langsam, nehmen den Aufzug, ich helfe Ihnen.«
»Na gut«, hatte sie gesagt. Dort im Aufzug, im ersten Stock, war der krumme Mann zugestiegen, den Rücken so zur Erde gekrümmt, als suchte er etwas, ununterbrochen, und fände nie, was er sucht. Und sein Blick, von unten hoch, die Augäpfel verdreht. Wie ein Bettler am Straßenrand. Man schaut hier schnell weg, wenn er durch das Restaurant schlurft oder über den Flur, berührt ihn nur kurz mit dem Blick, man verbrennt sich an ihm. Aber nicht das Mädchen. Julias Blick ruhte auf ihm, auf diese stille, unbefangene Art, bis er ausstieg, und Marietta hatte sich gefragt, wie es für ihn wohl gewesen war, ob es für ihn ein guter oder ein beschämender Blick gewesen war. Als der Mann fort war, schaute das Mädchen zu Boden, als spürte sie etwas nach, und dann trafen sich ihre Blicke. Sie lächelten beide.
Der Weg wurde ihr lang bis zur Bank, bis sie unter dem Blätterschirm der Kastanie saß. Hinter dem Rot der Rhododendren und dem Gehölz war das Feld, das vor einigen Wochen noch brach gelegen hatte und nun bestellt war mit langen Reihen Containern. Julia kauerte einige Meter entfernt im Gras. »Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier auf der Parkbank, Stunde um Stunde, Sie warten, Sie schauen in die Ferne.« Julia schlich nun über das Gras wie vorher durchs Zimmer. Sie kniete sich hin, dann wieder fotografierte sie stehend, schließlich stellte sie sich sogar auf die Sitzfläche der Bank und fotografierte von oben herab. Da wusste Marietta, es ging ihr schon nicht mehr um das Foto für die Zeitung. Allmählich wurde es ihr zu viel, sie war müde und musste den langen Weg noch zurück. »Also …« – »Und jetzt bitte einmal den Kopf dorthin drehen, zu den Bäumen.« Gerade wollte sie sagen, jetzt ist es genug, als da der Junge war. Regungslos stand er da und schaute sie an. Sie hatte ihn nicht kommen sehen. Seine Augen sehr dunkel, so wie sein Haar, ganz schwarz. Marietta sitzt da und hält still. Der Junge trägt eine blaue Jogginghose, sie ist mit Flecken übersät, seine Arme hängen herab wie vergessen. Jetzt macht er einen Schritt zurück. Julia. Er schaut Julia an, die jetzt die Kamera ansetzt. Der Junge reißt die Hände hoch, hält sie abwehrend vor sein Gesicht, dreht sich um und läuft weg. Fünf oder sechs Jahre alt, vielleicht auch sieben. Aber älter nicht.
3
Sie hatten eben Besuch?«, fragt Herr Groß, der klein ist und in der Resi das Sagen hat. Auch jetzt wirkt er klein, als er neben Frau Kühn steht und Marietta rote Rosen überreicht. »Im Namen des ganzen Residenz-Teams, neun Stück.« Er zwinkert ihr zu. »Neunundneunzig sprengen ja etwas den Rahmen.«
Das wäre auch eine Antwort gewesen für Julia. Mit neunundneunzig sprengst du den Rahmen. Sie nickt ein Dankeschön und fragt: »Möchten Sie Tee?«
»Erst das Foto«, sagt Frau Kühn. »Für unser Magazin.«
Noch ein Foto.
»Hierhin schauen«, sagt Frau Kühn. »Und lächeln.« Sie bekommt die Rosen ein zweites Mal überreicht.
Als sie sitzen, holt Frau Kühn ein Päckchen aus ihrer Tasche. »Ein Geburtstagspräsent.«
»Noch eines.« Marietta zieht die Schleife auf. »Ein Buch?« Nein, eine Kladde, mit einfarbig grauem Einband. Sie blättert sie auf wie ein Daumenkino. Die Seiten sind leer.
»Platz für Notizen«, sagt Frau Kühn. »Man sagte mir, Sie schreiben noch.«
Noch. Sagt sie so dahin.
»Und Sie lesen offenbar auch viel.« Herr Groß zeigt auf das Bücherregal. »All die bunten Zettelchen, sind das Lesezeichen?«
Sie wird ihm jetzt nicht ihr System erklären. Aber er sieht ja freundlich aus, wie er hier sitzt und zögerlich an der Teetasse nippt, als hätte er lieber Kaffee. Also erzählt sie ihm von der Augen-OP, dass ihr grauer Star danach weitergezogen sei zur nächsten Alten und mit ihm der trübe Blick auf die Welt und auf die Schrift und dass das vielleicht auch kein Leben mehr wäre für sie, ohne Bücher. Und ja, dass sie es darum mit Sorge beobachte, wie rasch sie beim Lesen ermüde.
Auch das hier ist ihr längst zu viel. Gisela fehlt am Tisch, sie schaut nur vom Schreibtisch aus zu. Und dann, als Frau Kühn und Herr Groß gegangen sind, nimmt sie Giselas Foto, hält es auf Armlänge vor sich. Hört ihre Stimme, aus dem Ohrensessel heraus: Verfallsdatum, Verabredung mit dem Tod. Ganz schön dick aufgetragen bei dem Mädchen! So etwas hätte sie gesagt. Der raue Klang ihrer Stimme. Er hatte zu den grellen Stoffen, mit denen sie sich umgab, nie recht passen wollen. Ach, Gisela. Sie legt das Foto zwischen die Seiten der Kladde.