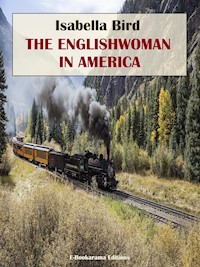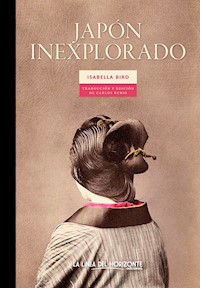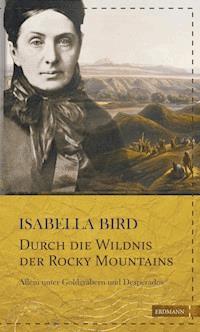
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Erdmann in der marixverlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die kühne Reisende
- Sprache: Deutsch
Die Engländerin Isabella Bird ist 23 Jahre alt, als ein Arzt ihr Reisen gegen ein hartnäckiges Rückenleiden empfiehlt. Ihr Vater schickt sie 1854 mit dem Schiff zu Verwandten nach Nordamerika. Von dort aus zieht Isabella auf eigene Faust weiter. Sie fährt von San Francisco mit der Eisenbahn zum Lake Tahoe, schwingt sich auf ein Pferd und reitet im Cowboysattel durch unerforschte Bergwelten und erobert die Rocky Mountains. Ein einziger wilder Ritt durch raue, gänzlich unzivilisierte Gegenden, in die sich bisher kaum ein Mann, geschweige denn eine Frau gewagt hatte. In England noch stets kränkelnd, meistert Isabella in der abenteuerlichen Fremde alle Herausforderungen bei bester Gesundheit. Eine Frau mit Fernweh! Isabella Birds Reisebeschreibungen werden zu Klassikern der Reiseliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE KÜHNE REISENDE
Isabella Bird, Entdeckerin, Schriftstellerin, Fotografin, wurde 1831 in der englischen Grafschaft Yorkshire geboren. Die Tochter eines Pastors, die von klein auf mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, entdeckte schon früh die heilsame Wirkung des Reisens – je unkonventioneller, desto besser. Reisen, über die sie acht Bücher schrieb, führten sie u. a. nach Japan, Tibet, Persien und Kurdistan, nach Neuseeland, Hawaii und in die Vereinigten Staaten. »A Lady’s Life in the Rocky Mountains«, erschienen 1879 bei John Murray, New York und London, wurde sofort zum Bestseller. Heute zählt das Buch zu den Klassikern unter den Reiseberichten. 1892 wurde Isabella Bird als erste Frau in die Royal Geographical Society aufgenommen. Als sie 1904 im Alter von 73 Jahren in Edinburgh starb, hatte sie soeben die Koffer für eine Reise nach China gepackt.
Klaudia Ruschkowski, Autorin, Kuratorin, Dramaturgin und Übersetzerin, lebt in Volterra, Italien, und in Berlin. Sie übersetzt aus dem Italienischen und Englischen, zuletzt u. a. Etel Adnan, Giuseppe Zigaina, Vincenzo Latronico.
Susanne Gretter studierte Anglistik, Romanistik und Politische Wissenschaft in Tübingen und Berlin. Sie lebt und arbeitet als Verlagslektorin in Berlin. Sie ist Herausgeberin der Reihe DIE KÜHNE REISENDE.
Isabella Bird
Durch die Wildnisder Rocky Mountains
Allein unter Goldgräbern undDesperados
Aus dem Englischen neu übersetzt und mit einemVorwort von Klaudia Ruschkowski
Isabella Bird (1831–1904)
»Estes Park ist mein Land. Es ist unerschlossen,ein ›Niemandsland‹, aber ich habe es mir erobert:seine wilden Morgenröten,seine unvergleichlichen Sonnenuntergänge,seine herrliche Dämmerung,seine gleißenden Mittagsstunden,seine wütenden Hurrikans.«
Isabella Bird
INHALT
VORWORT
von Klaudia Ruschkowski
1. BRIEFVON SAN FRANCISCO ZUM LAKE TAHOE
2. BRIEFTRUCKEE UND DER DONNER LAKE
3. BRIEFMIT DEM PAZIFIK-EXPRESS NACH CHEYENNE, VON GREELEY NACH FORT COLLINS
4. BRIEFDURCH DIE FOOT HILLS IN DIE WILDNIS DER ROCKY MOUNTAINS
5. BRIEFDAS HARTE LEBEN IM »GROSSEN EINSAMEN LAND«
6. BRIEFEINE VÖLLIG ANDERE WELT, LONGMONT, ENDLICH IN ESTES PARK
7. BRIEFDIE BESTEIGUNG DES LONGS PEAK
8. BRIEFLEBEN IN ESTES PARK
9. BRIEFVIEHTREIBEN, SCHNEESTÜRME, AUF BIRDIE DURCH COLORADO
10. BRIEFWUNDER ÜBER WUNDER, DIE PARKS VON COLORADO
11. BRIEFEISWÜSTEN, GOLDGRÄBER UND DER SNOWY RANGE
12. BRIEFVON DEER VALLEY NACH DENVER, WHISKEY UND LYNCHJUSTIZ
13. BRIEFMIT DEM LETZTEN CENT ZURÜCK NACH ESTES PARK
14. BRIEFDIE TRAURIGE GESCHICHTE EINES DESPERADOS, WÖLFE UND HARTE ZEITEN
15. BRIEFTHANKSGIVING IN ESTES PARK
16. BRIEFLOWER CANYON UND DEVIL’S GATE, EVANS UND MOUNTAIN JIM
17. BRIEFABSCHIED VON ESTES PARK, DURCH DIE PRÄRIE NACH NAMAQUA
VORWORT
Isabella war kaum vier Jahre alt, da saß sie schon auf dem Pferd, vor ihrem Vater, und begleitete ihn auf seiner täglichen Runde durch die Gemeinde. Pastor Edward Bird und seine Frau Dora folgten den Ratschlägen des Arztes, ihre älteste Tochter, die von klein auf an einer Wirbelsäulenerkrankung litt, viel an der frischen Luft und in Bewegung zu halten. Mit sechs ritt Isabella ihr eigenes Pferd.
Isabella Lucy Bird kam am 15. Oktober 1831 in Borough-bridge Hall zur Welt, einem kleinen Ort in der englischen Grafschaft Yorkshire. Im darauffolgenden Frühjahr erhielt ihr Vater eine Stelle als Vikar in Maidenhead bei London, doch schon zwei Jahre später nahm er, vom Lärmen der Stadt gesundheitlich angegriffen, eine Pfarrstelle im ruhigen, ländlichen Tattenhall südöstlich von Chester an. Hier, inmitten von Gärten, Wiesen und Weiden, wuchsen Isabella und ihre fünf Jahre jüngere Schwester Henrietta, genannt Hennie, auf. Die Ausritte mit dem Vater wurden bestimmend für Isabellas Form der Wahrnehmung, für ihre Sicht auf die Welt. Er lenkte die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Vielfalt der Natur, ließ es Bäume, Blumen und Gräser bestimmen, zeigte ihm die umliegenden Farmen mit den Ställen für das Vieh, führte es in die Wirtschaftsgebäude, erklärte ihm jedes einzelne Ding und befragte es minutiös nach allem, was es gesehen hatte: »Während wir daher ritten, ließ er mich das Getreide auf den Feldern, die Schwungrichtung der Wasserräder oder die Aufhängung der Gatter beschreiben, die Insekten benennen, die wir sahen, und die Tiere, denen wir begegneten.« Die leidenschaftliche Liebe zur Natur, die auch in ihren detaillierten Landschaftsbeschreibungen zum Ausdruck kommt, sollte Isabella ihr Leben lang begleiten.
Edward Bird, der nach dem Willen seines Vaters Rechtswissenschaften studiert und 1825 eine Anwaltskanzlei in Kalkutta übernommen hatte, war vier Jahre später, nach dem Tod seiner jungen Frau und seines Erstgeborenen, als gebrochener Mann nach England zurückgekehrt. Er fand Trost in Gott. Nachdem er 1830 die Priesterweihen der anglikanischen Kirche erhalten hatte, verschrieb er sich der Verbreitung des »rechten Glaubens«. Im selben Jahr heiratete er in Boroughbridge Isabellas Mutter, Dora Lawson, eine taktvolle, gebildete, reservierte Frau, die sich in der Sonntagsschule engagierte und die Erziehung ihrer beiden Kinder selbst in die Hand nahm: »Niemand war in der Lage, so zu unterrichten wie meine Mutter. Alles erschien so wunderbar und interessant, wir saßen wie verzaubert, wenn sie uns die Dinge erklärte.« Von beiden Eltern erbte Isabella einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, vom Vater und den Großeltern väterlicherseits eine Form von missionarischer Religiosität, die sie kurz vor ihrem Lebensende veranlasste, an das christliche England zu appellieren, »in die heidnische Welt zu ziehen und deren unglückliche Millionen dem Erlöser zuzuführen«.
Isabella stieß bereits als Kind mit ihren religiösen, sozialen und politischen Überlegungen bei Familie und Freunden auf Gehör und sorgte für Erstaunen. Da sie häufig krank war und immer wieder für längere Zeiten das Bett hüten musste, las sie viel, interessierte sich für Naturwissenschaft und Ökonomie und verschlang historische Bücher, darunter Archibald Alisons Schriften zur Französischen Revolution. Querelen um sein scharfes Verbot der Sonntagsarbeit veranlassten Edward Bird um 1842, Tattenhall zu verlassen und eine Pfarrstelle in Birmingham anzunehmen. Isabella hatte die Pflicht, in der Sonntagsschule zu unterrichten. Sie machte das Beste daraus, indem sie, die recht gern sang, einen Chor gründete. Zu jener Zeit litt sie unter furchtbaren Rückenschmerzen, hatte Abszesse an den Füßen und konnte kaum laufen. Allen Krankheiten und Gebrechen zum Trotz bildete sie sich unaufhörlich weiter, schlug in einer Gesellschaft, die einer intelligenten, ambitionierten jungen Frau wenig Möglichkeiten bot, konsequent ihren eigenen Weg ein und begann zu schreiben. Mit sechzehn verfasste sie ihren ersten Essay, eine Analyse von Freihandel und Protektionismus, der in einer kleinen Privatauflage in Huntingdon erschien.
1850 wurde ihr ein Tumor an der Wirbelsäule entfernt. Die Operation gelang nur teilweise, Isabella litt an Schlaflosigkeit und Depressionen. Die nächsten Sommer verbrachte sie im schottischen Hochland, doch ihr Zustand besserte sich erst, als ihr Vater sie 1854 auf ärztlichen Rat hin auf eine Seereise schickte, zu Verwandten nach Kanada. Ausgestattet mit hundert Pfund Sterling nutzte sie die Gelegenheit zu einer mehrmonatigen Tour durch die Vereinigten Staaten und den Osten Kanadas, sah Boston, Chicago und Detroit, Toronto und Montreal, verbrachte einige Wochen auf Prince Edward Island vor der kanadischen Küste, reiste durch Cincinnati und fuhr den Mississippi entlang. Die Briefe, die sie an ihre Schwester Hennie schickte, bildeten die Basis für ihr erstes Reisebuch, »The Englishwoman in America«. Isabella schrieb es bei Nacht, eine Gewohnheit, die sie beibehalten sollte. Es erschien im Januar 1856 in dem angesehenen Verlag von John Murray, New York und London, und erhielt begeisterte Rezensionen. Die erste Auflage war bereits im selben Jahr vergriffen, und Isabella bekam von Murray einen beachtlichen Scheck, ihr erstes Einkommen als Schriftstellerin. Diese frühe Reise, der in den nächsten Jahren mehrere andere nach Nordamerika und in den Mittelmeerraum folgten, war ein Vorgeschmack auf die Art von furchtlosem, unkonventionellem Reisen, wie Isabella es sich vorstellte, das Initial zur Veränderung ihres Lebens. Isabella, kaum größer als einen Meter fünfzig, scharfsinnig und gebildet, humorvoll, mitunter sarkastisch, ebenso schlagfertig wie mutig, geplagt von Schmerzen und depressiven Schüben, zuweilen verzweifelt, ja lebensmüde, sollte durch das Reisen der viktorianischen Enge, die ihr die Luft zum Atmen nahm, entkommen und zu sich selbst finden. Indem sie sich schwer zugänglichen Landstrichen aussetzte, gewann sie an physischer Kraft und geistiger Klarheit.
Nach dem Tod des Vaters 1858 zogen Isabella und ihre geliebte Schwester Hennie mit der Mutter nach Edinburgh und verbrachten einige Monate im schottischen Hochland. Dort verfasste Isabella, sie hatte es dem Vater versprochen, einen Essay über die Aspekte der Religion in den Vereinigten Staaten, der 1859 in Buchform erschien. Sie unternahm Touren durch die Highlands, forschte zu Archäologie und Geschichte, Chemie und Biologie und schrieb neben ihren Büchern auch Artikel für verschiedene Zeitschriften, unter anderem das in London erscheinende vielgelesene Wochenmagazin »The Leisure Hour«, wodurch sie ihren Lebensunterhalt bestritt. Mit ihrer Gesundheit ging es jedoch immer weiter bergab. »Ich fühle mich«, notierte sie 1864, »als verginge mein Leben mit der unwürdigen Beschäftigung, mich ausschließlich um mich selbst zu kümmern, und stelle fest, dass ich Gefahr laufe, in vollkommener Selbstbezogenheit zu verkrusten.« Ihre Krankheit ermöglichte es ihr eben auch, ungeliebten gesellschaftlichen Pflichten und langweiligen Menschen aus dem Weg zu gehen, sich früh zurückzuziehen, nachts zu schreiben, spät aufzustehen. Sie isolierte sich mehr und mehr, legte ihre unbändige Vitalität regelrecht still.
Der Knoten platzte 1872, Isabella war vierzig Jahre alt. Am 11. Juli brach sie auf Drängen ihres Arztes von Edinburgh aus zu einer Reise auf, die achtzehn Monate dauern sollte, verzweifelt über ihre Schwäche, doch diesmal fest entschlossen, über sich selbst hinauszuwachsen. Das erste Ziel: Australien. Dora Bird war 1868 gestorben. Zurück im westschottischen Tobermory blieb Henrietta, die Empfängerin sämtlicher Briefe, die Isabella als Fundus für ihre folgenden Bücher dienten. Im September zog sie sich auf See eine schwere Lungenentzündung zu. Man fürchtete um ihr Leben, doch sie erholte sich und ging am 5. Oktober in Melbourne an Land. Fast zwei Monate durchquerte sie den Südwesten Australiens, unternahm Ausflüge in den australischen Busch und erforschte die dortige Pflanzenwelt. An Bord eines kleinen, mit Menschen und Tieren überfüllten Dampfschiffs fuhr sie Ende November über die Tasmansee weiter nach Invercargill, einem Hafen an der Südspitze Neuseelands, getrieben von der Sehnsucht nach Territorien jenseits des ihr bekannten Horizonts. Hitze und Staub schlugen ihr entgegen, sie hatte die schlimmste Jahreszeit erwischt. Am 1. Januar 1873 legte sie, wie ihre Biografin und Freundin Anna Stoddart berichtet, auf der »Nevada«, einem reichlich ramponierten Schiff, von Auckland nach Hawaii, den damaligen Sandwichinseln, ab. Der Dampfer geriet nach kurzem in einen heftigen Hurrikan, der ihn wie Treibgut hin und her schleuderte. Die Mannschaft meuterte, die Passagiere verzweifelten – und Isabella war zum ersten Mal in ihrem Element. Sie kümmerte sich um die seekranken Mitreisenden, las Tennyson, half, die unzähligen Kakerlaken zu erschlagen, und vergnügte sich beim Scheibenwerfen. Am 25. Januar traf sie in Honolulu ein. Dort ereignete sich, wonach sie sich ihr Leben lang gesehnt hatte: Sie fühlte sich frei. Es war überwältigend: »Endlich liebe ich, und der alte Meeresgott hat mein Herz geraubt und meine Seele so ergriffen, dass ich von nun an, egal, wo sich mein Körper auch befindet, in meinem Herzen mit ihm verbunden bin. Es ist, als lebte ich in einer neuen Welt, so frisch, so vital, so sorglos, so ungehindert, so voll der Eindrücke, dass jeder alte Groll verschwindet. Keine Nervosität mehr, keine Konventionen.« Isabella organisierte sich ein Pferd und ritt quer durch das Land – zum ersten Mal so, wie sie wollte, im Herrensitz, was ihrem Rücken außerordentlich gut tat. »Mein Zustand bessert sich Tag für Tag«, schrieb sie an Hennie, »ich fühle mich nicht mehr als Invalidin.« Sie schlief in Hütten, wanderte durch Lavafelder und hatte kaum ihr Lager am Hang des Mauna Loa, einem der größten aktiven Vulkane der Welt, aufgeschlagen, als er ausbrach »und wie ein Drache zu brüllen und fauchen begann«. Als sie in den Spiegel schaute, erkannte sie sich selbst nicht wieder, so jung sah sie aus. »Ich war davon genauso überrascht«, berichtete sie ihrer Schwester, »wie manchmal in Edinburgh, wo ich nicht glauben konnte, dass dies ängstliche, abgezehrte Gesicht mir gehört.«
Es gab kein Zurück mehr. Von nun an sollte Isabella Bird ihr Leben dem Reisen, Forschen und dem Schreiben widmen. »Die sieben Monate auf den Sandwichinseln«, schrieb sie an ihren Verleger, »waren eine spannende und höchst faszinierende Zeit. Ich habe ausführliche Beschreibungen davon an meine Schwester geschickt … sie sind auf großes Interesse der Freunde zu Hause gestoßen, die mich drängen, meine Erfahrungen zu veröffentlichen, da es bislang kein modernes Reisebuch über Hawaii gibt.« »Six Months in the Sandwich Islands« erschien 1875. Von Hawaii aus reiste Isabella zur amerikanischen Westküste weiter. In San Francisco nahm sie den Zug, fuhr in die Berge, mietete in Truckee, dem Zentrum der »Holzfällerregion«, ein Pferd und ritt als erstes zum Lake Tahoe, einem einsam gelegenen Bergsee auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Ihr Ziel waren die Rocky Mountains in Colorado, deren trockenes Klima unzählige, vor allem an Lungenkrankheiten leidende Menschen anzog. Isabella trieb es in raue, gänzlich unerforschte Gegenden, je weiter von der Zivilisation entfernt, desto besser. Sie scheute keine Anstrengung, um an Orte zu gelangen, die sie mit einer von Menschen noch kaum berührten Natur konfrontierten. Das Ziel ihrer Sehnsucht war Estes Park, ein Tal in 2293 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, »eine unregelmäßig geformte Senke, funkelnd in den glühenden Strahlen, die sich in den Stromschnellen des Big Thompson River brachen, beschützt von riesenhaften, fantastisch geformten Bergen, die es wie Schildwachen umringen, über ihm Longs Peak in unnahbarer Pracht … Ich bin an den Ort gelangt, den ich so sehr ersehnt habe – und in allem übersteigt er meine kühnsten Träume«. In jener Abgeschiedenheit fand Isabella »Glück und Seligkeit, Frohsinn, Genuss und Freiheit« und begegnete vielleicht der Liebe ihres Lebens: Jim Nugent, bekannt als Rocky Mountain Jim, ein einäugiger, zur Fahndung ausgeschriebener Desperado, ebenso berüchtigt wie bewundert, klug, gebildet und sensibel, ebenso Gentleman wie Rowdy, unberechenbar und gewalttätig, aus Verzweiflung zum Trinker geworden, von enormer Vitalität und zugleich depressiv, ja lebensmüde. Zwei verwandte Seelen, die sich in der harten, kalten Einsamkeit der Berge begegneten, beide getrieben von unendlicher Sehnsucht nach einem anderen Leben, verbunden in ihrer Liebe zur Natur. Für Isabella öffnete Jim sein verkrustetes Herz. Trotz aller Ablehnung der viktorianischen Konventionen war sie noch immer so damit verwoben, dass sie sich ein Einlassen auf ihn, einen Outlaw, verwehrte. Darüber hinaus wurde ihr bewusst, dass sie Henrietta, ihr Ein und Alles, durch eine Entscheidung für Jim wohl verlieren würde. Sie wies ihn ab. Anna Stoddart berichtet, dass Jim Nugent zusammenbrach, als er in Namaqua von Isabella Abschied nahm. Am 25. Juli 1874 erhielt sie die Nachricht von seinem tragischen Tod: Er war von Evans, dem Mann, der ihn ebenso bewunderte wie hasste, erschossen worden. In »A Lady’s Life in the Rocky Mountains«, erschienen 1879, ihrem wohl berühmtesten Buch, setzt sie Jim Nugent, wenn auch verhohlen, ein Denkmal. Im Städtchen Estes Park, im heute von Touristen überfluteten Rocky Mountain National Park, erinnert das Restaurant »Bird & Jim« an die ungewöhnliche Begegnung.
1880 erschien bereits Isabellas nächstes Buch, »Unbeaten Tracks in Japan«. Mit einem jungen japanischen Dolmetscher hatte sie Hokkaido bereist und einige Zeit bei den Ureinwohnern Nordjapans, den Ainu, verbracht, war nach Hong Kong, Kanton, Saigon und Singapur gekommen und hatte Malaysia gesehen. 1881 brach alles zusammen: Henrietta, ihre »geliebte und einzige Schwester«, starb an Typhus. Ihr »liebevolles Interesse, ihre Aufmerksamkeit und sorgfältige Kritik« waren die Inspiration von Isabellas Schreiben. »Der Schmerz ist furchtbar«, notierte sie. »Sie war meine Welt, sie füllte mein ganzes Denken aus.« Henriettas Arzt John Bishop, ein langjähriger Freund beider Schwestern, hatte wiederholt um Isabellas Hand angehalten. Nun gab sie nach. Fünf Jahre lang spielte sie die aufmerksame Ehefrau, fiel in ihren alten Zustand zurück. Als Bishop 1886 starb, wurde Isabella klar, dass sie so schnell wie möglich wieder losziehen musste. Sie absolvierte einen Kurs als Krankenschwester und machte sich auf den Weg nach Indien, durchquerte Tibet, bereiste Persien, Kurdistan und die Türkei. Ihre Briefe galten nun Freunden in Schottland und vor allem ihrem Verleger John Murray. Ihre Reisen dehnten sich aus, wurden ambitionierter, dienten der Forschung. Sie begann zu fotografieren. 1892 wurde Isabella Bird als erste Frau in die Royal Geographical Society aufgenommen.
Eine ihrer letzten großen Unternehmungen führte sie 1894 mehrere Monate durch Korea und China. Sie erforschte den Han Jiang, den längsten Nebenfluss des Jangtsekiang, erstieg den Diamantenberg an der Ostküste Nordkoreas und erlebte den Ausbruch des Ersten Japanisch-Chinesischen Krieges, der zur Okkupation Koreas durch die Japaner führen sollte. Gezwungen, das Land zu verlassen, reiste sie in die Mandschurei und fotografierte chinesische Soldaten auf dem Weg an die Front. Nicht nur in Briefen, sondern nun auch in zahlreichen Fotografien dokumentierte sie die verschiedenen Stationen ihrer Reise.
Kurz vor ihrem dreiundsiebzigsten Geburtstag, die Taschen schon gepackt für eine Tour, die sie erneut nach China führen sollte, erkrankte Isabella. Einige Tage vor ihrem Tod, so Anna Stoddart, erhielt sie Besuch von einem alten Freund, der ahnte, dass es schlimm um sie stand. »Sag Hennie«, bat sie ihn, »dass ich nach Hause komme.« Isabella Bird starb am 7. Oktober 1904 in Edinburgh.
Klaudia Ruschkowski
Literatur
Anna M. Stoddart, »The Life of Isabella Bird (Mrs. Bishop)«, John Murray, London, 1906
Meiner Schwester,an diediese Briefe ursprünglich geschrieben wurdenund der sie nunin Liebe gewidmet sind.
1. BRIEF
VON SAN FRANCISCO ZUM LAKE TAHOE
Lake Tahoe – Ein Morgen in San Francisco – Staub – Pazifischer Postzug – Digger Indianer – Cape Horn – Ein Berghotel – Mietstall in Truckee – Ein Bergfluss – Begegnung mit einem Bären – Tahoe
LAKE TAHOE, 2. SEPTEMBER 1873
Ich habe einen Traum an Schönheit entdeckt, den man sein Leben lang betrachten und dabei tief einatmen möchte. Nicht einladend wie die Sandwichinseln1, sondern schön auf eigene Weise. Eine entschieden nordamerikanische Schönheit: schneebedeckte Berge, hoch aufragende Kiefern, Mammutbäume und Silberfichten. Eine kristallklare Atmosphäre, die reichsten Farbspiele und ein von Föhren umstandener See, auf dessen Oberfläche sich die ganze Herrlichkeit spiegelt. Vor mir erstreckt sich Lake Tahoe, eine zweiundzwanzig Meilen2 lange und zehn Meilen breite Wasserfläche. Der Bergsee, an manchen Stellen tausendsiebenhundert Fuß3 tief, liegt auf einer Höhe von sechstausend Fuß, die schneebedeckten Gipfel, die ihn umgeben, ragen zwischen acht- und elftausend Fuß empor. Die Luft ist scharf und geschmeidig. Bis auf das ferne, annähernd rhythmische Klirren der Axt eines Holzfällers ist kein Geräusch zu hören.
Allein der Gedanke, in das Getöse von San Francisco zurückkehren zu müssen, das ich gestern früh im kalten Morgennebel verließ, ist mir zuwider. Der Weg zur Oakland Fähre führte durch Straßen, an denen sich tausende von Cantaloupe- und Wassermelonen, Berge von Tomaten, Gurken, Kürbissen, Birnen, Weintrauben, Pfirsichen und Aprikosen türmten, alles von erstaunlicher Größe, verglichen mit dem, was ich kenne. In anderen Gassen stapelten sich Mehlsäcke, die man nachts draußen stehen lässt, da während dieser Jahreszeit kein Regen zu erwarten ist. Ich will mich nicht lange bei diesem ersten Teil der Reise aufhalten – dem Überqueren der Bucht in nasskaltem Nebel wie im November, den vielen Lunchkörben im Eisenbahnwaggon, als wäre eine riesige Picknickgesellschaft in ihm unterwegs, dem letzten Blick auf den Pazifik, den ich nun beinahe ein ganzes Jahr lang unentwegt vor Augen hatte, der grellen Sonne und dem strahlenden Himmel über der Küste, den Zeichen einer langen Trockenheit, die man nicht als Dürre bezeichnen kann, den von der Gifteiche blutrot gefärbten Rändern der Täler, den Weingärten mit ihren großen, purpurnen Trauben inmitten staubiger Blätter, und den zwischen den Rebstöcken liegenden mächtigen staubbedeckten Melonen. Das Getreide wurde bereits im Juni von den endlosen Feldern geerntet. Nun wartet es in Säcken, die sich längs der Gleise häufen, auf seinen Transport. Kalifornien ist »ein Land, wo Milch und Honig fließen«. Die Scheunen strotzen vor Fülle. In den Obstgärten werden die Äste der Apfel- und Birnbäume gestützt, um nicht unter der Last der Früchte einzubrechen. Melonen, Tomaten und riesige Kürbisse liegen nahezu unbeachtet am Boden. Gut genährtes, ja, fettes Vieh ruht im Schatten der Eichen. Das Fell der prächtigen rotbraunen Pferde glänzt nicht vom Striegeln, sondern vom guten Futter, und blühende Farmen ringsum zeigen, auf welch solider Basis der Wohlstand des »Goldenen Staates« gründet.
Sehr fruchtbar, doch weniger verlockend ist das glühendheiße Sacramento Valley und abstoßend die Stadt Sacramento selbst, die, hundertfünfundzwanzig Meilen vom Pazifik entfernt, nur dreißig Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Das Thermometer zeigte fast vierzig Grad im Schatten, und der feine weiße Staub war zum Ersticken.
Am späten Nachmittag begann die Auffahrt in die Sierra Nevada, deren gezackte Gipfel wir schon seit vielen Meilen vor uns haben. Die staubbedeckte Fruchtbarkeit blieb zurück, die Gegend wurde rau und felsig. Ströme, die dem schlammigen Sacramento die trübe Brühe aus den hochgelegenen Goldminen zuführen, schneiden sich tief in das Land ein. Die zerklüfteten Bergrücken zogen sich immer länger dahin, die Schluchten wurden immer abgründiger, die Kiefern immer mächtiger, je weiter wir in die kühle, großartige Höhe vordrangen. Am späten Nachmittag hatten wir die letzten Spuren von Landwirtschaft und die letzten Laubbäume hinter uns gelassen. In Colfax, einer zweitausendvierhundert Fuß hoch gelegenen Bahnstation, stieg ich aus und schritt den Zug ab. Ganz vorne standen zwei große, herausgeputzte Dampflokomotiven, »Grizzly Bear« und »White Fox«, die Tender hoch mit Holzscheiten gefüllt, beide über dem Kuhfänger4 mit einem einzigen großen Scheinwerfer ausgerüstet, dazu viel leuchtendes Messing, ein komfortables Führerhaus mit Glasscheiben und gut gepolsterte Sitze für den Lokomotivführer. Auf die Lokomotiven folgten ein Gepäck- und ein Postwagen. In einem von zwei Männern bewachten Wells, Fargo & Company Expresswaggon wurden Goldbarren und Wertpakete transportiert. Den Anschluss machten zwei Güterwagen voller Pfirsiche und Trauben, zwei sechzig Fuß lange Waggons erster Klasse, die sogenannten »Silver Palace Cars«, der größtenteils von Chinesen besetzte Raucherwagen und schließlich fünf einfache Passagierwaggons. Auf den Plattformen der vorderen vier drängten sich Digger Indianer5 mit ihren Frauen, Kindern und allem möglichen Gerät. Diese Indianer sind durch und durch Wilde, ohne den Funken einer noch so anspruchslosen Kultur, und zählen zu den armseligsten der unglücklichen Stämme, die vor den Augen der Weißen aussterben. Sie waren alle sehr klein, hatten flache Nasen, einen breiten Mund und schwarzes, über den Augen gerade geschnittenes Haar, das ihnen lang und strähnig über Schultern und Rücken fiel. Das Haar der Frauen schien dick mit einer pechartigen Substanz bestrichen, ein breiter, pechschwarzer Streifen zog sich auch über Nase und Wangen. Sie schleppten ihre Kinder an Bretter geschnallt auf dem Rücken. Die Kleidung aller bestand aus Fellen und zerlumpter, schmutzig grober Wolle. An den Füßen trugen sie schlichte Mokassins. Sie sahen schrecklich aus und starrten vor Ungeziefer und Schmutz. Die Männer hatten kurze Bogen und Pfeile bei sich. Einer mit einem Köcher aus Luchsfell schien der Häuptling zu sein. Manche von ihnen waren mit Angeln ausgerüstet, doch die Umstehenden erklärten mir, dass sich diese Indianer fast ausschließlich von Heuschrecken ernähren. Sie standen in traurigem Kontrast zu den sie umgebenden Zeugnissen einer einstmals mächtigen Zivilisation.
Das Licht der untergehenden Sonne, ein Licht aus jener alten Zeit, verklärte die Berge, und als sich der abendliche Tau über das Land legte, erfüllten aromatische Düfte die reglose Luft. Auf einem einzigen Gleis, das streckenweise nur auf einem schmalen Sims entlangführte, der von Männern, die man in Körben vom Gipfel hinabgelassen hatte, über zweibis dreitausend Fuß tiefen Schluchten in den Berg geschlagen worden war, kroch das eiserne Ungetüm nun langsam in die Höhe. Ab und zu hielten wir vor einer Reihe von Holzhäusern oder an einer einsamen Blockhütte, vor der ein paar Chinesen herumlungerten. Pfade an den Seiten der Schluchten deuteten allerdings auf nahegelegene Goldminen hin. An manchen Stellen folgten die engen Kurven so rasch aufeinander, dass selten mehr als ein Teil des Zuges zu sehen war, wenn man den Kopf aus dem Fenster streckte. Bei Cape Horn, wo die Gleise auf einem schmalen, zweitausendfünfhundert Fuß hoch gelegenen Felsvorsprung entlangführen, schließt jeder verständlicherweise die Augen und hält den Atem an. Ich sparte mir diesen Nervenkitzel jedoch für die Überquerung einer hölzernen Trestle-Brücke auf, die unmittelbar auf eine scharfe Kurve folgte. Die Waggons schienen über die Brücke hinauszuragen, und man hatte das Gefühl, als würde man direkt in eine wilde Schlucht hinabschauen, durch die in ungeheurer Tiefe ein reißender Sturzbach tobte.
In der Nähe des Gipfelpasses fuhren wir in hölzerne Galerien ein, die sogenannten Schneedächer, die für die nächsten fünfzig Meilen jeden Blick auf die Schönheiten des Landes verstellten. Selbst der Donner Lake, das »Juwel der Sierra«, blieb unsichtbar. In wenigen Stunden war die Temperatur von fast vierzig Grad auf null gesunken. Wir zitterten vor Kälte in der frostig klaren Luft. Auf einer Strecke von hundertfünf Meilen hatten wir eine Steigung von nahezu siebentausend Fuß bewältigt. Nachdem wir die Galerie durchquert hatten und im Dunkeln immer wieder großartige Blicke auf brennende Kiefernwälder werfen konnten, trafen wir nachts gegen elf Uhr in Truckee ein. Das Zentrum der »Holzfällerregion« der Sierra gilt als »Bergstadt mit rauen Sitten«. Alle Halunken der Gegend scharen sich hier zusammen, in den Saloons kommt es jede Nacht zu Schießereien. Mir wurde jedoch versichert, dass man einer Dame mit Respekt begegnen würde, und dringend empfohlen, ein paar Tage zu bleiben und mir die Seen anzuschauen. Trunken vor Müdigkeit stieg ich aus und beneidete die Passagiere in ihren Schlafwagen, die dort bereits auf komfortablen Ruhebetten in tiefem Schlummer lagen. Der Zug war an der Hauptstraße zum Stehen gekommen – wenn der große, gerodete, von Schienensträngen durchzogene Platz diese Bezeichnung verdiente. Hier und da ragte noch ein Baumstumpf auf, stapelten sich zersägte Stämme, und der Mond beschien ein Durcheinander von schindelgedeckten Häusern und überdachten Veranden. Gleich gegenüber vom Zug stand ein grobschlächtiges Westernhotel, in dessen hell erleuchteter Bar sich trinkende und rauchende Männer drängten. Zwischen dem Hotel und den vielen Waggons bewegten sich jede Menge Müßiggänger und Passagiere. Unter dem Geläut schwerer Glocken rangierten mächtige Dampflokomotiven auf den Gleisanlagen. Der grellwütige Blick ihrer Zyklopenaugen dämpfte den Schein, der von Waldbränden an einem der Berghänge herrührte. Auf einigen Freiflächen loderten Feuer aus Kiefernscheiten, um die sich Gruppen von Männern geschart hatten. Eine Kapelle lärmte, der unselige Schlag von Tom-Toms erklang in nicht allzu weiter Ferne. Berge schienen die Stadt wie Wälle zu umgeben, und hohe Kiefern reckten sich klar und deutlich gegen einen Himmel, aus dem Mond und Sterne ein eisiges Licht versprühten.
In dieser Höhe herrscht beißender Frost, und als ein »irrepressible nigger«6, der das Hotel zu vertreten schien, mich und meine Reisetasche in einer Art »Empfangsraum« abgesetzt hatte, war ich froh, im Ofen noch Reste glimmender Kiefernscheite zu entdecken. Ein Mann erschien und teilte mir mit, er werde versuchen, mich unterzubringen, sobald die Züge abgefahren seien. Ich dürfe aber nicht zu viel erwarten, das Hotel sei voll. Es war bereits halb zwölf. Seit sechs Uhr morgens hatte ich nichts gegessen. Als ich hoffnungsvoll nach einem heißen Abendessen und etwas Tee fragte, hieß es, um diese Zeit sei nichts mehr zu machen. Eine halbe Stunde später tauchte der Mann dennoch mit dünnem, kaltem Tee und einem Stück Brot auf, das aussah, als wäre es schon durch mehrere Hände gewandert.
Ich erkundigte mich bei dem »unbezähmbaren Faktotum«, wo es hier Pferde zu mieten gebe. Augenblicklich kam ein Mann vom Schlag eines echten West-Pioniers aus der Bar herüber, zog den Hut und versprach, mir zu helfen. Er ließ sich in einen Schaukelstuhl fallen, zog einen Spucknapf heran, schnitt ein Stück Tabak ab, schwang seine Füße mit den schmutzigen Stiefeln, in die er seine Hose gestopft hatte, auf den Ofen und begann energisch zu kauen. Zwischendurch bemerkte er, dass seine Pferde gut trabten und galoppierten, warf ein, dass einige Damen den mexikanischen Sattel bevorzugten, und versicherte, ich könne bedenkenlos allein reiten. Nachdem die Route festgelegt war, mietete ich ein Pferd für zwei Tage.
An der Brust des Mannes prangte ein Pionierabzeichen, das ihn als einen der ersten Siedler in Kalifornien auswies. Er war von einem Ort zum anderen gezogen, überall wurde es ihm zu zivilisiert, »aber in Truckee«, sagte er, »würde sich wohl nie viel ändern«. Später klärte man mich darüber auf, dass hier nicht zu festgelegten Zeiten geschlafen wird, da es nicht genug Unterkünfte für eine – vorwiegend männliche – Bevölkerung von zweitausend Seelen gibt, die sporadisch noch um eine Menge anderer Leute verstärkt wird. Die Betten sind daher rund um die Uhr von wechselnden Parteien belegt. Entsprechend sah die Kammer aus, die mir zugewiesen wurde. Auf den Haken hingen Mäntel und Reitpeitschen, auf dem Boden lagen schmutzige Stiefel, in einer Ecke lehnte ein Gewehr. Es gab weder ein Fenster, noch frische Luft, doch ich schlief tief und fest und erwachte nur einmal durch eine kurze, heftige Zunahme des Radaus, in dem ich eingeschlafen war, da hintereinander drei Pistolenschüsse abgefeuert wurden.
Am nächsten Morgen zeigte Truckee ein völlig verändertes Gesicht. Die Menschenmengen der vergangenen Nacht waren verschwunden. Wo die Feuer gebrannt hatten, türmten sich Aschehaufen. Ein schlaftrunkener deutscher Kellner schien der einzige Mensch im ganzen Haus zu sein. Die Saloons gähnten vor Leere, nur ein paar übernächtigte Faulenzer trieben sich auf der sogenannten Straße herum. Es hätte ein Sonntag sein können, doch gerade am Sonntag soll es hier, wie ich hörte, hoch her gehen. Gottesdienst scheint es zurzeit keinen zu geben. Die Arbeit ruht nur, um sich dem Vergnügen hinzugeben. Ich packte das Notwendigste in eine kleine Tasche, zog mein hawaiianisches Reitkostüm über einen Seidenrock, schlüpfte in einen Staubmantel und stahl mich über die Plaza zum Tattersall, dem größten Gebäude von Truckee. Dort standen zwölf Pferde in Ställen, die links und rechts einer breiten Einfahrt lagen. Mein Freund vom Vorabend zeigte mir seine Schätze in Gestalt von drei samtbezogenen Damensatteln ohne Knauf. Einige Damen, bemerkte er, benutzten auch einen mexikanischen Sattel, doch »in dieser Gegend« ritte keine Frau im Männersitz. Das brachte mich in Verlegenheit. Im Damensattel kann ich in diesem Gelände keinen Schritt weit reiten. Ich war drauf und dran, meinen euphorischen Plan aufzugeben, als der Mann bemerkte: »Ach, reiten Sie doch, wie Sie wollen. In Truckee kann jeder tun und lassen, was er will.« Seliges Truckee! Im Handumdrehen wurde ein großer Grauer mit einem prächtigen silberbeschlagenen mexikanischen Sattel herausgeputzt. Die Steigbügel waren mit herabbaumelnden Lederquasten verziert, die Schabracke bestand aus Schwarzbärenfell. Ich befestigte meinen Seidenrock am Sattel, deponierte meinen Mantel auf dem Futtertrog und saß sicher auf dem Pferd, bevor der Mann noch nachfragen konnte, ob er mir hinaufhelfen solle. Weder er noch einer der Tagediebe, die sich um uns versammelt hatten, zeigte die geringste Überraschung. Alle verhielten sich sehr respektvoll.
Kaum saß ich im Sattel, war meine Verlegenheit verflogen. Ich trabte durch die Stadt, die aussah wie ein längs der pazifischen Eisenbahn aufgeschlagenes Zeltlager, und folgte über zwölf Meilen den Windungen des Truckee, eines klaren, eiskalten, tosenden Bergstroms, auf dessen Grund riesige Kiefernstämme ruhten, die nicht vor dem nächsten Hochwasser fortgeschwemmt werden würden. An seinen Ufern wachsen weder Farne noch Kriechpflanzen. Nichts Grünes kann sich in Nachbarschaft der turbulenten Stromschnellen halten. Der helle Himmel und die kristallklare Atmosphäre, das strahlende Licht und ein Funkeln, wie ich es nur aus Kalifornien kenne, verleihen zusammen mit der belebenden Luft, die jede Trägheit verscheucht, eine Energie, die vor nichts haltmacht. Beiderseits des Stroms erheben sich riesige Felswände, zinnenbewehrt, zerfurcht, zerklüftet und von hoch aufragenden Kiefern gekrönt. Hin und wieder öffnet sich eine Felsspalte und gibt den Blick frei auf einen Schneegipfel, der in den maßlos blauen, wolkenlosen Himmel ragt. Auf sechstausend Fuß Höhe muss man sich mit Koniferen bescheiden. Mit Ausnahme einiger Espen, die sich dort ausbreiten, wo Kiefern gefällt wurden, und Pappeln, die in tieferen Lagen die Flüsse säumen, gibt es nichts als Nadelwald und ein Unterholz aus Himbeersträuchern, Johannis- und Stachelbeeren, wildem Wein und Bärentraube. Ich erfreute mich an den Zuckerkiefern, die zwar nicht so gigantische Ausmaße besitzen wie die Riesenmammutbäume im Yosemite Park, doch immerhin eine majestätische Höhe von zweihundertfünfzig Fuß erreichen. Die gewaltigen, kerzengeraden Stämme, in einem warmen Rot, das an Zedernholz erinnert, weisen im unteren Drittel nicht einen einzigen Ast auf. Sie haben Ähnlichkeit mit Lärchen, ihre Nadeln sind jedoch lang und dunkel, die Zapfen etwa einen Fuß groß. Diese Bäume, die Wurzeln schlagen, wo sich auch nur eine Krume findet, zerteilten den Himmel mit ihren spitzen Kronen, neigten sich fast rechtwinklig über den Fluss oder überspannten ihn in voller Größe. Überall Stümpfe und abgestorbene Bäume. Glatte Schneisen zeigten an, wo man die gefällten Stämme nach unten schießen ließ, um sie vom Fluss abtreiben zu lassen. Wegen dieser Stämme leben hier verstreut Menschen. Der helle Klang der Axt mischt sich mit den Lauten der wilden Tiere und dem Tosen der Stromschnellen.
Auf dem natürlichen, weichen Weg ließ sich sehr angenehm reiten. Das Pferd war viel zu hoch für mich und hatte seinen eigenen Kopf, doch dort, wo der Boden es erlaubte, bereitete mir sein schwerer Trab Vergnügen. Niemand war hier unterwegs, nur einmal begegnete ich einem von zweiundzwanzig Ochsen gezogenen Fuhrwerk. Die drei sympathischen jungen Fuhrmänner schufen mir mit Mühe genügend Platz, damit ich das schwerfällige Gespann überholen konnte. Nachdem ich zehn Meilen geritten war, führte der Weg über einen steilen Hang in den Wald hinauf, machte eine unvermittelte Biegung, und durch das blaue Dunkel der riesigen Kiefern, deren Stämme aus der vom Fluss durchtobten Schlucht emporwuchsen, schimmerten zwei gewaltige Berge mit kahlen, grauen Gipfeln, gekrönt mit leuchtend weißem Schnee – einer jener überwältigenden Eindrücke, die einen niederknien lassen, um zu beten. Der Wald war dicht und mit einem unwegsamen Unterholz aus Zwergkiefern und Brombeergestrüpp bewachsen. Da das Pferd jedoch auf dem Weg nervös und unberechenbar geworden war, kam mir eine Abkürzung gelegen, und ich ritt drauf zu. Unachtsam, damit beschäftigt, meinen Steigbügel zu verkürzen, schrak ich zusammen, als direkt vor mir ein großes, dunkles, behaartes Tier schnaubend aus dem Dickicht brach. Zuerst dachte ich an einen wilden Eber, doch es war ein Bär. Mein Pferd stürzte wiehernd los, als wolle es zum Fluss hinab, machte jedoch urplötzlich kehrt und preschte einen steilen Hang hinauf. Mir wurde klar, dass ich aus dem Sattel musste, ich sprang also nach rechts, zur Hangseite hin ab, um nicht allzu tief zu fallen. Staubbedeckt, doch unverletzt, kam ich wieder auf die Beine. Eine wahrhaft groteske und demütigende Situation. Der Bär stob in die eine Richtung davon, das Pferd in die andere. Ich eilte letzterem hinterher. Zweimal ließ es mich herankommen, besann sich dann und galoppierte wieder los. Nachdem ich mich eine ganze Meile durch das Dickicht zurück zum Weg geschlagen hatte, las ich zunächst die Satteldecke auf, dann meine Tasche. Kurz darauf erblickte ich den Grauen. Am ganzen Leib zitternd stand er da und schaute mich an. Die Gelegenheit, ihn einzufangen, schien günstig, doch als ich auf ihn zukam, machte er kehrt, bockte, schlug aus, lief im Kreis um mich herum, bäumte sich in einem letzten trotzigen Anfall auf und hetzte in Richtung Truckee davon, den Sattel im Genick. Mit Tasche und Decke beladen, ging ich beschämt weiter.
Nach einem einstündigen Fußmarsch, verschwitzt und hungrig, erblickte ich oberhalb einer Schlucht zu meiner Freude das Ochsenfuhrwerk. Einer der jungen Männer kam, das Pferd am Zügel, auf mich zu. Als sie den Grauen herangaloppieren sahen, hatten sie mit ihrem Gespann den Weg versperrt, um ihn aufzuhalten. Sie fürchteten, dass mir etwas zugestoßen sei, und wollten gerade eins ihrer Tiere satteln, um nach mir zu suchen. Der Junge brachte mir ein wenig Wasser, ich wusch mir das Gesicht und sattelte mein Pferd. Es schnaubte und bockte noch eine ganze Weile, bis es mich endlich aufsteigen ließ, tänzelte dann aber so angstvoll und nervös, dass mich der Junge noch ein Stück begleitete. Er erzählte, dass es in den Wäldern um Truckee seit einigen Tagen von Grizzlys und Braunbären nur so wimmele. Sie wären jedoch nicht gefährlich.
Ich galoppierte weit über die Stelle hinaus, an der ich abgesprungen war, um den immer noch störrischen Grauen zu beruhigen. Bald tat sich vor mir eine herrlich lebendige Landschaft auf. Blauhäher schossen pfeilschnell zwischen den dunklen Kiefern umher, hunderte von Eichhörnchen sprangen durch den Wald, rote Libellen funkelten wie lebendige Lichter, zierliche Streifenhörnchen huschten über den Weg. Hier und da zeigte sich eine blasse Lupine. In den kristallklaren Tiefen des Flusses, der sich allmählich verbreitert hatte und nun ruhig dahinströmte, spiegelten sich majestätische, pfeilgerade in die Höhe schießende Kiefern, die Stämme von gelbgrünen Flechten umrankt, zwischen Tannen und Balsamfichten. Die Schlucht öffnete sich. Vor mir lag der See, inmitten von Bergen, mit Buchten und Landzungen, von prachtvollen Zuckerkiefern umringt. Auf seiner gekräuselten Oberfläche glitzerten die Strahlen der Mittagssonne. Er lag so unberührt da wie zu Zeiten, wo bis auf Trapper und Indianer niemand von seiner Schönheit wusste. Nur ein einziger Mann lebt das ganze Jahr über hier, die wenigen anderen Siedler verlassen die Gegend Anfang Oktober. Sieben Monate lang ist dieser See, der niemals zufriert, kaum erreichbar. In den dichten Wäldern ringsum gibt es Grizzlys und Braunbären, Wölfe, Elche, Rotwild, Backenhörnchen, Marder, Nerze und Stinktiere, Füchse, Eichhörnchen und Schlangen. Am Ufer entdeckte ich ein rohgezimmertes Gasthaus, vor dessen Tür ein Holzfällerkarren stand und auf ihm der Kadaver eines riesigen Grizzlys, den man morgens hinter dem Haus erlegt hatte. Ich wollte eigentlich noch zehn Meilen weiterreiten, erfuhr aber, dass die meisten Pfade nicht weiterführten. Bezaubert von der Schönheit und der Stille des Lake Tahoe blieb ich also dort, zeichnete, genoss den Blick von der Veranda und durchstreifte den Wald. Auf dieser Höhe gibt es jede Nacht Frost, meine Finger wurden vor Kälte ganz steif, doch die atemberaubende Schönheit hielt mich in ihrem Bann.
Die Sonne versank hinter den Berghängen, die kiefernbestandenen Landzungen am Westufer des Sees färbten sich erst indigoblau, dann tiefrot und glühten schließlich in samtenem Purpur. Die Gipfel, auf denen das letzte Sonnenlicht lag, leuchteten mattrot, die gegenüberliegenden Berge waren von kräftigstem Rosa überzogen, und rosa glänzten auch die fernen, von ewigem Schnee bedeckten Gipfel. Bläulich violette, rote und orangefarbene Schatten färbten die Oberfläche des Sees, der andächtig im Schatten der stattlichen Kiefern ruhte. Während die Sonne noch sank, erhob sich am rotglühenden Himmel ein beinahe voller Mond: keine bleiche, flache Scheibe, sondern eine leuchtende Kugel.
Der Sonnenuntergang hatte in seiner Farbenpracht jedes erdenkliche Stadium der Herrlichkeit durchschritten, hatte das Land in Aufruhr und Triumphe versetzt, es durch Pathos und Leidenschaft geführt. Die tiefe, träumerische Stille des Mondlichts wurde nur durch vereinzelte Rufe von Nachttieren unterbrochen, die in den duftenden Wäldern widerhallten.
1Isabella Bird verbrachte 1873 sechs Monate auf den sogenannten »Sandwichinseln«, wie der englische Seefahrer und Entdecker James Cook (1728–1779) das Königreich Hawaii getauft hatte, und reiste im August 1873 direkt von dort aus nach San Francisco weiter.
2Eine Meile entspricht etwa 1,60 Kilometern.
3Ein Fuß entspricht ca. 0,30 Metern.
4Der vorstehende »Cowcatcher« diente den US-amerikanischen Dampflokomotiven als Schienenräumer. Erstmals wurde ein solcher »Kuhfänger«, eine Erfindung des Engländers Charles Babbage (1791–1871), bei der Dampflokomotive »John Bull« verwendet.
5Angehörige der Maidu, eines Stammes in Nordkalifornien. Jäger und Sammler, die sich vor allem von Eicheln ernährten und nach essbaren Wurzeln gruben, weshalb sie bei den europäischen Einwanderern »Digger Indians« hießen.
6Anspielung auf den als »irrepressible conflict« – den »unbezähmbaren Konflikt«, d. h. den Kampf gegen die Sklaverei und die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung – bezeichneten amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865.
2. BRIEF
TRUCKEE UND DER DONNER LAKE
Eine aufgetakelte Lady – Grizzlys – Das »Juwel der Sierra« – Eine tragische Geschichte – Karneval der Farben
CHEYENNE, WYOMING, 7. SEPTEMBER 1873
Als es nach Einbruch der Dunkelheit kalt wurde, zog es alle Gäste zum Ofen im Salon. Eine aufgetakelte Lady aus San Francisco, mit Diamanten behängt, in einem smaragdgrünen Samtkleid mit Brüsseler Spitze, unterhielt die Anwesenden durch pausenloses Geschwätz, zog über Leute und Ereignisse in anzüglich näselndem Westküstentonfall her, ohne sich die geringsten Gedanken zu machen, was sie da von sich gab. Dank seiner guten Erreichbarkeit wird Lake Tahoe in wenigen Jahren gewiss jeden Sommer von solcher Vulgarität überschwemmt werden. Mein Aussehen als »perfect guy« entsprach dem Ruf, den unsere Landsmänninnen in Amerika genießen, und ich spürte, dass der nächste Geistesblitz jener Dame auf mich zielen würde. Daher war ich erleichtert, als die Wirtin, eine kultivierte Engländerin, mich bat, ihr und ihrer Familie in der Bar Gesellschaft zu leisten. Wir unterhielten uns ausführlich über die Gegend und die wilden Tiere, vor allem die Bären, von denen es in den Wäldern jede Menge gibt. Wenn sie nicht verwundet sind, von Hunden gereizt werden, oder eine Bärin Gefahr für ihre Jungen fürchtet, scheinen sie aber keine Menschen anzugreifen.
Ich träumte so lebhaft von Bären, dass ich durch einen pelzigen Griff nach meiner Kehle erwachte. Dennoch fühlte ich mich erfrischt. Als ich nach dem Frühstück meinen Grauen bestieg, stand die Sonne hoch, und die Luft war so scharf und berauschend, dass ich dem Tier freien Lauf ließ, bergauf und bergab ritt, ohne einen Anflug von Müdigkeit. Diese Luft ist ein wahres Lebenselixier. Der Rückweg nach Truckee war herrlich, die Strecke jedoch nicht so verlassen wie tags zuvor. Tief im Wald schnaubte das Pferd und wollte sich aufbäumen. Ich erblickte eine zimtbraune Bärin mit zwei Jungen, die in einigem Abstand vor mir den Weg kreuzten, und bemühte mich, den Grauen ruhig zu halten. Die Bärin sollte nicht glauben, dass ich dunkle Absichten gegen ihre unbeholfenen Kleinen hegte. Allerdings war ich erleichtert, als sich die zottige Gesellschaft daran machte, den Fluss zu durchqueren. Kurz darauf begegnete mir ein Gespann. Der Kutscher hielt an und erkundigte sich, ob ich hier in der Gegend Bären gesehen hätte. Etwas später traf ich auf einen schwerbewaffneten Jäger, der wissen wollte, ob ich die englische Touristin sei, die gestern auf den Grizzly gestoßen war. Ein Holzfäller, der seine Mahlzeit auf einem Felsen mitten im Fluss einnahm, tippte grüßend an den Hut und brachte mir einen Schluck eiskalten Wassers, den ich kaum trinken konnte, da sich das widerspenstige Pferd nicht halten ließ. Er pflückte mir einige Bergnelken, und ich bewunderte sie gebührend. Ich erwähne diese Kleinigkeiten, um zu zeigen, wie groß der Respekt von Männern gegenüber Frauen in diesem Landstrich üblicherweise ist. Deshalb verzeiht man ihnen auch die ungenierte Art, mit der sie allein reitenden Damen begegnen. Die weibliche Würde und die männliche Achtung vor der Frau sind das Salz der Gesellschaft in diesem wilden Westen.
Mein Grauer war so reizbar, dass ich mir das Zentrum von Truckee ersparen wollte, und mich durch eine chinesische Barackensiedlung zur Stallung durchschlug, wo schon ein riesiger Rotschimmel für meinen Ritt zum Donner Lake bereitstand. Ich erkundigte mich bei dem Besitzer, ob ich mich auf umherziehende finstere Gesellen einstellen müsste. Das könnte eine abendliche Tour gefährlich machen. Derzeit kursiert die Geschichte von einem Mann, der zwei Abende zuvor mit einem zerhackten menschlichen Körper in seiner Satteltasche durch Truckee gekommen war. Geschichten dieser Art kann man hier viele hören, ob sie nun wahr sind oder nicht. »Es gibt die übelsten Halunken«, erwiderte der Stallbesitzer, »doch selbst die schlimmsten unter ihnen werden Sie unbehelligt lassen. Es gibt nichts, was die Leute hier im Westen mehr bewundern als den Mut einer Frau.« Ich musste auf ein Fass steigen, um in den Steigbügel zu treten, und als ich im Sattel saß, reichten meine Füße gerade bis zum Bauch des Rotschimmels. Ich fühlte mich auf ihm so klein wie eine Fliege.
Der Weg führte zunächst durch ein morastiges Tal, in dem üppiges Sumpfgras wucherte, das erste grüne Gras, das mir bislang in Amerika begegnet ist. Die Kiefern, deren rote Stämme sich aus dem Grün erhoben, waren prächtig anzuschauen. Ich ritt zügig weiter und gelangte bald zum Donner Lake, bezaubert von seiner Schönheit. Drei Meilen lang und eine halbe Meile breit liegt er versteckt zwischen den Bergen. An seinen Ufern stehen nur einige verlassene Holzfällerhütten. Die Abgeschiedenheit gefiel mir sehr. Auf dem ganzen Weg war ich weder einer Menschenseele noch einem Tier begegnet, selbst Vögel hatte ich nicht erblickt. Über die Berge, die sich direkt von den Rändern des Sees aus erheben,