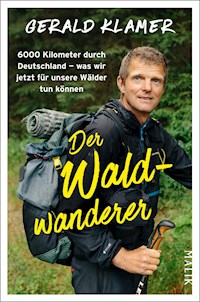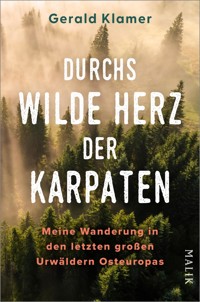
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zu Besuch bei Bären und Baumgiganten Im ausgehenden Winter startet Förster Gerald Klamer seine Wanderung durch die letzten großen Buchenurwälder der Karpaten. Er wird von Schneetreiben überrascht, bahnt sich neue Wege durch unwegsames Gelände und begegnet Wölfen, Bären und Hirtenhunden. Warum wir vom Menschen unberührte Wälder brauchen Unterwegs trifft er sich immer wieder mit Einheimischen, die ihm ihre heimatlichen Wälder zeigen und von den Gefahren berichten, denen sie als Aktivisten ausgesetzt sind. Auf tausend Wanderkilometern steht Gerald Klamer sowohl entsetzt vor frischen Kahlflächen als auch staunend vor uralten Baumgiganten mit dichten Moos- und Flechtenteppichen. Unterwegs im UNESCO-Weltnaturerbe in Polen, Rumänien und der Slowakei
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Durchs wilde Herz der Karpaten« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 32 farbigen Abbildungen und acht Karten
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Margret Trebbe-Plath, Berlin
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Anton Petrus / Getty Images
Illustration: freepik
Bildteilfotos: Gerald Klamer
Karten: Peter Palm, Berlin
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
((Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte))
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karten
Prolog
Teil 1
Nordkarpaten
Im Schnee der Veľká Fatra
Mit slowakischen Naturschützern in der Hohen Tatra
Unter Wölfen
Teil 2
Ostkarpaten
Durch das wilde Maramureș
Ein »verrückter Auerhahn«
Teil 3
Südkarpaten
Das ambitionierteste Nationalparkprojekt Europas: Carpathia
Faszinierende Zeitreise in Siebenbürgen
Kann Wandertourismus dem Urwald helfen?
Gabriel Paun, der Anwalt des Waldes
Das vielleicht schönste Urwaldtal Rumäniens
Angriff der Hirtenhunde
Teil 4
Südwestkarpaten
Retezat – zwischen Urwald und Gipfeln
Licht und Schatten im Nationalpark Domogled-Valea Cernei
Der schönste Wald Rumäniens?
Epilog
Dank
Bildteil
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Schon einige Male bin ich im Schnee tief eingesunken, aber jetzt hat es mich richtig erwischt: Mein rechtes Bein ist fast bis zum Schritt versackt, und an dem steilen Schneehang mitten im rumänischen Criva-Urwald kann ich mich auch mit einiger Anstrengung nicht befreien. Ich bewege mein Bein ein Stück nach oben, sacke aber immer wieder ein. Dabei hielt die weiße Decke im Abstieg vom Kamm zwischen den zwei Tälern zunächst sehr gut, weshalb ich darauf verzichtet habe, meine Schneeschuhe anzulegen. Im Frühling kann eine kompakte Schneedecke ziemlich tückisch sein, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.
Hier wohnt weit und breit kein Mensch, der mir helfen könnte, und in der Schlucht gibt es kein Funksignal. Mir wird bewusst, dass ich mich nur selbst aus dieser misslichen Lage befreien kann. Ich atme tief durch. Dann spanne ich noch einmal meinen Körper an und wuchte mein rechtes Bein nach oben. Mit einem Ruck entkomme ich dem Loch, allerdings mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Mein Rucksack zieht mich nach hinten, ich überschlage mich und rutsche den verschneiten Hang rasend schnell hinab. Panisch versuche ich, nach etwas zu greifen, mich irgendwo festzuhalten, doch ich schaffe es einfach nicht, die Schussfahrt aufzuhalten. Nach etwa 20 Metern lande ich hart in einem felsigen und schneefreien Bachbett. Für einen Moment bleibe ich schockstarr liegen. Meine Hüfte schmerzt, ich bin nass und schlammbedeckt. Nur langsam komme ich wieder auf die Beine und checke meinen Körper und meine Sachen. Offenbar habe ich mich nicht ernsthaft verletzt, und zum Glück scheinen sowohl Kamera als auch Rucksack und Teleobjektiv unversehrt zu sein. Allerdings sind meine Wanderstöcke, die in unwegsamem Gelände fast unverzichtbar sind, auf dem Schneehang liegen geblieben. Mit größter Vorsicht gehe ich den Hang wieder hoch, um sie zu bergen, ich möchte hier nicht noch einmal abrutschen …
Nachdem ich meine Ausrüstung wieder zusammenhabe, steige ich wie auf rohen Eiern weiter in die Criva-Schlucht ab. Der Schreck des Sturzes sitzt mir tief in den Knochen. Wo ich vorher noch leichtfüßig und ohne Bedenken vorgedrungen bin, überlege ich mir jetzt jeden Schritt. Die steilen Hänge scheinen auch von den Tieren weitgehend gemieden zu werden, ich entdecke kaum Spuren im Schnee. Allerdings bin ich vor dem Sturz eine Zeit lang der Fährte eines Bären gefolgt, der wahrscheinlich erst vor Kurzem aus dem Winterschlaf erwacht ist.
Das letzte Stück zum Bach muss ich in einer megasteilen Rinne zurücklegen. Zeitweise ist sie so abschüssig, dass ich mich auf den Hosenboden setze und Stück für Stück weiterrutsche, um einen erneuten Sturz zu vermeiden. Ich atme erleichtert auf, als ich den Bach endlich erreicht habe. Doch es folgt gleich die nächste schlechte Nachricht: Der Schnee ist hier zwar schon weitgehend getaut, allerdings sind Teile des Bachbetts immer noch unter hohlen, instabilen Schneebrücken verborgen. Wenn man sich daraufwagt, ist die Wahrscheinlichkeit einzubrechen jetzt, Ende April, sehr hoch. Meine ganze Hoffnung lag auf dem Weg, der hier im Tal laut Karte vorhanden sein soll, davon ist aber nichts zu erkennen. Stattdessen umgeben mich nur steile, glitschige, moosüberzogene Klippen, sehr viel Totholz im Bachbett und immer wieder Schneeflecken. Verzweifelt schaue ich mich um, denn mir wird klar, dass ein Weiterkommen in dieser Schlucht sehr gefährlich bis unmöglich sein wird. Außerdem ist es schon spät, ich bin ziemlich erschöpft und brauche unbedingt noch einen ebenen Platz für mein Zelt – doch auch der ist nicht in Sicht.
Entmutigt lasse ich mich auf einen Felsen sinken, um für einen Moment durchzuatmen. Mehr als drei Monate will ich die letzten Urwälder Zentraleuropas erkunden, doch jetzt frage ich mich: Sind sie solch ein Risiko wert?
Teil 1
Nordkarpaten
Im Schnee der Veľká Fatra
Zeitraum: 27. bis 30. März
Nationalpark: Veľká Fatra (66 503 Hektar)
Es ist früh am Sonntagmorgen, und ich stehe mit meiner Freundin Anke an der S-Bahn-Station Nürnberger Straße in Stuttgart und warte auf den Zug zum Flughafen. Noch vor wenigen Stunden habe ich meinen Rucksack fertig gepackt und alles zurechtgelegt, was ich heute brauchen werde, vor allem Pass und Geld. Auch wenn ich schon sehr oft zu einer langen Reise aufgebrochen bin, fühlt es sich jedes Mal merkwürdig an, von einem Moment auf den anderen einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
Zwar ist der Schritt diesmal weniger radikal als im letzten Jahr, als ich nicht nur zu einer 6000 Kilometer langen Wanderung durch Deutschland aufgebrochen war, sondern gleichzeitig meine Stelle als Forstbeamter, meine Wohnung und all meinen Besitz aufgegeben hatte. Dennoch fällt es mir schwer, mich von Anke zu verabschieden, ich bin müde und unsicher, ob es vernünftig ist, jetzt, zum Ausgang des Winters, in die Berge der Karpaten aufzubrechen. Der Karpatenbogen erstreckt sich von der Slowakei über Polen und die Ukraine bis nach Rumänien, dem Land mit dem größten Anteil an dieser Gebirgskette, die in der Hohen Tatra und den Südkarpaten bis über 2500 Meter aufragt.
Dort will ich etwas finden, das es in Deutschland kaum noch gibt: Urwälder. Bei meiner letzten großen Wanderung habe ich zwar zahlreiche wundervolle Waldgebiete kennengelernt, doch ursprüngliche Primärwälder wurden bei uns – bis auf winzige Reste im Bayerischen Wald – schon vor langer Zeit in Wirtschaftswälder umgewandelt. Auch in den Karpaten wird der Wald immer intensiver genutzt, aber dort gibt es bis zum heutigen Tag noch großflächig von menschlichen Eingriffen unberührte Wälder. Urwälder üben auf mich eine große Faszination aus. Nur dort bleibt die volle Biodiversität des Waldes erhalten, und sie sind einzigartige Kohlenstoffspeicher, echte Helfer im Kampf gegen die Klimakrise. Allerdings stehen die Wälder der Karpaten unter starkem Druck vonseiten der Holzwirtschaft. Fast täglich werden dort schützenswerte Urwälder unwiederbringlich abgeholzt.
Nachdem ich meine Deutschlandwanderung abgeschlossen hatte, stand mein Entschluss also schnell fest: Ich will alle größeren Urwaldgebiete der Karpaten zu Fuß besuchen und mir mit eigenen Augen ein Bild davon machen, wie es um ihren Erhalt steht.
Vom ausgehenden Winter bis zum Frühsommer möchte ich die unterschiedlichen Regionen entdecken und den Wechsel der Jahreszeiten erleben. Dafür werde ich Wanderwege nutzen, aber auch querwaldein via GPS laufen. Anders als auf meiner Deutschlandwanderung werde ich nicht die gesamte Strecke zu Fuß gehen, sondern zwischen den Urwaldgebieten überwiegend per Anhalter mit dem Auto fahren und so hoffentlich auch mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Außerdem will ich Naturschützer, Wissenschaftler und Aktivisten treffen, um meine persönlichen Eindrücke zu erweitern. Beginnen will ich in der Slowakei, von dort einen Abstecher nach Polen machen und dann relativ viel Zeit in Rumänien verbringen. Die Ukraine muss ich wegen des russischen Angriffs leider auslassen.
Am Flughafen Stuttgart angekommen, steuere ich nicht die Abflughalle an, sondern gehe zum Fernbusbahnhof. 24 Stunden werde ich brauchen, um in die Slowakei zu gelangen, dafür ist eine Busreise wesentlich klimaschonender als ein Flug – und in diesem Fall auch günstiger. Vor allem aber habe ich auf der Fahrt die Gelegenheit, mich mental auf die vor mir liegenden Wanderungen einzustellen.
Mit steifen Beinen steige ich schließlich in Banská Bystrica aus dem warmen Bus in die kühle Morgenluft. Endlich durchatmen und ausstrecken. Jetzt um 3:45 Uhr wirkt der Busbahnhof dieser Kleinstadt mitten in der Slowakei wie ausgestorben, aber immerhin ist alles gut organisiert und ich entdecke rasch die Haltestelle des lokalen Busses, mit dem ich hinauf nach Dolný Harmanec fahren will, einem kleinen Ort nordwestlich der Stadt. Für die 14 Kilometer muss ich nur 90 Cent bezahlen!
Als ich endlich den Ausgangspunkt meiner ersten Wanderung erreiche, wird es gerade hell. Hier auf 500 Metern ist es deutlich kühler als im Tal. Eine Tafel verrät, dass an dieser Stelle der Nationalpark Veľká Fatra beginnt, der etwa doppelt so groß ist wie der größte deutsche Nationalpark und einige Urwälder beherbergt, die ich auf einer selbst entworfenen Route einen nach dem anderen besuchen möchte. Ein Fahrweg führt mich in das bewaldete Tal der Bystrica. Zu meiner Überraschung liegt selbst auf dieser ziemlich niedrigen Höhe noch viel Schnee. Werde ich überhaupt vorankommen, wenn es weiter oben noch mehr davon gibt?
Einstweilen ist das Laufen zum Glück nicht allzu schwer, da der Schnee vielerorts noch gefroren und ziemlich hart ist. An Stellen, wo er bereits getaut ist, wachsen oft große, rhabarberartige Pestwurzblätter, und aus dem Bachbett fliegen mitunter Wasseramseln auf, die tauchend am Grund des Gewässers nach Insekten gesucht haben.
Während an den steilen Hängen überwiegend Buchen wachsen, ragen im Tal auch viele Fichten in die Höhe. Obwohl ich mich ja in einem Nationalpark befinde, wird der Wald genutzt. An etlichen Stellen liegen frisch gefällte Bäume, oftmals wurden schmale, schneisenartige Kahlschläge vorgenommen. Bereits hier wird mir klar, dass die oft immens großen neun slowakischen Nationalparks, von denen ich drei besuchen werde, nicht auf ganzer Fläche unberührt sind. Als Nationalpark ausgewiesen zu sein, bedeutet keineswegs, dass diese Gebiete wirklich geschützt werden.
Auf einem Pfad, der sich in Serpentinen nach oben schraubt, verlasse ich das Tal. Meist lässt es sich auf dem Schnee gut laufen, aber stellenweise breche ich durch die harte Kruste tief ein. Nach fast fünf Monaten, in denen ich das Buch über meine Deutschlandwanderung geschrieben habe und relativ wenig gelaufen bin, ist das Bergaufsteigen im Schnee ziemlich anstrengend für mich.
Doch zunächst komme ich recht gut voran. Als ich oberhalb von 1200 Metern in offene Bereiche gelange, ist der Schnee größtenteils vom Wind hart gepresst worden, und zeitweise kann ich der Spur eines Schneeschuhgehers folgen. Außerdem ist der Pfad mit langen Stangen gut markiert. Über die bewaldeten Hügel der Veľká Fatra – veľká bedeutet übrigens groß – schweift mein Blick zu den noch tief verschneiten Bergen an der Grenze zu Polen, und mich beschleichen Zweifel, ob es mir gelingen wird, mit so viel Schnee klarzukommen.
Etwa eine Stunde führt mein Weg durch dichten Fichtenwald hinunter ins Tal der Dedošová Dolina. Zwar gibt es stellenweise Markierungen an den Bäumen, aber ein Pfad ist an dem steilen Hang nicht zu erkennen. Getaut hat es hier auf der schattigen Nordseite noch kaum, und obwohl der Schnee recht hart ist, bricht die vereiste Kruste immer wieder, und ich versinke bis zum Schienbein in der weißen Masse. Dabei gelangt viel Schnee in meine Stiefel, der mir bald nasse Füße beschert. Der Abstieg ist ziemlich anstrengend, aber ich bin froh, dass ich wenigstens nicht raufmuss.
Gegen Mittag erreiche ich das sonnige Tal, wo ich ein bereits schneefreies Plätzchen für meine Schokoladenpause entdecke. Es ist angenehm warm, und ich genieße die Sonnenstrahlen im Gesicht. Rasch ziehe ich Stiefel und Socken aus, um meine kalten Füße trocknen zu lassen. Der Anfang war zwar nicht einfach, aber in mir breitet sich dennoch ein Wohlgefühl aus: Schokolade, Sonne und unberührte Natur – herrlich!
Als ich dem Tal weiter abwärts folge, gelange ich auf einen Forstweg, der von den weißen Massen geräumt wurde. Nach der anstrengenden Schneewanderung kommt es mir jetzt vor, als würde ich regelrecht durch die Landschaft fliegen. Normalerweise mag ich Forstwege nicht besonders und bin lieber auf kleinen Wegen oder querwaldein unterwegs, aber jetzt genieße ich es, schnell und einfach vorwärtszukommen. Doch leider führt mich ein Pfad schon bald wieder aufwärts. Der Schnee ist mittlerweile überall angetaut und das Vorankommen entsprechend nass und mühsam. Ich beschließe, dass ich für den ersten Tag genug habe. Bei meinen zahlreichen Wanderungen in der Vergangenheit habe ich gelernt, dass ich es vor allem zu Beginn langsam angehen lassen sollte, um mich nicht zu überlasten – und das ist gerade jetzt wichtig, weil ich nach der langen Winterpause nicht wirklich fit bin.
Da es hier am Hang zu steil zum Zelten ist, verlasse ich den Pfad und steige durch das Gelände zu einer kleinen Lichtung auf, wo ich ein halbwegs ebenes, schneefreies Plätzchen entdecke, das gerade genug Platz für mein kleines, nur etwa ein Kilo schweres Zelt bietet. Nachdem ich es aufgebaut und mit einigen Heringen befestigt habe, rolle ich meine einfache Isomatte aus und lege meinen Schlafsack darauf. Es ist sonnig und warm, sodass ich die Einsamkeit so richtig genießen kann.
Nachdem ich etwas entspannt habe, sammle ich kleine Ästchen und entzünde ein Feuer in meinem winzigen Hobo-Kocher, der wie eine Art Mini-Kamin sehr heiß brennt und kaum Holz verbraucht. Kartoffelbrei mit Erdnüssen gibt es heute Abend, sehr lecker nach einem ersten harten Tag im Schnee! Als später der Vollmond aufgeht, bin ich richtig glücklich, dass mein Karpatenabenteuer begonnen hat. Etwa 1000 Kilometer weit will ich durch dieses zweitgrößte Gebirge Europas wandern und bin sehr gespannt, was mich dort erwartet.
Am nächsten Morgen starte ich tatkräftig bereits gegen sieben Uhr in einen herrlichen, wolkenlosen Morgen. In der Nähe des Ostredok, des mit 1592 Meter höchsten Bergs der Veľká Fatra, erreiche ich ausgedehnte Freiflächen. Die Karpaten bestehen hier aus isolierten Bergstöcken, zwischen denen sich flache, besiedelte Beckenlandschaften befinden. So kann ich sowohl die Beskiden an der polnischen Grenze als auch Hohe und Niedere Tatra überblicken, fantastisch! Hier und da blitzt schon Gras durch die Schneeflächen, und die kullernden und zischenden Balzlaute der Birkhähne zeigen, dass der Frühling langsam Einzug hält.
Kurz darauf treffe ich auf einen ersten anderen Wanderer. Wojtek stammt von der polnischen Seite der Karpaten und kennt das Gebirge seit Jahrzehnten. Ich möchte von ihm wissen, ob sich in dieser Zeit etwas verändert hat. Der schlanke Mann Anfang 40 antwortet: »Noch vor 20 Jahren war die Veľká Fatra immer bis weit ins Frühjahr hinein tief verschneit, heute dagegen gibt es oft schon am 1. März kaum noch Schnee. Dieses Jahr ist eine Ausnahme, denn es hat mehr geschneit und war kühler.« Wojtek hat ebenfalls keine Schneeschuhe dabei, beruhigt mich aber, was die weitere Wanderung angeht. Auch er ist stellenweise eingebrochen, die Pfade auf den Kämmen waren jedoch recht gut zu begehen.
Unsere Wege trennen sich wieder, und für mich geht es in Richtung der Borisov-Hütte weiter, der einzigen Berghütte in der Veľká Fatra. Als ich an einem Steilhang entlangtraversiere, muss ich ziemlich konzentriert laufen, da der Schnee stellenweise vereist und höllisch glatt ist. Ich habe keine Lust, hier auszurutschen und dann den steilen Abhang hinunterzuschießen. Wo die Sonne den Schnee gerade erst geschmolzen hat, sprießen bereits weiße Schneeglöckchen und gelbe Krokusse aus dem Boden.
Am Nachmittag folge ich lange Zeit rot-weißen Markierungen entlang der Bergkämme, meistens durch dichte Buchenwälder, in denen einige Fichten und Weißtannen wachsen. Immer wieder geht es aber auch durch offene Grasflächen, beispielsweise an den Bergen Javoriza und Stefanova. Ich genieße diese tolle Wald- und Berglandschaft, wo man größtenteils kein Zeichen der Zivilisation sieht. Deutschland hat zwar auch sehr schöne Wälder, aber die Veľká Fatra stellt in ihrer Größe und Geschlossenheit selbst den Bayerischen Wald in den Schatten.
Den ganzen Tag über habe ich nirgendwo Wasser gefunden, daher schmelze ich abends Schnee in meinem Topf. Mein Lager habe ich auf dem Grat aufgeschlagen, von wo aus ich die Sonne später als roten Feuerball hinter den bewaldeten Bergkämmen verschwinden sehe.
Am nächsten Morgen verlasse ich bald den Grat und steige quer durchs Gelände steil ab in den Urwald Kornietovà. Auf ihn bin ich durch ein Projekt der Universität Prag aufmerksam geworden, in dem die letzten Urwälder Zentral- und Osteuropas erforscht werden. Seit 2010 hat das Projekt »REMOTE Primary Forests« über 1000 Forschungsflächen in Urwaldgebieten von acht europäischen Ländern angelegt, die auf ihrer Internetseite beschrieben werden. Dabei wird jede dieser basketballfeldgroßen Flächen akribisch begutachtet: Baumart, Höhe und Durchmesser jedes Baumes werden gemessen, und der Totholzvorrat wird bestimmt. Außerdem werden Holzproben entnommen, mit denen man das Alter der Bäume ermitteln kann.
Kornietovà steht seit 1973 mit lediglich 89 Hektar Fläche unter Schutz. Zunächst erscheint mir der Urwald nicht besonders eindrucksvoll, da die Buchen in dem rauen Bergklima auf 1100 Meter Höhe nur relativ bescheidene Dimensionen erreichen. Es gibt kaum Bäume mit mehr als 60 Zentimetern Durchmesser. Daneben finden sich Tannen, Fichten und Bergahorne, wobei die stärksten Bäume die vereinzelt wachsenden Ahorne sind. Kornietovà ist typisch für viele noch erhaltene Urwälder in der Slowakei: relativ klein und an einem steilen Hang gelegen, wo die forstwirtschaftliche Nutzung in der Vergangenheit schwierig war und sich daher Urwaldreste erhalten konnten. Trotz des unproduktiven Standorts weist der Wald im Vergleich zu deutschen Wirtschaftswäldern durchaus beeindruckende Kennzahlen auf: Während bei uns der durchschnittliche Holzvorrat – darunter versteht man das Holzvolumen pro Hektar – bei 300 bis 350 Kubikmeter liegt, beträgt dieser Wert in Kornietovà 500 Kubikmeter.
Noch beeindruckender ist allerdings die Totholzmenge: In deutschen Forsten gibt es im Durchschnitt 22 Kubikmeter, hier sind es fast 200 Kubikmeter stehendes und liegendes Totholz. Es ist nicht übertrieben, Totholz als ökologisches Gold zu bezeichnen, denn unzählige Waldorganismen von Pilzen bis zu Käfern sind darauf angewiesen und leiden im Wirtschaftswald ständig unter einem Mangel an geeigneten Lebensräumen. Allerdings sind viele der liegenden Totholzstämme unter der weißen Decke verborgen, da der Hang noch tief verschneit ist. Während die Bäume in einem bewirtschafteten Wald häufig gleich alt sind, wachsen hier alte und junge, dünne und dicke Buchen unmittelbar nebeneinander. Obwohl die Bäume natürlich noch längst keine Blätter tragen, wirkt der Wald sehr dicht. Weiter unten gelange ich in ein Bachtal, wo auch einige Weißtannen wachsen und die Bäume durch das reichliche Wasserangebot deutlich stärker sind.
Zwar sind 89 Hektar keine besonders große Fläche, aber ich bin dann doch überrascht, wie schnell ich mich wieder außerhalb des Urwalds befinde und auch gleich auf eine Kahlschlagfläche stoße. Wahrscheinlich waren die Fichten von Borkenkäfern befallen und wurden komplett abgeräumt. Nationalparks sollen eine ungestörte Naturentwicklung gewähren, zu der auch Borkenkäferbefall gehört. Doch das wird hier offenbar nicht zugelassen, wie ich später noch an vielen weiteren Beispielen sehen werde.
Als ich in ein Seitental der Bistra einbiege, gelange ich an eine Wiese, auf der eine große Rotwildfütterung steht. Zahlreiche Fährten verraten, dass die Hirsche hier im Winter offenbar ständig intensiv mit Heu versorgt werden. Auch das passt natürlich überhaupt nicht zur internationalen Zielsetzung von Nationalparks, eine natürliche Entwicklung zuzulassen. Die Nationalparks der Slowakei werden bisher von der Forstverwaltung betreut. Wie auch in Deutschland scheint man hier zu denken, dass Wildbestände ohne menschliche Eingriffe aus dem Ruder laufen würden. Das führt einerseits dazu, dass intensiv gejagt wird, andererseits wird mit der Fütterung der Wildtiere im Winter auch genau das Gegenteil unternommen. Dabei waren Bär, Wolf und Luchs in den Karpaten anders als in Deutschland nie ausgestorben und sind selbst heute noch vielerorts zu finden. Auch mir ist schon Wolfskot aufgefallen. Das Zusammenspiel zwischen Beute und Beutegreifern müsste also gut funktionieren, warum mischt man sich dann in einem Nationalpark durch Fütterung und Jagd so gravierend in die natürlichen Abläufe ein?
Ich durchstreife den Urwald Kundračka, einen weiteren kleinen Rest des ursprünglichen Buchenwalds in dieser Region, und gelange dann auf einen schneebedeckten, offenen Kamm. Als ich aus dem Wald heraustrete, sehe ich drei Hirschkühe, die auf der schneebedeckten Wiese äsen, kurz aufblicken und dann schnell in den Wald flüchten. Während bisher Buchenwald überwog, sehe ich auf den Hängen jetzt auch ausgedehnte Fichtenbestände, die hier in den höheren Lagen oberhalb von etwa 1300 Metern natürlicherweise vorkommen. Leider wirkt der Wald vielerorts durch große Kahlschläge wie zerlöchert.
Mühsam kämpfe ich mich durch tiefen Schnee und jungen, dichten Fichtenwald aufwärts zum 1485 Meter hohen Berg Male Smrekovica. Hier enden die Kahlschläge, und ich wandere durch die etwa 400 Hektar großen, alten Fichtenurwälder von Smrekovica und Janosikova Kolkaren. Die tiefbeasteten, alten Bäume wachsen in großem Abstand zueinander, dazwischen ragen aus der dichten und komplett geschlossenen Schneedecke graue Baumleichen auf.
Es ist schon später Nachmittag, und ich will eigentlich bald mein Lager aufschlagen. Allerdings möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, mit dem Zelt direkt auf dem Schnee zu stehen, da das ein kaltes Vergnügen ist. Außerdem brauche ich noch Wasser, doch beim Ansteuern verschiedener Quellen, die in meiner Kartenapp auf dem Smartphone eingezeichnet sind, habe ich kein Glück. Sie sind zwar schneefrei, aber fast trocken. Natürlich könnte ich zur Not Schnee schmelzen, aber ich hoffe, mir bei der Kälte das Schmelzen im Kocher draußen sparen und sofort in meinen warmen Schlafsack kriechen zu können. Es wird später und später, während ich durch den tiefen Schnee hangabwärts pflüge, in der Hoffnung, dass ich weiter unten einen schneefreien Platz mit Wasser finde. Der Wald wirkt kalt, einsam und leer, man könnte fast das Gefühl haben, in Kanada oder Alaska unterwegs zu sein. Kurz bevor es dunkel wird, habe ich schließlich Glück und entdecke ein ziemlich ebenes, bereits aufgetautes Plätzchen für mein Zelt mit einem Bach in der Nähe. Die Küche bleibt heute Abend kalt, daher esse ich eine Mischung aus Haferflocken, Erdnüssen und Wasser, angereichert mit Babynahrung und Schokocreme. Genügend Kalorien für einen hungrigen Wanderer!
Am nächsten Morgen gelange ich aus dem Fichtenurwald hinaus und stoße auf einen Weg, der in vom Schnee geräumten Asphalt übergeht und mich zu einer Straße führt. Die Durchquerung der Veľká Fatra liegt damit hinter mir, und ich werde versuchen, bis in die nächste Stadt zu trampen. Bereits zu Hause habe ich mir überlegt, wie ich auf dieser Tour möglichst viele unterschiedliche Urwälder in den verschiedenen Ländern der Karpaten zu Fuß besuchen kann. Dabei habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Entfernungen zu groß sind, um eine durchgängige Wanderung zu machen. Deshalb werde ich mich zwischen den Urwaldgebieten per Auto oder Bus bewegen und hoffe, dabei auch mit einigen Einheimischen ins Gespräch zu kommen.
Als ich an der Straße meinen Daumen in die Luft strecke, hält gleich das erste Auto an, und ein freundlicher älterer Mann nimmt mich etwa zehn Kilometer mit nach Ružomberok. Da der öffentliche Nahverkehr hier gut ausgebaut, günstig und dicht getaktet ist, kann ich von Ružomberok schon nach nur einer halben Stunde mit dem Bus die 30 Kilometer nach Liptovský Mikuláš zurücklegen, einer Stadt mit circa 30 000 Einwohnern am Fuß der Hohen Tatra, die ich als Nächstes erkunden will. Meine Durchquerung der Veľká Fatra war interessant, aber durch den vielen Schnee auch deutlich schwieriger und anstrengender als gedacht. In der Hohen Tatra werde ich es aber sicher mit noch mehr davon zu tun bekommen, daher beschließe ich, meine Ausrüstung zu erweitern, und kaufe in einem Sportgeschäft Schneeschuhe. Hoffentlich werden die nächsten Etappen leichter …
Mit slowakischen Naturschützern in der Hohen Tatra
Zeitraum: 31. März bis 6. April
Nationalpark: Hohe Tatra (73 800 Hektar)
In Liptovský Mikuláš gönne ich mir eine günstige Pension. Nachdem ich es mir in meinem kleinen Zimmer gemütlich gemacht habe, rufe ich für die weitere Planung Marek Kuchta an, der Kampagnenleiter bei einer hiesigen Naturschutzorganisation ist. In den nächsten Tagen möchte ich mit ihm und anderen Aktivisten einige Täler der Hohen Tatra besuchen. Doch zunächst verabreden wir, uns noch heute Abend zu treffen.
Der 40-jährige Marek hat wilde, dunkle Locken, aus denen erste graue Strähnen hervorschauen, und wirkt auf mich freundlich und sympathisch. Zu meiner Überraschung spricht er sehr gut Deutsch. Auf meine Nachfrage dazu lächelt er und erläutert: »Ich habe in Österreich Betriebswirtschaft studiert und dann gearbeitet, insgesamt habe ich 17 Jahre dort gelebt und natürlich auch die deutsche Sprache erlernt.« Ich frage mich, wie Marek als Wirtschaftswissenschaftler wohl dazu gekommen ist, Kampagnenleiter bei einer Naturschutzorganisation zu werden, doch bevor wir unsere Unterhaltung fortsetzen, laufen wir durch den leichten Sprühregen zu einem Pub namens Zeppelin.
Als wir ein Glas Bier vor uns stehen haben, erzählt mir Marek mehr über sich und seinen Werdegang: »Ich war schon immer naturverbunden und bin gerne durch die Wälder und Berge gewandert. Mein BWL-Job hat mir zwar Geld gebracht, mich aber nicht wirklich befriedigt. Über Dr. Martin Mikolas von der Uni Prag, den du noch kennenlernen wirst, erfuhr ich von dem Urwaldforschungsprojekt und dass dort auch Helfer ohne Biologiehintergrund mitarbeiten können. Die akribische Aufnahme der Forschungsflächen nimmt viel Zeit in Anspruch, daher habe ich oft Wochen mit den Wissenschaftlern in den wilden Wäldern verbracht, was meine Begeisterung für die Natur noch weiter angefacht hat. Als dann ›MYSMELES‹ mit einer großen Kampagne zum Schutz der slowakischen Wälder begann, bin ich gleich eingestiegen.«
Ich hake nach: »Was ist denn ›MYSMELES‹, und was war das für eine Initiative?«
Marek nimmt einen Schluck Bier und antwortet dann ausführlich: »Der Zustand der slowakischen Wälder hat sich in den letzten drei Jahrzehnten stark verschlechtert. Riesige Flächen wurden kahl geschlagen, häufig mit der Begründung, dass das zur Bekämpfung der Borkenkäfer notwendig sei. Daher ist auch der Holzeinschlag seit 1990 kontinuierlich um 75 Prozent gestiegen. So gingen seit den 70er-Jahren mindestens zwei Drittel des Lebensraums der Auerhühner verloren, einer wichtigen Charakterart unserer alten Fichtenwälder. Allein in den letzten zehn Jahren ist ihr Bestand um 40 Prozent zurückgegangen. Nun haben wir zwar neun Nationalparks, diese sind aber bislang nur sehr unzureichend geschützt. Viele Leute haben mit eigenen Augen gesehen, dass es mit unseren Wäldern bergab geht, daher hat sich ›MYSMELES‹ gebildet, eine Bürgerinitiative. Auf Deutsch übersetzt heißt das ›Wir sind der Wald‹.«
»Und welche Ziele hat ›MYSMELES‹?«, möchte ich wissen.
»Unser Schwerpunkt sind die Nationalparks. Nach internationalen Kriterien sollen sich dort mindestens 75 Prozent der Fläche ohne menschliche Nutzung natürlich entwickeln dürfen. Bei uns dagegen sind das bislang nur 20 Prozent. Auf dem großen Rest der Fläche ist sogar Holzeinschlag möglich. Da ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass die Nationalparks vom staatlichen Forstbetrieb betreut werden. Bei euch würde man sagen: ›Da hat man den Bock zum Gärtner gemacht.‹ Zwar nehmen die neun Nationalparks 6,5 Prozent der Landesfläche ein, wirklich geschützt ist davon aber wie gesagt nur sehr wenig. Das wollen wir ändern: 75 Prozent der Fläche in den Nationalparks als Kernzonen ohne jegliche menschliche Eingriffe ist unser wichtigstes Ziel. Außerdem wollen wir, dass die Parks nicht mehr vom Forstbetrieb, sondern von einer echten Naturschutzverwaltung betreut werden und dass die Umweltbildung deutlich verbessert wird.«
»Und wie seid ihr vorgegangen, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen?«, frage ich nach.
»Um unser Anliegen auf eine fundierte Grundlage zu stellen, haben wir die Unterstützung zahlreicher Wissenschaftler eingeholt, und dann sind wir mit einer Kampagne in den Medien an die Öffentlichkeit gegangen. Bis jetzt haben wir 71 000 Mitglieder gewonnen, daher wurde auch der Politik klar, dass es eine bedeutende Zahl an Menschen gibt, die Veränderungen wollen.«
»Und habt ihr bereits Erfolge erzielt?« Das interessiert mich brennend, denn leider wird der Naturschutz viel zu oft wirtschaftlichen Interessen geopfert.
Marek lächelt zufrieden und erzählt: »Natürlich gab es große Widerstände, vor allem aus Forstwirtschaft und Holzindustrie. Aber wir haben schon jetzt etwas erreicht. So werden die Nationalparks der Naturschutzverwaltung mit einem eigenen Budget übergeben, und wir sind dabei, die streng geschützten Kernzonen in den Nationalparks deutlich zu erweitern. Das ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber wir sind durchaus optimistisch. Langfristig wollen wir erreichen, dass sich mindestens fünf Prozent unserer Landesfläche zu ungenutzter Wildnis entwickeln dürfen!«
In diesem Zusammenhang muss ich an die Situation in Deutschland denken. Bei uns war das Ziel der von der Bundesregierung bereits im Jahr 2007 bekannt gegebenen nationalen Biodiversitätsstrategie, bis 2020 zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete auszuweisen. Bislang sind wir bei lediglich 0,7 Prozent, was sehr wenig ist, insbesondere da die EU für ihre Mitgliedsstaaten bis 2030 sogar zehn Prozent an streng geschützten Flächen vorsieht.
Da der Zeppelin schon recht früh schließt, gehen wir bald zurück zur Pension, in der Marek ebenfalls übernachtet. Nachdem wir am nächsten Morgen zusammen gefrühstückt haben, taucht um acht Uhr Erik Balaz, ein Aktivist und Filmemacher auf, mit dem wir gemeinsam das wilde Sucha-Tal besuchen wollen.
Während wir durch den grauen Morgen im Dauerregen auf die Berge der Hohen Tatra zufahren, erzählt mir der 43-jährige Erik, dessen rosige Gesichtsfarbe gleich anzeigt, dass er viel Zeit draußen verbringt, von seinem Leben: »Ich war schon immer etwas anders als die meisten Leute, in meiner Jugend war ich der Punk mit Irokesenschnitt. Na ja, nach Abschluss der Schule dachte ich dann doch, ich muss etwas ›Vernünftiges‹ lernen, und studierte Forstwirtschaft in Zvolen. Allerdings wurde mir schnell klar, dass das nichts für mich ist. Ich liebe die Wildnis und natürlichen Wald, aber in Zvolen ging es nur darum, wie man den Wald wirtschaftlich nutzt. Mir fehlte die ganzheitliche Sicht auf das Ökosystem. Und dann habe ich mich in der Zeit schon für den Schutz von wilden Tälern in der Hohen Tatra gegen die Forstwirtschaft engagiert. Danach wäre es sowieso nichts mehr mit einer Karriere als Förster geworden. Stattdessen habe ich meine Liebe zur Natur mit dem Wunsch zusammengebracht, auch andere Menschen dafür zu begeistern, und begonnen, Bücher zu schreiben und Filme zu drehen. Einen Ausflug in die Politik habe ich ebenfalls unternommen, um noch mehr bewirken zu können.«
Ich bin fasziniert von Eriks Lebensgeschichte, und die Fahrt vergeht wie im Flug. Schließlich halten wir auf einem kleinen Parkplatz und beginnen unsere Wanderung bei ständigem, aber nicht zu heftigem Regen. Das Sucha-Tal ist die wärmste Ecke am Südrand der Hohen Tatra, und so ist der untere Teil des Tals bereits weitgehend schneefrei. Der hier vorherrschende Kalkuntergrund hat eine vielfältige Vegetation hervorgebracht: Buchen, Fichten, Tannen, Ahorne, Eschen und einige der seltenen Eiben wechseln einander ab. Auf trockenen Felsrücken wachsen niedrige, knorrige Kiefern. Wir passieren eine enge Klamm mit farnbewachsenen, überhängenden Felsen und weiß schäumenden Wasserfallkaskaden und steigen dann auf einem kaum sichtbaren Pfad langsam höher.
Währenddessen erzählt Erik von der Geschichte der Hohen Tatra: »Dieses Gebirge wurde lange Zeit intensiv durch den Menschen genutzt, wodurch zum Beispiel die Eiche, die in den tieferen Lagen bis 800 Meter vorkam, fast vollständig verschwunden ist. Die Hochweiden wurden intensiv für die Viehzucht genutzt, und weite Teile der Wälder sind kahl geschlagen worden. Dann wurde hier aber bereits 1949 der erste Nationalpark der Slowakei ausgewiesen, mit immerhin 73 800 Hektar Fläche, ergänzt durch weitere etwa 30 000 Hektar auf der polnischen Seite. Da die Beweidung der Almen zu starker Erosion geführt hatte, wurde sie komplett verboten, während der größte Teil der Wälder im Nationalpark weiterhin forstwirtschaftlich genutzt wurde.«
»Und wie war die Entwicklung hier im Sucha-Tal?«, hake ich nach.
»Diese Wälder gehörten ursprünglich einer Gemeinschaft von privaten Waldbesitzern, wurden aber wie überall im Land mit der Machtübernahme der Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht und blieben seit Ausweisung des Nationalparks ungenutzt. Nach dem Ende des Kommunismus Anfang der 90er-Jahre erhielten die Eigentümer ihren Wald zurück und begannen mit dem Holzeinschlag im Tal. Erst nach massiven Protesten durch Naturschützer kam man zu einer Einigung. Zunächst wurde lediglich ein Teil des Waldes von der Umweltschutzbewegung gepachtet, heute zahlt der Staat den Waldbesitzern eine Entschädigung dafür, dass sie ihren Wald auf immerhin 1585 Hektar Fläche nicht nutzen.«
»Wow, das ist ja eine gute Lösung!«, werfe ich begeistert ein. »Passiert das auch woanders in der Slowakei?«
Erik nickt. »Ja, denn tatsächlich gehört eine Menge Wald in den Nationalparks privaten Waldbesitzern. 2020 hat das Institut für Umweltpolitik eine Studie veröffentlicht, nach der das den Staat bei einem Kernzonenanteil von 75 Prozent in den Nationalparks 12,5 bis 29,7 Millionen Euro an jährlicher Entschädigung kosten würde. Würde er all diese Flächen kaufen, müssten 374 Millionen Euro aufgewendet werden.«
»Das ist ja eine ganze Menge Geld«, konstatiere ich.
Doch Erik erwidert mit müdem Lächeln: »Das klingt nach viel, tatsächlich entspricht diese Summe aber lediglich den Kosten für zehn Kilometer Autobahnbau!«
Während wir weiterwandern, erleben wir einen unglaublich vielfältigen Wald. Erste Farbtupfer von Haselnusskätzchen und Seidelbastblüten lugen aus dem Dickicht hervor. Zwar sind viele Fichten abgestorben, aber überall gibt es auch noch grüne Exemplare, was zusammen mit dem vielen Totholz den Eindruck eines ziemlich offenen Waldes voller Lichtungen entstehen lässt. Dass auch die Tiere diese Wildnis lieben, zeigen frische Wolfs- und Bärenspuren.
Streckenweise laufen wir durch völlig weglose, abwechslungsreiche Waldbereiche, und Erik erklärt uns, warum dieser Lebensraum ideal ist für Auerhühner: »Eigentlich brauchen diese wilden Waldhühner gar nicht viel: einen Wald, in dem es auch Nadelbäume gibt, da die Nadeln ihre Winternahrung sind, tiefbeastete Fichten, um vor Adlerangriffen geschützt zu sein, besonntes Totholz als Lebensraum für Ameisen und andere Insekten, die als Nahrung für die Küken wichtig sind, sowie etwas Unterholz und Beerkraut als Deckung. Ein dichter, dunkler, gleichaltriger Fichtenwirtschaftswald kann kein Lebensraum für diese Vogelart sein, sie ist wirklich auf diese alten, abwechslungsreichen Bergwälder angewiesen.«
»Und warum sind Auerhühner so selten geworden?«, möchte ich wissen.
Eriks Antwort ist eindeutig: »Das liegt vor allem am Kahlschlagen der alten Fichtenwälder, oft nach einer Borkenkäfermassenvermehrung. Mit den Flächen toter Fichten würden die Auerhühner noch ganz gut klarkommen, doch das übliche komplette Abräumen des ganzen Totholzes und die nachfolgende dichte Bepflanzung zerstören ihren Lebensraum vollständig. Wie du ja schon weißt, sind die Bestände dieses Waldvogels in der Slowakei daher stark zurückgegangen.«
»Auch hier in der Hohen Tatra?«
»Nein, dadurch dass es uns in weiten Teilen gelungen ist, solche Abräumaktionen hier zu verhindern, ist der Bestand sogar gewachsen! Inzwischen haben wir erreicht, dass auch in anderen Auerhuhnbiotopen keine Kahlschläge mehr durchgeführt werden dürfen, daher besteht etwas Hoffnung. Allerdings gibt es Bereiche wie die Niedere Tatra, in denen der alte Wald in einem solchen Umfang verschwunden ist, dass die Auerhühner dort langfristig wohl aussterben werden.« Ich finde die Parallelen zu Deutschland sehr interessant, wo es leider auch die Regel ist, dass von Borkenkäfern zum Absterben gebrachte Baumbestände kahl geschlagen und vollständig abgeräumt werden. Das hat sehr viele negative Konsequenzen, auch wenn bei uns in den meisten Wäldern keine Auerhühner leben.
Nur selten bekommen wir einen Ausblick über die wolkenverhangenen Nadelwälder weiter talabwärts. Zumindest ist der Dauerregen im Wald nicht ganz so unangenehm. Entlang der Sucha, wo Kaskaden aus Eis von den Felsen bis an den Bach reichen, gelangen wir schließlich zurück zum Auto. In Liptovský Mikulàš essen wir noch zusammen, und dann verabschiede ich mich von meinen heutigen Begleitern. Ich gehe früh ins Bett, denn am nächsten Tag bin ich schon wieder verabredet.
Dr. Martin Mikolas holt mich in der Pension ab, und gemeinsam fahren wir im strömenden Regen durch eine offene Landschaft zum Eingang des Jalovecká Tals. Martin, ein jugendlich wirkender 35-jähriger slowakischer Waldökologe von der Universität Prag, arbeitet für das bereits erwähnte Forschungsprojekt zu europäischen Urwäldern, »REMOTE Primary Forests«. Während wir einige Schritte in das dicht bewaldete Tal hineinlaufen, erzählt er mir mehr über die Geschichte der beiden zusammenhängenden Täler Jalovecká und Bobrovecká: