
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dustlands
- Sprache: Deutsch
***Sabas letzter Kampf*** NICHTS IST GEWISS UND NIEMAND IST SICHER IM HERZSCHLAGFINALE DIESER PREISGEKRÖNTEN ENDZEITFANTASY Saba ist bereit, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und DeMalo und seine Soldaten zu schlagen. Bis sie ihm begegnet und er mit seiner verführerischen Vision von New Eden, einer geheilten Erde, alle ihre Erwartungen unterläuft. DeMalo will, dass Saba ihn begleitet, im Leben und bei seinem Werk, eine gesunde, stabile, nachhaltige Welt zu erschaffen – für die wenigen Auswerwählten. Jacks Entscheidung ist klar: DeMalo zu bekämpfen und New Eden aufzuhalten. Saba verpflichtet sich diesem Kampf, immer noch unsicher, und ihre Verbindung mit DeMalo bleibt ihr Geheimnis. Gemeinsam mit ihrem Bruder Lugh, der auf ein Stück Land in New Eden hofft, führt Saba eine unerfahrene Rebellengruppe in den Kampf gegen den mächtigen und charismatischen DeMalo mit seinen Siedlern und Soldaten. Welche Chance haben sie? Saba muss handeln. Und willens sein, den Preis zu zahlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Moira Young
Dustlands – Der Blutmond
Roman
Über dieses Buch
Saba ist bereit, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und DeMalo und seine Soldaten endgülitig zu schlagen. Doch DeMalo will, dass Saba ihn begleitet, im Leben und bei seinem Werk, eine heile neue Welt zu erschaffen – für die wenigen Auserwählten von New Eden. Und er stellt ihr ein Ultimatum: Bis zum Blutmond muss sie sich entschieden haben.
Jacks Entscheidung ist klar: DeMalo mit einer klugen Strategie zu besiegen. Saba verpflichtet sich diesem Kampf, immer noch unsicher, und ihre Verbindung mit DeMalo bleibt ihr Geheimnis. Gemeinsam mit ihrem Bruder Lugh, der auf ein Stück Land in New Eden hofft, führt Saba eine unerfahrene Rebellengruppe in den Kampf gegen den mächtigen und charismatischen Wegbereiter mit seinen Siedlern und Soldaten. Welche Chance haben sie? Saba muss handeln. Und willens sein, den Preis zu zahlen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Moira Young, geboren und aufgewachsen in British Columbia im Westen Kanadas, trat als Schauspielerin und Opernsängerin in Kanada und Europa auf. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Bath, England. Ihre DUSTLANDS-Trilogie erschien in zahlreichen Ländern und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet.
Im FISCHER Taschenbuch sind die beiden ersten Bände ›Die Entführung‹ (Bd. 19131) und ›Der Herzstein‹ (Bd. 19132) lieferbar.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
›Raging Star‹ bei Scholastic Children’s Books, London.
Copyright © Moira Young, 2014
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: www.buerosued.de
ISBN 978-3-10-403281-8
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen
des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403281-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Ich hab von meiner [...]
Die östliche Klamm
Nacht sieben
Nacht sechs
Nacht fünf
Nacht vier
Nacht drei
Nacht zwei
Danach
New Eden
Abbildung
Ich find den Fluss [...]
Dank
In liebevollem Gedenken an
John Elgin Stark,
Träumer, Künstler, Lehrer
Ich hab von meiner lange toten Mutter geträumt.
Als ich neun oder zehn war, hab ich das jede Nacht getan.
Ihr Leben ist aus ihr rausgeblutet, als sie Emmi geboren hat,
und Pas Trauer mit anzusehen ist furchtbar gewesen.
Er hat sie auf den Scheiterhaufen gelegt,
auf ihren Bestattungsscheiterhaufen,
den er mit seinen untröstlichen Händen errichtet hatte.
Immer wieder hat er sie beweint, hat sie geküsst,
ihr Gesicht, ihre Lippen, ihre Haare.
Stirb nicht, verlass mich nicht, süße Allis, geh nicht.
Meine goldene Schönheit.
Mein Leben.
Dann hat er den Scheiterhaufen angezündet, um sie,
seine Herzseele,
zurück zu den Sternen zu schicken.
Was am besten gewesen ist in uns, ist zu Asche verbrannt.
Sie ist durch meine Träume gelaufen,
meine sonnenhelle Mutter,
jede Nacht in jenen ersten zwei Jahren.
Und Lugh ging’s genauso.
Bei Lugh und bei mir genau das Gleiche.
Das ist ein kleiner Trost gewesen. Schätz ich.
Und so wie das Licht erloschen ist, ist unsere Finsternis gewachsen, und sie ist nicht mehr durch meine Träume gelaufen.
Aber jetzt, jetzt ist sie wieder da.
Im Dunkel meiner Träume
ist sie wieder
lebendig.
Die östliche Klamm
Wir laufen. Durch die Nacht. Wir fünf. Durch den weißen nächtlichen Wald von New Eden. Lugh und Tommo und Ash und Creed und ich. Wir fünf. Wir laufen.
Trockene Waldstreu polstert den Boden. Dämpft das Trommeln unserer Stiefel. Unser Atem macht Wölkchen in der kalten Luft. Wir sind alle hellwach und ganz bei der Sache.
Lugh trägt das Seil, hat es sich um die Brust geschlungen. Ich trag das Sprengpaket. In Stoff gewickelt, in meinem Beutel verstaut, zusammen mit meiner kärglichen Ausrüstung.
Weitgucker. Bettzeug. Medizintasche. Wasserschlauch. Salzblock. Essnapf. Hemd. Das Messer in der Scheide in meinem Stiefel. Bolzenschießer. Waffengürtel. Mein Weißeichenbogen und ein voller Köcher. Und der Herzstein liegt kühl in der Mulde an meinem Hals. Das ist es so ziemlich. Viel ist es nicht.
Partisanen reisen mit wenig Gepäck. Und schnell. Und wir sind Partisanen. Wir sind die wiedergeborenen Free Hawks. Wir wollen für das Recht kämpfen, in New Eden zu leben. Gutes Land und sauberes Wasser sind knapp in dieser Welt. Aber hier in New Eden gibt es das. Und da haben alle ein Recht drauf. Schwache und Starke. Alte und Junge. Menschen und Tiere und alle, die sich die Erde teilen. Nicht nur er und seine Auserwählten.
Er. DeMalo. Der Wegbereiter. Seine Auserwählten: die Verweser der Erde. Unverdorbene junge Leute. Stark und gesund. Gebärfreudig, Arbeiter für seine glänzende neue Welt. Mit vorgehaltener Waffe in seinen Dienst gezwungen. Und dann von ihm umschmeichelt und umworben. Überzeugt und überwältigt und seinem Willen gebeugt. Von seiner Tonton-Armee bei der Stange gehalten.
Heute Nacht schlängeln wir uns zwischen Bäumen durch. Jeder sucht sich seinen eigenen Weg. Wir springen über Wasserläufe. Über Felsen. Dann werden wir plötzlich langsamer, müssen uns ganz vorsichtig einen Weg durch ein Stolperfeld suchen, wo die Wurzeln über der Erde liegen. Verletzungen können wir uns nicht leisten. Bloß keine Ausrutscher, vertretenen Füße, Knochenbrüche.
Wir sind am äußersten Rand von New Eden. In der hintersten südöstlichen Ecke, wo es ins öde Raze übergeht. Das Land hier ist knochentot. Keine Siedlungen oder Farmen. Es besteht nur aus Graten und Senken und Hügeln. Hier ist das Land verschlossen. Die Erde ist nur eine dünne Schicht auf dem Fels. Die Bäume verwurzeln sich durchtrieben und zäh.
Wir bleiben so weit wie möglich auf höherem Gelände. Unsere Waldwelt ist gut beleuchtet. Vom Mond in kaltes Weiß getaucht. Wir verlassen die Schatten. Laufen raus ins Licht. Dann wieder zurück in die Schatten. Rein und raus, immer wieder. Wir sind versilbert. Weiß getüncht. Gespenster auf der Flucht.
Und Tracker ist mein gespenstischer Wolfshund. Ein zotteliger Herr der Wälder. Sein großer Körper streift mich beim Laufen. Hoch über uns krähensegelt Nero durch die Nacht. Lässt sich vom Wind über ein Meer aus Sternen tragen. Ein Meer aus rastlosen Sternen.
Es ist Sternenzeit. Sternenjahreszeit. In diesen kurzen Tagen des Jahres, wenn das Licht früh schwindet und die Dinge vergehen, flitzen die Sterne durch die Nacht. Sie sind die ruhelosen Seelen der Toten. Die zur Erde zurückkehren, weil sie noch was zu erledigen haben.
Ich lauf meistens vorneweg. Aber hin und wieder lass ich mich zurückfallen, um meine Kräfte zu schonen. Osten, das ist unsere Richtung, genau nach Osten, gemessen am Großen Bären. Es ist nicht mein Plan gewesen, dass wir den ganzen Weg rennen. Es ist einfach so gekommen. Als wir die Höhle verlassen haben, wo wir Rast gemacht hatten, bin ich zügig losgegangen. Nach ein paar Schritten waren wir schon am Rennen. Wir sind zu angespannt, zu aufgeregt, um langsamer zu laufen.
Ich halt von hier hinten aus die Augen offen. Ich such nach Jacks erster Wegmarkierung. Nach dem Anfang von seinem Weißfichtenpfad. Die Weißfichte ist ein Baum wie kein anderer. Verkümmert und verdreht. Leicht zu entdecken, tags wie nachts. Als ich den ersten Baum seh, seine erste Markierung, lächel ich. Er hat es genauso gemacht, wie er gesagt hat. Auf der Nordseite vom Baum hat er in Schulterhöhe ein Stück Wurzel an einen Ast gehängt. So hat er mir diese Abkürzung alle eineinhalb Meilen markiert. Es ist unser Geheimnis. Seins und meins.
Und Jack ist auch mein Geheimnis. Alle anderen halten ihn für tot. Sie glauben, er ist vor einem Monat getötet worden. Als wir die Tonton-Festung Resurrection in die Luft gesprengt haben. Und so muss es auch sein. Er muss tot bleiben. Jack hat bei uns nicht viele Freunde. Die, mit denen ich gerade durch diese Wälder renn, sind nicht seine Freunde.
Ash und Creed hassen ihn, weil er bei den Tonton gewesen ist. Jack hat sich dem Feind angeschlossen, das stimmt. Allerdings um gegen ihn zu arbeiten, nicht für ihn. Aber an ihm klebt Blut. Er ist dabei gewesen in jener Nacht, bei dem Darktrees-Gemetzel, als die Tonton unsere Freunde getötet haben. Die Free Hawks und die Weststraßenräuber. Er hat bei diesem Gemetzel nicht mitgemacht. Genau genommen hat er ihnen das Leben gerettet. Creed und Ash, meine ich. Und Maev auch. Und er hat uns in Resurrection geholfen. Er ist es gewesen, der den Laden in die Luft gesprengt hat. Sein schnelles Denken hat Emmi das Leben gerettet.
Nichts davon spricht für ihn. Nicht bei Ash und Creed. Sie haben in jener Nacht ihre Sippen verloren. Ihre Seelen sind tief und für immer verletzt. Jack ist mit den Mördern geritten, das reicht, um ihn zu verurteilen. Wenn sie wüssten, dass er am Leben ist, würden sie ihn garantiert verraten.
Lughs Hass auf Jack ist der größte. Tommos kommt dicht dahinter. Bei beiden hat es mit mir zu tun. Slim kennt Jack nicht. Molly und Emmi lieben ihn. Wie immer bei Jack, ist es nicht einfach. Also haben wir entschieden, er und ich. Wir können nicht allen trauen, also ist es am sichersten, wenn wir es keinem erzählen. Für die anderen muss er tot sein.
Wenn sie nur wüssten, dass Jack auf unserer Seite steht. Er ist mein Kundschafter, mein Spitzel. Baut sich fleißig sein kleines Netzwerk von New-Eden-Rebellen auf. Er hat ein paar Maulwürfe, ein paar hellwache Verweser, die dieselben Ziele haben wie wir. Und ein paar Geächtete. Die sogenannten Baumhunde, weil sie in den Wäldern untergetaucht sind. Als DeMalo ihr Land beschlagnahmt hat, haben sie beschlossen zu bleiben. Sich zu verstecken und ihm Ärger zu machen.
Jack hat mir geholfen, diese erste Aktion zu planen. Er hat Landkarten in die Erde gekratzt. Wir haben über Taktik und Waffen gesprochen. Er hat den ganzen Weg für uns markiert, etwas über sechs Meilen von der Höhle bis zur Brücke. Die Brücke über die östliche Klamm, die New Eden mit dem Raze verbindet. Die Brücke, die wir in die Luft jagen wollen. Sie ist von Sklavenarbeitern wieder aufgebaut worden. DeMalo ist ein großer Straßen- und Brückenbauer. Damit die Tonton schneller vorankommen. Damit seine Verweser der Erde es leichter haben, wenn sie ihr geraubtes Ackerland bestellen. Wir wollen sie alle zerstören, eine nach der anderen. Die hier ist abgelegen, eine gute Stelle, um anzufangen. Hier können wir unseren Drill, unsere Disziplin, unsere Vorgehensweise ausprobieren. Ohne Angst vor Störungen haben zu müssen.
Es ist gut, dass Jack den Weg für uns markiert hat. Mittlerweile kennen wir New Eden ganz gut. Aber bis sie diese Brücke gebaut haben, hat es hier in dieser abgelegenen Ecke gar nichts gegeben. Wir kennen sie nur ganz grob, nicht bis ins Kleinste.
Vor einer Weile hab ich mich zurückfallen lassen. Halte Ausschau nach Jacks letzter Wegmarkierung. Da vorne ist eine Weißfichte. Die hier steht ganz für sich allein da. Als ich näher komm, werd ich ein bisschen langsamer. Ja, da ist es. Das Wurzelstück, an einem Ast. Die Klamm und die Brücke sind gleich da vorne. Heiße Aufregung flackert in mir auf. Jetzt übernehm ich wieder die Führung. Ich stürm vor, und Tracker bleibt neben mir.
Creed läuft ein Stück links von mir. Wie immer trägt er kein Hemd. Er ist vom Hals bis zur Hüfte tätowiert. Und er trägt keine Stiefel, auch wie immer. Er sagt, seine Füße vermessen beim Laufen das Land. Die Kälte hat ihn in einen affigen Gehrock gestupst. Die schäbigen Rockschöße flattern hinter ihm her. Als ich an ihm vorbeirenn, wirft er mir ein breites weißes Grinsen zu. An seinen Ohren glitzern Silberringe.
Ash läuft mit langen, federnden Schritten. Die Schultern hält sie tief. Ihre Haare flattern hinter ihr her, ein hüftlanges Banner aus Zöpfen. Ich nick ihr im Vorbeilaufen zu. Fast geschafft. Ihr Gesicht mit dem eckigen Kinn verzieht sich zu einem seltenen Lächeln. Ash ist kein Miesepeter, gar nicht. Aber fröhlich ist sie auch überhaupt nicht. Außer es gibt Ärger oder wir sind in Gefahr oder ein Kampf liegt vor uns. Darauf hofft sie jetzt bestimmt. Aber nicht im schlechten Sinn.
Ich arbeite mich zu Tommo vor. Komm ihm näher und hol ihn ein. Er weicht mir aus. Senkt den Kopf, so dass seine Haare seine Augen verbergen. Aber ich weiß, was ich sehen würde, wenn ich sie sehen könnte. Verletzung. Und Wut. Ich berühr ihn am Arm, damit er weiß, dass wir in der Nähe der Brücke sind. Er schüttelt mich ab. Hastig. Ein bisschen grob.
Tommo hasst mich jetzt richtig. Und zu Recht. So wie ich auf seinem Herz rumgetrampelt bin. Achtlos, ohne an die Auswirkungen zu denken. Mit fünfzehn Sommern schwankt er zwischen Junge und Mann. Und ich hab sie beide getäuscht, den Mann wie den Jungen, mit einem Kuss. Mit dem Kuss einer Geliebten, der eine Lüge gewesen ist. Jetzt klammert er sich an die Verletzung, die meine Täuschung ihm beigebracht hat.
Tracker und ich preschen weiter vor und nähern uns Lugh. Er führt uns seit einer Weile an. Vorhin ist mir aufgefallen, dass er Tommo nicht die Führung überlassen wollte. Wahrscheinlich will er uns damit was zu verstehen geben. Aber ich hab jetzt keine Zeit, drüber nachzudenken, was.
»Lugh!«, sag ich leise, als ich zu ihm aufhol. »Wir sind fast da. Ab jetzt übernehm ich.«
Er wirft mir einen kurzen Blick zu. Seine Schönheit ist vom Mond weiß getüncht. Seine dunkle Geburtsmondtätowierung ist deutlich zu sehen. Oben auf seinem rechten Wangenknochen, genau wie bei mir. Die hat Pa dahin gemacht, um uns als was Besonderes zu kennzeichnen. Wir zwei, seltene Mittwinterzwillinge. Der Junge aus Tageslicht gemacht, golden wie die Sonne, das Herzkind unserer Mutter. Das Mädchen, ich, dunkel wie die Nacht, im Schatten von ihrem Bruder geboren. Man sieht uns kaum an, dass wir verwandt sind, geschweige denn, dass wir uns den Mutterbauch geteilt haben.
»Lass dich zurückfallen«, sag ich zu ihm. »Ich führ uns dahin, das weißt du.« Er beachtet mich nicht. Starrt einfach gradeaus, das Kinn störrisch vorgereckt. Er wird schneller. Also werd ich auch schneller, und im Nu liefern wir uns ein Rennen. Kopf an Kopf. Ungläubig guck ich ihn an. »Lass das. Komm schon, Lugh.«
Er gibt keine Antwort. Strengt sich noch mehr an. Atmet schwer. Seine Nasenlöcher blähen sich. Sein Kiefer ist völlig verkrampft. Aber er läuft schon zu lange so schnell.
Kopfschüttelnd leg ich noch einen Zahn zu. »Na schön! Wie du willst!«
Mühelos zieh ich davon. Wir lassen ihn hinter uns, Tracker und ich. Ich guck mich nach ihm um: Er hat angehalten. Steht vornübergebeugt, die Hände auf die Knie gestützt. Seine Brust hebt und senkt sich heftig. Ash, Creed und Tommo müssen um ihn rumlaufen.
Was für ein Zeitpunkt für eine Kraftprobe. Ich werd nachher mal ein Wörtchen mit ihm reden müssen. Im Augenblick muss das warten. Jetzt haben wir eine Brücke in die Luft zu jagen.
Wir hocken uns hinter eine Felsgruppe ein gutes Stück oberhalb von der Brücke. Wir warten, bis wir wieder zu Atem kommen, und gucken uns dabei das Gelände an. Tracker lässt sich zwischen Ash und mich plumpsen und die Zunge zum Abkühlen aus dem Maul hängen.
Nero kommt runtergesegelt und setzt sich auf meinen Kopf. Seine Krallen piksen mich in die Kopfhaut. Ich hol ihn da runter, und dabei find ich die klitzekleine Rolle aus Kirschbaumrinde an seinem rechten Bein. Das ist eine Botschaft von Jack. Ich bind sie los, aber so, dass die anderen nichts merken. Es könnt was sein, was ich sofort wissen muss. Er hat eine Pyramide in die Rinde gekratzt. Nein, ist nicht eilig. Er hat nur unseren Treffpunkt für heute Abend geändert. Wir treffen uns in Irontree. Ich steck die Rolle in die kleine Ledertasche an meinem Gürtel.
Dann guck ich mir durch den Weitgucker die Brücke und das Gelände drum rum an. Es ist alles genauso, wie Jack es mit einem Stock für mich in die Erde geritzt hat. Und wie ich es dann für meine Truppe gezeichnet hab, als wir diese Aktion durchgesprochen haben. Es ist alles haargenau so, wie er’s gesagt hat. Er hat ein gutes Auge für Einzelheiten, mein Jack, das ist mal sicher.
Sie haben auf den eisernen Überresten von einer alten Abwrackerbrücke aufgebaut. Haben ein paar Stützstreben aus Holz und eine neue Brückendecke und Tragbalken angebracht. Sie ist schlicht und robust, von einem Ende zum andern rund zwölf Meter lang und überbrückt eine steile Felsschlucht. Die östliche Klamm. Wie eine brutale Axtwunde im Körper der Erde. Ganz unten strömt schnelles, zorniges Wasser. Ein schmaler Fluss, silbern in der Nacht, schäumt und buckelt bergab.
Ash pfeift leise. »Hoffentlich hast du keine Höhenangst«, sagt sie zu Lugh. »Falls du doch tauschen willst, mein Angebot steht noch.«
»Was? Du glaubst nicht, dass ich das hinkrieg?«, fragt er.
Sie blinzelt, als sie seinen bärbeißigen Ton hört. »Sei nicht sauer. Du weißt doch, ich jag einfach gern Sachen in die Luft.«
»Besonders wenn sie von den Tonton gebaut sind«, sagt Creed.
»Von Sklaven, meinst du wohl«, sagt sie. »Das sind die, die New Eden aufbauen.«
»Okay«, sag ich, »lasst uns das noch mal durchgehen.« Ich klopf Tommo auf den Arm. Berühr ihn kaum. Er sieht mich an. »Tommo: Vorteile.«
Seine dunklen Augen funkeln, sind im Dunkeln nicht zu deuten. Er lächelt ein bisschen spöttisch. »Keine Wolken«, sagt er mit seiner rauen Stimme. »Heller Mond. Kleine Brücke. Schnell erledigt. Okay?« Er spricht jedes Wort überlangsam, überdeutlich aus.
Hitze versengt mir die Wangen. Neuerdings tut er so, als ob ich ihn von oben herab behandel. Was ich überhaupt nicht tu. Vielleicht sollte ein tauber Junge nicht an vorderster Front kämpfen. Ike hat sich deswegen immer Sorgen gemacht. Aber Tommo will nicht geschont werden, bloß weil er taub ist. Er braucht keine Schonung. Wir haben uns aus ein paar wirklich heiklen Situationen freigekämpft, und Tommo hat uns kein einziges Mal enttäuscht. Ich hab ihm noch nie eine Sonderbehandlung gegeben. Deshalb kränkt es mich, dass er so tut. Er weiß, dass mich das ärgert. Darum tut er’s ja. »Gut«, sag ich zu ihm. »Okay, Nachteile. Creed?«
Er sucht die Straße ab. »Das da ist unser Hauptproblem.«
Während er redet, hol ich aus meinem Beutel, was ich brauch. Eine schrille Blechpfeife an einer Schnur, die ich mir um den Hals häng. Unser Notsignal. Zwei Pfiffe heißen: aufteilen, fliehen, am Treffpunkt wieder sammeln. Dann das Sprengpaket, so groß und so schwer wie ein Ziegelstein. In Öltuch gewickelt, die lange Zündschnur fest aufgerollt.
»Wir haben keine gute Sicht«, sagt Creed. »Tommo und ich können in dieser Richtung nur etwa dreißig Meter weit sehen, in der anderen sogar nur etwa zwanzig Meter. Stimmt doch, Tommo?« Tommo nickt. »Wenn jemand um die Hügel da rumkommt«, sagt Creed, »haben wir ihn sofort am Hals, und das bedeutet schnelle Entscheidungen. Schießen oder nicht schießen.«
Die schmale unbefestigte Straße verläuft von Westen nach Osten. Sie kuschelt sich an die Hügel und kommt erst in letzter Minute für uns in Sicht. Genau wie Creed gesagt hat.
»Dein Informant«, sagt Lugh. »Ist der ganz sicher, dass die Tonton so weit draußen nicht Streife reiten?«
»Ganz sicher«, sag ich. »Aber wir halten die Augen offen und bewahren einen kühlen Kopf. Und zwar alle, Creed.«
»Was denn?«, fragt er. »Bin ich etwa ein Heißsporn? Ich bin eiskalt.«
»Ash«, sag ich, »du und Tracker, ihr seid unser Frühwarnsystem. Wo wollt ihr Wache halten?«
Mit ihrem eigenen Weitgucker sucht sie die Hügel um uns rum ab. Sie deutet auf einen mit Gestrüpp bewachsenen, langen und scharfen Hügelkamm hinter uns. »Da«, sagt sie, »keine Frage. Das ist die höchste Stelle in der Gegend.«
»Okay, Tracker geht mit dir«, sag ich. »Viel Glück. Na los, Junge, geh mit Ash.«
Er zögert. Gehorsam, aber hin- und hergerissen. Er ist ein Ein-Frauen-Wolfshund. Als ich ihn kennengelernt hab, ist er Mercys Hund gewesen. Dann hab ich ihn irgendwie – viele Tagesmärsche von seinem Zuhause entfernt – gefunden. Oder vielmehr er hat mich gefunden. Und mich für sich beansprucht.
»Tracker, geh«, sag ich.
Als er mit Ash davonrennt, gehen Creed und Tommo hinter den Felsen in Stellung. Vorteile, Nachteile, die beste Stelle für den Wachtposten, das haben wir alles vorher schon gewusst. Wir sind die ganze Aktion immer wieder durchgegangen, aber das ist jetzt der Ernstfall. Vor Ort alles noch mal zu wiederholen macht uns das richtig klar. Ich schieb mir drei kleine Birkenholzfackeln hinten in den Gürtel und klemm mir das Sprengpaket untern Arm.
»Bist du sicher, dass in dem Paket genug Sprengkraft ist?«, fragt Lugh.
»Ja«, sag ich. »Slim weiß, was er tut. Okay, los geht’s. Wir arbeiten, so schnell wir können.«
»Wir geben euch Deckung«, sagt Creed. Er ist jetzt ganz geschäftsmäßig, sein Blick ist grimmig und wachsam. Er und Tommo laden ihre Armbrüste.
Lugh und ich laufen eilig den Hang runter. Nero fliegt uns voraus. Wir kommen zur Straße, laufen die paar Schritte bis zur Brücke und klettern über die Felsen runter. Es ist dunkel unter der Brücke. Es riecht stark nach frisch geschlagenem Holz. Lugh legt das Seil ab, ich das Sprengpaket. Dann zünd ich mit Feuerstein und Feuerstahl eine Fackel an und halt sie hoch, damit wir die Brücke über uns sehen können.
Es ist eine ganz einfache Brücke. Wie ein flaches Dach, das von einem spitzen Dach gestützt wird. Die beiden Hauptträger, die aus den Abwrackertagen übrig sind – aus Eisen, schnurgerade, dreißig Zentimeter dick –, sind tief in die Wände der Klamm reingerammt. Von da aus verlaufen sie schräg nach oben und treffen sich in der Mitte von der Brückendecke. An jedem Träger sind v-förmig zwei neue Holzstreben befestigt. Keine Überraschungen. Alles ist so wie erwartet.
Ich riskier einen Blick in die Schlucht unter uns. Das hätt ich besser nicht getan. Hastig guck ich weg. Die Klamm fällt schwindelerregend steil ab bis zu dem Fluss, der da mit tödlicher Wut langströmt. Ich leuchte Lugh, während er sein Seil um den Eisenträger wickelt, genau da, wo er sich in die Schluchtwand bohrt. Mit einem Laufknoten bindet er es fest. Ich zünd die anderen beiden Fackeln an der ersten an. Dann steck ich alle drei so zwischen die Felsen, dass die Unterseite der Brücke erhellt wird. In der Zwischenzeit hat Lugh sich das andere Ende vom Seil um die Brust gebunden. Noch ein Laufknoten, um ihn zu sichern, und fertig. Er setzt sich rittlings auf den Träger. Ich geb ihm das Sprengpaket. Er verstaut es sicher in seiner Jacke und schiebt sich den Träger rauf, immer weiter rauf Richtung Brückenmitte. Ich roll so viel Seil ab wie nötig.
»Sachte, nur keine Hast«, sag ich zu ihm.
»Ich hab nicht vor loszurennen«, sagt er.
Er kommt zu dem V aus den beiden neuen Streben. Jetzt muss er dran vorbei. »Gib mir mehr Seil«, sagt er.
Er hält sich an der ersten Strebe fest und geht in die Hocke hoch. Dann steht er auf dem Träger auf. Ich halt den Atem an, während er um die beiden Streben rum und drüber weg klettert und sich dabei gut dran festhält. Es ist heikel. Er setzt die Füße ganz vorsichtig. Ich sorg dafür, dass das Seil ihn nicht behindert.
Dann hat er’s geschafft. Er lächelt. »Ziemlich glatt für die Füße.« Im Halbdunkel leuchten seine Zähne sehr weiß.
Wieder setzt er sich rittlings auf den Träger. Wieder schiebt er sich Zentimeter für Zentimeter voran und aufwärts Richtung Brückenmitte, während ich Seil nachgebe. Unbehagen kribbelt auf meiner Haut. Hör nicht auf das Tosen vom Fluss unter dir. Denk nicht dran, wie scharf die Felsen sind. Er zieht das Sprengpaket aus der Jacke.
»Steck’s gut fest. Mach langsam, Lugh, sei vorsichtig.«
»Sei doch mal still«, sagt er.
Das Geheul von einem Wolfshund lässt die Luft erzittern. Das ist Tracker. Das ist das Signal.
»Da kommt jemand«, sag ich.
»Hol die Fackeln«, sagt er.
»Aber das Seil …«
»Mach die Fackeln aus!«
»Rühr dich nicht vom Fleck, hörst du?« Ich lass das Seil fallen und lauf schnell zu den Fackeln. Ich schieb sie mit den Flammen voran zwischen die Felsen, um sie zu löschen. Als ich die letzte nehm, dreh ich mich nach Lugh um und seh, wie er die Hände ausstreckt. Um das Sprengpaket festzustecken.
Er streckt die Hände aus.
Er verliert das Gleichgewicht.
Und fällt.
Ich krabbel über die Felsen nach unten. Hechte nach dem Seil und pack es. Es spannt sich mit einem Ruck. Es hat sich ganz abgewickelt, weil Lughs Körper dran zieht, und verfängt sich am Holzstreben-V.
Lugh hängt in der Luft, hoch überm Fluss. Nur von dem Seil um seine Brust gehalten. Mit einer Hand umklammert er die Zündschnur. Das Sprengpaket baumelt tief unter ihm.
Ich steig hastig auf den Träger und krabbel drauf hoch, so schnell ich kann. Nero stößt zu uns runter und kreischt panisch. »Halt die Klappe«, zisch ich.
Ich kletter zwischen die Streben. Klemm mich dazwischen. Greif nach unten. Pack das Seil. Keine Ahnung, was ich da vorhab. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Mir ist ganz schlecht vor Angst. Lugh starrt zu mir hoch. Sein Gesicht ist angstverzerrt. Er dreht sich und schaukelt. Das Seil knarrt.
Dann hören wir ihn. Zuerst nur ganz leise. Hufschlag auf der Straße. Kommt von Westen her auf uns zu. Ein Pferd schnaubt. Zaumzeug klirrt. Metall. Das bedeutet astreine Ausrüstung. Zwei Reiter. Sie haben’s nicht eilig, aber sie trödeln auch nicht. Dann sind sie über uns. Ich wag nicht zu atmen, während keine eineinhalb Meter über mir eisenbeschlagene Hufe über die Brücke klappern. Während Lugh da unten hängt. Und sich dreht. Und das Seil knarrt. Ein Reiter sagt was. Der zweite lacht. Zwei Männer.
Sie erreichen die andere Seite. Ich atme weiter. Ihre Geräusche verklingen. Als sie die Straßenkurve um den Hügel rum nach Osten in Angriff nehmen, kann ich sie gut von hinten sehen.
Sie reiten gestriegelte Pferde mit poliertem Geschirr. Die knielangen Lederstiefel glänzen. Sie sind gepflegt und haben ganz kurze Haare. Von Kopf bis Fuß in Schwarz. Lange schwarze Gewänder. Es sind Tonton. DeMalos Miliz. Mitten in der Nacht. Am Rand vom Nirgendwo. Was zum Teufel wollen die hier? Sie verschwinden um die Kurve.
»Tonton«, sag ich zu Lugh.
»Schaukel mich«, sagt er.
»Was?«
»Schaukel mich zur Seite!«
Ich kapier sofort, was er will. Auf den Steilhängen wachsen Sträucher und zähe kleine Bäume. Wenn ich ihn zum Schaukeln bring – drei Meter weit oder so –, kann er sich vielleicht an einem von denen festhalten und in Sicherheit klettern. Ich fang an, das Seil hin- und herzuschaukeln. Ich bin stark, aber ich hab nicht viel Platz, und Lugh ist schwer. Er bewegt sich kaum.
»Mach weiter«, sagt er. »Fester.«
Ich zieh. Lass los. Zieh. Lass los. Meine Muskeln brennen. Meine Schultern kreischen. Ganz langsam werden die Schwingungen größer. Ich zapf die rote Hitze an. Lass sie meine Kraft verstärken.
»Hilf mir«, stoß ich hervor. »Atme mit mir. Nach außen ausatmen. Nach innen einatmen. Und schaukel mit.«
Unsere Blicke verschränken sich. Wir fangen an zusammenzuarbeiten. Zusammen zu atmen. Ausatmen, wenn ich zieh. Einatmen, wenn ich loslass. Und er schaukelt mit … beim Ausatmen … und beim Einatmen. Nach und nach wird es einfacher. Wir schaukeln ihn nach außen. Wir schaukeln ihn zurück. Bei jedem Atemzug kommt er ein Stückchen weiter.
Dann hör ich hastige Schritte. Tommo kommt runter zur Brücke. Von Creed geschickt, um nachzugucken, was los ist. Mit einem Blick erfasst er die Lage und flucht. Er klettert die Felsen runter, tiefer rein in die klaffende Schlucht. An einem robusten kleinen Baum findet er Halt. Stellt sich so hin, dass er Lugh packen kann, sobald der nahe genug kommt.
Wir schaukeln einmal, zweimal und …
»Jetzt!«, sagt Lugh.
Als er auf Tommo zuschwingt, streckt er den Arm aus, und Tommo reckt sich ihm entgegen. Sie packen sich an den Händen. Aber die Wucht von Lughs Rückwärtsschwung reißt Tommo von den Füßen. Sie lassen sich los. Steine rieseln bergab, während Tommo rückwärts krabbelt und knapp dem Tod entgeht. Er sucht sich einen festeren Halt.
»Fertig«, sagt er.
Als sie sich diesmal an den Händen fassen, zieht Tommo Lugh mit einem Ruck auf sich zu. Lugh packt den Baum, und die beiden purzeln übereinander. Aber er ist in Sicherheit. Lugh ist in Sicherheit. Beide sind sie in Sicherheit. Vor Erleichterung entfährt mir ein tiefer Seufzer.
Während Lugh sich an den Baum klammert, bis er sich ein bisschen erholt hat, zieht Tommo vorsichtig das Sprengpaket wieder hoch. Ich wink ihm zu, es mir schnell zu bringen. Er klettert zur Brücke und schiebt sich auf dem Träger bis da rauf, wo ich zwischen den Holzstreben eingeklemmt bin.
»Wir sollten abbrechen«, sagt Tommo.
»Gib mir das Paket«, sag ich. »Geh, hilf Lugh.«
»Ich hab kein gutes Gefühl dabei«, sagt er.
»Tommo, tu, was ich dir sag!« Ich steck mir das Paket sicher ins Hemd, schlängel mich um die Streben rum und rück weiter vor, ohne drüber nachzudenken, ohne nach unten zu gucken. Immer weiter den Träger lang, Zentimeter für Zentimeter, ins Stockdunkle unter der Brücke, bis ich mit dem Kopf an die Decke stoß. Dann hole ich ganz, ganz vorsichtig das Paket raus und schieb es mit einer Hand an seinen Platz. Ich vergewisser mich, dass es ganz fest sitzt, dann schieb ich mich rückwärts wieder den Träger runter und roll dabei die Zündschnur ab.
Endlich hab ich wieder festen Boden unter den Füßen. Geschafft. Lugh und Tommo helfen mir runter, und dann klettern wir schnell den Hang rauf. Plötzlich zieht eine tiefhängende Wolkenbank auf. Feucht und weiß und dicht wie Holzrauch. Ich kann kaum meine eigenen Füße sehen. Wir rollen die Zündschnur so gerade wie möglich ab. Über Felsblöcke, zwischen Sträuchern und Bäumen durch. Als wir bei Creed ankommen, ist nicht mal mehr ein halber Meter übrig.
Er hat schon einen Span angezündet. »Was zum Teufel ist da passiert?«, fragt er.
»Später«, sag ich. »Zünd sie an, wir sind schon zu lange hier.«
Die Zündschnur fängt nicht sofort Feuer. »Feucht«, sagt Creed. »Das ist diese verdammte Wolke. Wisst ihr, was das bedeutet? Ash kann überhaupt nichts sehen. Und viel hören kann sie bestimmt auch nicht.«
Lugh zittert immer noch vor Schreck. Ich drück seine Schultern. »Alles in Ordnung?«, frag ich.
»Dank dir«, sagt er. »Und dir, Tommo.« Er nimmt Tommos Hand. »Danke, Mann. Du hast mir das Leben gerettet.«
Ich wag es, Tommos andere Hand zu nehmen. Zu meiner Überraschung reißt er sie mir nicht weg. »Ohne dich hätt ich das nicht tun können«, sag ich. Er schenkt mir ein winziges Lächeln.
»Komm schon, komm schon«, murmelt Creed. Endlich fängt die Zündschnur Feuer. Es zischt. Knistert. Aber sie brennt nur schleppend ab. »Komm schon, brenn«, sagt er, »brenn doch, meine Schöne, verdammt.«
Genau da tönt Trackers Geheul durch die Nebelwolke. Wir reißen die Köpfe hoch.
Tommo fragt mich stumm: »Was ist?«
»Das ist Tracker«, sag ich.
Aber wenn Tracker schon wieder heult, dann heißt das …
Mein Gedanke erstirbt. Die Wolkenwand reißt auf wie eine Tür. Da unten reiten drei Tonton in Sicht. Sie kommen von Westen, genau wie die anderen zwei. Dahinter rattern zwei Pferdewagen. Creed flucht. Ich schnapp mir meinen Weitgucker. Im ersten Wagen sitzen ein Junge und ein Mädchen nebeneinander mit geraden Rücken auf dem Fahrersitz. Im weißen Wolkenlicht hebt sich das Brandmal in Form von einem geviertelten Kreis deutlich von ihren Stirnen ab. Verweser der Erde. DeMalos Auserwählte.
Sie hat sich ein gepunktetes Tuch um den Hals gebunden. Die Haare hängen ihr lose auf den Rücken. Sie kann noch nicht mehr als vierzehn Sommer gesehen haben. Er, der Junge, ungefähr genauso. Stark und kerngesund, wie alle Verweser. So jung. Wahrscheinlich sind sie gerade erst verheiratet worden und kommen frisch aus Edenhome. Von DeMalo füreinander ausgewählt, wie das Spitzenzuchtvieh, das sie sind. Der Wagen ist hochbeladen mit Tisch, Stühlen, Werkzeug und anderen Sachen, die man für ein Leben auf dem Land braucht. Aber wo? Bestimmt nicht im Raze. Das ist eine öde, tote Gegend.
Aber es ist der zweite Wagen, bei dem mein Herz aussetzt.
Ein Tonton fährt ihn. Ein anderer sitzt mit dem Gesicht nach hinten drauf, den Feuerstab im Anschlag, und bewacht die Ladung. Es sind Sklavenarbeiter. Vielleicht zehn, zwölf. Männer und Frauen, auf engstem Raum zusammengepfercht. Sie sitzen hinten in dem offenen Wagen auf dem Boden. Geschorene Köpfe. Eisenhalsbänder. Zusammengekettet, wie die Sklaven es hier immer sind. An den Knöcheln, wenn sie arbeiten, an Knöcheln und Händen und Hals für den Transport.
Acht berittene Tonton bilden die Nachhut. Zwei große Jagdhunde laufen neben ihnen. Kurzes, glattes weißes Fell. Rosa Augen. Massige Köpfe mit kräftigen Kiefern.
»Geisterjagdhunde«, sagt Creed. »Kriegshunde.«
Mein Blick zuckt zur Zündschnur. Sie brennt ab, immer noch schleppend, aber stetig. In Richtung Brücke und Sprengstoff. Sklaven. Unschuldiges Blut. Schon bin ich in Bewegung. Schmeiß den Weitgucker zu Boden, zieh mein Messer aus der Scheide in meinem Stiefel.
Tommo packt mich am Ärmel. »Zu spät«, sagt er.
Ich schüttel ihn ab und renn los.
»Saba, komm zurück!«, sagt Lugh.
Gebückt stürm ich den Hang runter und jag auf das brennende Ende von der Zündschnur zu. Ich muss es schaffen. Muss das aufhalten. Zum Glück ist sie feucht. Ich hol auf. Ich bin vorbei. Mach kehrt. Schnapp mir die Zündschnur, wo sie noch nicht brennt, hole mit dem Messer aus, um die Schnur durchzuschneiden, das Feuer zu löschen.
Dann tret ich auf lose Steine. Rutsch aus. Falle. Ich knall auf den Boden, und ab geht die Post. Mit den Stiefeln voran rutsch ich auf dem Rücken den Abhang runter. Jetzt brennt die Zündschnur schnell ab, zischt an mir vor, rast auf ihr Ziel zu. Ich prall von Bäumen ab, krache in Sträucher. Ich taste wild um mich, versuch, was zu fassen zu kriegen, irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann. Ich erwisch eine dicke Wurzel. Ein heftiger Ruck, vom Hand- bis zum Schultergelenk. Ich halt an. Aber: zu spät.
Die ersten drei Tonton reiten auf die Brücke. Die Pferdehufe klingen wie leiser Donner. Und gleich dahinter rollt der hochbeladene Wagen mit den Verwesern auf die Brücke. Die knisternde Zündschnur verschwindet außer Sicht. Jetzt fährt gleich der Sklavenwagen auf die Brücke. Ich werf mich mit dem Gesicht zu Boden. Leg die Arme über den Kopf, drück die Hände fest auf die Ohren.
Der Sprengstoff geht hoch. Ein gewaltiger Knall erschüttert die Erde. Ich werd in die Luft geworfen. Und knall dumpf wieder auf die Erde. Steine und Erde regnen aus der Luft runter. Auf mich. Um mich rum. Die Welt klingt sehr gedämpft. Als wär ich tief unter Wasser.
Ich heb den Kopf. Ein Warnschrei bleibt mir in der Kehle stecken. Ein Schrei, der nie aus meinem Mund kommt. Ich späh durch einen Riss in der Staubwolke. Und als der Knall endlich verklingt, blitzartige Bilder. Wie Traumscherben. Durch den Trümmerregen erhasch ich Blicke auf unser Werk. Und die Haut schrumpft um meine Knochen.
Weg. Die drei Tonton. Alle weg. Die Verweser in ihrem Wagen. Die unschuldigen Tiere. Tiere und Menschen, nur noch blutige Fleischklumpen. Durch die Gegend geschleudert wie verdorbenes Fleisch. Auf die Felsen der östlichen Klamm. Wagentrümmer. Stöcke, die mal Stühle und ein Tisch gewesen sind. Sie knallen, rutschen, purzeln, krachen. Stürzen in den Fluss in der Tiefe.
Kein Traum, das hier. Ein Albtraum. Der Anblick lässt meine Seele gefrieren. Ich steh auf. Ein Wagenrad wirbelt aus der Staubwolke direkt auf mich zu. Himmlische Vergeltung. Ich krabbel zur Seite und duck mich. Es knallt auf den Boden. Prallt davon ab. Trifft mich an der Schulter und schleudert mich in die Luft.
Das Feuer verschlingt die Brücke. Orange Flammen kerben die Nacht ein. Qualm wogt und wütet.
Dann. Die Geräusche kehren zurück. Pferde. Menschen. Schreie. Weinen. Dringen durch den Qualm und den Nebel und das Chaos. Ein Tonton ist unter seinem Pferd zerquetscht worden. Es tritt wild um sich und versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Der Sklavenwagen ist zertrümmert. Körper liegen verstreut und reglos auf der Straße. Immer noch an den Handgelenken zusammengekettet.
Irgendwas flattert vom Himmel und landet auf meinem Arm. Ich nehm es und starr es an. Es ist ein Fetzen von einem gepunkteten Tuch. Das Halstuch von der Verweserin, von dem langhaarigen Mädchen. Es ist nass. Dunkel und nass von ihrem Blut.
Geröll poltert bergab: Lugh schlittert zu mir. »Komm!« Er zerrt mich hoch. Zieht mich den Hang hoch. »Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, Saba?«
Die Worte wollen mir kaum über die Lippen. »Ich hab versucht, das aufzuhalten.«
Von unten hör ich einen Schrei. Wir gucken zurück zur Straße. Tonton. Die aufstehen. Benommen sind. Dann entdecken sie uns. Einer zeigt auf uns. Schreit. Gibt Befehle. Sechs laufen auf uns zu. Die Geisterjagdhunde rennen mit ihnen und heulen. Es ist ein sehr schrilles Heulen, wie ein Winterwind aus Norden.
»Beeilt euch!« Creed und Tommo treiben uns mit nervösen Händen an. Ich pack die Pfeife. Blas zweimal lange rein. »Lauft!«, brüll ich. »Los! Lauft!«
Creed packt Tommos Hand, und weg sind sie. Verstreuen sich im Wald über uns. Ash hat es garantiert auch gehört, egal wo sie ist. Sie wird sich direkt zum Treffpunkt aufmachen.
»Geh!«, sag ich zu Lugh.
»Nein, ich lass dich nicht allein!«
»Wir sammeln uns am Treffpunkt. Verdammt, Lugh, geh jetzt. Geh!«
Ich schubs ihn gegen die Brust. Er flucht, dann klettert er über den Hügelkamm und ist weg. Ich lauf in die entgegengesetzte Richtung.
Die rote Hitze lodert hell in mir. Überschwemmt mich. Treibt mich an. Gibt meinen Füßen Flügel, als ich durch den Wald flüchte. Über gefällte Bäume spring. Über Steine setz. Nero fliegt mir voraus. Er ist still. Kluger Vogel. Nicht krächzen, nicht piepsen, sonst finden sie uns.
Verfolgungsgeräusche. Rufe. Die Tonton. Sie entfernen sich von mir. Gut, ach, gut. Nein, nicht gut, womöglich sind sie einem von den anderen auf der Spur. Vielleicht Lugh. Nein, nicht Lugh, bitte nicht, ach, bitte. Wenn sie ihn finden, tun sie ihm weh. Rache, sie wollen garantiert Rache. Für das, was wir getan haben. Was wir getan haben, omeingott. Das Blut und das Geschrei und das Blut und das Fleisch und Körperteile, durch die Luft geschleudert …
Mir dreht sich der Magen um, ich schmeck Säure im Mund. Stolpernd bleib ich stehen, und mir wird übel. Es kommt nicht viel, aber mir ist so übel. Ich steh vornübergebeugt, eine Hand an einem Baum. Ich schnapp nach Luft, schluchze und renn weiter, wisch mir mit dem Ärmel übern Mund.
Moment mal? Was ist das? Todesfeengeheul zerreißt die Luft. Klagegeheul, das mir bis ins Mark geht. Das sind die Geisterjagdhunde. Ich zöger. Lausche. Krieg Angst. O Gott, die kommen in meine Richtung. Die Angst treibt mich weiter. Schneller. Noch schneller. Hunden kann man nicht weglaufen. Nie. Ich brauch Wasser. Einen Bach. Damit sie meine Witterung verlieren. Sofort.
Ich presch durch den Wald. Denk nach, schnell, schnell, denk nach! Wasser. Die Brücke. Die Schlucht. Der Fluss. Ja. Wo kommt der her? Denk nach. Nordnordost? Ja. Wo bin ich jetzt? Der Wind hat die Wolken vertrieben. Ich seh den Jupiter. Tief, hinter mir. Ich wend mich nach links. Nero bleibt dicht bei mir.
Ich kletter über Steine. Stolper. Renn weiter. Meine Lunge brennt. Jetzt hör ich was. Ganz leise. Ein Rauschen. Wind in den Bäumen? Nein, mehr wie Wasser, glaub ich. Ich geh dem Geräusch nach. Das unirdische Geheul der Geisterjagdhunde wird immer lauter. Kommt näher, näher, immer näher. Meine Haut stinkt nach Angst. Meine Spur muss überdeutlich sein. Schneller, schneller, renn schneller.
Denn brech ich aus dem Wald und – ja! Ein Fluss. Schmal und schnell. Sauber und – gottseidank – seicht. Nur etwa dreißig Zentimeter tief, mehr nicht. Ich lauf flussabwärts. Schlüpf unter niedrigen Zweigen durch, achte drauf, eine deutliche Spur zu hinterlassen. Ein abgebrochener Zweig hier, ein abgebrochener Ast da. Nicht zu viel, nur gerade genug. Ich lauf ein Stück in diese Richtung, dann mach ich kehrt und lauf flussaufwärts. Grob nach Norden. Das ist gut. Norden. Die richtige Richtung.
Nero fliegt voraus, dicht über der Wasseroberfläche. Ich dreh pausenlos den Kopf hin und her. Guck hierhin, dahin, überallhin. Aber alles ist still. Das seichte Wasser plätschert leise. Ein Rotkehlentrillerer dreht auf. Die leisen Geräusche in einem Wald, der sich auf den Tag einstimmt. Nicht mehr lang bis zur Dämmerung, jetzt nicht mehr. Die Jagdhunde heulen nicht mehr. Kann das sein? Hab ich’s geschafft, sie von meiner Spur abzubringen? Und wenn sie eine andere Beute gefunden haben? Tommo oder Creed oder Lugh? Aber ich kann nichts hören, überhaupt nichts. Bestimmt würd ich doch was hören. Schüsse oder Schreie oder sonst was.
Im Gehen schöpf ich mit den Händen Wasser, spül mir den Mund und spuck’s wieder aus.
Gleich vor mir ist eine tote Kiefer umgefallen. Sie liegt wie eine Brücke überm Fluss. Versperrt mir den Weg. Nero landet drauf und geht gleich auf Käfersuche. Stochert mit dem Schnabel in der Rinde. Ich setz mich rittlings auf den Stamm und schnapp ihn mir.
»Find sie, Nero«, flüster ich. »Los, find die Hunde.«
Ich werf ihn in die Luft. Er steigt hoch über den Wald auf, um einen Vogelblick auf die Gegend zu werfen, und dann kann ich ihn nicht mehr sehen. Am grauen Himmel sind ganz helle rosa Flecken zu sehen. Der Morgen bricht gleich an. Ein neuer Tag. Ich nehm den Bogen vom Rücken und leg einen Pfeil ein. Dann lass ich mich zurück ins Wasser rutschen. Schussbereit und wachsam lauf ich flussaufwärts. Das Wasser plätschert fröhlich, aber die Luft ist schwer. Angespannt. Das ist die Stille eines Pirschjägers. Das Herz schlägt mir bis zum Hals.
Der Fluss macht eine Biegung. Vorsichtig umrunde ich sie. Noch ein paar Schritte, und der Fluss verbreitert sich zu einem Teich, ruhig und friedvoll. Die Bäume drängen sich bis dicht ans Ufer. Verschlungene Wurzeln ragen ins Wasser. Ich wate in den Teich rein, und das Wasser wird tiefer. Geht mir bis zu den Knien. Dann bis zur Hüfte. Nero stößt zu mir runter. Aus dem Nichts. Und dann zerspringt die Welt.
Ein Höllenlärm aus Geheul und Gewinsel bricht los. Die Geisterjagdhunde! Da! Weiße Schrecken, die durch den Wald genau auf mich zujagen. Hier, sie sind gleich hier. Panisch guck ich mich um und häng mir den Bogen um. Eine robuste große Zeder lässt die Äste tief runterhängen bis fast zur Wasseroberfläche. Ich spring aus dem Wasser hoch. Pack einen Ast. Zieh mich hoch und kletter weiter rauf.
Die Geisterjagdhunde brechen aus dem Wald vor. Mit einem Klatschen landen sie im Wasser gleich unter mir und springen am Baum hoch. Ihre Körper verdrehen sich. Zähne zerreißen die Luft. Kiefer schnappen nach mir. Gerade noch rechtzeitig reiß ich den Fuß weg. Ich klettere höher, noch höher. Ihre heiße Wut schlägt mir hinterher. Sie knurren und geifern. Schlagen die Klauen in die Luft. Fallen zurück ins Wasser und springen wieder hoch. Sie wollen mich unbedingt zerfleischen.
Ich kletter, so hoch ich kann. Drück mich dicht an den Stamm. Klammer mich dran fest, kauer mich zwischen die dicken Äste. Ich zitter. Lege die Hand aufs Herz. Mein wild schlagendes Herz, das mir gleich aus der Brust springt. Der Herzstein. Er liegt heiß auf meiner Haut.
Der Herzstein? Ich fass ihn an. Heiß. Das bedeutet Jack. Aber … Jack? Meine Lippen bewegen sich stumm, als ich seinen Namen denke. Jack ist meilenweit weg. Das versteh ich nicht.
»Skoll! Hati! Platz!« Eine Männerstimme gibt den Hunden den Befehl. »Kommt«, sagt er. »Zu mir.«
Die Geisterhunde beruhigen sich. Ich hör sie platschend aus dem Wasser laufen. Hör sie hecheln. Diese Stimme. Diese Stimme. »Platz«, befiehlt der Mann ihnen noch mal.
Einen Augenblick lang herrscht Stille. Dann lacht er. Ein kurzes Lachen, das so klingt, als wär hier nichts lustig.
»Auf den Baum gejagt wie eine Katze«, sagt er. »Ich hatte mich schon gefragt, wann du deine Karten aufdeckst. Komm runter, Saba. Ich weiß, dass du da bist.«
Diese Stimme. Tief und geheimnisvoll. Eisige Angst packt mich. Das ist nicht Jack. O nein. Das ist DeMalo.
DeMalo. Das kann nicht sein. Aber er ist es. Das heißt, er ist auch an der Brücke gewesen. Er muss bei den Tonton hinten gewesen sein. Ist mit seinen Männern geritten, wie er’s gern tut. DeMalo. Hier. Ich fass es nicht.
»Also doch nicht tot«, sagt er. »Allerdings habe ich das sowieso nicht geglaubt.« Er ist außer Atem von der Jagd. Hält seine Wut im Zaum. »Siehst du, sie haben ihre Leiche sofort zu mir gebracht«, sagt er. »Das Mädchen in dem roten Kleid. Deine Freundin, die Free Hawk.«
Maev. In Resurrection. Von den Tonton erschossen. Die Hand fest auf ihre Seite gedrückt. Von wo ihr Lebensblut auf den Boden getropft ist.
»Gib mir dein Kleid. Mehr haben sie nicht gesehen. Ein Mädchen in einem roten Kleid. Hilf mir. Beweg dich!«
Wir hatten Emmi gerettet. Fast hätte alles geklappt. Nur ich und Maev sind noch in der Festung gewesen. Dann hab ich einen Fehler gemacht. Und sie haben uns entdeckt. Die Tonton haben uns gejagt und Maev angeschossen. Eine tödliche Wunde. Sie ist erledigt gewesen und hat es gewusst. Uns das Leben zu retten ist ihre letzte Tat gewesen. Uns allen. Indem sie mein Kleid angezogen hat.
»Keine schlechte Idee«, sagt DeMalo, »das Kleid anzuziehen, das ich dir geschenkt hatte. Ich musste glauben, du wärst diejenige gewesen, die da bis zum Tod gekämpft hatte. Du, die meine Soldaten in Schach hielt, damit deine Freunde entkommen konnten.«
»So, jetzt hau ab von hier«, sagt sie zu mir. »So weit weg, wie du kannst, so schnell du kannst. Jetzt geh.«
Das ist das Letzte gewesen, was ich diesseits der Sterne von ihr gesehen hab. Bevor ich in den See tief unten gesprungen bin, hab ich mich noch mal nach ihr umgeguckt. Sie hat den Kopf hoch erhoben gehabt, die Haare haben ihr offen bis auf die Hüften gehangen, in jeder Hand ein Bolzenschießer. Maev. Die Kriegerkönigin von den Free Hawks. In genau diesem Augenblick in meinem Gedächtnis eingefroren.
»Man sagte mir, sie sei furchtlos gewesen«, sagt DeMalo. »Sie habe mit ungeheurem Mut gekämpft. Ich habe sie selbst auf den Scheiterhaufen gelegt. Habe sie mit dem vollen Kriegerzeremoniell geehrt, falls es dich interessiert. Wie du ihr Opfer ehrst, Saba. Hockst da auf dem Baum. Sie war hundert Frauen von deiner Art wert. Wer sie auch gewesen sein mag.«
Schlagartig steigt mir das Blut in den Kopf. Ich kletter vom Baum und lass mich ins Wasser plumpsen. Dann dreh ich mich zu ihm um. Den Bogen gespannt, einen Pfeil aufgelegt.
»Ihr Name ist Maev, verdammt, Maev«, sag ich. Wir stehen nur drei Meter auseinander. Ich bis zum Oberschenkel im Teich. Er am Ufer, die beiden Geisterjagdhunde rechts und links neben sich. Sie liegen ganz brav da, mit tropfender Zunge, die rosa Augen auf DeMalo geheftet. Er ist nicht bewaffnet. Nur ein Bolzenschießer am Gürtel. Er trägt knielange Stiefel, Kniehosen und ein Hemd. Um die Schultern einen schwarzen Umhang. An einem Riemen, den er sich um die Brust geschlungen hat, trägt er einen abgewetzten Lederbeutel. In der Hand hält er meinen Rindenbeutel.
»Ach, verstehe«, sagt er. »Dann bin ich wohl derjenige, der hier einen Fehler begangen hat, ja?« Er lässt meinen Beutel fallen, wirft den Umhang ab und kommt ins Wasser.
»Wenn du noch näher kommst, töte ich dich, Hunde hin oder her«, sag ich.
Er achtet nicht drauf. Kommt langsam auf mich zu. »Wer hat denn ihre verwundete Freundin zum Sterben zurückgelassen? Wer hat denn diese Brücke gesprengt? Wer hat denn diese Menschen getötet? Zwölf nach meiner Zählung. Wie nennst du das, Saba?«
Ich spann den Bogen noch stärker. »Ich mein das ernst, bleib da.«
Aber er geht weiter. Die dunklen Augen auf mich gerichtet. »Ich will dir in Erinnerung rufen, was du gesagt hast. In jener Nacht, als du in mein Zimmer kamst. Du hast gesagt, das Leben hätte keinen Sinn, wenn man nicht wenigstens versucht, etwas zu verändern. Erinnerst du dich?«
»Halt die Klappe!«, sag ich. In meinem Kopf ist ein solches Getöse, dass ich nicht denken kann. Da schreit es: Schieß! Bring es zu Ende! Was ist mit dir los? Schieß, verdammt nochmal! Erschieß ihn!
Entschlossen kommt er auf mich zugewatet. »Weißt du noch, was du außerdem gesagt hast? Du hast gesagt, du wolltest die Welt mit mir zusammen besser machen.«
Seine Stimme ist klangvoll, wie üppige braune Erde.
»So wie es jetzt ist, das geht einfach nicht. Wir müssen eine neue Art zu leben finden. Das hast du gesagt, Saba. Ist das deine neue Art? Zerstörung? Mord? Ich erschaffe etwas. Ich bringe Ordnung ins Chaos. Ich erschaffe eine neue Welt, einen Grashalm nach dem anderen. Ich heile die Erde und ihre Bewohner. Ich dachte, wir wollten beide das Gleiche.«
»Halt die Klappe, ja? Halt einfach die Klappe!« Ich umklammere meinen Bogen. Immer fester. Na los, mach schon, sag ich mir. Ein Schuss, und das alles ist vorbei. Schlag der Schlange den Kopf ab. Tu’s ein für alle Mal. Tu’s jetzt.
Dicht vor mir bleibt er stehen. Breitet die Arme aus. Bietet mir ein Ziel, das ich nicht verfehlen kann.
An seinem Handgelenk glänzt der Silberarmreifen. Sein dünnes weißes Hemd klebt feucht an ihm. Durch den Stoff durch kann ich seine Tonton-Blut-Tätowierung sehen. Die rote Sonne, die über seinem Herzen aufgeht. Sein Geruch lässt mir die Haut eng werden. Dunkelgrün. Warmer Wacholder. Die Sonne sickert scheu durch die Bäume. Sie funkelt auf seinen Haaren, die dick und schwarz sind wie Neros Federn. Seine breiten Wangenknochen. Sein glattes, undurchschaubares Gesicht. Sein wachsames, schönes Gesicht.
Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun. Langsam lass ich den Bogen sinken. »Du gottverdammter Mistkerl.«
Er lässt die Arme sinken. »Wieder eine perfekte Gelegenheit vergeudet. Genau wie in jener Nacht in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, was du mir in den Wein getan hast, um mich außer Gefecht zu setzen, aber noch ein, zwei Tropfen mehr hätten mich getötet. Oder etwa nicht? Es wäre so einfach gewesen. Aber du hast es nicht getan. Wie kommt das, frage ich mich.« Er tritt dicht vor mich. Berührt den Herzstein. Er brennt in der Mulde an meinem Hals. Schweiß rinnt mir zwischen den Brüsten runter.
Er berührt meine nackte Haut, gleich überm Herz. Sie erschauert bei seiner Berührung. Seine Hand streift den Herzstein. »Er ist heiß«, sagt er überrascht.
»Das ist ein Herzstein«, sag ich. »Je näher man dem kommt, was das Herz sich wünscht, desto heißer brennt er.«
»Bin ich das, was dein Herz sich wünscht?«, fragt er.
Nein, nein, nein. Geh weg von ihm, geh sofort weg von ihm. Man kann ihm nicht trauen, er ist gefährlich, mein Feind. Aber ich tu’s nicht. Ich rühr mich nicht vom Fleck.
»Warum kannst du mich nicht töten, Saba?«, fragt er.
»Das könnt ich dich auch fragen«, sag ich.
»Als ich dich zum ersten Mal in Hopetown sah«, sagt er, »kannte ich dich. Ich wusste, wer du wirklich bist. Wer du sein kannst.«
»Du kennst mich nicht«, sag ich.
»O doch«, sagt er. »In dir brennt ein Feuer, das selten ist. Die Macht, etwas zu verändern. Der Mut, im Dienste von etwas zu handeln, was größer ist als du. Aber du erniedrigst dich mit diesem erbärmlichen Missgeschick. Was tust du bloß?«
Ich schweig.
»Ich tue Gutes«, sagt er. »Ich gebe den Menschen Führung, ich befreie sie von Mangel, Not und Leid, zeige ihnen den Weg in eine bessere Zukunft. Du warst dabei damals im Morgengrauen, im Bunker. Du hast meine Visionen von der Welt, wie sie einst war, gesehen. Das üppige Land, den Reichtum der Meere. Jene großartigen Geschöpfe. Unvorstellbare Wunder. Du erinnerst dich doch?«
Niemals könnt ich vergessen, was ich an dem Morgen da gesehen hab.
»Jetzt und hier«, sagt er, »haben wir eine echte Chance, vielleicht die einzige Chance, von vorn zu beginnen. Der Erde diesmal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wir können eine bessere Welt erschaffen. Wir können einige dieser Wunder selbst erleben. Sag nicht, du willst es nicht auch. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dein Gesicht gesehen. Deine Tränen. Es ist dir ebenso wichtig wie mir.«
Seine Worte schlängeln sich behutsam um mich herum. Sie packen mich. Packen noch fester zu. Ziehen mich auf ihn zu.
»Du tötest Menschen, um zu kriegen, was du willst«, sag ich.
»Du ebenfalls. Du hast es gerade erst wieder getan. Aber hier geht es nicht darum, was ich will. Ich tue das Richtige. Ich treffe jeden Tag schwierige, echte Entscheidungen. Teile denjenigen unsere knappen Mittel zu, die sie am besten nutzen können. Ich verhalte mich moralisch. Verantwortungsbewusst.«
»Moralisch«, sag ich.
»Die meisten Menschen leben nur von einem Tag zum anderen. Ich habe eine höhere Berufung: dem Allgemeinwohl zu dienen. Gewaltanwendung ist immer bedauerlich, aber sie ist ein Mittel zum Zweck. Man könnte sogar sagen, eine sittliche Notwendigkeit. Du erinnerst dich an das, was ich dir gesagt habe. Wir säubern die entzündeten Wunden von Mutter Erde. Hast du etwa geweint, als du diese Jauchegrube Hopetown zerstört hast? Hat es dir schlaflose Nächte bereitet, dass der Abschaum dort verbrannt ist?«
»Darauf kann ich dir keine Antwort geben.«
»Nein. Wir sind uns so ähnlich, Saba.«
»Eine sittliche Notwendigkeit«, sag ich. »Nennen deine Verweser das so, wenn sie ihre Neugeborenen ermorden?«
»Es werden keine Säuglinge getötet, wie du sehr wohl weißt. Die Schwachen werden über Nacht im Freien gelassen. Wenn sie am Morgen noch leben, bekommen sie eine zweite Chance. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, und jeder hier versteht das. Füttert ein Vogel alle seine Küken gleichermaßen? Natürlich nicht. Die Gesündesten und Größten wachsen und gedeihen. Die Schwachen fallen zurück und sterben. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, Mutter Erde zu heilen, dann brauchen wir dafür die Stärksten und Besten. Das Allgemeinwohl muss immer im Mittelpunkt stehen.«
Seine Augen überzeugen. Seine Stimme wirbt. Seine Worte streicheln. »Wir haben ein Schicksal«, sagt er. »Gemeinsam, Saba. Wir sind geboren, um zu befehlen, nicht um zu gehorchen.«
Endlich … endlich sehe ich ihm in die Augen. Augen so dunkel, dass sie fast schwarz sind. Schwere Lider, die verbergen, wer er ist. In diesen Augen, so dunkel wie ein Bergsee bei Nacht, seh ich eine klitzekleine Spiegelung. Das bin ich.
»Ich bin nicht dein Werkzeug«, sag ich.
»Das sollst du auch nicht sein. Davon habe ich reichlich.«
Er beugt den Kopf zu mir. Sein Mund so nah. Sein warmer Atem streichelt meine Haut. Ach, meine treulose Seele. Was ist das in mir drin, das an ihm festhält? Das sich auflösen, vergehen, sich verlieren will.
Ich verlier mich. In seiner Berührung, in seinem Geschmack, in seinem Geruch, bis ich spür, wie meine Ränder anfangen, sich aufzulösen. Ich führ ihn zum Bett. Wir legen uns zusammen hin. Und ich verschmelz mit der dunklen, reinen Hitze.
Meine Haut zittert. Ich kann kaum flüstern. Aber ich tu’s. Ich flüster: »Du wirst mich nicht … kriegen.«
Er wird still. Ganz still. In dem Schweigen zwischen uns hält der Tag den Atem an. Dann.
Tret ich zurück. Von ihm. Weg. Von ihm. Luft strömt so stürmisch in meine Lunge, dass mir schwindelig wird. Die Erde heilen. Das ist richtig. Aber so, wie er’s tut, ist es falsch. Falsch, falsch, falsch. Das Allgemeinwohl. Moralisch. Notwendigkeit. Er kann Lügen zu Wahrheiten verdrehen und die Wahrheit zu Lügen, bis ich die beiden nicht mehr auseinanderhalten kann. Und er kann mich verdrehen. Bis ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Bis ich nicht mehr weiß, an was ich glaub.
Was wir heute an der Brücke getan haben, ist falsch. Und er irrt sich. Er irrt sich. Was richtig ist, muss irgendwo anders liegen. Zwischen uns vielleicht. Oder jenseits von uns.
»Wenn du weiter so handelst«, sagt er, »werden noch mehr Menschen sterben. Vielleicht sogar Menschen, die dir wichtig sind. Deine Schwester. Dein Bruder. Wie viele seid ihr? Zehn? Zwölf? Ihr seid überfordert. Ich an deiner Stelle würde meine Aussichten klug abwägen.«
»Diese Erde gehört allem, was hier lebt. Nicht nur deinen Auserwählten, die du für würdig hältst. Sauberes Wasser und anständiges Land sind das Geburtsrecht von jedem. Das kannst du dir nicht einfach nehmen. Das kannst du nicht besitzen. Die Free Hawks gehen nirgendwohin.«
»Gut eingeübt, Saba. Wer hat dir diese Worte in den Mund gelegt?« Er schweigt einen Augenblick. Wie immer kann ich sein Gesicht nicht deuten. Ich seh keinen Anflug von dem, was in ihm vorgeht. Dann sagt er: »Ich will dir ein Angebot machen. Unter den gegebenen Umständen ist es ein großzügiges Angebot. Ihr ergebt euch mir offiziell, mit allen Waffen und Kämpfern. Ich garantiere allen sicheres Geleit durch das Ödland, deiner Familie und deinen Freunden. Ich stelle ihnen einen Geleitschutz bis zum Low China Pass. Von da aus führt eine anständige Straße durch die Berge. Das alles versteht sich natürlich unter der Voraussetzung, dass sie tot sind, wenn sie jemals nach New Eden zurückkehren.«
»Und im Gegenzug?«, frag ich.
»Dich«, sagt er.
»Als Gefangene.«
»Nein. Meine Frau.«
»Das ist dasselbe«, sag ich. »Den Teufel werd ich tun.«
»Du und ich, wir sind auf Seiten der Engel«, sagt er.
Er watet ans Ufer, packt einen Ast und zieht sich aus dem Teich. Wasser läuft an seiner Hose und seinen Stiefeln runter. Als er seinen Umhang aufhebt, stehen die Geisterjagdhunde auf. »Ich baue die Brücke in einer Woche wieder auf«, sagt er. »Wenn ihr mich noch einmal schlagt, schlage ich zehnfach zurück. Wenn du dann genug hast – falls du dann noch aufrecht stehst –, komm und such mich. Mein Angebot gilt bis zum Blutmond. Wie gesagt, mir ist nach Großzügigkeit zumute. Danach lasse ich deine ganze jämmerliche Bande jagen und töten. Egal wohin ihr euch flüchtet. Und das schließt dich mit ein, Saba. Glaub mir, ich bin nicht rührselig.«
»Das sagst du«, sag ich. »Du hattest deine Gelegenheiten, genau wie ich. Ich bin immer noch da.«
»Das ist das Endspiel. Von jetzt an spielen wir nach neuen Regeln.« Er geht davon. »Ach!« Er macht kehrt, als hätte er was vergessen. »Du bist nicht zufällig schwanger?«
Im Nu ist mein Bogen oben, und ich schieß. Mein Pfeil streift sein Ohr. Bohrt sich in den Baum neben seinem Kopf. Die Hunde werden unruhig. Wollen sich auf mich stürzen. Er hebt die Hand und hält sie auf. DeMalo hat sich nicht gerührt. Hat nicht einmal gezuckt. Von seinem Ohr tropft es rot auf sein weißes, weißes Hemd.
»Neue Regeln«, sag ich.
»Der Blutmond«, sagt er.
Er neigt den Kopf und verschwindet zwischen den Bäumen. Die großen weißen Hunde folgen ihm auf den Fersen.
Ich rühr mich nicht. Kein Zucken. Mein ganz und gar verkrampftes Herz spürt DeMalo nach. Nicht durch Geräusche. Er bewegt sich geräuschlos, und seine Hunde auch. Nein, ich spür ihm mit Hilfe der Hitze in meinem Herzstein nach. Sie wird schwächer. Er kühlt ab. Dann ist er kalt. Er ist weg.
Ich lass den Bogen sinken. Tu einen langen, zittrigen Atemzug. Meine Verwegenheit winselt und erstirbt. Sein Wille zerrt an mir, so stark wie eine schnelle Flussströmung. Ich brauch meine ganze Kraft, um ihm zu widerstehen.
Auf meinen zittrigen Beinen wate ich ans Ufer und lass mich zwischen den bemoosten Wurzeln fallen. Gottverdammter Herzstein. Nicht DeMalo ist das, was mein Herz sich wünscht. Nie, niemals DeMalo. Ich reiß mir das Ding vom Hals. Hol aus, um es in den Teich zu werfen, zu versenken, seine heißen Lügen ein für alle Mal loszuwerden. Aber ich zögere. Ich kann es nicht. Er hat meiner Mutter gehört. Das Einzige, was ich je von ihr gehabt hab. Ich schieb ihn tief in die Tasche.
Ich locker meine schmerzenden Schultern. Das spür ich erst jetzt. Das Wagenrad an der Brücke hat mich hart getroffen. Ich werd einen blauen Fleck bekommen, der sich sehen lassen kann.
DeMalo hat mich bis ins Mark erschüttert. Seine letzten Worte klemmen meinen Kopf ein wie ein Schraubstock. Ich trag kein Kind unterm Herzen, garantiert nicht. O Hilfe! Zuerst dieser Albtraum an der Brücke, dann er, der mich aufspürt, mich mit seinen unirdischen Jagdhunden jagt. Kann er das wirklich ernst meinen, was er gesagt hat?
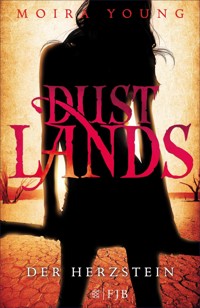













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














