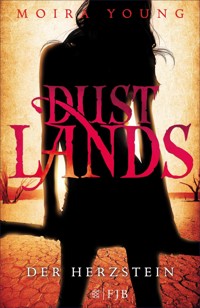
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dustlands
- Sprache: Deutsch
***SIE NENNEN MICH DEN TODESENGEL. WEIL ICH NOCH NIE EINEN KAMPF VERLOREN HABE.*** Sabas Zwillingsbruder wird von Soldaten verschleppt. Sie schwört, ihn zu finden und zu befreien. Mit dem Mut der Verzweiflung macht sie sich auf einen Weg voller Gefahren, Gewalt und Verrat. Sie kann niemandem vertrauen - auch nicht dem Mann, der ihr das Leben rettet. Der erste Band einer epischen Endzeit-Fantasy, eine Geschichte, die dein Herz schneller schlagen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Moira Young
- Der Herzstein -
Roman
Über dieses Buch
Saba hat einen Tyrannen gestürzt, seine Soldaten, die Tonton, besiegt und ihren entführten Zwillingsbruder Lugh befreit. Sie ist mit ihren Geschwistern auf dem Weg nach Westen, an die Küste, wo sie ihren Freund Jack zu treffen hofft. Doch die Tonton haben sich wieder gesammelt, und sie haben einen neuen Anführer, der einen Preis auf Sabas Kopf ausgesetzt hat. Jack wird bei einem Überfall gefangen genommen und muss fortan dem Regime dienen – kann Saba ihm noch trauen, oder hat er etwa wirklich die Seiten gewechselt? Als sie auf den neuen Herrscher trifft, zeigt sich, dass er ein alter Bekannter ist, der andere Pläne mit ihr hat, als sie zu töten…
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Moira Young, geboren und aufgewachsen in British Columbia im Westen Kanadas, trat als Schauspielerin und Opernsängerin in Kanada und Europa auf. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Bath, England.Bei FISCHER FJB erschien ihr Roman »DUSTLANDS - Die Entführung«, der erste Teil der Trilogie.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
›Rebel Heart‹ bei Marion Lloyd Books, London.
Copyright © Moira Young, 2012
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: bürosüd°, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen
des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402036-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Jack
Das Ödland Einen Monat später
Der Snake River
Der Geisterweg
New Eden
Das Lost Cause
Sektor neun
Weeping Water
Die Straße nach Resurrection
Resurrection
Dank
Für meine Schwestern
Jack
Es ist später Nachmittag. Seit dem Morgen folgt der Pfad einer Reihe von Lichtmasten. Besser gesagt, den eisernen Überresten von dem, was einmal Lichtmasten waren, damals zur Zeit der Abwracker, vor undenklichen Zeiten. Er schlängelt sich durch ausgebleichte faltige Hügel, verbranntes Gras und Dornensträucher.
Die Hochsommerhitze sengt auf seinen Kopf herab. Sein Hut ist schweißfeucht. Der Staub langer Tage klebt an seiner Haut, seiner Kleidung, seinen Stiefeln. Er schmeckt ihn, als er sich über die trockenen Lippen leckt. Bisher ist es eine Reise durch ausgedörrtes, unwirtliches Land gewesen. Er erklimmt einen Bergrücken, dann geht es hinab in ein kleines Tal, und plötzlich ist alles frisch und grün. Die Luft ist mild. Erfüllt vom süßlichen Duft der verstreut auf den Hängen wachsenden niedrigen Kiefern.
Jack zügelt sein Pferd. Er atmet ein. Ein langer, tiefer, dankbarer Atemzug. Er nimmt die Aussicht in sich auf. Den gerodeten Talboden und den kleinen See, der in der Sonne glitzert.
Am See steht eine Hütte mit einem Dach aus Rinde und Grassoden, der Rest ist aus Abwrackerschrott, Steinen, getrocknetem Lehm und dem ein oder anderen Baumstamm zusammengebaut. Ein Mann, eine Frau und ein Mädchen arbeiten auf den ordentlich bestellten Feldern.
Menschen. Endlich. Abgesehen von Atlas, dem weißen Mustang, hat er seit Tagen mit niemandem gesprochen. Allmählich macht ihm die Einsamkeit zu schaffen.
»Und ich hab schon gedacht«, sagt er laut, »ich bin der einzige Mensch auf der Welt.«
Vor sich hinpfeifend reitet er weiter. Als sie ihre Arbeit niederlegen und ihm entgegenkommen, ruft er einen Gruß. Sie sind nicht besonders freundlich. Ihre Gesichter sehen müde aus. Ihre Blicke sind misstrauisch. Sie sind an Gesellschaft kaum gewöhnt, nehmen nicht viel Anteil an der Außenwelt und haben wenig zu sagen. Macht nichts. Schon ihr Anblick und die verlegene, größtenteils von ihm bestrittene Unterhaltung tun ihm unendlich gut.
Der Mann ist völlig erschöpft. Die Frau ist krank. Sterbenskrank, wenn er sich nicht sehr täuscht. Mit gelblicher Haut, die Lippen vor Schmerz fest aufeinandergepresst. Das Mädchen ist recht kräftig, etwa vierzehn. Sie starrt auf ihre Stiefel. Still, sogar wenn sie spricht. Aber als ihr Bruder aus der Hütte gerannt kommt und ihren Namen ruft: »Nessa! Nessa!«, strahlt ihr unscheinbares Gesicht vor Liebe.
Er ist ein fröhliches Kind, ein Sonnenscheinchen. Ein Vierjähriger namens Robbie mit runden Augen und nackten Füßen. Seine Familie betrachtet ihn mit liebevollem Staunen und kann ganz offensichtlich ihr Glück kaum fassen. Robbie lehnt sich an die Beine seiner Schwester, lutscht energisch am Daumen und mustert Jack. Den ramponierten Hut mit der breiten Krempe. Die silbergrauen Augen. Das schmale, gebräunte Gesicht, das seit Wochen kein Rasiermesser mehr gesehen hat. Den langen staubigen Mantel und die abgetragenen Stiefel. Die Armbrust auf dem Rücken, den gut bestückten Waffengürtel: Bolzenschießer, Langmesser, Bola, Schleuder.
»Buh!«, macht Jack. Robbie bleibt der Mund offen stehen. Der Daumen fällt heraus.
Jack knurrt. Der Junge quietscht vergnügt und rennt davon Richtung See. Nessa jagt ihm hinterher. Das Tal hallt wider von ihren Schreien und ihrem Lachen.
Es sind keine geselligen Leute, aber sie sind auch nicht geizig. Sie sorgen dafür, dass sein Pferd getränkt, abgerieben und gefüttert wird. Sie bieten ihm einen Schlafplatz für die Nacht an, aber er hat es eilig. Als er weiterreitet, sinkt die Dämmerung herab. Es sind hart arbeitende Menschen, Frühaufsteher. Sie gehen sicher ins Bett, sobald er fort ist.
Seiner Schätzung nach dürften es von hier bis zum Sturmgürtel nicht mehr als drei Tagesritte sein. Und dorthin ist er unterwegs. Zum Sturmgürtel, zu einer Schenke namens The Lost Cause und einer alten Freundin namens Molly. Er ist der Überbringer schlechter Nachrichten. Der allerschlimmsten. Je eher er sie überbringt, desto eher kann er kehrtmachen, wieder zurück und weiter nach Westen reiten. Nach Westen. Zum Großen Wasser. Denn dort ist sie. Dort hat er versprochen, sich mit ihr zu treffen. Er zieht den Stein hervor, den er an einem Lederband um den Hals trägt. Er ist glatt und liegt kühl in der Hand. Hell rosarot. Wie ein Vogelei geformt, etwa daumenlang.
Es ist ein Herzstein. Er führt einen zu dem, was das Herz sich wünscht, heißt es. Sie hat ihn ihm gegeben. Er wird nach Westen reiten und sie finden.
Saba.
Er wird sie finden.
Jack hat das Tal gerade erst hinter sich gelassen, da zögert Atlas, wirft den Kopf hoch und wiehert. Vor ihnen ist etwas. Jack denkt nicht lange nach. Im Nu ist er vom Pfad herunter, im Kiefernwald und außer Sicht. In Deckung zwischen den Bäumen, die Hand auf dem Maul des Mustangs, beobachtet er, wie sie vorbeiziehen.
Es sind Tonton. Neun in lange schwarze Gewänder gekleidete Männer mit Pferden. Sie begleiten ein Pärchen in einem Büffelwagen. Der Befehlshaber reitet vor. Dahinter vier Männer, dann der Wagen, dann drei Berittene. Der letzte Mann, der neunte, fährt einen Wagen mit einem leeren Gefängniskäfig.
Er mustert sie gründlich. Er kennt die Tonton gut. Sie sind struppig und schmutzig und werden schnell gewalttätig. Ein loser Verband von skrupellosen Schlägern im Dunstkreis der Macht. Treu nur untereinander, gehorsam gegenüber einem Herrn nur, falls und wann es ihnen passt. Bis auf den letzten Mann von Eigennutz angetrieben. Diese hier sehen jedoch anders aus. Alles an ihnen ist sauber und ordentlich und auf Hochglanz poliert. Sie sind gut bewaffnet. Sie wirken diszipliniert. Zielstrebig.
Und das flößt ihm Unbehagen ein. Es bedeutet, der Feind spielt jetzt ein anderes Spiel.
Er sieht sich das Pärchen im Wagen an. Sie sind jung, stark, sehen gesund aus. Ein Junge und ein Mädchen, nicht älter als sechzehn oder siebzehn. Sie sitzen dicht nebeneinander auf dem Bock. Der Junge fährt. In einer Hand hält er die Zügel, den anderen Arm hat er dem Mädchen um die Taille gelegt. Doch zwischen ihren Körpern ist eine Lücke. Sie sitzen aufrecht und steif da. Sie fühlen sich nicht wohl, so viel ist sicher. Es sieht aus, als würden sie sich kaum kennen.
Sie starren mit erhobenem Kinn geradeaus. Sie sehen entschlossen aus. Sogar stolz. Eindeutig keine Gefangenen der Tonton.
Der Wagen ist ordentlich mit Möbeln, Bettzeug und Werkzeug beladen. Mit allem, was man braucht, wenn man einen Hausstand gründen will.
Als sie vorbeirattern, dreht das Mädchen abrupt den Kopf. Sie starrt in den Wald, beinahe als würde sie spüren, dass dort jemand ist. Es dämmert schon, und er weiß, er ist gut verborgen, aber er weicht trotzdem zurück. Sie sieht in seine Richtung, bis sie den Wald hinter sich gelassen haben. Niemand – nicht die Tonton, nicht der Junge neben ihr – scheint es zu bemerken.
Jack kann ihre Stirn gut sehen. Die des Jungen auch. Sie sind gebrandmarkt worden. Und zwar erst kürzlich. Der Kreis mit dem Kreuz darin, mitten auf der Stirn, sieht noch wund aus.
Sie fahren ins Tal. In Richtung der kleinen Farm. Mit einem leeren Gefangenenwagen.
Jetzt empfindet er nicht mehr bloß Unbehagen. Er ist besorgt.
Er macht kehrt und folgt ihnen. Er bleibt im Wald, das Pferd führt er.
Zwischen den Bäumen am oberen Ende des Tals hat er jetzt, während die Dunkelheit hereinbricht, ungehinderte Sicht auf die Farm, die er gerade erst verlassen hat. Die Tonton stürmen schon in die Hütte.
Er muss seine Füße davon abhalten, zu ihnen zu laufen. Seine Hand bremsen, die zum Bogen greifen will. Denn der Überlebenskünstler in ihm weiß, dass dies beschlossene Sache ist. Was hier auch gleich geschehen mag, er kann es nicht verhindern.
Aber er kann darüber berichten. Er wird darüber berichten. Mit geballten Fäusten und voller Wut beobachtet er, was im Tal geschieht.
Jetzt haben sie die Familie aus den Betten geholt. Den erschöpften Mann und die kranke Frau, ihre Kinder Nessa und Robbie. Haben sie mit vorgehaltenem Feuerstab aus der Hütte gescheucht. Im schwindenden Licht drängen sie sich zusammen, während der Befehlshaber der Tonton eine kurze Ansprache hält. Wahrscheinlich sagt er ihnen, was jetzt passiert und warum. Worte, um Menschen zu ängstigen und zu verwirren, die schon zu verängstigt und verwirrt sind, um richtig zuzuhören.
Jack fragt sich, warum der Mann sich die Mühe macht. Ist wohl so vorgeschrieben.
Das junge Paar mit den Brandmalen wartet im Wagen. Bereit, das neue Zuhause zu beziehen. Landraub. Ein Umsiedlungskommando. Darum geht es hier.
Von hier oben aus wirken alle klein. Wie Puppen. Er kann nicht verstehen, was gesprochen wird, nicht die Worte. Aber er hört die Bestürzung in den erhobenen Stimmen der Farmer. Das Mädchen, Nessa, fällt auf die Knie. Sie fleht sie an und hält dabei ihren Bruder fest an sich gedrückt. Einer nimmt ihr Robbie ab, während zwei andere sie an den Armen packen. Sie gehen auf den Gefängniswagen zu. Sie wehrt sich, schreit, dreht sich zu ihren Eltern um.
Sie erschießen sie beide zugleich. Mann und Frau. Je einen Bolzen durch die Stirn, und ihre Körper sacken zu Boden. Nessa kreischt. Und diesmal hört Jack sie. »Lauf, Robbie!«, schreit sie. »Lauf!«
Der kleine Junge tritt um sich und windet sich im Griff des Tonton. Er beißt ihn in die Hand. Der Mann schreit auf und lässt ihn los. Robbie ist frei. Er rennt aufs Feld, so schnell er kann, während seine Schwester ihm zuschreit, er solle schneller rennen. Aber es ist Sommer, und das Getreide steht hoch, und er ist erst vier.
Der Befehlshaber bellt Anordnungen. Ein Mann rennt dem Jungen hinterher. Zu spät. Der eifrige neue Siedler ist aus dem Wagen gesprungen, zielt mit dem Feuerstab, schießt. Robbie bricht zusammen.
Der Befehlshaber hat die Kontrolle über die Situation verloren. Es hätte alles glatt laufen müssen. Stattdessen herrscht Chaos. Während er und der Siedler sich gegenseitig die Schuld zuschieben, fängt Nessa an zu schreien. Schrille Schreie der Trauer und Wut, bei denen Jack eine Gänsehaut bekommt.
Ihr Hemd ist zerrissen. Die Männer lachen, als sie versucht, sich zu bedecken, weint, kreischt, um sich schlägt. Sie halten ihr die Hände hinterm Rücken fest, und einer fasst sie grob an.
Der Befehlshaber sieht das. Er handelt schnell. Er schießt dem Mann in den Kopf.
Irgendwie bekommt Nessa in dem ganzen Durcheinander einen Bolzenschießer zu fassen. Sie schiebt ihn sich in den Mund und drückt ab.
Jack wendet sich ab. Er lehnt den Kopf an den Hals des weißen Pferdes und atmet mehrmals tief durch. Atlas tänzelt unruhig.
Was für ein Schlamassel. Pfuscharbeit. Anscheinend sollten sie die Jungen und Gesunden, Nessa und Robbie, mitnehmen und die kränklichen Eltern töten. Stattdessen sind jetzt alle tot.
Die Tonton spielen wirklich ein neues Spiel. Er hat schon vor Monaten Gerüchte über Landraub und Umsiedlung gehört. Aber nicht so weit im Westen, noch nie so weit im Westen. Sie breiten sich aus wie eine Seuche.
Wenn das hier Tonton-Gebiet ist, dann der Sturmgürtel ebenso. Und das bedeutet, Molly ist in Gefahr.
Jetzt ist er nicht mehr nur besorgt. Jetzt hat er Angst.
Er verlässt den Pfad. Dort ist er nicht sicher.
Atlas und er ziehen über unbekannte Straßen ostwärts. Sie kommen nur schwer voran, die Gegend ist unwirtlich. Der Weg ist düster und steinig, wird niemals von der Sonne erwärmt und selten genutzt. Hin und wieder sieht er in der Ferne andere Reisende – bewegliche Punkte in der Landschaft –, aber sie sind wohl ebenso scharfäugig wie er und genauso darauf bedacht, unbemerkt zu bleiben, denn näher kommt ihm nie jemand. Jack beeilt sich, ruht mal hier eine Stunde, dann dort zwei Stunden aus. Er hat viel Zeit, über das nachzudenken, was er mit angesehen hat.
Die Tonton. Bis vor kurzem die Privatarmee von Vikar Pinch, dem Verrückten, Drogenbaron und selbsternannten König der Welt. Mittlerweile tot.
Sie haben die Tonton am Pine Top Hill besiegt. Saba, Ike und er, mit Hilfe von Maev, deren Free-Hawks-Kriegerinnen und den mit ihnen verbündeten Straßenräubern. Und Saba hat Vikar Pinch getötet. Aber sie haben die Tonton nicht ausgelöscht. Sie haben sie nicht bis zum letzten Mann getötet. Und selbst wenn – er ist alt genug, hat genug erlebt, um zu wissen, dass man das Böse auf der Welt nicht ausrotten kann. Man tötet es vor sich, und wenn man sich umdreht, steht es hinter einem.
Ganz offensichtlich gibt es die Tonton noch. Nur anders jetzt. Früher waren sie, gelinde gesagt, schmuddelig, mit langen Haaren und Vollbärten. Die hier waren glatt rasiert und hatten stoppelkurze Haare. Ihre Gewänder waren sauber, ihre Stiefel und ihre gesamte Ausrüstung auch. Ihre Pferde waren gestriegelt, das Fell glänzte. Eine neue, saubere und manierliche Art von Tonton.
Nicht manierlich genug. Der Einsatz im Tal ist völlig danebengegangen. Der Befehlshaber hatte seine Männer nicht ganz im Griff. Sie zögerten, ihm zu gehorchen. Und die zudringliche Art des einen bei Nessa zeigt, dass ein paar von ihnen immer noch nach den alten Regeln spielen wollen. Aber der Befehlshaber hat ihn erschossen. Schnell. Ohne zu zögern. Eine laute, deutliche Botschaft an alle, die vielleicht genauso denken. Ein neues Spiel. Neue Regeln. Keine zweite Chance.
Also.
Das kleine grüne Tal. Ein fruchtbares Fleckchen Erde. Obdach. Sauberes Wasser. Die Tonton töten die kranke Frau und den erschöpften Mann. Und wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten sie Robbie und seine Schwester mitgenommen. Beide waren jung und gesund. Aber wohin hätten sie sie gebracht? Woher kommen der Junge und das Mädchen in dem Wagen, die Umsiedler? Vielleicht wurden auch sie ihren Familien geraubt. Aber sie schienen nur allzu bereitwillig. Mehr als bereitwillig. Der Junge hat bei der Vertreibung mitgemacht. Hat die Sache selbst in die Hand genommen.
Der Kreis mit dem Kreuz darin auf ihrer Stirn hat etwas zu bedeuten. In Hopetown brandmarkten die Tonton die Huren mit einem W – für whore –, aber von anderen Brandmarkungen hat er noch nie gehört. Brandmale sind etwas Bleibendes. Sie zeigen an, zu welcher Gruppe man gehört.
Gesunde junge Menschen, gebrandmarkt. Gebietserweiterung. Raub von fruchtbarem Land und sauberem Wasser. Gewalt über die Naturschätze. Neue diszipliniertere Tonton, die Befehle ausführen. Aber wessen Befehle? Von jemand Höhergestelltem. Von jemandem, der auf etwas Größeres hinarbeitet. Ein Mann mit einem Plan.
Dieser Mann müsste große Macht haben. Er müsste entschlossen, diszipliniert, überzeugend und sehr, sehr klug sein.
Jack kennt nur einen solchen Mann. Einen Tonton. Er war Vikar Pinchs Stellvertreter. Die Macht hinter dem Thron. Er ritt vom Pine Top Hill weg, bevor der Kampf auch nur begonnen hatte. Er verließ seinen wahnsinnigen Herrn, überließ ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, seinem Schicksal. Und er nahm auch ein paar Männer mit.
DeMalo.
Das Ganze muss schon eine Weile im Gang sein. So weit, wie es gediehen ist, muss es in die Wege geleitet worden sein, als Vikar Pinch noch lebte. DeMalo muss nebenbei sein eigenes Süppchen gekocht haben. Das erklärt auch die Gerüchte, die Jack vor ein paar Jahren zum ersten Mal gehört hat. Das wenige, was er über den Mann weiß, was er mit eigenen Augen gesehen hat, zeigt ihm, dass DeMalo niemand ist, der auf einen blutigen Umsturz aus ist.
Er ist viel gerissener. Er ist der Dolch in der Dunkelheit. Das Gift im Getränk. Er muss auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben. Jack kann sich das verstohlene Lächeln vorstellen, das DeMalo sich sicherlich gestattet hat, als ihm klar wurde, dass sie am Pine Top Hill die Drecksarbeit für ihn erledigen würden.
Jedenfalls hat er die Sache ins Rollen gebracht, außer Sicht- und Hörweite von Pinch. Das hätte er nicht tun können, ohne sich dauerhaft der Treue und des Stillschweigens seiner Tonton-Gefolgsleute zu versichern.
Unerhört. Sehr interessant. Sehr besorgniserregend.
Jack würde viel darum geben zu wissen, was genau DeMalo vorhat. Wo. Wie. Und warum.
Je eher er das Lost Cause erreicht, desto besser.
Die Schenke steht an der Kreuzung vor ihm. Es ist ein niedriges Gebäude, das sich gleichsam an den Boden drückt. Ein schäbiges Etwas. Es steht einsam und allein auf der verdorrten weiten Ebene, umgeben von bedrückenden schwarzen Bergen.
Das Lost Cause. Endlich.
Wegen des Umwegs, den er genommen hat, um den Tonton auch garantiert nicht zu begegnen, hat er trotz scharfen Reittempos eine ganze Woche bis hierher gebraucht. Viel länger, als er gedacht hatte. Es ist kurz vor Tagesanbruch. Bei Tagesanbruch und zur Abenddämmerung geht es im Sturmgürtel rund. Er sieht zum Himmel. Pünktlich türmen sich hässliche braune Wolken über der Ebene auf. Aus allen Richtungen jagen sie herbei, stolpern und überschlagen sich vor Hast. Ein mächtiges Gewitter braut sich zusammen. Ein Sulfatgewitter.
Atlas wirft den Kopf hin und her. Tänzelt ein bisschen. Jack zwingt ihn mit den Fersen, weiterzugehen. An der Schenke springt er ab und bringt ihn in den Stall. Das einzige andere Pferd im Stall ist Prue, Mollys rötliche Langhaarstute. Im Trog ist frisches Futter, in der Tränke Wasser. Immerhin. Er hatte schon Angst, dass die Tonton die Schenke vielleicht niedergebrannt haben, wenn er ankommt. Trotzdem: Normalerweise ist der Stall gut gefüllt mit den Reittieren der Gäste: Maultiere und Pferde, auch schon einmal ein Kamel.
Als er auf die Tür zugeht, quietscht das Schild der Schenke im aufkommenden Wind. Die Farbe ist verblichen und blättert ab, aber er kann das winzige Boot gerade noch erkennen, das in stürmischen Wellen untergeht und gleich von einer gewaltigen Woge verschluckt werden wird. Jedes Mal, wenn er hier ist, rechnet er halb damit, dass das Boot fort ist. Untergegangen.
The Lost Cause – Der Hoffnungslose Fall. Nie war der Name einer Schenke passender. Ein Haufen Abwrackerschrott, in den nicht einmal eine Ratte die Nase stecken würde. Fetzen von wer weiß was. Ramponierte Überreste von diesem und jenem. Sie sieht aus, als könnte schon ein tiefer Seufzer sie einstürzen lassen. Aber sie steht schon ewig hier. Sie stand schon, lange bevor das Wetter sich veränderte und die Stürme aufkamen. Als das hier noch eine grasbewachsene grüne Ebene voller Leben war. Schon damals war es eine weithin bekannte Spelunke und ein Dirnenhaus. Aber als Mollys Familie die Schenke übernahm, wurde sie berüchtigt. Vier Generationen von Pratts machten sie zur einzigen Raststätte in dieser Gegend. Spektakuläre Raufereien, Schurken, die in einer finsteren Ecke Unheil ausheckten, hektisch-schrille Musik, Getränke, so scharf, dass sie einem die Haarwurzeln betäubten, und leichte Mädchen jeder Prägung. Er fragt sich, ob Lilith immer noch hier arbeitet. Sie muss schon ein bisschen älter sein.
Er hat das Lost Cause noch nie geschlossen erlebt, weder tagsüber noch nachts. Molly ist sicher noch wach, selbst um diese Zeit. Sie ist Frühaufsteherin. Kommt mit vier Stunden nachts und einem Nickerchen am Nachmittag aus. Vielleicht steht sie sogar noch hinter der Theke.
Vor der Tür zögert Jack. Vor Anspannung ist ihm flau im Magen. Immer wieder hat er darüber nachgedacht, was er zu ihr sagen wird. Wie er ihr von Ike erzählen soll. Und er weiß es immer noch nicht. So etwas musste er noch nie tun. Er muss einfach hoffen, dass ihm die richtigen Worte einfallen.
Um Zeit zu schinden, klopft er den Staub von seinem Hut. Zupft an der Taubenfeder, die im Hutband steckt. Flüchtig spielt ein kleines Lächeln um seine Lippen, als er sich daran erinnert, mit welchem Tamtam Emmi die ideale Feder gesucht hat, um seinen ramponierten alten Hut zu verschönern. Er setzt ihn wieder auf. Schiebt ihn keck über ein Ohr.
Dann atmet er tief durch. Öffnet die Tür. Und geht hinein.
Molly steht hinter der Theke und trocknet Schnapsbecher ab. Die rostigen zerbeulten Blechbecher und -krüge sehen sogar noch ungesünder aus als bei seinem letzten Besuch. Sie arbeitet sich durch einen ganzen Haufen, als würden jede Menge durstiger Zecher auf sie warten. Er ist der einzige Gast.
Sie sieht hoch. Sie kann nicht verhindern, dass sie vor Überraschung zusammenfährt. Dass blitzartig Freude über ihr Gesicht huscht. Und noch etwas. Erleichterung. Gleich darauf ist das alles weg. Sie hat die Maske wieder aufgesetzt. Das Lächeln, das besagt: Hab ich alles schon mal gehört. Den Blick, der schon alles gesehen hat.
Sie haben eine gemeinsame Geschichte, Molly und er. Und die reicht tief. Trotzdem galt die Freude nicht ihm. Niemals seinetwegen die wilde, heiße Freude, die gerade aufgeschimmert ist. Nein. Sie glaubt, Ike sei bei ihm. Er hat einen Kloß im Hals, muss schlucken.
»Schau an«, sagt sie gedehnt, »wen der Wind reingeblasen hat.«
Sie geht wieder an die Arbeit. Ihre dichten blonden Locken sind hinten zusammengebunden. Sie hat aufreizende Lippen. Gefährliche Kurven. Einen direkten Blick. Reisende machen weite Umwege, nur um mit ihr in einem Raum zu sein. Auf mehr können die meisten nicht hoffen.
»Molly Pratt«, sagt er. »Sag mir noch mal, was macht ein himmlisches Geschöpf wie du in so einer Bruchbude?«
»Halunken wie dir Fusel servieren. Und wenn du mein Haus noch mal Bruchbude nennst, kriegst du Hausverbot.«
»Hab ich letztes Mal schon bekommen und das Mal davor und das davor. Schon vergessen?«
»Ach, stimmt. Tja, komm rein, nur nicht so schüchtern. Du stehst da wie eine Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht. Setz dich, trink was, hol einen Stuhl für Ike. Wo ist er? Pferde versorgen?«
Er antwortet nicht. Er wird sich langsam herantasten an das, was er sagen muss. Wird zuerst ein Glas trinken oder drei. Wird auf den richtigen Augenblick warten. Er geht zur Theke und schnappt sich unterwegs zwei Hocker. Wirft seine Satteltasche aus Rinde auf den Boden, lässt den Waffengürtel auf die Theke fallen. Überall ist Sand. Sammelt sich in den Ecken. Treibt um seine Füße, wenn es von der Tür her zieht.
»Da draußen passieren schlimme Sachen, Molly.«
»Willkommen in New Eden, dem neuen Paradies!«, sagt sie. »In der strahlenden, funkelnagelneuen Welt.«
»Blutige Welt, meinst du.«
»Die Welt ist immer schon blutig gewesen. Bloß ist heute das Blut von manchen besser als das von anderen.«
»Was gibt’s Neues?«, fragt er. »Die Tonton sind jedenfalls nicht mehr das, was sie mal gewesen sind. Was ist mit ihrem Anführer? Schon mal den Namen DeMalo gehört?«
Sie schüttelt den Kopf. »Er wird der Wegbereiter genannt«, sagt sie. »Die Siedler – Verzeihung, die Verweser der Erde –, die hauchen seinen Namen, als wenn er kein Mensch wär. Sie sagen, er tut Wunder. Er wär hier, um die Erde zu heilen.«
»Du dürftest nicht hier sein. Es ist nicht sicher.«
»Tja, stimmt schon, die Tonton mögen keinen Schnaps, und sie mögen keine Huren. Jedenfalls nach außen hin. Aber die Mistkerle da haben größere Sachen im Sinn als meine Schenke. Das Land im Sturmgürtel taugt nicht für sie. Ich hab Lilith und die andern Mädchen gehen lassen, wie du siehst, werd ja nicht gerade von Gästen überrannt. Keine Huren, nicht viel Schnaps. Mit mir geben die sich gar nicht ab.«
»Das weißt du nicht. Du musst weggehen, Molly.«
»Das ist mein Zuhause, Jack. Mein Lebensunterhalt. Die Schenke gehört mir, seit ich fünfzehn war. Vor mir hat sie meinem Vater gehört, und er hat sie von seinem Vater geerbt. Mit hartgesottenen Hurensöhnen werd ich schon mein ganzes Leben fertig.«
»Ich hab sie gesehen, Molly. Ich hab sie bei ihrem Treiben erlebt. Willst du dein Leben für den Laden hergeben? Dafür?«
»Dazu kommt’s nicht. Und falls doch, ich kann auf mich aufpassen.«
»Tja, du solltest nicht hier allein sein. Wann sind die Mädchen weg?«
»Schon länger her. Es ist okay, wenn ich für mich ein Risiko eingeh, aber bei ihnen ist das was anderes.«
Etwas an der Art, wie sie das sagt, macht ihn hellhörig. Er kneift die Augen zusammen. »Was hast du vor?«
»Lass stecken«, sagt sie. »Das Thema ist erledigt.« Sie schiebt ihm einen übervollen rostigen Becher zu. Obendrauf schwimmt ein toter Käfer.
»Trink. Der Käfer geht aufs Haus. Ich werd Ike auch einen eingießen. Ihr Jungs müsst doch ausgetrocknet sein.« Während sie noch einen Schnapsbecher füllt und er den Käfer aus seinem fischt, wirft sie einen Blick zur Tür. »Wo bleibt der denn? Ach, sag nichts, ich weiß. Versteckt sich hinter seinem Pferd. Ike, wie er leibt und lebt. Schickt dich vor, den Feind auskundschaften, während er wartet, bis die Luft rein ist. ›Ich bin in drei Monaten wieder da‹, sagt er zu mir, ›in drei Monaten, Molly, ich geb dir mein Wort, und dann weich ich nicht mehr von deiner Seite.‹ Drei Monate, heiliges Kanonenrohr. Wie wär’s mit drei Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen? Ich hab’s dir damals gesagt, Jack, und ich sag’s dir jetzt noch mal: Komm ja nicht durch meine Tür, außer du bringst Ike mit, damit er eine ehrbare Frau aus mir macht, für immer und ewig, amen. Sonst schieb ich dich in die Brennerei und verkoch dich zu miesem Fusel. Hab ich das gesagt oder nicht?«
»Das hast du«, sagt er.
»Und bin ich nicht eine Frau, die ihr Wort hält?«
»Doch.«
»Tja dann.«
Er schüttet sein Getränk hinunter. Schnappt nach Luft, als es durch seine Kehle rinnt. »Das ist ja scheußlich«, sagt er, als er wieder sprechen kann. »Was ist das?«
»Wurmkrautwhisky. Letzten Dienstag gebrannt. Hält Bettwanzen, Läuse und Fliegen ab. Hilft auch, wenn du wund geritten bist. Der Letzte, der ihn probiert hat, ist auf allen vieren hier rausgekrochen und hat geheult wie ein Wolfshund.«
»Du wirst noch mal jemand damit umbringen«, sagt er.
»Wer sagt, dass ich das nicht schon getan hab? Wo zum Teufel bleibt der Mann?« Sie klingt, als würde es sie gar nicht interessieren. Aber ihr Blick besagt etwas anderes.
Noch einen Becher, dann erzählt er es ihr. Er schiebt ihr den Becher zu. »Schenk nach.«
»Bedien dich selbst.«
Sie betrachtet sich in der Spiegelscherbe, die sie hinter der Theke verwahrt. Sie kneift sich in die Wangen, beißt sich auf die Lippen und zupft an ihren Haaren, dabei wirft sie immer wieder verstohlene Blicke zur Tür. Neunundzwanzig, aber tut wie ein aufgeregtes junges Mädchen, das auf den einen wartet, der ihr Herz höher schlagen lässt. Es drückt ihm sein eigenes Herz ab.
Er trinkt. Ihm ist flau im Magen. Na los, sagt er sich, tu’s. Sag’s ihr jetzt. Aber unwillkürlich sagt er: »Ich schwör dir, Molly, jedes Mal, wenn ich dich seh, bist du noch schöner geworden. Wie viele Herzen hast du heute gebrochen?«
»Halt die Klappe, ich weiß, ich bin eine alte Vettel.«
Er schnaubt ungläubig, und sie lächelt sich zufrieden im Spiegel an. »Das Leben in der Bruchbude hier ist die Hölle für meine Haut. Beim Warten auf Ike bin ich alt geworden. The Lost Cause. Das bin eindeutig ich, Jack, der hoffnungsloseste Fall, der je gelebt hat. Und weißt du, warum? Weil ich geglaubt hab, der Mann könnt es ernst meinen. Ike Twelvetrees und sesshaft werden? Da kann man genauso gut die Sonne bitten, sie soll nicht mehr scheinen.«
Jetzt. Sag’s ihr jetzt. »Molly, ich muss dir was –«
»Ach, genug von Ike. Wird schon auftauchen, wenn er seinen Mut wiedergefunden hat.« Sie stützt die Ellbogen auf die Theke. »Was ist denn das für ein armseliges Ding?« Sie schnippt ihm den Hut vom Kopf. »Schon besser. Verdammich, Jack, du bist ein fescher Teufel, kein Vertun. Du mit deinen Mondlichtaugen.«
»Hör mal, Molly, Ich … ähm …«
»Denkst du manchmal an sie?«, fragt Molly unvermittelt.
Er antwortet nicht. Er starrt in seinen Becher.
»Sie wär jetzt sechs«, sagt sie. »Ich weiß, es ist bescheuert, aber … ich stell mir gern vor, wie sie jetzt wär. Ihre Wesensart und so. Nach wem sie gekommen wär. Ich glaub, sie hätte deine Augen gehabt. Sie war schön, oder?«
»Ja«, sagt er. »Und wie.«
Er nimmt ihre Hand in seine Hände. Hält sie fest und küsst sie. Sie sehen sich in die Augen. Zwischen ihnen hängt drückend das, was war. Was niemals wirklich gewesen ist, aber sie immer verbinden wird.
»Jack?« Sie mustert ihn prüfend, suchend. Dann weicht sie ein Stück zurück und sieht ihn nochmals an, als wäre ihr plötzlich etwas an ihm aufgefallen. »Omeingott, Jack. Du hast mir was zu erzählen.«
Er atmet aus. »Ja. Ja, das hab ich. Die Sache ist die, Molly … ich, ähm –«
»Na, ich fress einen Besen!«, sagt sie. Langsam breitet sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
Er runzelt die Stirn. »Molly?«
»Haha! Ich glaub’s nicht.« Sie schlägt mit der flachen Hand auf die Theke. »Verdammich und halleluja, Jack, wer ist sie?«
»Was? Wovon redest du?«
»Jetzt tu nicht so, ich kenn dich zu gut. Wer ist sie? Wer ist die Frau?« Mollys scharfe Augen erspähen das Lederband um seinen Hals. »Und was ist das?« Sie zieht den Herzstein aus seinem Hemd und betrachtet ihn. »Ein Herzstein«, sagt sie. Staunend sieht sie ihn an. »Sie hat dir einen Herzstein gegeben.«
»Vielleicht hab ich ihn ja gefunden«, sagt er.
»O nein. Ich seh sie in deinem Gesicht, Jack. Ich seh sie in deinen Augen.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, sagt er.
»Hey, ich bin’s, weißt du noch? Wir zwei machen uns nichts vor. Das haben wir hinter uns. Solang ich dich kenn, Jack, ist die Tür zu deinem Herzen abgeschlossen und der Schlüssel versteckt gewesen. Sieht aus, als hätt sie ihn gefunden.«
Er sagt nichts. Molly wartet. Dann: »Schlüssel sind nicht ihre Sache. Sie hat die Tür eingetreten.«
»Du liebst sie«, sagt Molly.
»Ach, das weiß ich nicht. Ich, ähm … hm. Das klingt zu sicher. Das hier ist nicht sicher.«
»Oh. So ist das also, wie?«
»Ich will das nicht, Molly. Ich … was das auch ist, ich hab nicht danach gesucht.«
»Musst du auch nicht«, sagt sie. »Wenn’s sein soll, findet’s dich. Wir machen uns vor, wir hätten unser Leben im Griff, aber das haben wir nicht. Nicht ganz. Solltest du mittlerweile wissen.«
»Einen größeren Dickkopf gibt’s nicht«, sagt er. »Und sie glaubt immer, sie weiß es besser, auch wenn sie keine Ahnung hat, dann sogar besonders. Sie ist hitzig und stur und alles, was ganz unten auf die Liste käm, falls man eine … so eine Liste machen würd. Was ich nicht getan hab. Überhaupt nicht.«
»Aber?«, fragt Molly.
»Aber … Molly, sie strahlt. Das Leben brennt so stark in ihr. Ich hab’s nie gemerkt, erst als ich sie getroffen hab. Mir ist mein ganzes Leben lang kalt gewesen, Moll.«
»Ich weiß«, sagt sie sanft.
»Es ist nur, dass … ach, verdammt. Sie hält mich für besser, als ich bin.«
»Tja, du bist besser, als du glaubst.«
»Sie ist zu jung«, sagt er. »Achtzehn.«
»Haarsträubend! Weil du ja schon so alt bist.«
»Alter hat nichts mit Jahren zu tun, und das weißt du. Jedenfalls, wenn einem jemand so wichtig wird … das ist gefährlich.«
»Wag ja nicht, davor zu fliehen, Jack, wag es ja nicht«, sagt Molly grimmig. »Die meisten Leute fühlen nie, was du jetzt fühlst. Sei bei ihr. Und wenn’s nur eine Stunde, eine Nacht, eine Woche, einen Monat dauert, das ist egal. Sei bei ihr, brenn mit ihr, leuchte mit ihr … so lange, wie euch gegeben ist. So. Sag mir ihren Namen. Sag ihn mir.«
Er atmet tief durch. »Saba. Sie heißt Saba.«
Molly legt eine Hand an sein Gesicht. »Ach, mein lieber Jack. Das … das hab ich dir gewünscht. Genau das hab ich dir gewünscht. Wie hat sie diesen Augen widerstehen können?«
»Sie hat’s versucht«, sagt Jack. »O Mann, sie hat’s versucht. Aber … hör mal, Molly, das ist nicht der Grund, warum ich –«
»Eine Feier!«, ruft sie. »Das schreit nach einem anständigen Besäufnis! Und ich meine anständig!« Lachend knallt sie Schnapsbecher auf die Theke und ordnet sie in einer langen Reihe an. »Wo zum Teufel bleibt Ike? Ike!«, brüllt sie. »Verdammich, Mann, schieb deinen Hintern sofort hier rein! Wir trinken auf Jack und Saba!« Sie beginnt einzuschenken, so ungestüm, dass einiges danebengeht. »Ich sag dir, Jack, du beflügelst mich. Ich benenn den Laden um. Kein hoffnungsloser Fall mehr, o nein. Nicht diese Schenke und garantiert nicht ich. Von jetzt an soll sie heißen: Sieg der Hoffnung! Und wenn Ike gleich durch die Tür da kommt – nachdem ich fertig damit bin, ihn totzuküssen –, dann bind ich ihn an den Stuhl da und lass ihn nie mehr weg, weil das Leben nämlich verdammt nochmal zu kurz ist und es Zeit wird, dass ich mich an meinen eigenen Rat halt. Vielleicht brauch ich deine Hilfe, klar, aber das macht dir bestimmt nichts aus, weil –«
»Molly!« Jack packt ihre Hand. »Hör auf, Molly, bitte. Verdammt, Molly, Ike kommt nicht durch die Tür da.«
Sie wird still. Ganz still. Ihr Lächeln verblasst. »Bitte sag’s nicht«, flüstert sie.
Er bringt es nicht über sich. Aber er muss.
»Ike ist tot. Er ist tot, Molly. Es tut mir leid.«
Tränen treten ihr in die Augen. Laufen ihr lautlos übers Gesicht. Sie sieht ihm in die Augen.
»Es ist einen Monat her«, sagt er. »Nein … ein bisschen länger. Da ist ein … es hat einen großen Kampf gegeben. Einen echten diesmal, nicht bloß eine Schenkenrauferei. Die Tonton.«
»Die Tonton«, flüstert sie.
»Wir sind zurück nach Freedom Fields. Wir haben die Chaalfelder abgebrannt. Sie haben uns verfolgt und … nicht bloß Ike und ich, auch Saba und ein paar andere. Wir haben gegen sie gekämpft, Molly. Wir haben sie besiegt. Und für kurze Zeit, für … eine Weile, waren die Guten obenauf. Ike und ich, die Guten. Wer hätte das gedacht?«
»Ich«, sagt sie. »Ich hätte. Ich weiß.«
»Er ist unter Freunden gewesen, Molly«, sagt Jack. »Ich bin bei ihm gewesen. Ich bin ganz in der Nähe gewesen und … und er ist in meinen Armen gestorben. Er ist gut gestorben. Er ist großartig gestorben. Wie er’s gewollt hätte. Das Letzte, was ich zu ihm gesagt hab, ich … ich hab’s ihm ins Ohr geflüstert. Molly liebt dich, Ike. Das ist das Letzte, was er gehört hat.«
Einen Augenblick lang steht sie da. Nickt einmal. Zieht ihre Hand weg. »Ich bin froh, dass du’s mir erzählt hast«, sagt sie. »Verschwend keine Zeit, Jack. Geh zu ihr. Sei bei ihr. Brennt hell. Versprich’s mir.«
»Geh von hier weg. Komm mit mir. Bitte.«
»Versprich’s mir«, sagt sie.
»Ich versprech’s«, sagt er.
»Wiedersehen, Jack.« Sie küsst ihn auf die Wange. Dann schlüpft sie durch die Tür ins Hinterzimmer und schließt sie hinter sich.
Stille. Sie muss sich etwas auf den Mund drücken, um kein Geräusch zu machen. Sie könnte sich genauso gut gehenlassen und laut heulen. Außer ihm ist ja keiner da. Er geht um die Theke herum und klopft.
»Molly?« Keine Antwort. »Er hat zu dir zurückkommen wollen, Molly. Er hat dich geliebt.«
»Geh weg.«
»Ich kann dich so nicht hierlassen«, sagt er. »Lass mich rein.«
»Himmelherrgott, tu einfach, was ich dir sag!«, schreit sie.
Er geht zurück zu seinem Hocker. Betrachtet die gefüllten Schnapsbecher auf der Theke und fängt beim ersten an. Er weiß, wie Molly trauert. Sobald er weg ist, wird sie den Laden dichtmachen. Dann wird sie ein bisschen weinen und ein bisschen trinken. Und das wird sie immer abwechselnd tun, so lange, bis die Narbenhaut über dieser neuesten Wunde so dick ist, dass sie weitermachen kann.
Er wird warten, bis das Unwetter vorüber ist. Dann wird er gehen. Er holt den Herzstein wieder hervor. Reibt ihn zwischen den Fingern. Er ist kühl, obwohl er direkt auf seiner Haut lag. So ist das bei einem Herzstein. Kühl, bis man sich dem nähert, was das Herz sich wünscht. Je näher man kommt, desto heißer brennt er. Als er sie das letzte Mal sah, hat sie ihm den Stein um den Hals gehängt. Er war heiß.
»Er wird dir helfen, mich zu finden«, hat sie gesagt.
»Ich brauche keinen Stein, um dich zu finden«, hat er gesagt. »Ich würde dich immer finden, egal wo du bist.«
Dann hat sie ihn geküsst. Bis er nicht mehr denken konnte. Bis ihm schwindlig war vor Verlangen nach ihr.
Er steckt den Stein wieder ins Hemd.
Das Unwetter bricht los. Abrupt hört er das Sulfat dumpf aufs Dach prasseln. Bald wird der Regen folgen und alles abwaschen.
Die Tür springt auf. Der Wind dringt heulend in die Schenke, lässt die Dachsparren ächzen, wirbelt den Sand am Boden auf, zupft an seinem Mantel. Er steht auf, um die Tür zu schließen.
Zwei Männer kommen herein. Sie sind überall mit Sulfat bestäubt. Lederrüstung. Armbrüste. Bolzenschießer. Lange schwarze Gewänder. Lange Haare. Bärte.
Tonton. Von der alten Sorte.
Gefahr. Jeder Nerv, jeder Muskel in Jacks Körper spannt sich an und bebt. Dennoch sagt er in beiläufigem Ton: »Der Laden ist leer, Leute. Sieht so aus, als wären alle abgehauen.«
»Ich will zu dieser Lilith«, sagt der eine. »Wo ist sie?«
»Weg«, sagt Jack, »wie ich gesagt hab. Guckt doch selber nach.«
Der Tonton sieht ihn an. Dann geht er zu einer Tür in der Ecke. Sie führt auf einen Gang, von dem vier kleine Zimmer abgehen, in denen die Mädchen ihrem Gewerbe nachgingen. Er geht auf den Gang und brüllt: »Lilith! Hey, Lilith! Komm raus da!«
Dann werden Türen aufgerissen, eine nach der anderen.
Ein Tonton aus dem Weg. Jacks Blick zuckt zur Theke, wo sein Waffengürtel liegt.
Eine blitzschnelle Bewegung, und der andere Tonton richtet einen Bolzenschießer auf Jack. Es hat nur eine Sekunde gedauert. Der Tonton geht zur Theke und leert einen der Schnapsbecher. Er lässt Jack nicht aus den Augen.
Der erste Tonton kommt wieder zurück. »Wo ist sie hin?«, fragt er.
»Ich weiß nicht, mein Freund«, sagt Jack. »Wie gesagt, hier ist keiner.«
Genau in diesem Augenblick entfährt Molly ein Schrei. Ein langgezogener, klagender, tierischer Schmerzensschrei.
Als er verklingt, fragt der an der Theke: »Und wer ist das?«
Er und Jack starren einander an.
»Lasst sie in Ruh«, sagt Jack.
Der Tonton richtet den Bolzenschießer auf Jacks Herz. Träge. Er lächelt.
»Ruf sie«, sagt er. »Na los … mein Freund. Ruf sie.«
Das Ödland Einen Monat später
Ich steh auf dem Hügelkamm und seh die Sonne aufgehen. Weißgesichtig und gnadenlos fängt sie an, die Erde zu versengen. Ein neuer Tag im Ödland. Ein neuer Tag in diesem Nirgendwo. Hochsommer. Hitze und Staub. Durst und Hunger und Vorwürfe.
Lugh und Tommo und Emmi und ich. Gegenseitig. Wer was getan hat. Wer was gesagt hat. Wer schuld ist, dass wir hier festsitzen. Dass wir mitten in diesem Land aus Tod und Knochen festsitzen, wo wir doch in Saus und Braus im Westen leben sollten. Uns ein neues Leben aufbauen sollten.
Hinter den Bergen. Am Großen Wasser. Wo die Luft nach Honig duftet. Wo Jack auf mich wartet.
Ach, Jack. Bitte. Warte.
Ich zähl drauf, dass du wartest.
Wir hätten längst da sein sollen. Schon vor Wochen. Emmi sagt, dass das Land uns hier festhält. Dass es uns gefangen hält. Ich wünschte, sie würde so was nicht sagen. Man weiß, dass es dumm ist, aber sie sagt’s, und irgendwie setzt es sich im Kopf fest, und dann muss man immer dran denken. Die Sache ist die: Wir haben es falsch angefangen. Wir haben keinen Plan gehabt. Wir haben einfach die Köpfe nach Westen gedreht und sind los. Kaum zu glauben, dass vier Leute so dumm sein können, aber so ist es. Wir haben nicht richtig nachgedacht, keiner von uns. Zu viel ist passiert. Wir hatten gerade erst die Tonton in einem harten Kampf besiegt. Und das auch nur knapp und nur dank Maev und ihren Hawks. Wenn die nicht aufgetaucht wären, wären wir geliefert gewesen. Dann Jack. Der Wiedersehen gesagt hat, statt mir Lebewohl zu wünschen: Ich seh dich im Westen – ach, und übrigens – du bist in meinem Blut, Saba.
Deshalb ist mein Kopf voll von ihm und all dem andern gewesen und … ich hab Lugh wieder. Seit die Tonton ihn am Silverlake gefangen hatten, hab ich nur das im Sinn gehabt. Lugh zu finden und zurückzuholen. Und ich bin einfach so froh gewesen. So froh und so dankbar, dass er und ich wieder zusammen sind.
Damit will ich nicht sagen, es wär mir egal, dass Ike in dem Kampf getötet worden ist. Es macht mich unendlich traurig, wenn ich an ihn denk. Das Herz tut mir weh. Nicht wie Tommos, nicht so. Tommo trauert schwer und tief um Ike. Taube Jungs sind bestimmt nie sehr gesprächig, aber er ist so am Boden, dass wir seine seltsame heisere Stimme neuerdings kaum noch zu hören bekommen. Em hat sich angewöhnt, an seiner Stelle zu sprechen. Scheint ihm nichts auszumachen.
Aber am Anfang ist die Hauptsache gewesen, dass wir am Leben sind. Irgendwie … irgendwie haben wir das alles überlebt. Und ich hab meinen Lugh wieder gehabt. Meinen Bruder, aus tiefstem Herzen geliebt. Uns ist irgendwie ganz schwindlig gewesen vor Erleichterung und Freude und … wir sind so erleichtert gewesen, dass wir alles andere vergessen haben.
Zum Beispiel, wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen.
Am Ende haben wir den ersten Reisenden gefragt, den wir getroffen haben. Einen Salzsammler auf einem Kamel, der gerade in einem der großen Salzseen im Ödland ernten gewesen war. Mit unserer Tauschware hat es ziemlich mau ausgesehen, das Beste, was wir ihm anbieten konnten, sind eine Gürtelschnalle und ein Paar Stiefelschnürsenkel gewesen. Dafür haben wir eine halbe Büchse Salz bekommen und den Rat, quer durchs Ödland zu reiten. Er hat gesagt, das wär der schnellste, direkteste Weg nach Westen. Wir haben gedacht, er weiß, wovon er redet, also haben wir getan, was er gesagt hat. Wir sind mitten reingeritten.
Für eine Schnalle und Schnürsenkel bekommt man keinen guten Rat. Er hat uns nicht erzählt, was das für eine Gegend ist. Warum sie das Ödland heißt. Er hat uns nichts vom Todeswasser erzählt. Davon, dass es kaum was zu jagen gibt. Von den Seuchengruben der Abwracker, die sich über Meilen hinziehen. Von den Erdlöchern, die sich plötzlich auftun, wenn man gerade drübergeht. Eben läuft man noch über festen Boden, im nächsten Augenblick öffnet sich ein Loch, und man liegt unten zwischen den Toten.
Ich bin die Erste gewesen, die in eins reingefallen ist. Ich hab früher schon mal bis zum Hals in den Knochen von Toten gesteckt. Man sollte meinen, dass ich dran gewöhnt bin. Dass es mir nichts ausmacht. Tut es aber. Es macht mir was aus.
Ich hab den Tod so unendlich satt.
Dann hat’s Buck getroffen, Lughs Pferd. Zum Glück hat er sich nicht das Bein gebrochen oder schlimmer. Zum Glück hat Lugh ihn gerade geführt und nicht geritten. Aber er hat sich das rechte Bein vertreten. Das ist vor einer Woche gewesen, aber er ist immer noch nicht richtig gesund. Also sitzen wir hier fest, bis es ihm besser geht. Sitzen im Ödland fest.
Vielleicht versucht es wirklich, uns hier festzuhalten. Vielleicht hat Emmi recht. Ist noch gar nicht lang her, dass ich auf das, was eine neunjährige kleine Schwester zu sagen hat, nichts gegeben hätte. Aber Em weiß manche Sachen einfach. Neuerdings tu ich sie nicht so schnell ab.
Eins stimmt. Eins weiß ich sicher. Diese Gegend ist nicht richtig. Da sind Schatten, wo keine sein dürften. Ich seh was aus dem Augenwinkel, und ich denk, es wär Nero oder ein anderer Vogel, aber dann ist da keiner. Und ich hör diese … diese Geräusche. Es ist wie … weiß auch nicht, als wenn jemand flüstern würd oder so.
Den anderen sag ich nichts davon. Jetzt nicht mehr. Am Anfang schon. Da sind wir dann jedes Mal alle durch die Gegend gejagt um nachzugucken, aber keiner hat was gefunden, und dann haben sie angefangen, mich komisch anzusehen, also halt ich jetzt den Mund.
Ich schlaf nicht gut. Ich schlaf schon lange nicht gut, deshalb bin ich halbwegs dran gewöhnt, aber seit Epona tot ist, ist es schlimmer geworden. Immerhin kann ich dadurch über sie wachen. Über Lugh und Emmi und Tommo. Kann dafür sorgen, dass ihnen nichts passiert. Wenn ich nicht schlaf, kann keiner kommen und sie holen.
Hauptsächlich beobachte ich aber Lugh. Er schläft tief und lang. Aber nicht ruhig. Niemals ruhig. In den meisten Nächten redet er im Schlaf. Ich versteh immer nur hier und da ein Wort, meist hör ich bloß Gemurmel.
Manchmal weint er. Wie ein kleines Kind. Das ist am schlimmsten. Ich wein mit ihm. Kann nicht dagegen an. Seine Tränen sind meine. So ist das bei uns. Bis dahin hab ich ihn nur ein einziges Mal weinen gesehen, soweit ich mich erinner, und zwar, als Ma gestorben ist. Da sind wir acht gewesen. Damals sind jede Menge Tränen geflossen. Lugh und Pa und ich müssen so viele Tränen geweint haben, dass man den Silverlake damit dreimal hätte füllen können.
Jetzt muss ich erst mal was tun. Sie werden mit leerem Magen aufwachen, drüben im Lager, und ich bin mit Jagen an der Reihe. Eidechse, Beutelratte, Schlange, ich bin nicht wählerisch. Alles geht, außer Heuschrecken. Heuschrecken hab ich die letzten drei Mal mitgebracht, und alles nur, weil – tja, jedenfalls haben es alle satt, auf Insekten zu kauen.
Ich runzel die Stirn. Weiß nicht, wie ich heut Morgen hierhergekommen bin. Wie ich auf diesen Kamm gekommen bin, so weit weg von unserm Lager. Ich muss auf Hermes hergekommen sein. Da ist er ja, gleich da drüben, mit seinem struppigen kastanienbraunen Fell und den kräftigen Beinen, und rupft welke Grasbüschel aus. Man sollte meinen, dass ich mich an den Ritt erinner, aber das kann ich nicht. Komisch.
Ich nehm den Weitgucker und such die Landschaft ab. Das Ödland erstreckt sich, so weit ich gucken kann. Bis zum Horizont und noch weiter. Trockener, gelber Boden. Vereinzelte Hügel aus grauem Fels mit roten Streifen. Vom Wind glattgeschmirgelt.
»Diese Gegend würd den Teufel zum Weinen bringen«, sag ich.
Plötzlich hör ich ein Grollen. Und gleichzeitig fühl ich es auch. Ein leises stetiges Beben unter meinen Füßen. Links von mir bewegt sich was wie der Blitz. Von Norden her. Ich richte den Weitgucker drauf.
»Heilige Scheiße.«
Windhosen. In einer langen Reihe wirbeln sie über die Ebene. Kleine, nicht mehr als zwölf Meter hoch. So was hab ich noch nie gesehen. Sie wirbeln den Staub auf und kommen in meine Richtung.
Und da ist ein Windspringer. Er rennt vor den Windhosen her, sie jagen ihm hinterher. Dem Geweih nach ein zwei Jahre alter Bock. Er läuft mit voller Kraft. Falls er ihnen nicht davonlaufen kann, wird er in eine Windhose gesaugt. Nero segelt über mir auf der warmen Luft. Ich pfeif. Er schießt zu mir runter und landet auf meiner ausgestreckten Hand.
Ich zeig auf den Windspringer. »Siehst du den? Das ist Frühstück, Mittag- und Abendessen für die nächste Woche.«
Nero kreischt.
»Du weißt, was du tun musst. Dreh ihn nach hier um. Bring ihn zu mir. Bring ihn her, Nero!« Ich werf ihn in die Luft. Er flitzt davon. Nero ist ein guter Jäger. Er glaubt, er wär ein Falke, keine Krähe. Er wird den Windspringer von den Windhosen wegtreiben. Er wird ihn direkt bis in Reichweite meiner Armbrust scheuchen.
Ich lauf los.
Meine Füße fühlen sich schwer an. Als würden sie nicht zu mir gehören. Sie wollen sich nicht bewegen. Aber ich zwing sie. Ich lauf schneller. Im Rennen nehm ich die Armbrust vom Rücken. Zieh einen Pfeil aus dem Köcher an meiner Seite. Ich hüpf den trockenen Hang runter. Fast unten am Fuß vom Hang ragt ein flaches Stück Fels raus. Von da aus kann ich gut schießen und bin weit genug weg, in Sicherheit vor den Windhosen.
Ich erreiche den Fels. Staub wirbelt um mich rum. Der Wind heult. Ich geh in Stellung. Leg den Pfeil auf die Sehne.
Ich muss ruhig bleiben. Wenn ich ruhig bleib, geht alles gut. Diesmal geht alles gut. Ich atme tief durch.
Nero schreit aufgeregt. Er treibt den Windspringer vor sich her. Der bricht nach links aus, dann nach rechts, aber Nero stößt kreischend auf ihn runter. Er kommt direkt auf mich zu. Auf der Brust hat er eine Blesse. Über dem Herzen. Die perfekte Zielscheibe.
Das wird der perfekte Schuss.
Ich heb den Bogen. Ziele. Genau aufs Herz.
Meine Hände fangen an zu zittern. Weißes Licht blitzt auf.
Epona rennt auf mich zu. Breitet die Arme aus. Und ich erschieß sie. Mitten ins Herz.
Kalter Schweiß. Auf meiner Stirn, in meinen Augen. Ich blinzel. Epona ist tot. Ich hab sie getötet. Saabaa. Saaabaaa.
Mein Name flüstert um mich her. Ich dreh mich um, guck. Nichts. Niemand.
»Wer ist da?«, frag ich.
Sabaaa. Es ist der Wind. Die Windhosen. Das ist alles. Beruhig dich. Ziel. Schieß den Windspringer ab. Er ist nur noch ein paar hundert Schritte weit weg.
Ich pack die Armbrust fester. Das Zittern wird schlimmer. Es ist genau wie vorher. Genau wie letztes Mal. Und das Mal davor. Jedes Mal, wenn ich versuch zu schießen.
Dann.
Merk ich:
Mein Atem.
Brust eng.
Kehle trocken.
Kann nicht atmen.
Brauch Luft.
Tiefe Atemzüge.
Ich kann nicht, ich –
– kann nicht
atmen,
kann nicht
atmen.
Auf den Knien, auf dem Boden, Kehle zu, Herz rast, viel zu schnell.
Luft.
Luft.
Kann nicht atmen, kann nicht sehen, kann nicht –
Nero.
Kreischt.
Nero.
Warnt mich.
Gefahr.
Gefahr.
Gefahr.
Ich heb den Kopf. Alles ist … verschwommen.
Dann. Seh ich etwas. Es bewegt sich. Und zwar schnell. Ich kneif die Augen zusammen. Versuch zu erkennen, was es ist, was –
»Wolfshunde«, sag ich.
Ein Rudel Wolfshunde ist dem Windspringer hart auf den Fersen. Sie sind zu sechst. Nein. Zu acht. Wo kommen die her?
Das Rudel teilt sich auf. Sechs Wolfshunde bleiben dem Springer auf den Fersen. Sie jagen ihn nach Süden, über das Ödland. Die Windhosen wirbeln hinter ihnen her.
Zwei Hunde scheren aus. Zwei Hunde kommen auf mich zu. In meine Richtung.
Sie riechen mich. Sie riechen meine Schwäche.
Tief drin, in meinem Bauch, flackert die rote Hitze auf. Aber sie ist schwach. Ein schwacher Funke, wo ich eine lodernde Flamme brauch, ein glühendes Feuer, das mich rettet. Die rote Hitze rettet mich … immer.
Ich rappel mich hoch. Ich atme schwerfällig. Meine Hände zittern, aber ich … kann das, ich kann – der Bogen fällt mir aus den Händen. Auf den Boden. Das Flackern ist weg. Die rote Hitze. Weg.
Ich bin hilflos. Verzweifelt. Allein.
Nein. Nicht ganz.
Nero kreischt wütend. Er greift die Wolfshunde an. Stößt auf ihre Köpfe runter. Aber sie rennen weiter. Sie sind nur noch fünfzehn Meter weg. Zehn.
Beweg dich, Saba. Tu was! Irgendwas! Ich taste nach Steinen, Kieseln, Zweigen.
Nero verlangsamt sie. Er stößt runter, reißt eine Wunde, zieht sich zurück. Immer und immer wieder. Sie schnappen nach ihm. Schlagen mit den Pfoten nach ihm. Eine Wolke aus Federn und Staub. Kreischen und Knurren. Sie werden ihm wehtun. Ihn töten.
»Nero! Nero!«, schrei ich. Ich hab Steine in den Händen. Werf sie, werf sie doch! Nein, nein, ich könnt Nero treffen. Staub und Durcheinander. Ich kann nichts erkennen.
Mein Atem, ich kann wieder leichter atmen. Das, was mich im Griff gehabt hat, lässt langsam los. Aber ich bin schwach. Zittrig. Nero löst sich von den Wolfshunden. Ich lass die Steine fliegen. Aber ich werf daneben. Die Wolfshunde kommen auf mich zu. Drei Meter. Zwei.
Ein Hund vor mir. Einer links von mir. Kalte Hitze in ihren dumpfen gelben Augen.
Nero kreischt und kreischt. Er stößt runter. Sie ducken sich.
Ich schrei und schrei. Schleudere Kiesel und Erde. Ich werf, sie zucken zurück, aber sie lassen sich nicht vertreiben. Plötzlich fällt mir das Messer in meinem Stiefel ein. Ich greif danach. Meine Hände. Meine Hände zittern.
Ganz langsam rücken sie näher. Die Augen fest auf mich gerichtet. Ein Grollen tief in ihren Kehlen kündigt meinen Tod an.
Dann, hinter mir, aus dem Nichts, ein Geräusch und ein Ansturm. Bevor ich mich rühren kann, springt was an mir vorbei.
Eine graue Gestalt. Groß. Zottelig. Noch ein Wolfshund. Ein neuer.
Dieser neue Wolfshund stürzt sich auf den Hund links von mir. Geht ihm direkt an die Kehle und wirft ihn um. Reißt ihm den Hals auf. Als Blut strömt, greift der andere Wolfshund, der gleich vor mir, den neuen an. Zähne blitzen auf. Staub fliegt auf.
Ich krabbele aus dem Weg.
Der neue Wolfshund ist nicht mit den anderen gerannt. Er ist ein Einzelgänger. Er hat blaue Augen. Hellblaue Augen.
Das ist selten. So einen hab ich erst einmal vorher gesehen. Und er ist in schlechter Verfassung. Klapperdürr, mattes Fell, und jetzt eine blutende Wunde an der Flanke. Aber er kämpft wie der Teufel.
Denk nach, Saba. Ich brauch Hermes. Falls sich eine Gelegenheit ergibt … falls sich eine Gelegenheit ergibt, ergreif ich sie. Ich werd alles tun, um davonzukommen, aber ich brauch Hermes hier.
Nein, nein, warte, das geht nicht, die Hunde könnten sich auf ihn stürzen. So verwirrt. Kann nicht klar denken. Beweg dich, Saba. Beweg dich doch! Ich weich langsam zurück, geh hoch Richtung Hügelkamm. Die Hunde, die sich da zerfleischen, diesen Kampf auf Leben und Tod, lass ich nicht aus den Augen.
Über uns kreischt Nero.
Ein loser Stein. Ich rutsch aus. Ich stolpere. Geh zu Boden.
Und ich rutsche. Purzel. Stürze.
Den Hang wieder runter.
Genau auf die Wolfshunde zu.
Ich lieg auf dem Rücken. Auf hartem flachem Fels. Auf heißem Fels, der in der Hitze brutzelt und mich regelrecht kocht. Alle Knochen tun mir weh. Meine Augen sind schwer. Trocken. Ich mach eins halb auf. Zu hell. In meinem Hinterkopf pocht ein dumpfer Schmerz.
Ich stöhne.
Nero krächzt. Ich fühl sein Gewicht auf meinem Bauch. Und ich rieche Hundeatem, er riecht nach Fleisch, heiß und nah. Eine raue Zunge leckt mir übers Gesicht. Meine Augen springen auf. Der blauäugige Wolfshund steht über mir.
»Aahhh!« Ich krabbele weg und spring auf. Nero flattert kreischend in die Luft. Der Hund weicht winselnd zurück. Bleibt stehen. Setzt sich knapp zwei Meter von mir entfernt hin. Die lange rosa Zunge hängt ihm aus dem Maul und tropft. Ich runzel die Stirn. Ist das – lächelt der mich an? Jetzt fällt mir auf, dass ein Ohr runterhängt. Das rechte.
Blaue Augen. Ein runterhängendes Ohr. Genau wie bei Tracker. Mercys Wolfshund Tracker. Aber … wie kann das sein? Von Mercys Haus in Crosscreek bis hierher dauert es bestimmt mehrere Wochen.
»Tracker?«, frag ich.
Er steht auf. Bellt zweimal. Kommt ein paar Schritte auf mich zu. Nero sitzt auf einem Felsen in der Nähe und krächzt.
»Tracker! Omeingott, Tracker, du bist es! Was tust du –«
Ein Pfeil schwirrt durch die Luft. Ich duck mich. Tracker rast davon. Der Pfeil verfehlt seine linke Flanke nur knapp. Ich seh mich nach dem Schützen um.
Es ist Lugh. Er steht auf dem Kamm über mir und hat schon wieder einen Pfeil eingelegt.
»Nein!«, schrei ich. »Warte! Nicht schießen!«
Zu spät. Dann hüpft Lugh den Hang runter, brüllt und wedelt mit den Armen. Der Pfeil prallt von einem Fels ab.
Und ich brülle: »Lugh, hör auf! Alles ist gut! Nicht schießen!«
Und Nero fliegt über uns hin und her, kreischt und zetert.
Und Tracker ist weg. Ich kann ihn übers Ödland flitzen sehen.
»Verdammt«, sag ich. »Au!« Ein stechender Schmerz in meinem Hinterkopf. Ich taste ihn ab und finde eine ganz ordentliche Beule.
Dann erstarre ich. Zwei Wolfshunde, nur ein paar Meter weg. Jedenfalls das, was von ihnen übrig ist. Es sind die, die mich angegriffen haben. Sie liegen in Pfützen aus ihrem eigenen Blut. Beide haben aufgerissene Kehlen. Die Zähne sind gefletscht, die gelben Augen sehen sogar tot wütend aus. Jetzt hör ich ein hungriges Summen. Fliegen. Hunderte. Tausende. Die offenen Wunden, die halb getrockneten Pfützen aus klebrigem Blut wimmeln von glänzenden Körperchen.
Tracker hat das getan. Tracker hat die Wolfshunde getötet. Er hat mir das Leben gerettet.
Tracker. Hier. Das versteh ich nicht.
»Saba!« Lugh kommt angerannt, die Armbrust in der Hand. Er keucht. Erleichterung und Sorge und Ärger, alles auf einmal, huschen über sein Gesicht. »Saba, alles in Ordnung?«
»Ja«, sag ich. »Mir geht’s gut, danke.« Aber dabei denk ich: Tracker hier. Allein im Ödland. Also … heißt das, dass Mercy in der Nähe ist? Nein, kann nicht sein … Tracker hat furchtbar ausgesehen, so dünn und struppig. Sie würde ihn nie so herunterkommen lassen. Also, was ist los? Wie kommt er hierher? Und wo ist Mercy? Die zähe, kluge Mercy. Was ist ihr zugestoßen?
»Wie meinst du das, dir geht’s gut? Saba!« Lugh packt mich am Arm und schüttelt mich. »Saba, was zum Teufel ist hier passiert?«
»Das ist Tracker gewesen«, sag ich. »Der Wolfshund, auf den du gerade geschossen hast. Das ist Tracker. Omeingott, Lugh, er hat mir das Leben gerettet.«
»Wer?« Er guckt verständnislos.
Dann fällt mir wieder ein, dass Lugh nicht mit Emmi und mir bei Mercy in Crosscreek gewesen ist. Das war ja, nachdem die Tonton ihn gefangen hatten. Also kennt er Tracker nicht. »Tracker«, sag ich. »Er ist Mercys zahmer Wolfshund. Du weißt doch? Mercy, Mas Freundin … aus Crosscreek.«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














