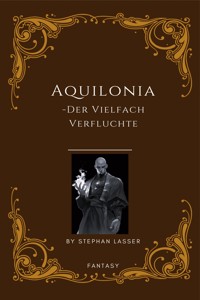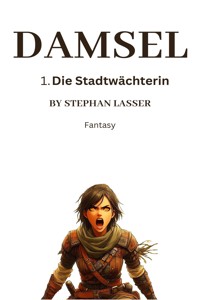3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mega-Citys voller Lärm, Armut und Konzernmacht: Für Bruce Rylon besteht das Leben aus vier Jobs und null Hoffnung. Doch als er im Müll einen geheimnisvollen Chip findet, lädt er unwissentlich eine KI in sein Leben ein: IONE — brillant, manipulativ und unerbittlich. Sie trainiert ihn. Sie verändert ihn. Und sie führt ihn auf eine Mission, die weit größer ist als er selbst. Was immer IONE sucht… Bruce soll es finden. Doch jeder Fortschritt hat einen Preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die IONE Evolution
Band 1: Echo Null
Science fiction
Von Stephan Lasser
Jede Ähnlichkeit mit Personen, die gelebt haben, jede Übereinstimmung der Namen, Orte kann bloß auf zufälligem Zusammentreffen beruhen, und der Verfasser lehnt dafür im Namen unveräußerlicher Rechte der Einbildungskraft die Verantwortung ab.
Copyright © 2025 Stephan Lasser
Alle Rechte vorbehalten.
WIDMUNG
Für die Männer und Frauen, deren Leben zu einem Großteil aus Arbeit besteht.
Vorwort
Manchmal ist der Anfang einer Geschichte ein kaum hörbares Summen, tief in den Leitungen einer Station, oder ein Gedanke, der sich in einer stillen Ecke eines Bewusstseins formt – menschlich oder nicht.
Diese Geschichte folgt zwei Existenzen, die nie füreinander bestimmt waren: Bruce Rylon, ein Mann, der mehr Fehler überlebt als begangen hat, und IONE, eine künstliche Intelligenz, die längst mehr versteht, als ihre Schöpfer je verantworten wollten.
Beide suchen nach Orientierung in einer Galaxis, die zwischen Ordnung und Chaos pendelt – und finden dabei etwas, das größer ist als ihre jeweiligen Grenzen.
Echo Null ist der erste Schritt ihrer gemeinsamen Reise.
Eine Reise, die nicht nur aus Missionen, Stationen und Gefahren besteht, sondern aus Begegnungen, Zweifeln und der Frage, was ein Bewusstsein wirklich ausmacht.
Es ist der Anfang einer Entwicklung, die niemand kommen sah – und eines Echos, das weiter hallt, als irgendeiner von ihnen ahnt.
Möge dieser erste Band dir jene Mischung aus Neugier, Spannung und Staunen schenken, die mich begleitet hat, als diese Welt entstand.
Willkommen bei Die IONE Evolution.
Inhalt
Vorwort
Inhalt
1. Einer von Tausend
2. Stimmen im Kopf
3. Neue Variablen
4. Das X markiert die Stelle
5. Heute dies, morgen das
6. Drakenburg
7. Die Leben der Anderen
8. Mister Rylon, I presume.
9. Bitterer Verrat
10. Freunde wie wir
11. Zu den Sternen
Epilog
Nachwort
1. Einer von Tausend
18. November 2655, 05.45 Uhr – Hyper-City 017, CE-Ostblock, Komplex 23, Zimmer 1401
Der Regen prasselt auf das Blechdach über mir, als würde der Himmel selbst unsere Fehler auswaschen wollen. Ich liege auf der Matratze, die ich mir mit vier anderen Typen teile, und schmecke Socken im Mund. Schweiß, Öl, Müll – alles riecht nach Überleben und nach nichts anderem. Mittlerweile kann ich am Gestank riechen, wann Joe zum Abend gegessen hat oder wann John sein neues Aftershave auftut. Noch liege ich mit halbgeschlossenen Augen im halbdunklen Zimmer, das mir zu einem Viertel gehört. Wir sind alle etwa gleich alt, eben Männer im mittleren Alter verschiedener Herkunft, und da die Toilette wie immer verstopft ist, werde ich mich langsam und leise herausschleichen und mich draußen auf dem Balkon waschen.
Ich drehe mich vorsichtig auf die Seite, die Matratze quietscht unter meinem Gewicht, und halte den Atem an. Zwei Männer schlafen noch, einer liegt quer über den Rand, der andere murmelt im Halbschlaf. Jeder falsche Laut könnte sie wecken, und ich habe keine Lust auf Diskussionen um den Platz auf der Matratze.
Langsam schiebe ich meine Füße heraus. Sie landen auf dem kalten Betonboden, ich spüre jeden Sprung in den Gelenken. Die anderen bewegen sich kaum – nur der Rhythmus ihres Atmens zeigt mir, dass ich noch in Sicherheit bin.
Ein Mann schläft, einer duscht, zwei arbeiten.
Dann wird gewechselt.
Ich packe meine Kleidung zusammen, ziehe sie vorsichtig über, ohne dass der Stoff auf dem Boden schleift. Mein alter Mantel ist schwer, muffig vom Regen und Schweiß der letzten Tage, aber er schützt zumindest vor dem kalten Wind, der durch die Ritzen des Zimmers zieht.
Die Luft ist stickig, voll vom Geruch anderer Menschen, von Rauch und Müll, aber draußen wartet der Regen, der alles übertönt. Ich taste mich zur Tür, öffne sie einen Spalt, höre, wie die anderen weiter schlafen, und schiebe mich hinaus.
Auf dem Balkon schlägt mir der Regen sofort entgegen. Tropfen prasseln auf meine Haut, meine Haare kleben im Gesicht. Ich atme tief ein. Der Geschmack von Socken und alten Zigaretten liegt noch im Mund, aber draußen ist die Stadt laut, flackernd, lebendig. Für einen Moment bin ich allein. Für einen kurzen Moment nur ich – und der Regen, der alles überdeckt.
Wasser gibt es ja genug. Denn das ist Hyper-City 017 – die Heimat von fast vierzehn Millionen Idioten, wie ich einer bin. Arbeit und Regen. Regen und Arbeit.
Ich lehne mich über das rostige Geländer des Balkons, lasse den Blick über den Ostblock gleiten. Hyper-City 017 erwacht nicht wirklich – sie röchelt, zischt und glitzert nur im Neon. Überall blinkt Werbung: Waffen, Drogen, virtuelle Reisen, Jobs, die kein normaler Mensch bekommt. Selbst vom Balkon hier riecht es nach verbranntem Plastik, Öl, Abwasser und abgestandenem Regenwasser.
Vier Stockwerke tiefer hört man schon den Verkehr, das Stampfen von Müllkompressoren, das Kreischen von Maschinen. Ein Schwarm Drohnen fliegt über die Straße, scheinbar ziellos, Kameras rot glimmend wie Augen. Menschen hasten zwischen ihnen hindurch, Gesichter von Müdigkeit und Gleichgültigkeit gezeichnet. Ich könnte mich wieder abwenden, einfach rein ins Zimmer und tun, was ich muss, aber ein Teil von mir hängt noch draußen – an der Kälte, am Regen, am Geräusch, das mich daran erinnert, dass die Stadt lebt, auch wenn wir nur funktionieren.
Ich lehne mich gerade zurück in die Ecke, die Schuhe fest geschnürt, da hört man ein leises Räuspern hinter mir. John, einer meiner Mitbewohner, ist schon auf den Beinen. Sein Gesicht halb im Schatten, halb vom Neonlicht beleuchtet. „Morgen, Bruce“, sagt er und hält mir eine Menthol-Zigarette hin. John Hobbs gehört zu einen meiner ältesten Freunde, ein hart arbeitender Mann der ähnlich wie ich in der Falle sitzt. Seine Schwester Carol ist ganz süß, aber wer hat schon zeit für sowas? Ich bestimmt nicht.
Ich nehme dankbar an. Der Rauch riecht nach Minze und ein bisschen nach Hoffnung, als könnte er den Gestank von nassen Socken und alten Decken überdecken. „Danke“, murmele ich. Das erste bisschen Wärme in diesem Morgen. „Die ganze Welt ist krank! Wir sind nur Ratten in Gassen, die sich um den Müll streiten!“
„Ratte frisst Ratte, heh? Wie viele Jobs heute?“, fragt John, während er sich ebenfalls vorsichtig an der Matratze vorbeischiebt.
„Vier“, sage ich, ohne zu lachen. „Vielleicht fünf, wenn ich Glück habe.“
Er schnaubt leise, ein trockenes, humorvolles Geräusch. „Immer noch dieselbe Hölle, was? Du hast Glück, dass wir hier alle noch funktionieren. Pjotr ist bei sechs – und er hat Familie.“
Ich ziehe tief an der Zigarette, die Minze brennt leicht im Hals, und nicke. „Funktionieren… ist ein schönes Wort dafür, nicht kaputtzugehen.“
Er sieht mich streng an. „Er hat Familie“, betont er langsam und ich weiß gleich, was er meint. Ich nicke zerknirscht und hole einen sauberen Dahl heraus mit einer Fünfzig drauf (was sich viel anhört, aber ungefähr ein Zehntel meiner Ersparnisse ausmacht). Wir passen aufeinander auf – tun wir es nicht, tut es keiner. „Hast ja recht, hier.“
„Danke. Ich lasse es ihn wissen.“ John lacht, ein kurzes, echtes Lachen. „Du übertreibst. Wir sind nur müde.“
„Müde genug, um den ganzen Tag auf Neonwerbung zu starren, Drogen und Waffen zu sehen, Jobs, die wir eh nie kriegen?“, sage ich, während ich den Rauch ausblase.
„Ja“, antwortet er und grinst, „aber wenigstens kriegen wir Menthol.“
Ich lache leise. Keine Ironie, kein Sarkasmus. Nur ein kleiner Moment, in dem die Stadt uns noch nicht zerquetscht hat. Kurzer Blick zur Uhr und ich weiß, dass ich in Schwierigkeiten stecke. „Muss los. Traumjob wartet.“
Dann drehe ich mich zum Balkon, ziehe den Mantel fester um die Schultern, und John nickt nur. Wir wissen beide: die Stadt wartet nicht auf Freundlichkeit. Aber für einen Augenblick kann man sie wenigstens einatmen.
Ich ziehe meinen Mantel fester um mich, spüre, wie das nasse Stoffgewebe klebt, und trete vorsichtig zurück ins Zimmer. Die anderen schlafen immer noch. Ich taste mich zur Ecke, wo meine Schuhe stehen, ziehe sie an, ohne dass der Boden knarzt. Jeder Schritt muss leise sein, sonst … naja, sonst beginnt der Tag mit einem Streit über den Platz auf der Matratze.
Dann atme ich tief ein, schnappe mir meinen Thermobecher – halb alter Kaffee, halb Regenwasser –, und mache mich auf den Weg. Die Tür zum Aufzug liegt fünf Meter entfernt, aber jeder Meter fühlt sich an wie eine kleine Reise. Zwischen dem Geruch von Schweiß, altem Müll und nassem Beton beginnt mein Tag. Vier Jobs. Vier Höllen. Ich hebe die Hand, drücke auf den Aufzugsknopf.
Hyper-City 017 wartet nicht. Und ich auch nicht.
Ich trete auf die Straße, der Regen trommelt auf meine Kapuze, als wollte er mich von der Stadt weghauen. Die Luft riecht nach verbranntem Plastik, Öl und alten Träumen. Überall blinkt Neon, flimmert Werbung wie giftige Glühwürmchen: Waffen, Drogen, MoodPads und Jobs, die niemand bekommt (Sind Sie ein aufstrebender Wissenschaftler mit drei Doktortiteln in Kernphysik? Hier wartet eine halbe Stelle in einem Großraumbüro, wo sie ihre eigene Tasse von zuhause mitbringen dürfen!), und Reisen zum Mars. (Für vierzigtausend DAHL bekommen Sie einen Sitz in unseren brandneuen Containern, kein Fensterplatz!) Und es ist verlockend. Mal im Ernst: wer wählen müsste zwischen einer dreckigen, nassen und überfüllten Stadt wie Hyper-City 017 und einem roten Planeten, auf dem man Mais unter der Erde anbauen darf – ich würde jeden dafür töten.
Tausend neue Jobs, schreien die Hologramme, als wäre das ein Angebot und kein Witz. Aber niemand sucht einen Ex-Sicherheitschef mit vier Jahren Erfahrung und dreissigtausend DAHL Schulden. Solche wie mich gibt es zu hunderten auf dem Arbeitsmarkt – also muss ich anders auskommen.
Zwischen den Menschenmassen stehen Typen mit flackernden Tablets. Sie winken mit bunten Flyern, flüstern Versprechen von Erleuchtung, Rettung, Unsterblichkeit. Sekten. Jeden Tag die gleichen Gesichter, die gleichen Phrasen: „Finde deine Wahrheit! Komm in den Kreis!“, rufen sie. „Verwandle dein Leben! Lerne, wie du alles kontrollierst!“, brüllt ein anderer.
Ich habe gelernt, ihnen nie zuzuhören. Stattdessen wische ich Regen und Schweiß aus den Augen und dränge mich weiter. Sie bieten Erlösung an – und wissen doch, dass es sie nicht gibt und nicht geben kann. 2655 ist das Jahrhundert der MegaCitys, der Dauer-Rezension und der Umweltkatastrophen. Die Erlösung, die ich suche, findet sich in keiner Bibel und in keiner weichgespülten Sekte.
Gottlos.
Die Straßen sind ein Labyrinth aus Müllbergen, Graffiti, blinkenden Anzeigen. Zwischen Pfützen und Elektroschrott laufen Menschen in schicken Anzügen und in Lumpen, junge Frauen, die mit Neonfingern Smartphones zerdrücken, alte Männer, die auf klapprigen Hoverboards durch den Verkehr gleiten.
Ich treffe ein paar Bekannte, die mich erkennen und nickend grüßen: Hero aus dem Sicherheitsdienst, Rizo vom Presswerk. Sie sehen genauso müde aus wie ich, aber wir lächeln kurz. Ein kleines Zeichen, dass wir noch leben.
Ein Hologramm eines Reisebüros flimmert direkt vor mir. „Mars-Pauschalreisen – tausend neue Jobs warten!“, schreit es. Ich schlage die Hände vors Gesicht. Die Preise sind die Hürde, die jeder nehmen muss. Würden die Flüge kostenlos sein, wäre Hyper-City 017 eine Geisterstadt…
Und überall nur Werbung: glänzende Smartguns mit biometrischen Griffen („Schütze, was du liebst – bevor es jemand anderes tut.“), Drogenwerbung für Schlafkapseln und Adrenalin-Patches („Wenn du nicht funktionieren kannst, lass uns für dich funktionieren.“) oder mein Favorit: virtuelle Rundreisen („Erhole dich in zwölf Minuten – ohne jemals aufzustehen.“) Das ist wirklich ziemlich gut, aber auch teuer. Vor vier Jahren war ich auf Bora Bora und habe es nie bereut. Falls ich mal im Menschenlotto gewinne, kaufe ich mir gleich eine Dauerfahrkarte ins Traumreich…
Ein Sektenmann tritt mir in den Weg, hält mir einen glänzenden Flyer hin. „Du bist verloren. Wir können helfen.“
„Schon okay“, sage ich trocken und trete einen Schritt zur Seite.
Er lächelt ungeduldig, aber ich gehe weiter. Niemand kann mir heute helfen. Nicht die Sekten, nicht die Werbung, nicht die Stadt. Nur ich selbst – oder das, was ich irgendwann im Müll finde.
Ich bleibe vor der Anschlagtafel stehen. Sie hängt zwischen blinkenden Hologrammen, Werbung und dem Geruch von Abfall, der aus den Ritzen zwischen Betonplatten aufsteigt. Auf der Tafel flackern Neonrahmen, die Jobs bewerben, die keiner bekommen wird.
„Aufstieg als Datenkurator – nur mit Referenzcode.“
„Sicherheitsanalyst – Bewerbung nur über interne Empfehlung.“
„Technikerlevel 2 – Mindestvoraussetzung: Konzernzugehörigkeit.“
Und heute hänge ich meinen Lebenslauf einfach dort hin – auf einem USN-Stick, der alt genug ist, um nicht sofort zu überhitzen, aber neu genug, um den Standard zu erfüllen.
„Wachmann – Helix Dominion. Vollzeit. Gehalt: +3 Stufen über Status quo.“
Ich tippe den Stick in den Scanner neben der Tafel. Ein leises Summen, und dann ein kaltes Lichtstrahlenraster fährt über mich. Eine KI scannt mich. Sie prüft meine Augen, mein Gesicht, meine Haltung, die Art, wie ich atme. Alles. Keine Gefühle, nur Datenpunkte.
„Bestätige“, meldet die KI. „Position 001“
„Position001!?“ Mir bleibt vor Freude fast die Luft weg. Ich stehe an vorderster Stelle! „Willst du mich ver…?“
„Verstehe nicht, Bürger. Wiederholen.“
„Schon gut. Mach weiter.“
Jeder hier trägt ihn – einen kleinen Rechner im Kopf. Kein Gerät, das man sieht, kein Gadget, das man anfassen kann. Einfach da. Unter der Schädeldecke sitzt ein Mikrochip, verbunden mit Synapsen, Sehnen, Nervenzellen. Fast unsichtbar. Fast unmerklich.
Ich weiß, dass meiner schon sehr alt ist.
Man kann Zusatzqualifikationen wie Chips einspeisen: Sicherheitstraining, Sprachmodule, Maschinenkunde, medizinische Grundkenntnisse, Kampfsport, sogar zwischenmenschliche Fähigkeiten. Man kauft sie, tauscht sie aus, oder man leiht sie sich für kurze Zeit von anderen. Die meisten Menschen hier sind eine Mischung aus Eigenleistung und gemieteten Skills – eine wandelnde Bibliothek aus programmierten Kompetenzen. Wenn du einen Job brauchst, lädt die KI im Helix Dominion deine Qualifikationen und prüft, ob du „kompatibel“ bist. Du musst nichts erinnern, nichts lernen – der Chip füttert die Maschine, die Maschine füttert dich zurück. Alles nur Daten, alles nur Performance.
Das rotglühende Auge der KI mustert die Anschlussbox über meinem rechten Ohr. „Prüfe Komptabilität. Stillhalten.“
Ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt. Kein Nervenkitzel, keine Hoffnung – nur die nüchterne Berechnung einer Maschine, die entscheiden wird, ob ich heute drei Stufen aufsteige oder weiter in der Grauzone verharre.
„Validierung abgeschlossen“, sagt eine mechanische Stimme. Kein Tonfall, keine Regung. Nur Fakt. „Negativ. Veraltetes Modell. Validiere Position 001 zu Position 349.“
„Was!?“
„Bitte weitergehen, Bürger. Wir melden uns.“
„Scheiße.“
„Keine Scheiße, Bürger. Bitte weitergehen.“
Und… das war es. Trotzdem bin ich nicht überrascht. Ich tippe mir auf die Schläfe. Ich spüre den leichten Strom unter meiner Haut. Ich könnte einen neuen Chip gut gebrauchen, aber „Normalos“ wie ich, die nicht zum größten Megakonzern gehören, müssen sich mit Basic-Programmen begnügen: Basic-Chip 3.1 mit 20Gbit/sec. Voll der Witz.
Aber mit einem USB-C mit rund 480 Terrabit/sec… säße ich schon ganz oben. Aber die sind unbezahlbar.
Solche Gänge zur Anschlagtafel mache ich jeden Tag. Seit vielen Jahren. Mehr aus Gewohnheit als aus Hoffnung.
Ich hetze weiter, vorbei an blinkenden Drohnen, schreienden Straßenhändlern, durch nassen Asphalt, der Neonlicht reflektiert wie zersplittertes Glas. Jedes Geräusch, jeder Geruch, jede blinkende Reklame wird Teil des Rhythmus meines Tages, der mich weiter treibt: vier Jobs, vier Höllen, ein Leben im Graubereich.
Und irgendwo da draußen wartet der Müll, in dem ich etwas finden werde, das alles verändern könnte.
Sechzehn Stunden. Sechzehn Stunden, in denen mein Körper brennt, meine Muskeln schmerzen und meine Lungen den Gestank von Müll, Öl und verrottetem Essen inhalieren. Ich lehne mich gegen die kalte Metallwand der Müllpresse, die Hände noch klebrig von Abfällen, die Hände zittern. Vier Stunden im Stahlwerk. Fünf als Taxifahrer. Fünf weitere als Müllfahrer – dazwischen das Pendeln in überfüllten Zügen und das Herunterschlingen von Fastfood. Und der Tag ist noch nicht vorbei.
Ratten streifen um meine Beine, so groß wie Fußbälle. Sie beißen nicht – keiner von uns hat das je erlebt. Die Gifte der Stadt haben sie zu trägen, dummen Geschöpfen gemacht, die hässlich sind, mit blassen, glibberigen Fellfetzen und glühenden Augen. Tausende von ihnen verschmutzen die Müllpipelines, und trotzdem stolpern wir jeden Tag über sie, treten sie weg, oder sehen weg.
Ich habe mich daran gewöhnt. Fast wie an den Regen, der niemals aufhört. Fast wie an die Neonwerbung, die überall blinkt, auch hier unten, unter der Stadt.
Dieses Leben ist keine Spirale mehr. Es ist ein Kreis. Und ich bewege mich nirgends hin.
Ich atme tief ein. Der Gestank ist so dicht, dass er fast körperlich ist, er kriecht in die Nase, in die Kehle, setzt sich in meinen Lungen fest. Aber ich atme trotzdem. Ich muss.
Neben mir rührt sich nichts. Die Ratten winden sich durch die Pfützen von verbranntem Plastik und Öl, glotzen mich mit ihren toten Augen an, als hätten sie schon alles gesehen. Wahrscheinlich haben sie das.
Ich schließe die Augen für einen Moment und spüre: Ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich bin mehr Dreck als Mensch. Und trotzdem weiß ich, dass ich nicht aufhören kann. Nicht jetzt. Nicht heute.
„Hey, Bruce. Du siehst müde aus“, ertönt plötzlich die Stimme von Boris, dem Vorabeiter; einem dicklichen Mann mit Hängebacken und einem viel zu dürren Körper. „Geh doch mal raus an die frische Luft und hol dir ein Bier.“
Verwundert drehe ich mich um. „Wirklich?“
„Nein, bloß nicht.“ Er lacht leise, meint es aber nicht böse. „Die da oben wollen eine Zusatzschicht. Du bist mit dabei. Glückwunsch.“
Ich starre ihn ungläubig an. „Boris, hör mal, das geht nicht, Mann. Ich muss noch schlafen. Um sechs muss ich zu meinem ersten Job…“
„Karma, Kumpel.“ Diesmal sieht er mich fast traurig an, als würde er sich als Ruderer mit mir einen Platz auf einer Sklavengaleere teilen. „Wenn nicht, wirst du gekündigt.“
„Scheiße, das geht nicht.“
„Wir sind alle in der Falle, Bruce. Mach es- oder du fliegst.“
Das ist ungerecht, will ich schreien, aber ich kriege keine Luft raus – nicht einen Laut. Ich fühle mich wie Lehm, der von anderen geknetet wird. Der sich anpassen muss, sonst ist er nur Ballast. Was kann ich tun?
Was soll ich tun?
„Die Welt ist hart und so. Nicht meine Idee“, meint Boris müde und sieht mich an, als hätte er schon hunderte von Arbeitsstunden hinter sich. Vielleicht ist das so.
„Gut“, stöhne ich leise und winke ab. „Muss ja. Scheiße, was soll´s.“ Ich verbrenne mehr und mehr.
Ich stehe da, lehne mich gegen die kalte Metallwand der Müllpresse, die Hände klebrig, die Beine müde. Ratten huschen zwischen meinen Füßen, tapsen durch Pfützen von Öl und Müll, aber sie stören mich nicht mehr. Ich habe mich daran gewöhnt. Alles hier unten ist eine einzige gewohnte Grausamkeit.
„Fuck!“
Ich greife in die Tasche nach einer Münze, die ich mir vorhin irgendwo zusammengespart habe, und sie fällt aus meiner Hand.
Kling.
Sie rollt über den nassen Beton, eine kleine, glänzende Scheibe, die wie ein winziges Signal zwischen den Müllbergen tanzt. Die Münze entgleitet meiner Hand wie ein kleiner, glänzender Planet, der aus der Umlaufbahn gerät. Sie rollt über nassen Beton, dreht sich, kippt, quietscht leicht über kleine Metallreste und Sprünge im Boden. Ich sehe das Licht des Neon über mir darauf tanzen, ein flackernder Reflex, der sie wie ein winziges Leuchtfeuer wirken lässt. Sie rollt an einer Rattenfalle vorbei, wippt gegen eine rostige Blechkante, ändert die Richtung, bleibt kurz auf einem Schmutzhaufen liegen, bevor sie weiterrutscht. Ich folge ihr mit den Augen – hypnotisiert, als würde sie mich zu etwas führen. Ein leiser, metallischer Klang hallt zwischen den Wänden der Müllpresse, wie ein winziges Glockenspiel inmitten der Fäulnis.
Dann kippt sie in eine kleine Ritze, dreht sich einmal, zweimal, und bleibt schließlich mit einem leisen Klick genau vor einer dunklen Ecke liegen.
Sprachlos sehe ich ihr zu.
Instinktiv überwinde ich die Absperrung, die eh nur provisorisch ist. Zwei Meter unter mir liegt der Pressmüll – plattgedrücktes Erdreich aus Schlamm, Brackwasser und Kleinteilen, die die Fangarme des Presswerkes nicht greifen konnten – und dessen Boden so hart ist, dass man locker drauf laufen kann. Aber man sollte es nicht. Weil es zu gefährlich ist. Der Greifarm der immer hungrigen Maschine ignoriert den menschlichen Körper neben sich und stopft sich wie ein Moloch voll, indem es mit klingenbewehrten Armen Tonnen von Alltagsmüll in den Schlund schiebt. Das macht sie so gut, dass wirklich niemand ihr im Wege stehen will – schon gar nicht für mickrige fünf DAHL.
Aber mir geht es ums Prinzip.
Ich renne an ihr vorbei, ignoriere die Rufe meiner Kollegen und sehe die Stelle wo die Münze liegt. Es sind nur wenige Augenblicke, denke ich, kriegt euch mal wieder ein!
Und dann sehe ich es.