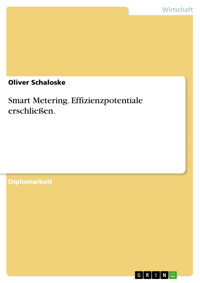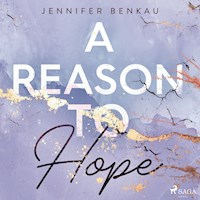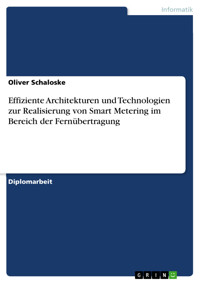
Effiziente Architekturen und Technologien zur Realisierung von Smart Metering im Bereich der Fernübertragung E-Book
Oliver Schaloske
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Berlin früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Umsetzung des Projektes Smart Metering stellt die betroffenen Parteien vor gewaltige Herausforderungen. Verschiedene Interessengruppen arbeiten an Lösungsansätzen für den Datenverkehr und das Data-Management im Zuge des Smart Metering. Gerade bei der Wahl eines geeigneten Übertragungsmediums gibt es eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Doch gibt es eine optimale Lösung? Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedenste Übertragungstechniken einander gegenüberzustellen, um Aussagen darüber treffen zu können, welche Lösungsansätze denkbar sind. Dazu werden unterschiedliche Szenarien entwickelt, die diese Ansätze ins Verhältnis zu äußeren Rahmenbedingungen setzen. So kann beispielsweise ein Lösungsansatz für ein dicht besiedeltes Gebiet anders geartet als für eine ländliche, sehr dünn besiedelte Gegend. Darüber hinaus werden mögliche Netzwerkarchitekturen in die Bewertung einfließen, das heißt welche Infrastruktur ist im jeweiligen Szenario denkbar und wie kann eine effiziente Übertragung der Daten erfolgen. Damit eine Bewertung der verschiedensten Technologien erfolgen kann, müssen konkrete Anforderungen definiert werden. Diese Anforderungen sollen durch ausgewählte Kennzahlen formuliert werden. Eine objektive Bewertung kann dann erfolgen, wenn diese Kennzahlen messbar und damit auch vergleichbar sind. Danach sind diese Kriterien durch ein geeignetes Entscheidungsmodell einander gegenüberzustellen. Folgende Teilziele sind demnach zu erreichen: 1. Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Identifikation von Kommunikationspartnern 2. Identifikation kommunikationsrelevanter Prozesse als Rückschluss aus der Konstellation der Kommunikationspartner 3. Ableitung von Anforderungen an ein mögliches Kommunikationsmedium 4. Formulierung von Umsetzungsszenarien 5. Analyse von Netzwerkarchitekturen und Übertragungsmedien in Bezug konkreter Anforderungen 6. Gegenüberstellung und Bewertung der Übertragungsmedien Diese Arbeit betrachtet die informationstechnische Ebene des Gesamtthemas. Gerade im Bereich Smart Metering gibt es sowohl politische, soziale und ökologische Aspekte, die der Autor in der Analyse der vorliegenden Daten ausschließt. Wertungen zu Marktrollen bzw. die Analyse der Beziehungen unter Marktpartnern werden ebenfalls kein Schwerpunkt dieser Arbeit sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Motivation und Rahmenbedingungen
1.2. Ziele und Abgrenzungen
1.3. Vorgehen
2. Smart Metering
2.1. Definition Smart Metering
2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen
2.2.1. EU-Richtlinien
2.2.2. Deutsche Gesetzgebung
2.3. Kommunikationspartner
2.3.1. Rollenverteilung
2.3.2. Sonderfall Deutschland
2.4. Basiselemente
2.4.1. Grundsätzlicher Systemaufbau
2.4.2. Grundlegende Datenstruktur
2.5. Konkretisierung des Zielsystems
3. Prozessanalyse
3.1. Implementierung einer Messstelle
3.2. Steuerungsprozesse
3.2.1. Fehlerbehandlung
3.2.2. Ein- und Ausschaltung
3.2.3. Störungsmeldung
3.3. Datenmanagementprozesse
3.3.1. Zählwertermittlung
3.3.2. Produktwechsel
3.3.3. Stammdatenänderung
3.3.4. Lieferantenwechsel
3.3.5. Wechsel des Messstellenbetreibers
3.4. Prozessauswertung
3.5. Anforderungen der Kommunikationspartner
3.5.1. Endverbraucher
3.5.2. Verteilnetzbetreiber
3.5.3. Messstellenbetreiber
3.5.4. Stromlieferant
3.6. Zielkennzahlen
3.6.1. Bandbreite
3.6.2. Latenz
3.6.3. Verzögerung-Bandbreite-Produkt
3.6.4. Signalreichweite
3.6.5. Verfügbarkeit
3.6.6. Flexibilität
3.6.7. Standardisierung
3.6.8. Sicherheit
3.6.9. Dienste
3.6.10. Kosten
4. Szenarioanalyse
4.1. Wichtige Einflussfaktoren
4.2. Urbanes Szenario
4.3. Ländliches Szenario
5. Architektur der Netze
5.1. Kriterien guter Netzwerkarchitekturen
5.1.1. Skalierbarkeit
5.1.2. Fehlertoleranz
5.1.3. Dienstgüte
5.1.4. Netzwerksicherheit
5.1.5. Aufwand
5.2. Strukturelle Grundgedanken
5.3. Existierende Netzwerkkonzepte
5.3.1. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
5.3.2. Frame Relay (FR)
5.3.3. Distributed Queue Dual Bus (DQDB)
5.3.4. Synchrone digitale Hierarchie (SDH)
5.3.5. Ethernet
5.4. Netzwerkentwurf
5.5. Datenmanagement
5.5.1. Meter Data Management System
5.5.2. Meter Management System
6. Fernübertragungstechnologien
6.1. Drahtlose Kommunikation
6.1.1. GSM / GPRS
6.1.2. UMTS / HSDPA
6.1.3. WiMAX
6.2. Drahtgebundene Kommunikation
6.2.1. Power Line Communication
6.2.2. Breitband PLC
6.2.3. DSL
6.2.4. Lichtwellenleiter
6.3. Zusammenfassung
7. Gegenüberstellung und Bewertung
7.1. Entscheidungsmodelle als Grundlage
7.2. Analytic Hierarchy Process
7.2.1. Beurteilungsskala und Gewichtung
7.2.2. Konsistenzprüfung
7.3. Ergebnis
7.4. Sensitivitätsanalyse
7.5. Handlungsempfehlung
8. Weitere Forschungsfelder
9. Schlussbetrachtung und Ausblick
Anhang A
Anhang B
Anhang C
Anhang D
Anhang E
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Abgrenzung Übertragungs- und Verteilnetz
Abbildung 2: Marktakteure auf dem deutschen Strommarkt™
Abbildung 3: Übertragungsstationen
Abbildung 4: Prozess der Zählerinstallation
Abbildung 5: Prozess Fehlerbehandlung
Abbildung 6: Prozess Ein-/Ausschaltung
Abbildung 7: Prozess Störungsmeldung
Abbildung 8: Prozess Zählwertermittlung
Abbildung 9: Prozess Produktwechsel
Abbildung 10: Prozess Stammdatenänderung
Abbildung 11: Prozess Lieferantenwechsel
Abbildung 12: Durchschnittliche Investitionen je Zähler in C
Abbildung 13: Bevölkerungsdichte Deutschlands
Abbildung 14: Struktur eines TK-Netzwerks
Abbildung 15: ATM-Netzwerk
Abbildung 16: DQDB-Netztopologien
Abbildung 17: Entwurf einer Netztopologie
Abbildung 18: Smart Metering Architektur
Abbildung 19: Vereinfachter Aufbau des GSM-Netz
Abbildung 20: Mögliche Übertragungskapazitäten bei GPRS
Abbildung 21: T-Mobile Netzabdeckung Deutschland
Abbildung 22: Elektromagnetische Störungen durch PLC
Abbildung 23: ADSL-Frequenzbänder
Abbildung 24: Prinzipieller Aufbau optischer Übertragungssysteme
Abbildung 25: Querschnitt einer Glasfaser
Abbildung 27: Entwicklungsstufen für Smart Energy Solutions
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: EDIFACT Nachrichtentypen
Tabelle 2: Identifizierte Prozesse
Tabelle 3: Angenommene Datenmengen
Tabelle 4: Entstehendes Datenvolumen eines Zählers pro Prozess
Tabelle 5: Gewicht der Prozesse bezogen auf das Datenvolumen pro Jahr
Tabelle 6: Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts
Tabelle 7: Mehrkosten/Einsparungen durch Smart Metering für die EVUs
Tabelle 8: Entwicklung Zähleranzahl im urbanen Szenario
Tabelle 9: Notwendige Bandbreiten im urbanen Szenario in kbit/s
Tabelle 10: Entwicklung Zähleranzahl im ländlichen Szenario
Tabelle 11: Notwendige Bandbreiten im ländlichen Szenario in kbit/s
Tabelle 12: Ethernet-Standards
Tabelle 13: PLC-Frequenzbänder nach CENELEC EN 50065
Tabelle 14: Verfügbarkeiten von Breitbandmedien
Tabelle 15: Technologien in Kurzform
Tabelle 16: Neun-Punkte-Skala von Saaty
Tabelle 17: Gewichtung der Kriterien innerhalb der Szenarien
Tabelle 18: Durchschnittswerte der Konsistenzindizes
Tabelle 19: Konsistenz der Kriterienmatrix
Tabelle 20: Ergebnismatrix
Tabelle 21: Technologie-Ranking
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Motivation und Rahmenbedingungen
"Die Herausforderung für die Gesellschaft wird sein, den Klimawandel in Grenzen zu halten, um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen.", sagt Prof. Andreas Schmittner, Professor für Meeres- und Klimawissenschaften an der Oregon State University in Amerika zum Thema Klimawandel. Weiterhin führt er aus, dass „ungebremster Anstieg der CO2 Emissionen in der Zukunft [...] zu spürbaren Klimaänderungen auch in anderen Regionen führen" wird. "Viele dieser vorhergesagten Änderungen werden negative Auswirkungen für die Menschen mit sich bringen."[1]
Dadurch stehen Energieerzeuger aufgrund ihres sehr hohen CO2-Ausstoßes in der Kritik. Derzeit ist es nicht möglich die gesamte Stromerzeugung CO2-frei zu gestalten. Die Erzeugungsformen im regenerativen Bereich sind schwer steuerbar, so dass die Grundlast durch Energieträger wie Kohle, Gas und Öl erzeugt wird. Durch den weltweit wachsenden Druck und Beschlüsse der Umweltgipfel, beginnend mit dem Kyoto-Protokoll, erlässt der Gesetzgeber neue Regelungen. Diese verfolgen das Ziel, den Bürger dazu zu motivieren, seinen eigenen Energieverbrauch in Frage zu stellen. Der Bürger soll Energie effizienter nutzen, ineffiziente Geräte beseitigen, elektrische Energie sparen und so den CO2-Ausstoß verringern. Dies ist mit der aktuellen Messgerätegeneration nicht möglich. Die jährliche Ablesung durch einen Mitarbeiter ist die Grundlage für die Stromrechnung, das heißt der Stromnutzer wird nur einmal im Jahr mit seinem tatsächlichen Stromverbrauch konfrontiert. Dies führt dazu, dass 50% der Stromkunden gar nicht wissen wie viel Strom sie im Jahr verbrauchen, was dieser kostet und ob ein solcher Verbrauch normal ist. Zudem ist die Steuerung der eigenen Stromverbrauchskosten nicht möglich. Das soll sich im Zuge des Smart Metering europaweit ändern.
Die Umsetzung des Projektes Smart Metering stellt die betroffenen Parteien vor gewaltige Herausforderungen. Die zur Datenübertragung notwendigen Protokolle sind noch nicht standardisiert. Verschiedene Interessengruppen arbeiten an einer Lösung für den Datenverkehr und das Data-Management. Gerade bei der Wahl der Übertragungsmedien gibt es eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Doch gibt es eine optimale Lösung?
1.2. Ziele und Abgrenzungen
Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedensten Übertragungstechniken einander gegenüberzustellen, um Aussagen darüber treffen zu können, welche Lösungsansätze denkbar sind. Dazu werden unterschiedliche Szenarien entwickelt, die diese Ansätze ins Verhältnis zu Äußeren Rahmenbedingungen setzen. So kann beispielsweise ein Lösungsansatz für ein dicht besiedeltes Gebiet anders geartet als für eine ländliche, sehr dünn besiedelte Gegend. Darüber hinaus werden mögliche Netzwerkarchitekturen in die Bewertung einfließen, das heißt welche Infrastruktur ist im jeweiligen Szenario denkbar und wie kann eine effiziente Übertragung der Daten erfolgen. Damit eine Bewertung der verschiedensten Technologien erfolgen kann, müssen konkrete Anforderungen definiert werden. Diese Anforderungen sollen durch ausgewählte Kennzahlen formuliert werden. Eine objektive Bewertung kann dann erfolgen, wenn diese Kennzahlen messbar und damit auch vergleichbar sind. Danach sind diese Kriterien durch ein geeignetes Entscheidungsmodell einander gegenüberzustellen. Folgende Teilziele sind demnach zu erreichen:
1. Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Identifikation von Kommunikationspartnern
2. Identifikation kommunikationsrelevanter Prozesse als Rückschluss aus der Konstellation der Kommunikationspartner
3. Ableitung von Anforderungen an ein mögliches Kommunikationsmedium
4. Formulierung von Umsetzungsszenarien
5. Analyse von Netzwerkarchitekturen und Übertragungsmedien in Bezug konkreter Anforderungen
6. Gegenüberstellung und Bewertung der Übertragungsmedien
Diese Arbeit betrachtet die informationstechnische Ebene des Gesamtthemas. Gerade im Bereich Smart Metering gibt es sowohl politische, soziale und ökologische Aspekte, die der Autor in der Analyse der vorliegenden Daten ausschließt. Wertungen zu Marktrollen bzw. die Analyse der Beziehungen unter Marktpartnern werden ebenfalls kein Schwerpunkt dieser Arbeit sein.
1.3. Vorgehen
Der erste Teil der Arbeit wird sich daher mit der Frage beschäftigen, welche Kommunikationspartner gibt es und welche Anforderungen stellen sie an das Gesamtsystem. Da der gesamte Wandel durch die Gesetzgebung herbeigeführt wird, gilt als erster Schritt, die treibenden Kräfte innerhalb der Gesetze herauszufiltern, die grundsätzlichen Kommunikationsteilnehmer zu benennen und ihre Aufgaben zu erläutern.
Wenn diese identifiziert sind, und deren Aufgaben umrissen wurden, werden nach ARIS-Definition [2] Prozesse formuliert. Der Schwerpunkt liegt demnach auf der Steuerungssicht des ARIS-Konzeptes. Mögliche Prozesse, die eine Kommunikation mit der Verbrauchsmesseinrichtung (Zähler) erfordern, werden einzeln betrachtet und dienen als Grundlage für Rückschlüsse auf technische Anforderungen an die Übertragungstechnologien und Netzwerkarchitekturen. Darüber hinaus werden konkrete Anforderungen der Kommunikationsteilnehmer an die Datenübertragung formuliert. Daraus schlussfolgernd werden Kennzahlen definiert, die als Vergleichskriterien im weiteren Verlauf dienen sollen. Über die Datensicht des ARIS- Konzeptes werden grundlegende Aussagen getroffen. Diese werden bei den Berechnungen als gegeben vorausgesetzt. Die Prozessanalyse ist eine wesentliche Grundlage im Verlauf dieser Arbeit.
Schließlich sind Szenarien zu entwickeln, die die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für eine Umsetzung von Smart Metering konkretisieren. Im Anschluss daran wird die technologische Seite betrachtet. Die Netzwerkarchitekturen und mögliche Übertragungsarten werden thematisiert und Rückschlüsse auf den Einfluss auf die einsetzbaren Übertragungsmedien gezogen. Danach werden diese anhand der entwickelten Kennzahlen geprüft.
Der Abschluss wird die Durchführung einer AHP-Analyse bilden. Hier werden die Stärken und Schwächen der Technologien abgewogen und einander gegenüber gestellt. Durch die mathematischen Abläufe in diesem Prozess kann abschließend ein Ansatz formuliert werden, der unter den benannten Rahmenbedingungen optimal ist.
Weitere sich ergebende Forschungs- oder Handlungsfelder werden in einem gesonderten Kapitel benannt.
2. Smart Metering
Dieses Kapitel betrachtet das Thema Smart Metering allgemein. Die treibenden Kräfte seitens der Gesetzgebung werden analysiert, um konkrete Kommunikationspartner zu ermitteln. Da es sich bei den meisten energieerzeugenden Unternehmen um internationale Konzerne handelt, sind rechtliche Rahmenbedingungen nicht allein in Deutschland zu suchen, sondern haben ihren Ursprung auf internationaler Ebene. Daher werden zunächst Richtlinien auf europäischer Ebene benannt, die wiederum eine Auswirkung auf die deutsche Rechtsprechung haben. Die grundlegenden Gesetze werden in den Gesamtzusammenhang gebracht, um daraus Marktrollen zu schlussfolgern, die in ihrer jeweiligen Form die Kommunikation beeinflusst. Danach erfolgen die genaue Abgrenzung der Thematik und die Ausarbeitung von Basiselementen, worauf sich dann eine konkretere Zielstellung für den weiteren Verlauf der Arbeit schlussfolgert.
2.1. Definition Smart Metering
Eine einheitliche Definition von Smart Metering ist derzeit nicht zu finden. Die verschiedenen Forschungsgruppen definieren Eigenschaften, anhand derer ein Smart Meter erkannt werden kann. Grundsätzlich geht es um die neue Generation von Messgeräten für Endverbraucher, die nicht in das Großkundensegment der Versorger fallen. Die European Smart Metering Alliance (ESMA) beschreibt folgende Funktionen, die ein Smart Meter erfüllen muss:
- Automatische Verarbeitung, Transfer, Management und Verwendung von Messdaten