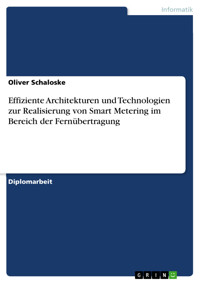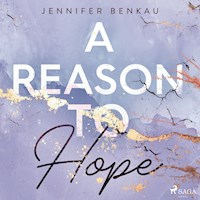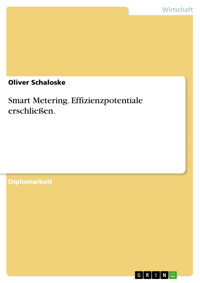
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Berlin früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Smart Metering ist in den letzten Jahren zu einer bekannten Begrifflichkeit in der Energiebranche geworden. Derzeit arbeiten Unternehmen deutschlandweit an Lösungen zur Realisierung der Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers. Der Zwang zur Realisierung des Smart-Metering-Ansatzes durch den Gesetzgeber sowie die Überwachung durch die Regulierungsbehörden hat den Energiemarkt in Bewegung gebracht. Das Unbundling, die Trennung von Vertrieb und Netz, weitet sich erkennbar über die gesamte Prozesslandschaft der Unternehmen aus. Daraus resultieren Veränderungen in allen Unternehmensbereichen sowohl technisch, als auch organisatorisch. Zusätzlich werden gewohnte Einnahmequellen anderen Marktrollen zugeordnet, was einen Wegfall von Unternehmensteilen bedeuten kann. Durch die Liberalisierung des Messwesens entstehen zusätzlich neue Unternehmen am Markt. Die neue Marktrolle des Messstellenbetreibers erhöht die Anforderungen an die Prozesse und die Kommunikation zwischen den Marktpartnern. Neben diesen Anstrengungen wird immer wieder die Frage nach dem Nutzen gestellt. Welche Marktrolle am Ende die Kosten der umfangreichen Investitionen trägt, ist derzeit noch ungeklärt. Jedoch die Unternehmen, denen es gelingt aus den Auflagen Nutzen und aus den Risiken Chancen zu generieren, werden den Energiemarkt der Zukunft dominieren. Daher ist es unumgänglich die Teile der Unternehmen zu identifizieren, die einen Nutzen aus der Realisierung von Smart Metering generieren können. Aktuell wird Smart Metering stets mit technischen Anforderungen und Lösungsansätzen in Verbindung gebracht. Jedoch ist es in seiner Begrifflichkeit wesentlich weiter zu fassen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der betriebswirtschaftlichen Sicht und möglichen Nutzenpotentialen, die aus der Umsetzung von Smart Metering resultieren. Folgende Teilziele stehen im Vordergrund der Arbeit: - Marktrollenunabhängige Ermittlung von Unternehmensbereichen, die durch eine Einführung von Smart Metering beeinflusst werden - Beschreibung der betroffenen betrieblichen Abläufe und Identifikation des Potentials - Bewertung der Potentiale und Bestimmung einer Nutzendimension - Umlage der Potentiale auf die Marktrollen - Beschreibung möglicher Maßnahmen zur Erschließung der Potentiale - Benennung von Innovatoren am Markt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Motivation und Rahmenbedingungen
1.2. Ziele und Abgrenzungen
1.3. Vorgehen
2. Grundlegende Rahmenbedingungen
2.1. Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft
2.2. Rollenverteilung innerhalb der Wertschöpfungskette
2.2.1. Strommarkt im Ursprung
2.2.2. Öffnung der Märkte
2.2.3. Aktuelle Marktsituation
2.3. Einfluss von Smart Metering als technisch-intelligente Erfassung ressourcenrelevanter Daten
2.3.1. Definition Smart Metering
2.3.2. Betroffene Marktrollen
2.4. Analyse der Marktrollen
2.4.1. Lieferant
2.4.2. Verteilnetzbetreiber
2.4.3. Messstellenbetreiber
2.4.4. Kunde
2.4.5. Übersicht der wichtigsten Marktpartner
3. IST-Analyse der Unternehmen
3.1. Wirkungen von Smart Metering
3.2. Aufbauorganisation
3.2.1. Anforderungen durch Trennung von Netz- und Messstellenbetrieb
3.2.2. Änderungen in der Unternehmensstruktur
3.3. Ablauforganisation
3.3.1. Identifikation potentieller Unternehmensbereiche
3.3.2. Prozessorientierte Potentiale
3.3.3. Instrumente des Managements
3.4. Produktentwicklung
3.4.1. Segmentierung der Kundengruppen
3.4.2. Mehrwertdienste und Bonusprogramme
3.4.3. Folgen der Produktentwicklung
4. Bewertung Effizienzpotentiale
4.1. Herangehensweise
4.2. Auswahl geeigneter Kennzahlen
4.2.1. Qualität
4.2.2. Zeit
4.2.3. Kosten
4.3. Evaluierung der identifizierten Potentiale
4.3.1. SOLL/ IST - Vergleich der Prozesse
4.3.2. Strombeschaffung
4.3.3. Zeit- und lastabhängige Produkte
4.4. Potentialumlage auf die Marktrollen
4.4.1. Potentialübersicht
4.4.2. SWOT-Matrix des Lieferanten
4.4.3. SWOT-Matrix des Verteilnetzbetreibers
4.4.4. SWOT-Matrix des Messstellenbetreibers
5. Erschließung der Potentiale
5.1. Maßnahmen zur Erschließung
5.1.1. Organisationspotentiale
5.1.2. Prozesspotentiale
5.1.3. Produktpotentiale
5.2. Investitionsbedarf
5.2.1. Analyse der Gesamtinvestition
5.2.2. Kostenumlage
5.3. Beurteilung der Investition
6. Fazit
Anhang A
Anhang B
Anhang C
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Wertschöpfung in der Energiewirtschaft
Abbildung 2: Wertschöpfungskette im Zuge des Unbundling
Abbildung 3: Wertschöpfungskette aktuell
Abbildung 4: Beziehungen zwischen den Marktpartnern
Abbildung 5: Betroffene Prozesse durch Smart Metering (rot markiert)
Abbildung 6: Empfohlenes Organigramm eines Messstellenbetreibers
Abbildung 7: Organigramm Pfalzwerke Netzgesellschaft mbH
Abbildung 8: Verbrauchsdatenerfassung
Abbildung 9: Grundablauf Abrechnung
Abbildung 10: Verbrauchsdatenermittlung bei unterjährigem Abrechnungszyklus
Abbildung 11: Prozess des einfachen Mahnlaufs
Abbildung 12: Prozess des komplexen Mahnlaufs
Abbildung 13: Prozess der Entstörung
Abbildung 14: Ausgewählte Standardlastprofile
Abbildung 15: Grundsatzplanung Netzbetrieb (Mittelspannungsnetz)
Abbildung 16: Instandhaltungsstrategien
Abbildung 17: Kundenmanagement
Abbildung 18: Erwartungshaltung der Kunden
Abbildung 19: Prozess automatische Verbrauchsdatenermittlung
Abbildung 20: Neue Grundstruktur Abrechnung
Abbildung 21: Kostendegression
Abbildung 22: Prozess Universeller Mahnlauf
Abbildung 23: Prozess der erweiterten Entstörung
Abbildung 24: Untertägiges Lastprofil
Abbildung 25: Beschaffungspotential
Abbildung 26: Ausgewählte Preismodell pro kWh (bisher / zeitabhängig / lastabhängig)
Abbildung 27: Lieferantenmatrix
Abbildung 28: Verteilnetzbetreibermatrix
Abbildung 29: Messstellenbetreibermatrix
Abbildung 30: Durchschnittliche Investition je Zähler in €
Abbildung 31: Kundenpräferenzen zu Smart Metering Aspekten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht Marktrollen
Tabelle 2: Wirkungen auf die Prozesslandschaft der EVUs
Tabelle 3: Antworten der Befragten Kunden
Tabelle 4: Regulierungsmethoden
Tabelle 5: Produktpalette im Zuge von Smart Metering
Tabelle 6: Produktbaukasten
Tabelle 7: Wesentliche Kostenfaktoren
Tabelle 8: Anfallende Prozesszeiten (alter Ablauf) in Minuten
Tabelle 9: Kennzahlenübersicht Verbrauchsdatenermittlung
Tabelle 10: Kennzahlenübersicht Abrechnung
Tabelle 11: Kennzahlenübersicht Mahnläufe
Tabelle 12: Kennzahlenübersicht Entstörung
Tabelle 13: Kosten für Verlustenergie 2009
Tabelle 14: Bewertete Prozesspotentiale
Tabelle 15: Effizienzpotentiale in Bezug zu den Marktrollen
Tabelle 16: Chancen/ Risiken des Outsourcing
Tabelle 17: Zusammenfassung Prozesspotentiale
Tabelle 18: Rechenweg Kapitalwertbestimmung
Tabelle 19: Rollout-Szenarien
Tabelle 20: Kritische Menge des Kapitalwertes
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Motivation und Rahmenbedingungen
Smart Metering ist in den letzten Jahren zu einer bekannten Begrifflichkeit in der Energiebranche geworden. Derzeit arbeiten Unternehmen deutschlandweit an Lösungen zur Realisierung der Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers. Der Zwang zur Realisierung des Smart-Metering-Ansatzes durch den Gesetzgeber sowie die Überwachung durch die Regulierungsbehörden hat den Energiemarkt in Bewegung gebracht. Das Unbundling, die Trennung von Vertrieb und Netz, weitet sich erkennbar über die gesamte Prozesslandschaft der Unternehmen aus. Daraus resultieren Veränderungen in allen Unternehmensbereichen sowohl technisch, als auch organisatorisch. Zusätzlich werden gewohnte Einnahmequellen anderen Marktrollen zugeordnet, was einen Wegfall von Unternehmensteilen bedeuten kann. Durch die Liberalisierung des Messwesens entstehen zusätzlich neue Unternehmen am Markt. Die neue Marktrolle des Messstellenbetreibers erhöht die Anforderungen an die Prozesse und die Kommunikation zwischen den Marktpartnern.
Neben diesen Anstrengungen wird immer wieder die Frage nach dem Nutzen gestellt. Welche Marktrolle am Ende die Kosten der umfangreichen Investitionen trägt, ist derzeit noch ungeklärt. Die Unternehmen selbst agieren teilweise nur in dem Maße, die gesetzlichen Vorgaben mit minimalem Aufwand zu erfüllen. Die Hoffnung darauf, dass diese Maßgaben zurückgenommen oder aufgeschoben werden, wie aktuell zum Thema Atomausstieg, ist unbegründet. Die Unternehmen, denen es gelingt aus den Auflagen Nutzen und aus den Risiken Chancen zu generieren, werden den Energiemarkt der Zukunft dominieren. Daher ist es unumgänglich die Teile der Unternehmen zu identifizieren, die einen Nutzen aus der Realisierung von Smart Metering generieren können.
Aktuell wird Smart Metering stets mit technischen Anforderungen und Lösungsansätzen in Verbindung gebracht. Jedoch ist es in seiner Begrifflichkeit wesentlich weiter zu fassen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der betriebswirtschaftlichen Sicht und möglichen Nutzenpotentialen, die aus der Umsetzung von Smart Metering resultieren.
1.2. Ziele und Abgrenzungen
Da die aktuellen Studien meist Smart Metering als eine rein technische Herausforderung verstehen, befasst sich diese Arbeit mit den Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation der verschiedenen Unternehmen. Dazu ist es zunächst erforderlich Rahmenbedingungen abzustecken. Der aktuelle Energiemarkt ist mit den Märkten vor 20 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Die historisch gewachsenen Strukturen der Energieversorger in ihrem Ursprung wurden mehrfach geteilt, so dass das entstandene Marktrollensystem sehr komplex geworden ist. Diese Veränderungen der Wertschöpfungskette sollen einführend in das Thema führen und einen Überblick über die beteiligten Marktrollen geben.
Danach wird grundlegend der Begriff Smart Metering betriebswirtschaftlich beschrieben, um dann die Marktrollen zu unterscheiden, die direkt durch die Einführung intelligenter Messsysteme betroffen sind. Besonders wichtig bei der Analyse der Marktrollen ist deren Interaktion miteinander, da die Regelung der Kommunikation direkte Auswirkungen auf die Prozesszeiten und damit deren Kosten hat.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob durch Smart Metering ein Nutzen für ein Unternehmen realisiert werden kann. Weiterführend wird nach Möglichkeiten gesucht, diesen Nutzen zu bewerten. Das Ziel der Analyse ist es, eine Aussage darüber treffen zu können, ob das Gesamtprojekt Smart Metering eine lohnenswerte Investition ist oder ob die erarbeiteten Optimierungsansätze allein nicht ausreichen, um die Investitionen zu rechtfertigen. Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung Technologietreiber; das heißt Unternehmen, die ein großes Interesse an der Realisierung haben, zu benennen, die in ihrer Funktion am Markt den Fortschritt dieser Technik vorantreiben können.
Dabei stehen folgende Teilziele im Vordergrund:
- Marktrollenunabhängige Ermittlung von Unternehmensbereichen, die durch eine Einführung von Smart Metering beeinflusst werden
- Beschreibung der betroffenen betrieblichen Abläufe und Identifikation des Potentials
- Bewertung der Potentiale und Bestimmung einer Nutzendimension
- Umlage der Potentiale auf die Marktrollen
- Beschreibung möglicher Maßnahmen zur Erschließung der Potentiale
- Benennung von Innovatoren auf dem Markt
1.3. Vorgehen
Die Arbeit gliedert sich nach der Themeneinführung in drei wesentliche Teilschritte auf. Zunächst werden die Unternehmensbereiche identifiziert, die einen Nutzen aus der Einführung der Technik generieren können. Während im einführenden Kapitel auf die Komplexität des Marktes und die daraus resultierende enge Vernetzung der Marktpartner hingewiesen wird, steht in dem Teil weniger die Marktrolle, sondern vielmehr deren Potential im Vordergrund. Es erfolgt somit zunächst eine marktrollenunabhängige Betrachtung der Aspekte
Der zweite Teil der Arbeit wird die ermittelten Potentiale anhand von ausgewählten Kennzahlen bewerten. Dabei sollen mögliche Stellgrößen herausgestellt und eine Größenordnung des Potentials ermittelt werden. Da die betrieblichen Rahmenbedingungen von Marktpartner zu Marktpartner stark differieren können, sollen auch allgemeine Aussagen über Herangehensweisen zur Berechnung des individuellen Potentials aufgezeigt werden. Abschließend werden die Ergebnisse auf die Marktpartner umgelegt, um damit die Frage zu beantworten, welche der Marktrollen als Technologietreiber auftreten kann. Weiterführend können Gedankenansätze zur Kostenübernahme gebildet werden.
Nachdem die Potentiale den Marktrollen zugeordnet wurden, ist zu überlegen, welche Entscheidungen jedes der Unternehmen zu treffen hat, um diese Potentiale zu erschließen. Dabei sollen auch Kostenaspekte der Innovation berücksichtigt werden. Schlussendlich soll auf Grundlage der Analysen der vorangegangenen Kapitel eine Aussage über einen möglichen Kapitalwert getroffen werden. Danach kann eine konkrete Aussage darüber getroffen werden, ob sich das Gesamtprojekt Smart Metering lohnt.