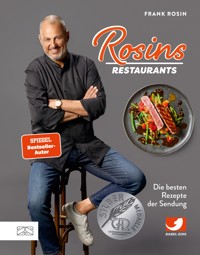18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Persönlich, witzig und authentisch: Sternekoch und TV-Star Frank Rosin erzählt aus seinem Leben Als Sohn einer Imbissbuden-Besitzerin und eines Lieferanten für Gastronomiebedarf lernt Frank Rosin das Restaurantgeschäft von der Pike auf. »Ich bin mir sicher, dass ich mit elf oder zwölf Jahren schon mehr Frittierfett bewegt hatte als jeder Filialleiter von McDonald's in seiner gesamten Karriere«, erinnert sich Frank Rosin in seiner Biografie. Dabei kam es ihm lange gar nicht in den Sinn, etwas anderes zu schreiben als Kochbücher. Nun erzählt einer der erfolgreichsten Starköche Deutschlands, wie alles anfing. Wie wurde aus einem »ziemlich miesen, völlig uninteressierten Schüler« ein prominenter 2-Sterne-Koch mit eigenen Fernseh-Shows und einem Restaurant in Dorsten? - Sein Leben, seine Karriere, seine Familie: Frank Rosin im persönlichen Porträt - Von der Pommesbude ins Sternerestaurant: Erfolgsgeschichte eines Ausnahme-Gastronomen - »Rosins Restaurants«, »The Taste« oder »Hell's Kitchen«: Frank Rosin erobert das TV - Kochen als Leidenschaft: Frank Rosins Buch als Geschenk für Hobbyköche und Kochbegeisterte 40 Jahre Gastronomie: Harte Lehrjahre, wichtige Erkenntnisse und neue Pläne Wie viel Sterne hat Frank Rosin? Was ist sein Lieblingsrezept und hatte er vor seinen Auftritten auch schon Lampenfieber? Der Promi-Koch beantwortet in seinem Buch all diese Fragen. Aber er teilt noch viel mehr mit seinen Lesern und Fans – seine kulinarische Geschichte, seine prägendsten Momente und seine persönlichste Botschaft: Jeder kann sich seinen Lebenstraum erfüllen! Frank Rosin berichtet in seiner Autobiografie von den Höhen und Tiefen seines Lebens, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen – eben genau so, wie wir den Sternekoch kennen und lieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FRANK ROSIN
mit Andreas Hock
Ehrlich wie ’ne Currywurst
Mein Weg von der Pommesbude ins Sternerestaurant
Aus redaktionellen Gründen wurden die Namen im Text teilweise geändert.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2022 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, unter Verwendung eines Fotos von Daniel Kunzfeld
Die Fotos im Innenteil stammen aus dem Privatbesitz von Frank Rosin, mit Ausnahme von: S. 126 (imago/biky).
Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN 978-3-7110-0304-1
eISBN 978-3-7110-5326-8
Dieses Buch widme ich meinen ElternMarlies und Willi
Inhalt
Vorwort
1Fritten, Tischtennis und Hochzeitsessen –Meine nicht ganz unbeschwerte Jugend
2Schläge, Schinderei und verbrannte Füße –Meine harten Lehrjahre
3Bundeswehr, Schiffskombüse und Amerika –Meine verrückte Wanderschaft
4Wulfen, Mallorca und der FC Schalke –Meine Abenteuer als junger Gastronom
5Neues Konzept, neue Mannschaft, neue Ziele –Meine wichtigsten Erkenntnisse als Chef
6Marketing-Gags, Junge Wilde, Kabel Eins –Mein Weg vom Pausenkasper zur Fernsehfresse
7Kritiker, Unternehmertum, Lieblingskollegen –Mein Fazit nach vierzig Jahren Gastronomie
Dank
Vorwort
Im Lauf der letzten Jahre wurde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mal etwas anderes als ein Kochbuch zu schreiben. Das habe ich eigentlich immer dankend abgelehnt, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass mein bisheriges Leben interessant genug für eine Biografie sein könnte. Klar, durch TV-Auftritte und meine eigenen Sendungen kennen mich inzwischen viele Menschen, und wenn ich nicht gerade in Ruhe Zeit mit meiner Familie oder meinen Freunden verbringen möchte, freue ich mich natürlich, wenn mich jemand auf »Rosins Restaurants« oder meine anderen Formate anspricht. Letztlich bin ich aber nur ein Koch, oder besser gesagt: ein Gastronom. Davon gibt’s Zigtausende, und trotz der zwei Michelin-Sterne, mit denen wir unseren Betrieb in Dorsten seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue schmücken dürfen, sicherlich auch etliche bessere.
Trotzdem habe ich mich eines schönen Tages mit einem guten Glas Wein an den Tisch gesetzt, die alten Alben hervorgekramt, jede Menge Fotos von früher angeschaut und überlegt, wie das damals alles eigentlich angefangen hat. Und wie aus einem ziemlich miesen, völlig uninteressierten Schüler der Typ werden konnte, der ich heute bin.
Klar habe ich auch eine Menge Glück gehabt! Da war zum einen meine Mutter, die immer an mich geglaubt und mir den Rücken gestärkt hat – selbst als wir mal wieder nicht wussten, wie wir in unserem gerade eröffneten Laden die Stromrechnung für den abgelaufenen Monat bezahlen sollten. Und zum anderen, dass ich in den richtigen Momenten ganz besondere Menschen treffen durfte, die mich inspiriert haben – und mich mit »Augen und Ohren klauen« ließen, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. Aber ich habe auch immer mal wieder ordentlich auf die Fresse bekommen, manchmal sogar im wörtlichen Sinne, dennoch den Arsch zusammengekniffen und mein Ding durchgezogen.
Wäre es nach manch schlauem Experten, Kritiker oder auch Kollegen in dieser Branche gegangen, hätte aus mir nichts anderes werden können als der Nachfolger meiner Mama in unserem kleinen »Glückauf-Grill« in Hervest. Das wäre natürlich auch in Ordnung gewesen, aber ich würde lügen, wenn ich nicht ein bisschen stolz darauf wäre, dass ich all das, wofür ich heute stehe, aus eigener Kraft und mit viel Durchhaltevermögen geschafft habe.
Daher habe ich mich dann schließlich doch dazu entschieden, meine kulinarische Geschichte aufzuschreiben. Vielleicht auch, weil ich damit nicht nur unterhalten, sondern – genauso wie in »Rosins Restaurants« – eine letztlich banale und doch absolut wahre Botschaft verbinden möchte: nämlich die, dass sich im Grunde jeder seinen ganz persönlichen Lebenstraum erfüllen kann. Man muss sich nur bei allem, was man tut, treu bleiben, darf sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und sollte aus seinen eigenen Fehlern lernen. Dann hat man gute Chancen, dass es klappt.
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass die lange Reise zu einem selbst gesteckten Ziel völlig spaßbefreit sein muss. Ich habe in meinem Leben Gott sei Dank unglaublich viel gelacht, gerne und oft auch einfach über mich selbst. Manchmal aber habe ich bittere Tränen geweint. Inzwischen weiß ich, dass diese genauso dazugehören. Als ich während der Arbeit zu diesem Buch mit meinem Co-Autor Andi Hock zusammensaß und darüber nachgedacht habe, welche Ereignisse aus den letzten dreißig, vierzig Jahren sich für diese Biografie eignen, sind viele Erinnerungen wieder hochgekommen, die ich schon längst vergessen geglaubt hatte. Und manches hatte ich schlichtweg auch einfach verdrängt. Falls ich nun mit meinen Geschichten jemandem zu nahe treten sollte, tut es mir aufrichtig leid. Aber alles, was ich auf den folgenden Seiten schildere, ist genau so passiert. Ich musste in dem einen oder anderen Moment selbst staunen, was ich bislang alles schon erlebt habe.
Frank Rosin, im Frühjahr 2022
1
Fritten, Tischtennis und Hochzeitsessen – Meine nicht ganz unbeschwerte Jugend
Kleider an, rasch den Scheitel gezogen, und los geht’s. Dieser Morgen war genauso gemütlich wie jeder Morgen bei uns zu Hause; einer rund hundert Quadratmeter großen Wohnung in Polsum, in der meine Schwester und ich jeweils ein kleines Zimmer besaßen, in das nicht viel mehr hineinpasste als ein Bett und ein Schreibtisch. Meine Eltern hatten unsere Bude eher funktional eingerichtet, ohne großen Schnickschnack und Gelsenkirchener Barock, aber trotzdem fühlte ich mich durchaus wohl. Andererseits war ich ohnehin fast nur zum Schlafen da. Die restliche Zeit verbrachte ich in der Schule oder dort, wo mein Vater und meine Mutter arbeiteten: in ihrem Betrieb.
Für Frühstück blieb mal wieder keine Zeit, meine Mutter drückte mir noch schnell die Stulle in die Hand, dann rannte ich los. Wie üblich war ich verdammt spät dran, und der Bus, der mich zur Schule nach Marl bringen sollte, fuhr nur ein oder zwei Mal die Stunde. Wenn ich den verpasste, gab’s wieder nur unnötigen Ärger. Das musste nicht sein – die Schule und ich hatten eh keinen besonders engen Draht zueinander. Daheim herrschte dank meinem Vater auch nicht gerade rund um die Uhr pure Wohlfühlatmosphäre, weshalb ich einen Anruf vom Klassenlehrer erst recht nicht gebrauchen konnte. Zu allem Überfluss wartete am Nachmittag jede Menge Arbeit auf mich.
Die Haltestelle lag ein paar Minuten entfernt. Direkt gegenüber befand sich ein riesengroßes Feld, dahinter konnte man die Bundesstraße erkennen. Polsum war ein beschauliches Örtchen zwischen Dorsten und Marl, umgeben von Äckern, Weiden und Wald. Es gab dort eine alte Kirche, ein historisches Wasserschloss, und die Hauptattraktion des Jahres war neben dem Schützenfest der Weihnachtsmarkt, der immer am dritten Advent stattfand, nur einen einzigen Tag dauerte und ein paar Tausend Besucher aus der ganzen Region anzog. Wenn hier etwas tobte, dann war es unser Familienoberhaupt. Das Leben jedenfalls war es nicht.
Nur einen Steinwurf weiter südlich jedoch befand sich das Ruhrgebiet. Gelsenkirchen, Bottrop, Oberhausen, Essen – hier brodelten nicht nur die Kohleöfen. Hier steppte bestimmt auch der Bär. Zumindest vermutete ich das, wenn ich sehnsüchtig auf die nur wenige Kilometer entfernten Schlote sah, deren Rauch oft den Horizont verdunkelte. Oder auf die riesigen Fördertürme der Zechen, die damals noch überall in der Gegend herumstanden wie heute die Windräder. Die Kulisse wirkte auf mich spektakulär, und irgendwie fühlte ich mich magisch angezogen von diesem riesigen Gebilde aus Städten, Gruben, Fabriken und vor allem: Menschen. Für mich stand schon immer fest, dass ich ein Kind des Potts war und immer bleiben würde.
Ich beobachtete die Autos, die hinten auf der B225 vorbeirasten, und stellte mir vor, selbst in einem zu sitzen. Vielleicht würde ich mir irgendwann einen Mercedes leisten können, mit dem ich dann täglich zu meiner Arbeit fuhr. Einer Arbeit, die mich glücklich machte, ausfüllte und dafür sorgte, dass ich etwas bewegte – und damit meinte ich nicht den Wagen. Ich kann heute nicht genau sagen, warum, aber als ich an diesem einen Morgen in dem zugigen und versifften Unterstand auf meinen Bus wartete, spürte ich ein komisches Kribbeln im Bauch. Als wäre da was in mir, das niemand außer mir bemerkte. Etwas, das mich antreiben würde. Etwas Kreatives. Das Problem war nur: Ich hatte keinen Schimmer, was das sein konnte. Und mein Vater erst recht nicht.
Er betrieb einen Großhandel für Gastronomieartikel und führte alles, was man für den Betrieb einer Kneipe, eines Speiselokals oder eines Imbisses brauchte – von der Gemüsereibe über alle möglichen Getränke bis hin zur Gulaschkanone mit zweihundert Litern Fassungsvermögen. Und ganz wichtig: Er war Generalimporteur für De Fritesspecialist, den weltgrößten Hersteller von Tiefkühlpommes mit Sitz in Holland. Es gab wahrscheinlich kaum eine Frittenbude von Wuppertal bis Münster, die ihre Ware nicht bei meinem Vater bezog. Eigentlich war der Mann gelernter Steinmetz und wäre angesichts seiner Begabung sicherlich ein guter Bildhauer geworden. Schon meine Oma als begnadete Schneiderin mit polnischen Wurzeln war schöpferisch begabt. Aber Papas Auffassung war nun mal nicht, dass der Sinn des Lebens darin bestand, seiner wie auch immer gearteten künstlerischen Ader nachzugeben. Sondern hart zu arbeiten. Genau das verlangte er auch von mir.
»Junge, du musst ein echter Kerl werden. Sonst wird das nix«, sagte er immer zu mir, wenn er mich für unsere Firma einspannte. Und das passierte sehr häufig und vor allem: sehr früh. Ich bin mir sicher, dass ich mit elf oder zwölf Jahren schon mehr Frittierfett bewegt hatte als jeder Filialleiter von McDonald’s in seiner gesamten Karriere. Wir besaßen nicht mal einen Gabelstapler, und es grenzte an ein Wunder, dass mein armer Rücken der ganzen Schlepperei standgehalten hat. Jeden Tag, nachdem ich von der Schule nach Hause gekommen war, musste ich erst mal mithelfen, die vielen Kisten, Pakete und Kartons abzuladen und in unserem Kühlhaus und im Lager zu verstauen. Ordnung war meinem Vater wichtig. Bei uns sah es immer aus wie geleckt. Bis auf das eine Mal, als ich beim Rangieren mit einem unserer Lieferwagen blöderweise das falsche Pedal erwischte.
Ich hasste es zwar, wenn ich mal wieder zum wöchentlichen Autoputzen abgeordnet worden war. Aber zumindest durfte ich zu diesem Zweck die Lkw aus der Fahrzeughalle raus- und nach meiner zärtlichen Spezialhandwäsche wieder hineinrangieren, was mir ausnahmsweise sogar halbwegs Spaß machte: Welches andere Kind hatte die Möglichkeit, einen echten Zwölftonner zu bewegen? Nach all der Zeit war ich schon ein geübter Fahrer. Wäre ich nicht altersbedingt noch etwas klein gewesen und dadurch hinterm Steuer sicherlich bereits kurz hinterm Schermbecker Wasserschloss der allerersten Polizeistreife aufgefallen, hätte ich es mir, ohne mit der Wimper zu zucken, zugetraut, höchstpersönlich nach Venlo in die Niederlande zu fahren, um dort die nächste Fuhre Pommes abzuholen.
Nur an diesem bescheuerten Nachmittag verwechselte ich auf unserem Firmengelände Gas und Bremse – und schoss kerzengerade in die gut hundertfünfzig Bierkisten, die ich gerade erst säuberlich über- und nebeneinandergestapelt hatte. Es krachte, schepperte und splitterte, dann war Ruhe. Ich kletterte etwas benommen aus dem Führerhaus. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme hatten der Laster und ich den Unfall mit ein paar kleinen Schrammen überstanden. Nur das Bier war bis auf eine Handvoll Flaschen leider nicht mehr zu retten. Auf dem Boden lag ein Scherbenmeer in einem schaumigen Pils-See, und obwohl ich sofort alles vorsichtig aufsammelte und danach putzte wie der Teufel, riecht es dort wahrscheinlich heute noch wie im Sudhaus einer Großbrauerei. Mein Vater ist vor Wut fast geplatzt. Aber in solchen Dingen ließ er am Ende des Tages meistens doch Gnade walten: Er wusste insgeheim, dass er sich nicht auch noch über meine höchst illegale Kinderarbeit beschweren konnte, die jedem halbwegs gewissenhaften Gewerkschaftsfunktionär vermutlich einen mittelschweren Herzinfarkt beschert hätte, wenn sie rausgekommen wäre. Trotzdem war der Anschiss so groß, dass ich mich erst mal nicht mehr ans Steuer setzte.
Weniger nachsichtig war er, was meine Hobbys betraf. Ein Stück weit hatte ich für seine Ansichten sogar Verständnis, denn mit seinem durchaus gut laufenden, kleinen Unternehmen sicherte er unserer Familie eine halbwegs sorgenfreie Existenz – fürs Erste jedenfalls, was uns noch blühen sollte, wussten wir da natürlich nicht. Unser Vater war während des Krieges geboren worden und in einem kaputten Land aufgewachsen. Deshalb blieb in seiner Welt vermutlich kein Platz für Träumereien, wie sie ein Teenager wie ich in den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren hatte. Es war eine Zeit, in der man eigentlich auf Bonanzarädern durch die Gegend cruisen, im Café Flipper spielen und zu Hause Loopings von Carrerabahnen aufbauen sollte – und nicht wie ich tonnenweise Leergut sortieren oder den ganzen Dreck des Ruhrschnellwegs von einem Kühllaster schrubben.
Meine ältere Schwester Petra genoss mehr Freiheiten, was aber vor allem daran lag, dass sie als Mädchen logischerweise nicht genauso für Papa schuften konnte wie ich. Trotzdem suchte ich mir meine kleinen Fluchtpunkte: Wann immer sich die Gelegenheit ergab, haute ich ab, um Tischtennis zu spielen. Ein paar Freunde von mir waren im örtlichen Sportverein und nahmen mich irgendwann mit. Obwohl mir den Umgang mit der Pfanne niemand so richtig zeigte und ich mir alle Schläge und Bewegungen selber beibrachte, war ich richtig fit an der Platte und schaffte es mit zarten vierzehn zu den gestandenen Herren in die erste Mannschaft. Das machte mich stolz und hat mich sehr motiviert.
»Das ist doch totaler Quatsch mit diesem albernen Pingpong«, grantelte mein Vater, wenn ich wieder für irgendwelche Frondienste auszufallen drohte, weil ich mit meinen Kumpels ein Turnier spielen wollte.
»Willi, lass doch den Jungen mal ein bisschen abschalten«, versuchte meine Mutter immer zwischen uns zu vermitteln, wenn wir darüber stritten, ob ich am Wochenende ausnahmsweise bei den Bezirksmeisterschaften spielen durfte oder doch wieder mit ihm auf Tour gehen musste. Das machte ich längst regelmäßig, wodurch ich inzwischen Hunderte verschiedenster Gastwirtschaften zwischen Nordhessen und Südniedersachsen kennengelernt hatte. Von der hinterletzten Ranzbude bis zum geschniegelten Feinschmeckertempel war da alles dabei. Ich fand die Einblicke, die ich dadurch in die Branche bekam, spannend. Trotzdem wäre es zwischendurch eine nette Abwechslung gewesen, etwas Eigenes zu unternehmen – und neben der Tischtennis- zum Beispiel meine Karriere als weltberühmter Star-Gitarrist voranzutreiben, von der ich mir einbildete, dass sie gerade Fahrt aufnahm.
Zu Weihnachten hatte ich mir eine E-Gitarre gewünscht und erstaunlicherweise auch von meinen Eltern bekommen – wahrscheinlich, weil meine Mutter meinen Vater dazu überredet hatte. Gitarrenunterricht aber war leider nicht im Geschenk inbegriffen. Wenn abends das ganze Fett in den Regalen verstaut, die Pommes im Kühlhaus untergebracht und die Laster poliert waren und ich mich den allernötigsten Hausaufgaben gewidmet hatte, übte ich ein paar Riffs und die richtige Pose. Einige meiner allesamt volljährigen Vereinskameraden hatten eine eigene Band gegründet und nahmen mich hin und wieder zu den Proben mit. Ich versuchte mir möglichst viel von den Jungs abzuschauen und anschließend zu Hause nachzuspielen. Offenbar besaß ich mehr als einen Funken Talent, denn nach kurzer Zeit schaffte ich einige Akkorde, die halbwegs nach Led Zeppelin oder Deep Purple klangen. Zumindest in dieser Hinsicht lagen mein Vater und ich auf einer Wellenlänge, denn auch er liebte die Musik und hörte mit mir immer Sachen wie Genesis oder melancholischen Jazz, George Benson etwa oder Jean-Luc Ponty. Allerdings beschränkte sich seine Vorliebe tatsächlich aufs reine Zuhören. Warum man selber Musik machen sollte, erschloss sich ihm nicht. Das kostete schließlich viel zu viel wertvolle Zeit, die man doch auch prima mit Arbeit zubringen konnte.
Ich aber bekam meine Chance, der neue Jimi Hendrix zu werden, als in der Band meines Tischtennisvereins von jetzt auf gleich der Gitarrist hinschmiss. Wie das bei großen und kleinen Rock ’n’ Rollern eben so ist, hatte er sich wohl ordentlich mit den anderen gefetzt, machte einfach die Biege und kam danach nicht wieder. Am nächsten Abend war jedoch ein Auftritt in einem örtlichen Club geplant, der ohne Lead-Gitarre natürlich nicht stattfinden konnte.
»Frank, kannst du vielleicht einspringen?«, fragte mich einer der anderen Musiker, und die Unsicherheit war ihm anzumerken. Der hatte mich schließlich noch nie spielen gehört.
»Klar«, sagte ich, »ich kann das.«
Und was soll ich sagen? Ich konnte es wirklich. Durch die monatelangen »Trockenübungen« in meinem Zimmer war ich in der Lage, den Gig so durchzuziehen, dass niemand einen Unterschied bemerkte. Von da an war ich offizielles Bandmitglied. Wir tingelten durch die Gegend und hatten mal fünfzig, mal zweihundert Zuschauer. Das ging eine ganze Weile so und machte jede Menge Bock, aber mein altes Problem setzte meiner Laufbahn als künftiger Gitarrengott dann doch ein jähes Ende: Ich hatte einfach keine Zeit, weil ich zu sehr im Betrieb eingespannt wurde. Schon zum Tischtennistraining zu gehen war jedes Mal ein zäher Kampf, denn mein Vater betrachtete mich mehr oder weniger als Vollzeitkraft – mit dem kleinen Unterschied, dass ich keinen Urlaubsanspruch besaß und auch keinen Lohn bekam, weil ich zur Familie gehörte. Auch er ackerte hart, aber er nahm sich zwischendurch immer mal wieder die Freiheit heraus, mit dem Nachbarn im Getränkemarkt nebenan einen zwitschern zu gehen. Das konnte ich selbstverständlich nicht bringen. Mir hätte es allerdings schon gereicht, beständig zu den Proben marschieren zu dürfen und ein oder zwei Mal pro Monat am Wochenende aufzutreten. Aber auch das war nicht drin, weshalb ich bald wieder draußen war.
Witzigerweise hat mich die Musik dennoch nie losgelassen: »Music was my first love«, sage ich mit John Miles immer – und deswegen mache ich nicht nur hobbymäßig immer mal wieder Musik, sondern betätige mich schon ziemlich lange als Produzent. Das betreibe ich ernsthaft und professionell, aber trotzdem nur aus reinem Spaß an der Freude und sicher nicht zum Geldverdienen. Mit Jaxon Bellina habe ich in der Vergangenheit ein Doppelalbum aufgenommen und mit einer Menge wirklich bekannter Leute aus dem Business zusammengearbeitet, aber das ist eine andere Geschichte.
Damals jedenfalls hatte mein Dasein als Gitarrist einer ambitionierten Schülerband keine Zukunft. Und weil es aus dem Geschäft meines Vaters kein Entrinnen zu geben schien, arrangierte ich mich nach und nach mit der Situation und machte das Beste draus. Ich musste ja auch zugeben, dass der aus Vater und Sohn Rosin bestehende Außendienst samt persönlicher Kundenbetreuung seine guten Seiten hatte. Meistens am Samstag tingelten wir durch die Lande und klapperten der Reihe nach sämtliche Lokale ab, die wir unter der Woche belieferten. Wir erkundigten uns bei den Besitzern danach, was benötigt wurde, nahmen Bestellungen auf oder stellten Neuheiten vor. Und jedes Mal, wenn wir durch den Eingang in einen vollbesetzten Gastraum gingen, pochte mein Herz. Es war seltsam, aber obwohl ich erst dreizehn oder vierzehn gewesen bin, fühlte ich mich in dieser Szenerie unter all den Erwachsenen absolut wohl.
Später, als ich schon viele Jahre mein eigenes Lokal führte, habe ich lange darüber nachgedacht, was genau mich damals so faszinierte. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem: der sprichwörtlich dicken Luft aus Rauch, Schweiß und Essensgerüchen, die jedem einzelnen Restaurant eine ganz eigene Geruchsnote verpasste; dem Geräuschpegel, wenn sich Dutzende Menschen an engen Tischen miteinander unterhielten, lachten, Skat spielten oder stritten; der aufgeladenen Atmosphäre in der stickigen Küche, in der sich nicht selten zwölf Mitarbeiter oder mehr gegenseitig auf den Füßen standen und doch mehr oder weniger koordiniert ihre jeweilige Aufgabe erledigten. Und vor allem begeisterte mich der unantastbare Status des Wirts hinter der Theke, der wie ein Kapitän am Steuerrad an seinem Zapfhahn stand und über die vor ihm liegende raue See wachte.
So anstrengend und manchmal auch frustrierend die ganze Schinderei in unserer Firma war: In diesen Jahren wurde der Grundstein für mein gesamtes späteres Leben gelegt. Niemals hätte ich mich für eine Laufbahn als Koch und später als Restaurantbesitzer und Unternehmer entschieden, wenn ich nicht diese frühen und intensiven Einblicke in die Gastronomie bekommen hätte. Sowohl Einblicke, die mich mächtig beeindruckten, als auch solche, die mich total abschreckten. Ich sah Küchen, die so picobello waren, dass man selbst ein hinter die Spülmaschine gefallenes Schnitzel noch hätte servieren können – und andere, in denen ich nicht für viel Geld auch nur einen einzigen Löffel Suppe versuchen wollte. Ich lernte Wirte kennen, die selbst im größten Chaos noch den Überblick behielten und für ihre Stammgäste viel mehr waren als ein schnöder Dienstleister, nämlich Freund, Beichtvater, Grundversorger und Psychologe. Und andere, die selbst ihr bester Kunde waren und sich und den gesamten Betrieb unaufhaltsam in den Ruin soffen.
In der Schule lief es derweil mehr schlecht als recht. Ständig spürte ich das Gefühl, dass mir das, was ich dort lernte, hinten und vorne nicht reichte. Nicht weil ich intellektuell unterfordert gewesen wäre – ich war weiß Gott kein guter Schüler. Sondern weil das, was dort passierte, mit meinem wirklichen Leben, wie es nach dem Ende der sechsten Stunde begann, im Prinzip rein gar nichts zu tun hatte. Ich konnte mich nicht an den Unterricht anpassen und der Unterricht sich erst recht nicht an mich. Da traf es sich gut, dass wir öfter in der »Waldschenke« von Onkel Gerd einkehrten.
Sie lag nur etwa zehn Autominuten von uns entfernt in Gelsenkirchen-Resse, einem Viertel zwischen Hauptfriedhof und Schloßpark, das sich vom Rest der Stadt dadurch unterschied, dass man plötzlich gar nicht mehr merkte, in einer Bergarbeitermetropole zu sein. Resse verströmte wie Polsum fast dörflichen Charakter, mit viel Landwirtschaft drum herum, kleinen Geschäften und jeder Menge Grün entlang der schmalen Straßen. Das einzig Urbane dort war die »Alte Hütte«, die älteste Disco Gelsenkirchens. Ansonsten kamen die meisten Menschen hierher, wenn sie mal aus dem ganzen stickigen Industriemoloch raus und ein paar schöne Stunden erleben wollten. Die »Waldschenke« selbst war ein uriges zweistöckiges Häuschen mit einer schmucken Fassade, grünen Fensterläden und einem Anbau, unter dessen langem Vordach man im Sommer schattig sitzen konnte – fast wie in einem echten bayerischen Biergarten. Und sie befand sich, wie der Name schon sagte, im Wald. Man konnte sagen, dass sich ein Besuch hier für Gelsenkirchener Verhältnisse beinah wie Urlaub anfühlte.
Pächter Gerd Wenke war eigentlich gar nicht mein richtiger Onkel, aber nachdem ihn meine Eltern schon ewig kannten und er uns auch zu Hause besuchte, nannten wir Kinder ihn eben so. Nebenbei war er ein guter Koch und ein noch besserer Konditor. Dadurch verpasste er seinem Laden einen Ruf als gepflegtes Ausflugslokal, in dem man gemütlich sitzen und prima essen konnte. Es war der Klassiker: Erst bot er einen Mittagstisch, dann gab’s für ein paar Stunden Kaffee und Kuchen, bevor die Abendgäste auftauchten. Eine Menge Holz für den Chef, aber sicher lukrativ.
»Sag mal, Frank – willst du nicht mal bei uns aushelfen? Ich könnte momentan dringend Verstärkung gebrauchen, und für dich springt auf jeden Fall ein ordentlicher Lohn raus«, fragte er mich eines Tages, als wir mal wieder einen Familienausflug nach Resse machten. Ich musste nicht lange überlegen und sagte zu. Mir war zwar klar, dass ich künftig noch weniger Möglichkeiten haben würde, mich mit meinen Freunden zu treffen. Aber etwas Taschengeld extra konnten auf keinen Fall schaden, und außerdem interessierte es mich brennend, wie Gerd seinen Betrieb führte.
Auf der Speisekarte stand gehobene Hausmannskost der guten alten Achtziger, die damals gerade begannen: Züricher Geschnetzeltes, Cordon bleu, Rinderschmorbraten und ähnliche Gerichte, wie sie vor rund vierzig Jahren in deutschen Küchen landauf, landab angesagt waren. Das war vielleicht nicht die ganz feine Klinge, aber deutlich filigraner als das, was sonst im Pott auf den Tisch kam – wie der berüchtigte Schlabberkappes, dicke Bohnen oder Frikadellen mit Kartoffelsalat. Als ich wenige Tage später zum ersten Mal die Küche der »Waldschenke« betrat, bekam ich erst mal einen Schock. Der Raum sah aus, als hätte ihn ein farbenblinder Fliesenleger gekachelt: Vom Boden bis zur Decke war alles gelb und orange, und man wäre nicht darauf gekommen, dass es sich hierbei um die Küche eines Speiselokals handelt – vom Wohlfühlfaktor ganz zu schweigen.
Außerdem wehte mir sofort ein von den vielen Touren mit meinem Vater wohlbekannter Geruch entgegen. Es war ein Geruch, den man nie vergaß, wenn man ihn einmal in der Nase hatte. Das Parfüm der Gastronomie, sozusagen. Obwohl es sauber war, roch es für Außenstehende hier drinnen nicht anders als in den meisten anderen Küchen, nämlich wie in einem Schlachthaus oder einer Sickergrube. Aber für mich war der typische Duft, der sich aus verschiedensten Gewürzpülverchen, stehendem Wasser und kalter Fritteuse zusammensetzte und der über die Jahre in jede einzelne Fuge hineinkroch, ein angenehmes Aroma. Es mag sich jetzt dämlich anhören, aber in diesem Augenblick wusste ich: Ich bin beruflich zu Hause!
Onkel Gerd spannte mich gleich voll ein: Ich servierte, spülte und half in der Küche bei kleineren Vorbereitungsarbeiten. Vom Kochen war ich weit entfernt, aber ich war zumindest schon mal in der Nähe eines Herds. Anscheinend stellte ich mich dabei gar nicht so dumm an, denn einige Zeit später empfahl er mich an seine Schwester Hildegard weiter, die ein paar Kilometer entfernt in Buer eine Gaststätte namens »Klosterschenke« betrieb, in der gerade noch größerer personeller Notstand herrschte als bei ihm selber. Dieses Lokal kannte ich ebenfalls gut, weil mein Vater dort ab und zu sonntags zum Frühschoppen einlief, auf dem ein etwas abgerocktes polnisches Jazzorchester aufspielte. Es gab dort noch mehr zu tun als in der »Waldschenke«, sodass ich mich entschied, nur noch bei Hilde auszuhelfen.
Auch in der »Klosterschenke« sprang ich erst mal überall dort ein, wo ich gerade benötigt wurde. Es machte mir nichts aus, Tische zu wischen oder leere Gläser abzuräumen, im Gegenteil: Die quirlige Atmosphäre, die auch in diesem Gasthaus herrschte, trieb mich förmlich an. Außerdem verdiente ich zusätzlich zu meinem Stundenlohn ein stattliches Trinkgeld. Das konnte nichts schaden, denn mein Vater war leider ein Mensch von dem Schlag, der einem ein altes Fahrrad schenkte, obwohl er eigentlich ein neues Mofa versprochen hatte.
Pächterin Hildegard war groß, kräftig und herzlich – kurzum, eine tolle Frau und vor allem: eine Wirtin, wie sie im Buche steht. So, wie sie mit Gästen und Personal umging, glaubte ich, dass nichts sie erschüttern konnte. Aber ich sollte mich täuschen. Als ich einmal meinen sonntäglichen Aushilfsdienst antreten wollte, empfing sie mich mit vollkommen verheulten Augen und zitternder Stimme.
»Mein Koch kann nicht«, flüsterte sie. »Und gleich kommt eine Hochzeitsgesellschaft mit zwanzig Gästen.«
»Scheiße«, antwortete ich. »Und jetzt?«
»Nix jetzt. Muss ich denen absagen. Am schönsten Tag ihres Lebens fällt die Feier aus. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich bin erledigt.«
Das war in der Tat eine ziemlich aussichtslose Situation, denn ohne Koch kein Hochzeitsessen – zumindest keins, das über belegte Brötchen hinausging, und Lieferando gab’s damals noch nicht.
»Von wegen erledigt«, sagte ich plötzlich entschlossen. »Ich mach das.«
»Du?«, fragte sie und schaute mich ungläubig mit ihren großen Augen an.
»Klar. Wer sonst?«
Und dann marschierte ich in die Küche.
Mein Vater brachte mir einst einen Leitspruch bei, den ich mein gesamtes Leben nicht vergessen würde – und der mir in diesem Moment ziemlich weiterhalf, weil ich ihn immer beherzigt hatte, seit ich ihn das erste Mal von ihm hörte: »Du musst einfach mit den Augen und den Ohren klauen, mein Junge!«, pflegte er immer zu sagen, wenn ich wissen wollte, wie bestimmte Dinge funktionierten. Ich saugte das, was ich über meinen Vater oder bei Onkel Gerd an gastronomischem Know-how mitbekam, auf wie ein trockener Schwamm – so wie zuvor auch die Schläge beim Tischtennis oder die Akkorde auf der Gitarre. Ich merkte mir, wenn ich sah, wie jemand ein Stück Fleisch parierte. Ich prägte mir ein, in welcher Reihenfolge man eine der zwei oder drei gängigen Grundsoßen ansetzte. Und ich wusste, wo in einer gewöhnlichen Küche Teller, Töpfe und Pfannen verstaut waren. Die verschiedenen Arbeitsgänge speicherte ich auf meiner persönlichen Festplatte ab. Dort lagen sie nun bereit, um sie im richtigen Moment abzurufen. Und der war jetzt gekommen.
Natürlich hätte ich der ahnungslosen Hochzeitsgesellschaft kein fünfgängiges Gala-Menü zaubern können. Aber es heirateten an diesem Tag in der »Klosterschenke« zum Glück nicht Prinzessin Diana und Prinz Charles, sondern eine normale Gelsenkirchener Mittelstandsfamilie. Und die wünschte sich zu meinem Glück nicht irgendeinen ausgefallenen Schnickschnack, sondern das weithin berühmte Geschnetzelte mit Pilzen und Kroketten, dessen Zubereitung ich schon Dutzende Male beobachten konnte.