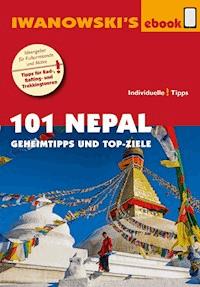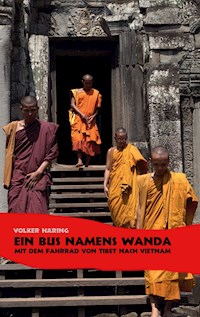
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Mekong ist mit seinen etwa 4.500 Kilometern der zehntlängste Fluss der Erde. Er gilt als Lebensader Südostasiens und fließt durch China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam. Mit Fahrrad, Bus und Boot begleitet Volker Häring den Mekong vom tibetischen Hochland bis in die kambodschanische Tiefebene und erzählt dabei vom Leben entlang des drittgrößten Stroms Asiens. Er trinkt Wein mit in die Jahre gekommenen chinesischen Ministranten, lernt in Laos die Langsamkeit kennen und entdeckt die unbekannten Mekongufer Kambodschas. Eine Reise entlang des Mekongs ist immer auch eine Reise in Umwegen. Die sind mal rührend, mal traurig, meistens aber heiter - und führen immer zum Ziel: Dem Mythos Mekong näher zu kommen. Ohne falschen Pathos und immer mit einem Schuss Ironie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Frau Zornica und meine Kinder Sarah und Nora
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
EIN BUS NAMENS WANDA
WO DIE SONNE UND DER MOND DAS HERZ BERÜHREN.
IN LUFTIGEN HÖHEN
ZU GAST BEI LEHRER LIU
KARAOKE FÜR FORTGESCHRITTENE
HAO JIU!
VON DAOISTEN UND KULTURREVOLUTIONÄREN
VOM PFERD ZUR ZIEGE
12.000 REISBEZIRKE UND EIN SCHREBERGARTEN
GROßE WELT – ENDE DER WELT
LAOS
SAWADII!
ABENDS NUN MIT BELEUCHTUNG: UDOMXAI
SPRITZTOUR MIT MÖNCHEN
VON ALTEN UND NEUEN GEISTERN
BERG‐ UND TALBAHN DURCHS HMONG‐LAND
ZAPFENSTREICH!
INSELHÄNGEN AM MEKONG
KAMBODSCHA
BAMBUSVORHANG OHNE BÄUME
I SAY HELLO, YOU SAY GOODBYE!
AUF DEN SPUREN DER KHMER
ENTGLEIST IN PHNOM PENH
KOLONIALE PATINA
VORWORT
Der Mekong ist ein Mythos. Gehört hat im Westen fast jedes Kind von Asiens drittlängstem Strom und die meisten träumen davon, ihn einmal in Natura zu sehen. Mir ging es da nicht anders und zuweilen fühlte ich mich wie der kleine Tiger bei Janosch: „Oh wie schön ist der Mekong!“ schwärmte ich über Bildern und Landkarten, noch bevor ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Und ja, zuweilen riecht der Mekong tatsächlich von oben bis unten nach Bananen! Und nach Blüten, Kokos und leckerem Essen. Zuweilen aber auch nach Diesel, Abfall und Abwasser. Warum sollte ein Mythos auch vollkommen sein?
Dem Mekong von der Quelle zur Mündung zu folgen, war mein Traum. Schließlich wurde es eine insgesamt knapp über 3.000 Kilometer lange Entdeckungsfahrt, vom Oberlauf in Deqin an der tibetischen Grenze bis nach Phnom Penh, der kambodschanischen Hauptstadt. Die in diesem Buch beschriebene Reise habe ich in vier Etappen zwischen 2003 und 2009 überwiegend mit dem Fahrrad gemacht. Dabei stand das Radfahren aber nicht im Vordergrund. Sicherlich habe ich auch meinen Spaß daran, 2.000 Höhenmeter zu bewältigen und dann ebenso viele bergab zu sausen. Ein Vergnügen, das sich aber für den Leser spätestens bei der wiederholten Beschreibung in Grenzen hält. Das Fahrrad hat daher eher eine Nebenrolle und war für mich Mittel zum Zweck. Denn mit kaum einem Fortbewegungsmittel kommt man den Menschen einer Region so nahe wie auf zwei Rädern. Und darum ging es mir, die Menschen hinter dem Mythos Mekong kennen zu lernen. Das sind nicht nur Tibeter, Chinesen, Laoten und Kambodschaner, sondern auch die vielen kleinen Minderheiten entlang des Mekongs, Volksgruppen, von denen im Westen kaum jemand gehört hat. Menschen, die am und vom Mekong leben oder in seinem Einzugsbereich.
Allerdings: Entlang des Mekongs – das klingt einfacher als es ist. In China gibt es gerade einmal auf 300 Kilometern eine Uferstraße, in Laos hält das Straßennetz zumeist einen Anstandsabstand von einigen Kilometern zum Fluss. Nur in Kambodscha konnte ich dem Fluss wirklich am Ufer folgen – dann aber auch nicht auf Straßen, sondern brüchigen Feldwegen.
Entlang des Mekongs konnte also nur eine Grobrichtung sein, ein geografischer Pfeil in Richtung Süden. Ich folgte einer Lebensweise, einer Kultur, die maßgeblich vom Mekong beeinflusst ist – jenseits von Landes‐ und Sprachgrenzen.
Beim Mekong denkt man gemeinhin an Palmen, Kolonialarchitektur und tropische Früchte: Südostasien eben. Das hat auch etwas mit der Entdeckungsrichtung des Mekongs zu tun: Sie verlief immer von der Mündung in Richtung Quelle, von Vietnam nach China, und über die subtropische Vegetationslinie schafften es die Wenigsten. Dabei entspringt der Mekong, wie fast alle anderen berühmten Flüsse des asiatischen Kontinents, im Himalaja und fließt immerhin fast die Hälfte seiner Länge durch China, meist durch enge Schluchten, umgeben von schneebedeckten Bergen. Klein, klar und reißend ist der Mekong dort, und will so gar nicht seinem Klischee entsprechen. Unter anderem deshalb wollte ich meine Reise dort beginnen und dem Mekong flussabwärts folgen.
Noch vor 100 Jahren hatte eine Reise am Mekong entlang Expeditionscharakter. Krankheiten, feindlich gesinnte Völker und das Klima machten das Reisen am Fluss zu einer Tortur. Heute kreuzen Fünf‐Sterne‐Schiffe durch das Delta, der Mekong scheint entzaubert, bezwungen.
Jenseits der Fassade hat der Fluss aber nicht von seiner Faszination eingebüßt. Der Alltag am Mekong birgt heute das Abenteuer. Der Rest ist ein Mythos.
EIN BUS NAMENS WANDA
„Mashang! Ist das jetzt ein Yunnan‐Mashang, ein Peking‐ Mashang oder ein Shanghai‐Mashang?!“ Der alte Mann, dessen Hornbrille noch größer als sein rundes Gesicht ist, blickt erwartungsfroh in die Runde. „Mashang ist ja ein vielfältiges Wort!“, legt er nach. Auf die Frage, wann denn der längst überfällige Bus nach Zhongdian kommen würde, hatte der Fahrkartenverkäufer „Mashang jiu daole!“ geantwortet, „Er wird gleich kommen!“ Gleich, mashan geben, eines dieser Wörter, die sich mit gutem Gewissen wirklich nur in „alles zwischen einer Minute und einer Ewigkeit“ übersetzen lassen. „Peking‐Mashang heißt in der Regel zehn Minuten, Shanghai‐Mashang heißt wirklich Mashang, also alles unter fünf Minuten!“, zieht der alte Chinese unbeirrt seine rhetorisch‐philosophischen Kreise. „Wir haben es hier also mit einem typischen Yunnan‐Mashang zu tun, das mit den Guizhou‐ und den Hunan‐Mashangs zu den langsamsten des Vaterlandes gehört. Ein Yunnan‐Mashang ist, wie soeben bewiesen, mehr als eine Stunde!“
Ehe die anderen potentiellen, dem philosophischen Exkurs ziemlich indifferent gegenüberstehen Fahrgäste einen Kommentar abgeben können, hupt eine Schiffssirene um Aufmerksamkeit und unsere Köpfe schnellen in Richtung des Wunderhornes. Was da rumpelnd und hupend auf uns zukommt, bleibt deutlich hinter seinen akustischen Fähigkeiten zurück und lässt Zweifel aufkommen, ob es der anspruchsvolle Strecke bis ins auf 3.200 Metern gelegene Zhongdian gewachsen ist. Immerhin, „Wanda Che“ steht da in frischer Farbe auf der Seitenfront. „Ein Bus namens Wanda“, übersetze ich murmelnd vor mich hin und versuche die Aufmerksamkeit des Beifahrers zu erregen, der für das Ein‐ und Ausladen zuständig ist. Der versucht, mich und mein Fahrrad geflissentlich zu ignorieren. „Shifu, Meister“, spreche ich ihn an und er gibt ein wissendes Grunzen von sich. „Kannst Du mit in den Bus nehmen!“, sagt er, ohne aufzuschauen. „Meister!“, sage ich nun mit leichter Ungeduld und schließlich erhebt sich der Shifu aus seinem gefederten, weil wacklig in der Luft hängenden Beifahrersitz, geht zum Heck des Busses und zieht eine Eisenleiter vom Dach. Ich reiche ihm mein Rad, das er umständlich in der Luft umdreht. „Pass auf die Schaltung auf“, rufe ich ihm zu, kurz bevor das Schaltwerk auf das Eisen des Dachgepäckträgers knallt. Am Morgen war ich mit dem Nachtzug aus Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, im 400 Kilometer entfernten Dali angekommen. Yunnan, Chinas Vielvölkerprovinz im Südwesten des Landes liegt an den südlichen Ausläufern des Himalayas auf durchschnittlich 2.000 Metern Höhe. Vor zehn Jahren war die Strecke Kunming‐Dali noch ein zwölfstündiger rumpliger Bustrip, heute braucht selbst die Bummelbahn gerade mal sieben Stunden. Dali, die legendäre Backpacker‐Metropole, mit der in den frühen 1990er Jahren Pizza und Banana Pancake den Einzug ins Reich der Mitte gehalten haben, wird in zwei Wochen noch einmal ein längerer Stopp auf meine Reise sein, jetzt geht erst einmal Richtung Oberlauf des Mekong. Zhongdian ist mein Etappenziel, das ich mit dem Bus ansteuere. Mehr als 5.000 Höhenmeter auf knapp über 200 Kilometern ist mir für den Anfang mit dem Fahrrad eindeutig zu viel.
Mein Busticket verspricht die Sitznummer 1, die sich dann aber direkt über dem hinteren Radkasten befindet. Die Sitze in der ersten Reihe tragen die Nummern 26 und 14, wobei letztere Zahl wohl ein Omen ist. Yaosi, geh zum Teufel, kann man die 14 auch aussprechen, und hiermit ist verbal vorweggenommen, was den Sitzplatzinhaber bei einer Vollbremsung erwartet. Wobei die Kombination Yaosi Erliu(14‐26) auch mit viel gutem Willen als „Er ist verdammt und hat es dennoch geschafft!“ gelesen werden kann. Man könnte meinen, die Busgesellschaft hätte sich etwas bei der Zuordnung der Nummern gedacht. Die Abfahrt verzögert sich trotzdem, da einige Chinesen auf ihre Sitznummern bestehen, während andere wohl nichts von Zahlenmystik halten. Auf der Rückbank sitzt eine Gruppe junger Tibeter und grinst. Der Busfahrer mahnt zur Eile und der Philosoph murmelt ein Mashang jiuzou. Gleich wird es losgehen! Endlich schließt sich die pneumatische Tür auf den dritten Versuch mit einem lauten Seufzer und der Fahrer würgt mit ohrenbetäubendem Knarzen den ersten Gang ins Getriebe. Eine Minute Schwung holen und dann ist mein Bus namens Wanda eher Känguru als Fisch und hüpft munter von Schlagloch zu Bodenwelle. Jeden Schlag bekomme ich über die butterweiche Federung direkt auf meine Wirbelsäule. Die neugebaute Straße zwei Kilometer tiefer im Tal sei zwar ungleich besser, koste aber Maut, erzählt grinsend der Beifahrer, der für den Sozialkontakt an Bord zuständig ist und mich als einzige Langnase im Bus als primären Gesprächspartner ausgemacht hat. Besser gesagt, als Zuhörer. Dafür hat er sogar seinen bequemen Sitz neben dem Fahrer verlassen und sitzt mir nun halb auf dem Schoß. Kaum habe ich ihm erzählt, dass ich aus Deutschland komme, rattert er etwas herunter, dass wie Rummenigge‐Matthäus‐ Beckenbauer‐ Hitler‐Daimler Benz klingt. Also Lu‐me‐ni‐ge, Ma‐te‐you‐si, Bei‐ken‐bao‐er, Xi‐te‐le, Ben‐che. Dazu geht dann der Daumen nach oben und ich spare mir die Bemerkung, dass Hitler nicht nur als Fußballer eine Null war – für die meisten Chinesen übt das Dritte Reich nun mal einen gewaltigen Reiz aus. Das kleine Deutschland gegen die ganze Welt, da findet sich manch ein Chinese wieder, auch wenn das Reich der Mitte natürlich nicht gerade ein kleines Land ist. Aber im Selbstverständnis eben auch allein gegen den Rest der Welt steht. „Aber Hitler war doch ein großer Führer!“, insistiert der Beifahrer, als er meine angeekelte Grimasse sieht. Da ich nicht weiß, wie man Gröfaz auf Chinesisch übersetzt, frage ich ihn nach Chiang Kai‐shek, den in der VR China meist eher gehassten großen Gegenspieler Mao Zedongs und erfahre, dass er auch den gut findet. Am besten gefällt ihm aber Helmut Kohl, der hätte Maos Leibesfülle gehabt. Dann grinst er, hält mir zwei Zigaretten ins Gesicht, dessen bodenwellenbedingtes Wippen direkt unter meiner Nase mich etwas schwummrig macht. „Tingle!“,Hab’ aufgehört!, versuche ich die höflich‐bestimmte Variante der Ablehnung. Als Nichtraucher ist man in diesen Breitengraden kein vollwertiger Mann, als Ex‐Raucher aber ein echter Kerl, weil man es geschafft hat, aufzuhören. „Ich schaff das nicht!“, entgegnet der Beifahrer, der auf den schönen Namen Liu hört, neben Wang und Zhang der chinesische Meier.
Nach einer Stunde Gehüpfe und Geruckel erreichen wir das nördliche Ende des Erhai‐Sees. Ein halbverfallener Wachturm erinnert an die glorreiche Vergangenheit des Örtchens Shaping, das, als es noch Shangguan, der Obere Pass, hieß, wichtigste Zollstation am oberen See war. Die Karawanen der Teestraße kamen hier vollgepackt aus Lhasa an und mussten ihren Obolus entrichten, bevor sie ihren Weg über Dali in Richtung Indien und Südostasien fortsetzen konnten. Zuweilen wurde die wertvolle Fracht auch auf Dschunken umgeladen, die sie dann auf dem Erhai, den Ohrensee, nach Xiaguan am Südufer brachten. Heute tummeln sich nur noch einige vereinzelte Ausflugs‐ und einige Fischerboote auf dem See, Motorboote sind streng reglementiert, nachdem der Erhai Ende der 1990er ob seiner Verschmutzung negative Schlagzeilen machte. Das war schlecht für den gerade aufkeimenden Fremdenverkehr und so griff die Umweltbehörde der Provinz zu drastischen Maßnahmen. Sprich: Die Touristenströme wurden auf große staatliche Ausflugsboote verfrachtet und die Fischer, die sich vor allem mit der Beförderung von Backpackern eine kleines Zubrot verdienten, gehen seitdem fast leer aus.
Die Straße ist, seit wir das Tal des Erhai verlassen haben, deutlich besser geworden. Zur Fahrgeschwindigkeit trägt dies nur unwesentlich bei, da gerade Erntezeit ist und die Bauern die Staatsstraße zum Trocknen und Dreschen des Korns verwenden. Das ist so praktisch wie verboten, aber wer legt sich in China schon gerne mit ein paar Tausend Bauern und der Tradition an. Von einem Verbotsschild am Straßenrand mit der Aufschrift „Missbraucht nicht die Straßen – öffentliches Eigentum ist Volkseigentum!“ hängt eine Dolde Maiskolben neben knallroten Chilischoten zum Trocknen. „Su zhi tai di, den Bauern fehlt es an Bildung!“ bemerkt der Beifahrer und rotzt in den Mittelgang. Der Fahrer gibt Gas und verlässt sich auf die Warnwirkung seiner Hupe. Da alle anderen Fahrer das aber genauso machen, stört sich keiner mehr an der Hupkakophonie und die Bauern schlichten in aller Seelenruhe das fertig gedroschene Getreide um. An der Ortseinfahrt von Niujie, zur Karawanenzeit noch wichtige Übernachtungsstation, heute ein schäbiges Straßendorf, prunkt ein großes Propagandaplakat, mit der chinesischen Fahne, Deng Xiaoping und dem Spruch „Nur der Fortschritt ist ein harte Tatsache!“. Direkt dahinter hört die asphaltierte Straße für ein paar Kilometer auf und führt dann mit runderneuerter Teerdecke in die Berge. Die Ortschaften und damit die zerealen Hindernisse werden seltener und der Fahrer schaltet zum ersten Mal in den vierten Gang. Leider. Er lehnt sich in die engen Kurven, als säße er auf einem Motorrad. Tatsächlich fühlt es sich in einigen Serpentinen so an, als würden die dem Abgrund gegenüberliegenden Räder abheben. Weil es sein Fahrgefühl fördert, schiebt der Busfahrer eine Kassette mit Kantopop in die Anlage und aus von der Lautstärke vollkommen überforderten Boxen schmalzt eine männliche Stimme, dass sie ihn doch endlich verstehen sollte. Die weibliche Antwort lässt nicht lange auf sich warten und so plätschert das Lied als Duett dahin, gefolgt von einer Auswahl weiterer chinesischer Schlager. Nach einer halben Stunde chinesischer Schnulzen aus dem Perlflussdelta arbeitet sich einer der Tibeter durch den mit Gepäck vollgestellten Gang nach vorne und hält dem verdutzten Fahrer eine Kassette unter die Nase. „Liebesgesänge, tibetische!“ sagt er grinsend. Der Busfahrer dreht sich in den Fahrgastraum um und fragt, ob die anderen Passagiere das hören möchten, wohl in der Hoffnung, ein „Nein“ als Antwort zu bekommen. „Warum nicht!“, ruft eine Chinesin in der dritten Reihe und ich schließe mich an. Der Philosoph sagt, die tibetischen Gesänge sollte man Mashang hören und der Busfahrer versteht dies als Shanghai‐Mashang und wechselt die Kassette. So wie ich den Philosophen und Sprachkünstler einschätze, könnte er Mashang auch im Wortsinne gemeint haben: „Zu Pferde, mashang, sollte man diese Musik hören!“ Wobei das Wortspiel wohl eher rhetorisch als abschätzig gemeint ist. Für dem Chinesen, auch den gebildeten, sitzen die Tibeter eben idealtypisch auf Pferden, tragen Cowboyhüte und trällern Lieder. Es ertönt ein herzzerreißender A‐capella‐Gesang, gerade als wir die Passhöhe erreicht haben, der Fahrer auskuppelt, den Motor abstellt und den Bus die stark abschüssige Straße hinab rollen lässt. Einige tibetische Liebesschwüre später, nach einigen engen Kurven, die wir mit gefühlten 80 Stundenkilometern durchjagen, ohne dass der Fahrer den Fuß auch nur in der Nähe der Bremse zu haben scheint, glänzt im Tal ein träge dahinfließender Fluss in der Sonne. Eigentlich möchte ich ja zum Mekong, jetzt gebe ich mich vorerst aber auch mit dem Yangzi zufrieden. Der liegt quasi auf dem Weg und war, wie Geologen festgestellt haben, vor 20 Millionen Jahren ja auch nicht mehr als ein Nebenfluss des Mekong. Drei der gewaltigsten Flüsse Asiens, der Salween, der Mekong und der Yangzi laufen hier auf mehr als 100 Kilometern parallel zueinander, getrennt durch bis zu 6.000 Meter hohe Bergketten. Nur der Yangzi stößt in Shigu an eine Berggranitwand und dreht in Richtung chinesisches Kernland nach Osten ab.
„Aussichtspunkt“, kündigt rechter Hand ein großes Schild an, und prompt hält Wanda am Straßenrand, der Beifahrer füllt in einer improvisierten Raststätte Wasser nach, die männlichen Passagiere wässern den Straßengraben und die Frauen kaufen ein paar Äpfel, die direkt vor dem Yangzi‐ Blick von Bauersfrauen unter großen roten Schirmen mit der Aufschrift „Coca Cola“ angeboten werden. „Das ist die erste Biegung des Yangzi!“ gibt Liu den Fremdenführer, „ohne diese Schleife des Flusses gäbe es China wahrscheinlich nicht!“ Tatsächlich würde der Yangzi ohne diese und eine weiter abrupte 180 Grad Kehre im Norden Lijiangs direkt in Richtung Süden fließen und schließlich in den Mekong, was er zu Urzeiten auch tat. Dann säße China heute auf dem Trockenen. Während ich die Aussicht bewundere und meine, Shigu in der Ferne erkennen zu können, zupft ein Naxi‐Bauer in blauer Arbeiterkluft und ‐mütze an meinem Ärmel und hält mir einen Korb Steinpilze unter die Nase. Die Pilze duften herrlich, und für einen Augenblick bin ich versucht, zuzugreifen und für den Abend ein Restaurant zu suchen, das sie mir zubereitet. Da augenblicklich aber Pilzsaison ist und jedes Restaurant eine Auswahl von mindestens drei frischen Pilzsorten im Angebot hat, nehme ich von der Idee wieder Abstand. Schließlich greift der Fahrer zu. „Bringe ich meiner Frau mit!“, sagt er, „die bereitet die Pilze wunderbar mit Knoblauch und grüner Paprika zu!“ Mir läuft bei dem Gedanken das Wasser im Mund zusammen, ich beruhige mich mit einem Apfel und der Hoffnung auf eine baldige Mittagspause. Die folgt nach einer weiteren halsbrecherischen Abfahrt ins Yangzi‐Tal in Qiaotou. Qiaotou liegt am westlichen Ende der Tigersprungschlucht, die sich im Norden Yunnans zwischen den Jadedrachenschneeberg und den Haba‐Schneeberg in den Granit gefressen hat. Hier heißt der Yangzi noch Jinshajiang, Goldsandfluss, und zwängt sich auf knappe 30 Kilometer durch eine 3.900 Meter tiefe Schlucht, die an ihrer engsten Stelle am Talboden gerade einmal 20 Meter breit ist. „Banana Pancake!!!“ schreit es von einer der Cafétafeln. Unser Bus biegt jedoch in einen schmuddeligen Innenhof gegenüber, reiht sich in einem geschickten Manöver neben zwei weiteren Wandas, anscheinend die Lieblingsmarke der Yunnaner Busunternehmen, ein und spuckt uns mit einem Seufzer in eine Schlammpfütze. „30 Minuten Pause! Geht auf die Toilette und esst was!“, schreit Liu uns hinterher. Die Toilette ist ein offenes Loch, das direkt in den kleinen Zhongdian‐ Fluss abfällt. Das Restaurant ein Loch in einer Badezimmerfliesen gekachelten Wand, das einen starken Öl‐ und Knoblauchgeruch verströmt. Die lokale Yakfleisch‐ Nudelsuppe schmeckt allerdings erstaunlich gut und ist so reichhaltig, dass ich die Stäbchen schon nach der halben Schüssel zur Seite lege. Derweil schlürfen meinen Mitreisenden Nudelsuppen mit Heißhunger und laben sich an allerlei Kurzgebratenem. Nach fünf Minuten ist das Yakfett in meiner Suppenschüssel geronnen und sieht weniger appetitlich aus, eher wie etwas, das ich mir für lange Radetappen prophylaktisch auf das Hinterteil schmieren könnte. Yakfett soll ja gesund für die Haut sein. Bevor das Yakfett Wurfqualitäten bekommt, hupt der Busfahrer zum Aufbruch, 45 Passagiere drängen sich durch die enge Tür, wir rangieren eine gute Viertelstunde aus dem Innenhof heraus und nehmen dann, nun wieder stramm bergauf, langsam aber stetig Fahrt auf. „Hier gibt es auch eine neue Straße!“, raunt mir Liu mit einem Grinsen zu. „..aber ich wüsste ja!“ 20 Yuan Maut für zwei Stunden Fahrtzeitersparnis lohnt eben nicht. Diesmal bin ich über die Wahl der alten Straße aber nicht unglücklich. Während die neue Straße (Highway steht an der Abzweigung) größtenteils durch eine langen Tunnel führt, schlängelt sich die alte, etwas derelikte Straße über mehr als 50 Serpentinen fast 2.000 Meter in die Höhe. Wir folgen dem kleinen Zhongdian‐Fluss, der als reißender Bergbach in mehreren Wasserfällen und vielen Wildwasserpassagen durch eine dichtbewaldete Schlucht in Richtung Yangzi stürzt. Rhododendron blüht an den Hängen inmitten von dichtem Mischwald, dessen Baumstämme an der Nordseite von Flechten bedeckt sind. Die Baumgrenze liegt in Nordyunnan bei knapp 4.000 Metern Höhe, selbst in höheren Lagen trotzen noch einige knochige Nadelhölzer den Elementen. Bauern transportieren tief gebeugt Brennholz auf dem Rücken, notdürftig mit einfachen Stricken auf wackelige Gestelle geschnallt. Die engen Serpentinen nötigen selbst unserem Busfahrer Respekt ab, unvergleichbar vorsichtig geht er die Kurven an, schleicht den Pass hoch und gibt nur dann unnachgiebig Gas, wenn er für eine besonders steile Rampe Schwung braucht. Ein letztes Stöhnen der Federung, ein Rumsen durch ein Schlagloch und schon ist nach fast drei Stunden die Passhöhe erreicht. Die Tibeter auf der Rückbank stimmen ein Lied an. Auf der rechten Seite begrüßt uns eine weiße, mit Gebetsfahnen behängte Stupa im tibetischen Kulturraum. Von der Passhöhe führt eine breit ausgebaute Straße durch weites Grasland direkt nach Zhongdian. Nach insgesamt 250 Kilometern und acht Stunden Fahrtzeit empfängt uns eine dreisprachig chinesisch, tibetisch und englisch gehaltene große Tafel, die fröhlich tanzende Tibeter in Lokaltracht vor Schneebergen zeigt, in Shangri‐La, wie Zhongdian neuerdings heißt, das „Land, in dem die Sonne und der Mond das Herz berühren.“
WO DIE SONNE UND DER MOND DAS HERZ BERÜHREN.
„Sie haben die Stadt tibetisiert!“, sagt Uttara, die Sales Managerin des Gyalthang Zang Hotels mit einem ironischen Lächeln. „Chinesische Häuser mit tibetischer Fassade!“ Also quasi Lei‐Fengsche‐Dörfer. Lei Feng, das war der chinesische Mustersoldat, der in den 1960er Jahren jedem Untertanen im Reich der Mitte als Vorbild gepriesen wurde. Xiang Lei Fang xuexi!, von Lei Feng lernen, meinte wörtlich, den Kameraden die Socken zu stopfen, die Schriften Mao Zedongs in‐ und auswendig zu können und seinen Sold der Garnison zu spenden. In der Propaganda stand Lei Feng für die gelebte sozialistische Idee, Altruismus und war – zumindest in den Köpfen der leitenden Kader ‐ integrierendes Element der chinesischen Gesellschaft. Eine fabrizierte Gestalt, wie viele heute vermuten.
Zhongdian ist nun eine Musterstadt, Shangri‐La eine Musterregion und dient den chinesischen Behörden als Utopia, als Beweis, wie das Zusammenleben zwischen Tibetern und Chinesen funktionieren kann. Oder besser gesagt, das Zusammenleben von Tibetern, Chinesen und Touristen im Sinne des guten Profites. Nun heißt Zhongdian also Shangri‐la, nach dem mythischen Paradies einer tibetischen Sage, die der amerikanische Autor James Hilton in den 1930er Jahren als Vorlage nahm, um in seinem Roman „Lost Horizont“ eine christlich‐buddhistische Utopie im Himalaya zu kreieren: Ein unzugängliches Bergtal im Schatten eines Eisriesen, in dem westliche und östlich Ideen unter der Ägide eines katholischen Abtes eine gewinnbringende Synthese eingegangen sind. Auf der Flucht vor einem Aufstand in Nordindien besteigt der amtsmüde britische Diplomat Convey ein Flugzeug, das ihn und seine drei Mitreisenden in Sicherheit bringen soll. Stattdessen entführt der Pilot die Maschine und steuert sie über die Bergriesen des Himalayas in ein abgeschiedenes Hochtal, in dem ein einsames Kloster liegt: Besagtes „Shangri‐La“. Im Anflug seines Helden auf das gelobte Land beschreibt Hilton einen großen Strom, der, und da sind sich die Exegeten einig, als der Mekong gedeutet werden kann.
Xuan Ke, Zeremonienmeister und gnadenloser Selbstdarsteller des berühmten Naxi‐Orchesters in Lijiang, einer alten Karawanenstadt etwa 150 Kilometer von Zhongdian entfernt, war angeblich der erste, der das mythische Shangri‐La in Zusammenhang mit der Region gebracht hat. Wahrscheinlich dachte er dabei eher an seine Heimatstadt Lijiang, die mit dem Jadedrachenschneeberg einen schneebedeckten Bergriesen vor den Stadttoren hat und so der Beschreibung in James Hiltons „Lost Horizont“ entspricht. „Zu weit weg vom Mekong!“, schrien die Möchtegern‐Shangri‐laer von Sichuan bis Tibet und brachten die eigenen Städte und Regionen ins Gespräch. Nun hat eben Dechen den Zuschlag bekommen; und das liegt im Verwaltungsbezirk Diqing, dessen Kreisstadt Zhongdian ist. Heutzutage heißt alles Shangri‐la, das macht es zumindest für den Sprachunkundigen einfacher. Wer möchte sich schon den Unterschied zwischen Diqing und Dechen merken oder gar aussprechen.
Seit Ende der 1990er Jahre managed Uttara das Gyalthang Zang Hotel. Die Idee war eine große: Eine nachhaltig geführte Herberge, die die tibetische Kultur fördert; ausgerichtet auf eher zahlungskräftigeres Klientel. Die Realität sah anders aus: Aus Geldmangel wurde vor allem an den Sanitäranlagen gespart. 50 US $ für kaltes Wasser auf knapp über 3.200 Metern Höhe bei gut 100 Frosttagen im Jahr, das bekam selbst den wohlwollensten Gästen auf Dauer nicht. Und der rußende, kohlebefeuerte Heizungsofen in der Waschküche des Hotels sah beim besten Willen nicht umweltfreundlich aus. Nach Komplettsanierung 2003 hielten dann mit einer großzügigen Investition der singapurianischen Banyan‐Tree‐Gruppe endlich neben stilvollem Ambiente auch funktionierende Nasszellen den Einzug in das Hotel, das sich nun zu einem der interessantesten Boutiquehotels des Ortes gemausert hat. Und lokale Vorbildfunktion hat. Ehemalige chinesische Standardbettenburgen wurden tibetische Fassaden verpasst, Familien öffneten ihre Häuser für Individualtouristen und vom Dalai‐Lama‐Breakfast über tibetischen Buttertee bis hin zu tibetischen Feuertopf haben nun auch die Gerichte in den Garküchen und Restaurants einen vorher kaum gesehenen Lokalkolorit. Fehlt nur noch ein Drink mit dem Namen „Lost Horizont“! Ein Yak‐Steak „Shangri‐la“ gibt es bereits.
Die Umbenennung von Zhongdian in Shangri‐la hat dem Ort also zumindest wirtschaftlich nicht geschadet. Relativ pragmatisch sieht Uttara daher auch den ganzen Rummel um die Verortung des vermeintlichen Paradieses. „Immerhin, den Bürgermeister von Zhongdian haben wir so schon überzeugen können, dass der alte tibetische Teil der Stadt bewahrt wird“!, erzählt sie bei einem Glas tibetischen Rotwein mit Hirse, der so schmeckt, als hätte man einen Tetrapack Rotweinfusel mit billigem Korn vermischt. Auf dem Etikett steht „Tibetan Dry Wine“ und „Shangri‐La“. Uttara, Inderin mit kosmopoliten Wurzeln, trinkt Schwarztee mit Milch und Zucker.
In Zhongdian habe ich mich mit Andreas, meinem Bandkollegen aus Berlin, getroffen, der mich die nächsten zwei Wochen auf dem Rad begleiten wird. Die große Höhe und ein Rest‐Jet‐Lag machen uns beiden zu schaffen. Trotzdem schwingen wir uns am nächsten Tag auf unsere Fahrräder und nehmen Kurs auf das Songzanlin‐Kloster, das etwa fünf Kilometer nördlich der Stadt gut sichtbar auf einem Berghang thront. Auf dem Weg dorthin fahren wir die Hauptstraße des Ortes entlang.
Zhongdian hat tatsächlich etwas von einer Westernstadtkulisse. Nicht nur, dass uns mehrmals eine Gruppe Tibeter in Tracht auf Pferden entgegenkommt; die Häuser sehen zudem aus, als beständen sie nur aus Fassaden. Vorne tibetische Ziselierungen, dahinter chinesische Einheitsbauweise: Windschiefer Beton, die Zwischenräume mit verputzten Ziegeln ausgefüllt. Ein Hauch Disney wehte durch die Stadt, wären da nicht immer die Einbrüche der manifesten Realität in das Shangri‐la‐Image. Verrostete Minibusse rasen laut hupend auf schwarze Abgasschwaden knatternd in die Luft schleudernde Traktoren zu. Dazwischen kämpfen Fußgänger, mobile Marktstände und Kühe um ein Stück Straße. Orange‐uniformierte Straßenkehrerinnen versuchen, mit riesigen Reisigbesen den immer wieder aufgewirbelten Staubwolken Herr zu werden und verteilen den Dreck damit von einer Straßenseite auf die andere.
Der Markt, etwas versteckt in einer riesigen offenen Wellblechhalle am nördlichen Ende der Hauptstraße, sieht aus, als wäre Tourismus ein fernes Echo aus einer andern Welt. Nur die kleinen, unaufgeräumten, selbstgezimmerten Stände mit Tibetnippes verraten etwas von einer bescheidenen Ausrichtung auf finanzkräftige Langnasen, die ihren imaginären Teil von Tibet mit nach Hause nehmen wollen. Ansonsten regiert hier der Alltag: Allerlei Haushaltsgegenstände, Tonnen von Gemüse, lokales und mit viel Aufwand aus Sichuan und den wärmeren Teilen Yunnans hierher transportiertes. Eine Art Baumarkt mit simplen Holz‐ und Plastikmöbeln, ein Wahrsager, ein Zahnarzt, der die gezogenen Zähne seiner Klienten als Zeichen seiner Arztkunst auf einem Batiktuch ausbreitet und ein gutes Dutzend von Garküchen, die mit verführerischem Duft zum Verweilen einladen.
Wir setzen uns an einem der Garstände auf gerade einmal 10 Zentimeter hohe hölzerne Stümmelbänke und probieren uns mit wachsender Begeisterung durch das Marktangebot. In Kombination mit den 30 Zentimeter hohen Tischen geht das erstaunlich gut. Der erste Gang besteht aus Maultauschen mit Yak‐Gemüse‐Füllung, die direkt vor unseren Augen frisch hergestellt werden. Dann schlürfen wir eine Nudelsuppe mit Yakfleisch, die gar nicht erst die Chance hat, zu gerinnen, so schnell ist sie im Magen verschwunden. Und als Krönung gibt es Zhongdian – nein nicht Yak, sondern – Ente. Das schmackhafte Federvieh wird in großen als Backofen umfunktionierten Ölfässern goldbraun gebacken. Alle paar Minuten holt die Köchin die noch vollständigen Enten mit einem großen Eisenhaken am Hals an die Luft und prüft den Backfortschritt. Wenn die Ente gar ist, kommt sie auf ein großes Holzbrett und wird mit dem Hackebeilchen kurz und klein geschlagen. Handgranatenfleisch. Das hinterlässt Knochensplitter in fast jedem Happen, die das Essen ein wenig mühsam machen, der saftig‐knusprige Geschmack wiegt das aber bei Weitem auf. Nach der ersten Ente schauen uns Andreas und ich kurz an, lachen, und bestellen dann unisono eine zweite. Bergluft macht hungrig!
Und schwere Beine. Oder ist es der volle Magen? Schon der leichte Anstieg zum Songzanlin‐Kloster hat uns mächtig ins Keuchen gebracht. Nun stehen wir vor einer steilen, etwa einhundert Meter langen Treppe, die zur den Hauptgebäuden des Songzanlin‐Klosters führt. Das historisch an der Grenze des Einflussbereiches des Panchen und des Dalai Lamas gelegene, im 17. Jahrhundert gebaute Kloster ist eines der bedeutendsten lamaistischen Klöster außerhalb des tibetischen Kerngebietes. Die dem Potala in Lhasa nachempfundene Anlage beherbergte zu Hochzeiten mehr als 3000 Mönche. 1980, kurz nach Ende der Kulturrevolution waren es gerade mal 30 Robenträger.
Namkha, ein tibetischer Reiseleiter aus Zhongdian, nimmt uns unter seine Fittiche und erzählt ein wenig über Geschichte und Aufbau des Klosters. „Auf dem 500 Mu1 großen Areal sind neben den Hauptgebäuden auch die Gesandtschaften der einzelnen Kreise Shangri‐Las untergebracht. Diese befinden sich in den kleinen Flachbauten, die sich beiderseits der zentralen Treppe den Klosterhang hinauf befinden.“ Wir nehmen seine Erklärung zum Anlass, eine kurze Pause einzulegen, nach Luft zu ringen und die Aussicht zu bewundern. „An der Spitze der Treppe steht linkerhand das erst im Jahre 2004 wiederhergestellte Gebäude des Zhaji‐Tempels. In seinem Inneren blickt eine etwa 20 Meter hohe Figur des Gründers der Gelbkappensekte, Tsongkapa wohlwollend auf die Gläubigen herab.“, setzt Namkha seine Ausführungen fort. Sie klingen ein wenig auswendig gelernt. Ehrfürchtig betreten wir die linke Halle und blicken in die Augen einer riesigen, zur Hälfte vergoldeten Figur. Überall in der Halle wird gehobelt, gehämmert und gesägt. „Die Tsongkapa‐Figur bauen sie jetzt schon zum zweiten Mal!“, flüstert Namkha uns ins Ohr. „Das erste Mal haben die Handwerker gefuscht und die Figur ist nach einigen Tagen umgestürzt!“ Er fixiert uns kurz. „Kein gutes Omen!“, sagt er mit ernstem Gesicht. Tatsächlich wird das weder den Chinesen noch den Tibetern gefallen haben, die sich bei allen Differenzen untereinander auf jeden Fall eines teilen: Den Aberglauben. Eine eingestürzte religiöse Figur, ein kollabierendes Tempelgebäude oder eine große Naturkatastrophe, das sind so ziemlich die deutlichsten aller Zeichen, dass etwas im Diesseits nicht stimmt und das Jenseits darüber gar nicht erfreut ist. Als Ende des 19. Jahrhunderts in Peking die Halle des Ernteopfers abbrannte, wusste jeder im Lande, dass der Zusammenbruch der Qing‐Dynastie nahe ist. Das Ende der Ära Mao Zedongs wurde so 1976 auch durch ein verheerendes Erdbeben eingeläutet.
„Vielleicht gefiel Tsongkapa die Umbenennung Zhongdians in Shangri‐la nicht?!“, versuche ich die Stimmung ein wenig aufzulockern. „Das echte Shangri‐La kann nur im Herzen gefunden werden“, sagt Namkha wie aus der Pistole geschossen. Kein auswendig gelernter Satz. Andererseits sei der durch die Umbenennung in Shangri‐La bedingte Anstieg im Tourismus auch gut für ihn als Reiseleiter, gibt er nach einer kurzen Kunstpause ohne Umschweife zu. „Vor allem die Amerikaner kommen nun in Scharen und das ist gut für das Trinkgeld!“
Wir machen eine Runde durch das Kloster, erfahren, dass etwa 80 Prozent des Klosteretats für Yakbutter verwendet wird, die in Kerzenform die niedrigen Gebetshallen mit einem warmen Licht ausleuchtet. Und den so charakteristischen tibetischen Klostergeruch verströmt, den wir in den nächsten Tagen nicht mehr aus unserer Kleidung und Nase bekommen sollten. In schmackhafter Form begegnet uns die Yakmilch in der Klosterküche. Über einer kleinen Feuerstelle wird auf einem kleinen Metallnetz Yakkäse geräuchert. Der Küchendienst habende Novize bedeutet uns einzutreten und bietet uns jeweils ein kleines Stück zum Probieren an. Schmeckt wie… Nein schmeckt wie gar nichts, das ich kenne. Aber rauchig, bröselig, gut! Am Eingang der vom Rauch komplett geschwärzten Küche steht auf Englisch „No ladies please!“ Wie auch in manchen christlichen Glaubensströmungen gelten Frauen im Buddhismus als potentiell unrein und der Zutritt zu gewissen Gebäuden ist ihnen deshalb verwehrt.
„Im Kloster gibt es auch einen lebenden Buddha!“, Namkhas Stimme schwingt ins Klandestin‐Religiöse. „Ist das ein Geheimnis?“, frage ich ihn betont naiv. „Nein, eine große Ehre!“, insistiert Namkha. Ein lebender Buddha, das ist ein Mensch, der erleuchtet ist und nach seinem Tod ins Nirwana eingehen wird. Damit ist er ein Vorbild für alle gläubigen Buddhisten, begehrter Ratgeber und der Stolz eines jeden Klosters, in dem er Residenz nimmt. Ein wesentlicher Teil der Erleuchtung beinhaltet die Erkenntnis, dass alles Irdische nur Schall und Rauch und das Festhalten an irdischen Gütern und Errungenschaften ein Irrweg ist, der die Sinne verblendet. Der in diesem Kloster ansässige Buddha scheint seine eigene Einstellung zu dieser Erkenntnis zu haben. Er sitzt gut gepolstert in dem einzigen heizbaren Raum des Klosters, während die vor allem tibetischen Pilger auf allen Vieren auf ihn zurobben. An der Wand hinter ihm kann ich in einem Schrank einen Fernseher, eine Stereoanlage und ein Mobiltelefon erkennen. Neben dem Buddha steht ein ernst dreinblickender junger Mann, den ich von der Kleidung und Gestik her irgendwo zwischen Manager und Leibwächter einordnen würde. Etwas gelangweilt erteilt der Buddha jedem Gläubigen seinen Segen. Dieser verweilt kurz vor ihm, steht dann vorsichtig auf, bedacht, seinen Rücken auf keinen Fall dem Buddha zuzuwenden und hinterlässt dann einen Obolus zwischen zehn und 100 Yuan, also zwischen einem und zehn Euro, was für einen lokalen Bauern oder Arbeiter bei einem Durchschnittseinkommen von unter 100 Euro eine beträchtliche Summe ist, in den Händen des jungen Mannes. Der Leibwächter/Manager bedeutet auch uns, niederzuknien. Ein kurzer Blick, dann legt uns der Buddha ein rotes Glücksband um das linke Handgelenk. Auch wir entrichten unsere Spende und dann ist die Audienz vorbei. Hinter uns wartet noch ein Dutzend Pilger auf eine kurze Begegnung mit dem heiligen Mönch.
Sowohl Andreas als auch mich hat die Begegnung mit dem lebenden Buddha eher abgestoßen als beseelt. Namkha, der den heiligen Mann die ganze Zeit mit glänzenden Augen angeschaut hat, wollen wir das aber nicht so deutlich zeigen, geschweige denn sagen, und so schweigen wir alle auf dem Weg die steilen Treppen hinunter zum Klostertor. Namkha in Hingabe, wir in leichter Irritierung.
Auf dem Parkplatz, wo gerade ein großer klimatisierter Reisebus eine Gruppe deutscher Touristen ausspuckt, verabschieden wir uns von Namkha, und genießen dann die kurze Abfahrt zurück in die Stadt. Zum Abendessen hatte er uns ein tibetisches Feuertopf‐Restaurant empfohlen, das, wie er nach kurzer Nachfrage zugab, einem seiner Freunde gehört. Wir sitzen in einer kleinen Öffnung in einer Mauer, drei mal drei Meter groß, grelles Neonlicht, weiße ölverschmierte Kacheln an der Wand. Vor uns ein niedriger Resopaltisch mit einem kreisrunden Loch in der Mitte, in dem ein Topf mit dampfender Brühe befestigt ist, der von unten befeuert wird. Die Bedienung bringt kleine Plastikbehälter mit Netzboden, randvoll gefüllt mit zu kochenden Zutaten: Allerlei Gemüse, Huhn, Schwein, Rind, leider kein Yak. Nachdem wir ein wenig zögern, schmeißt sie den Inhalt der Körbe ohne viel Federlesen in den brodelnden Suppentopf und wünscht uns einen guten Appetit.
Auf der einen Seite des Restaurants spielen Chinesen eines ihrer überbordenden Trinkspiele. Zwei sich abwechselnde Spieler schmeißen sich gleichzeitig und in rascher Abfolge verbal Zahlen an den Kopf und zeigen die geschätzte Summe