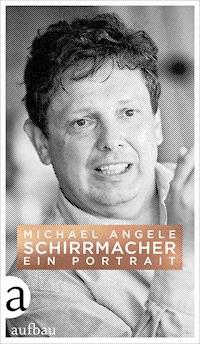18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine deutsche Kommune Am Stuttgarter Platz in West-Berlin spielt sich die ganze deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ab: Babylon Berlin, Schwarzmarkt und Fluchtort für die Verlorenen des Kriges, Rotlichtviertel, Keimzelle der Studentenbewegung, in den 80er-Jahren auch Underground. Michael Angele geht den Geschichten und den schillernden Figuren des Stutti nach und erzählt vom Babalu und den Dreharbeiten der ›Halbstarken‹ mit Karin Baal und Horst Buchholz. Den »Elefant« führte lange der KZ-Überlebende Leo Fischmann und Rainer Langhans zieht in eine große Altbauwohnung ein. An diesem Platz kommen die großen politische und kulturellen Strömungen Deutschlands zusammen: ›Ein deutscher Platz‹ ist eine süffige Geschichte der alten Bundesrepublik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Es geht um einen Platz, der wenig repräsentativ ist, nicht schön, großzügig oder glanzvoll jedenfalls. Aber vielleicht doch repräsentativ für das Nachkriegsdeutschland. Da ist der Busbahnhof, der in den fünfziger Jahren am Stuttgarter Platz entsteht. Busse sind günstiger als die Bahn, sie sind das Mittel der Wahl für alle, die knapp bei Kasse sind. In Charlottenburg kommt man an, doch anders als vor dem Krieg geht man nicht mehr nach Berlin, um dort dauerhaft sein Glück zu machen. Man kommt, sieht sich um, will eine schöne oder interessante Zeit haben, ohne allzu verbindlich zu werden. Irgendwie oder irgendwoanders geht es schon weiter. Das gilt für Studenten wie die von der Kommune 1, die hier ihr Quartier hat, aber auch für viele aus dem Rotlichtmilieu. Wer nach München oder Hamburg geht, der hält es wohl anders, aber auf Dauer greift das Leben auf Probe überall um sich, Berlin geht hier voran. Deshalb kann man den Stuttgarter Platz getrost einen deutschen Ort nennen.«
Michael Angele
Ein deutscher Platz
Die Ballade vom Stutti
Eine Art Gebrauchsanleitung
Als ich an einem noch warmen Septemberabend im Jahr 2022 vor dem Café Lentz saß, kam der Schriftsteller und Bonvivant A. an unserem Tisch vorbei. »A., der junge Mann interessiert sich für die Geschichte des Stutti«, sagte jemand aus der Gruppe am Tisch, »du weißt doch so viel.« Der Schriftsteller, auf dem Weg zu seinem Stammtisch drinnen im Lokal, blieb stehen und dachte kurz nach. »Unmittelbar nach dem Krieg gab es eine Buchhandlung am Platz«, sagte er dann im offenkundigen Bemühen, nichts allzu Bekanntes über den Ort von sich zu geben. »Hier oder nebenan, im Leonhardt. Eine Buchhandlung, die zugleich eine Leihbücherei war.« Auf meine Nachfrage, woher er das wisse, war die Antwort, davon habe er in einem Buch gelesen, wisse aber nicht mehr, in welchem.
Ein paar Wochen später fuhr ich nach Charlottenburg zum Sitz des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in der Danckelmannstraße. In einem Regal standen die Verzeichnisse der Berliner Buchhandlungen und Antiquariate. Es dauerte nicht lange, bis ich sah, dass der Schriftsteller recht gehabt hatte.
Von 1947 bis 1949 hatte es tatsächlich eine Buchhandlung am Stuttgarter Platz gegeben. Sie war in der Nummer 21, wo heute das Café Leonhardt ist, direkt neben dem Lentz. Geführt wurde die Buchhandlung von Käthe Bönninghof-Dähnert, der Frau oder eher der Tochter eines gewissen Erich Dähnert. Eingetragen war der Betrieb als »Dähnert, Erich Erben«. Neben dem Eintrag standen die Kürzel: »Bh. Lhb.« Buchhandlung und Leihbücherei. Auch da hatte A. recht gehabt.
1950 verschwand die Buchhandlung aus dem Verzeichnis. Vielleicht würde ich bei meinen weiteren Erkundungen zu diesem Buch mehr erfahren. Obwohl ich ganz gerne gewusst hätte, wer die Dähnerts waren oder welche Bücher man zwei Jahre nach dem Krieg ausgeliehen hatte. In einer Gegend, die damals keine bürgerliche mehr war, macht es mich nicht allzu traurig, bis heute keine weitere Spur zur Buchhandlung der Käthe Bönninghof-Dähnert gefunden zu haben. Ich wollte die Welt der Bücher, die für mich eine sichere Welt ist, verlassen.
Während der Pandemie war das Lentz geschlossen geblieben. Die Gäste hatten Sorge, dass es für immer zubleibe. Aber es eröffnete wieder, mit einer neuen Chefin, die an der Einrichtung nichts veränderte. Das Lentz ist einer der wenigen Orte, die an diesem Platz Bestand haben. Die Stammgäste kommen, sooft es geht. Es scheint, als würden sie sich festkleben in einer Stadt, in der sich fast alles verändert und weniges zum Guten. Die, die sich festkleben, werden weniger. Wenn einer von ihnen stirbt, treffen sie sich auf dem Friedhof Grunewald zwischen den Gleisen.
»Da sind wir fast alle begraben«, erklärte mir Brigitte. Ich mochte sie sofort, mit ihrem trockenen Witz, dem verlebten, lebensklugen Gesicht. Seit 1984 geht sie ins Lentz, war mal Grundschullehrerin, unterrichtete an einer sogenannten Problemschule in Neukölln, viele ihrer Schüler gehörten zu den verrufenen arabischen Clans.
Keine Clans, aber Banden gab es früher auch am Stuttgarter Platz, ihre Mitglieder trugen fast alle deutsche Namen. Bis 2012 war der Stuttgarter Platz ein »gefährlicher Ort«. Das hat er amtlich. Dann trieb die Polizei dem Namen die Poesie aus und sprach nun von »kriminalitätsbelasteten Orten«, ein gutes Dutzend gab es davon in Berlin. 2017 wurde der Stuttgarter Platz von der Liste gestrichen, zur Verwunderung vieler Polizeibeamter, denn es gab ja immer noch den Drogenhandel am Platz.[1] Wer sich an einem gefährlichen Ort aufhält, gilt gewissermaßen per se als verdächtig, er darf ohne Anlass von der Polizei kontrolliert werden.
Aber von wo bis wo genau soll dieser gefährliche Ort reichen? Was alles gehört zum Stuttgarter Platz? Ist das überhaupt ein Platz? Eigentlich ist er eine Straße am Bahnhof Charlottenburg. Meistens ist nur die nördliche Seite mit ihrer Häuserzeile, gekreuzt von Windscheid- und Kaiser-Friedrich-Straße, gemeint, wenn vom Stuttgarter Platz die Rede ist. Das ist auch in diesem Buch so. Auf der südlichen Seite grenzt er heute an einen schmalen Park, das Bahnhofsgebäude und die Böschung des Bahndamms. Im Westen kommt noch ein Gebäude hinzu, in dem sich eine Kneipe befand. Und dort, wo heute der Park die Straße säumt, war noch vor ein paar Jahren ein Parkplatz, auf dem das Auto stand, in das Sabine D. die Einnahmen aus der Bon Bon Table Dance Bar bringen musste, immer ein wenig in Angst, sie könne auf dem kurzen Weg dorthin überfallen werden.[2]
Sabine D., die ehemalige Geschäftsführerin der Bar und Frau des 2015 verstorbenen Rotlichtprinzen Steffen Jacob, lebt nicht mehr in Berlin. Sie ist in ihre süddeutsche Heimat zurückgegangen. In der Pandemie schloss auch die Bon Bon Table Dance Bar, sie machte nicht wieder auf.[3]
Das Bon Bon lag direkt am Stuttgarter Platz 7. Aber auch die Nachtbars in der Kaiser-Friedrich-Straße zählte man zum »Stutti«. Die letzte dieser Bars war die Monte Carlo Bar, an der Ecke zur Kantstraße. Die Sozialarbeiterinnen des Gesundheitsamts hatten gegen die Schließung durch das Bezirksamt protestiert, weil es in ihren Augen besser für die Frauen ist, wenn das Milieu sichtbare Orte hat. Die enorme Sichtbarkeit des Milieus ist verschwunden. Das verändert eine Stadt fundamental.
Der Stuttgarter Platz zerfällt sozial in zwei Teile. Die Leute, die ich im Lentz kennenlernte, Akademiker, Lehrerinnen, Schriftsteller, sprachen von dem Teil, in dem die Bon Bon Table Dance Bar oder die Monte Carlo Bar lagen, als wäre das eine entlegene Welt, die man nur aus den Zeitungen kennt. Ich war erstaunt, wie stark eine unsichtbare Mauer wirkte, die vom Lentz aus gesehen hinter der Windscheidstraße verlief.
Der heimelige Teil des Stuttgarter Platzes, in dem ihr Lentz liegt, gehört zu dem, was sie bis heute ihr Dorf nennen. Den anderen Teil will ich den »bösen Stutti« nennen. Mich selbst hat der böse Stutti immer stärker angezogen als das Dorf. Doch von dem, was mich dort drüben angezogen hat, ist nichts geblieben. Nicht die Bars, nicht die Koberer vor den Bars mit den Namen, die noch in meinem Kopf herumschwirren. Dem Dorf am nächsten lag das Hanky Panky, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es war da, wo jetzt das Medusa ist. Und im Chocolate, in der Nummer 16, war zwischendurch ein Antiquariat (die Bücher, wieder). Jetzt befinden sich dort der Stutti Döner und ein Teeladen. Aber wo genau war das Mon Cheri? Direkt neben dem Chocolate? Und waren im Hanky Panky die Bar links und die schweren roten Sessel rechts? Im hinteren Raum gab es eine Stange, aber es wurde nicht daran getanzt. Oder doch? War davor ein Vorhang?
Einmal lernte ich im Hanky Panky eine Studentin aus Polen kennen. Sie studierte Modedesign in Krakau. Ich gab ihr in meiner albernen Verliebtheit meine Telefonnummer. An einem frühen Montagabend, als ich im Italienischkurs war, vibrierte mein Handy, es war sie, Name längst vergessen. Ich konnte nicht ran. Ich rief nicht zurück, dazu war ich zu schüchtern, schickte ihr lieber eine SMS, die nie beantwortet wurde. Sie rief nicht wieder an. Aber ich notierte mir die Nummer ihres Mobiltelefons in meinem Adressbuch. Für die Recherche zu diesem Buch habe ich sie angerufen. Sie hat natürlich längst den Anbieter gewechselt.
Das Verschwinden der Vergangenheit ist in Berlin überall spürbar. Vergangenes dämmert in Archiven weiter, bis es von Filmen, Büchern oder Podcasts wieder zum halben Leben erweckt wird. Die Generation der 68er legte schon zu Lebzeiten ihre Archive an, die man heute in den Bibliotheken findet. Auch am Stuttgarter Platz selbst gibt es ein paar Erinnerungszeichen. Eine Tafel für die Kommune 1, im Dollinger ein 5x3,70 Meter großes Wandgemälde vom Busbahnhof, der vor mehr als einem halben Jahrhundert den Platz prägte, vis à vis von Bars wie dem Babalu und der Lolita Bar.
Vom Dorf selbst und seinen Bewohnern gibt es etliche Fotoserien. Es gibt sogar einen Dorffotografen und einen Dorfschriftsteller. Für den bösen Stutti sieht es nicht so gut aus. Hier hat keiner bewusst gesammelt, diese Vergangenheit droht lautlos zu verschwinden. Verschwinden wird dann aber nicht einfach ein Ort, verschwinden wird eine Welt. Eine Welt, die gewiss problematisch war und gegen Ende immer trauriger wurde, eine Welt aber auch, in der die Stadt ein markantes Gesicht zeigte. Die Fotos und Bilddokumente in diesem Buch sollen wie Einladungen in diese Welt wirken.
Und es geht um einen Platz, der wenig repräsentativ ist, nicht schön, großzügig oder glanzvoll jedenfalls. Aber vielleicht doch repräsentativ für das Nachkriegsdeutschland. Da ist der Busbahnhof, der in den Fünfzigerjahren am Stuttgarter Platz entsteht. Busse sind günstiger als die Bahn, sie sind das Mittel der Wahl für alle, die knapp bei Kasse sind. In Charlottenburg kommt man an, doch anders als vor dem Krieg geht man nicht mehr nach Berlin, um dort dauerhaft sein Glück zu machen. Man kommt, sieht sich um, will eine schöne oder interessante Zeit haben, ohne allzu verbindlich zu werden. Irgendwie oder irgendwo anders geht es schon weiter. Das gilt für Studenten wie die von der Kommune 1, die hier ihr Quartier hat, aber auch für viele aus dem Rotlichtmilieu. Wer nach München oder Hamburg geht, der hält es wohl anders, aber auf Dauer greift das Leben auf Probe überall um sich, Berlin geht hier voran. Deshalb kann man den Stuttgarter Platz getrost einen deutschen Ort nennen.
Die meisten der Protagonisten, die der Leser und die Leserin kennenlernen werden, sind also Zugereiste, Glückssucher, Vertriebene, Hoffnungsvolle, Gestrandete und Verlorene. Zugereist sind aber eben nicht nur die Intellektuellen, die Freigeister und Freaks, zugereist sind dann auch die Armutsprostituierten aus Rumänien und der türkischsprachigen Minderheit in Bulgarien, die sogenannten Balkantürken. Sie kommen kaum vor in der Literatur, gehören aber zum Bild von West-Berlin, das auch nach dem Fall der Mauer an einem Ort wie dem Stuttgarter Platz noch eine Weile weiterlebte.
Natürlich ist auch das heutige Berlin von einem internationalen Flair geprägt. Die Expats, Langzeittouristen, Studenten und natürlich Lebenskünstler aus aller Welt bilden keine Stadt mehr. Sie geben einen Werbefilm für Berliner Pilsener her, aber keinen Mythos. Der Mythos von West-Berlin? Etwas hochgestochen gesagt: das Erbe der Weimarer Republik in den Kulissen der Mauerstadt. Oder noch eine These, ohne kulturtheoretischen Ballast: West-Berlin war ein Ort, an dem man sich bestens verlieren konnte, in einer Zeit, in ganzen Jahrzehnten.
Das klingt sentimental, schon klar. Aber ein wenig geht es in diesem Buch schon auch um die Rehabilitierung eines zu Unrecht verpönten Gefühls.
Ich sah es zuerst in Ulrich Enzensbergers Buch Die Jahre der Kommune 1. Auf dem Foto ist Enzensberger links klein im Bild zu sehen, neben ihm lehnt sich Dieter Kunzelmann weit aus dem Fenster. Beim Schreiben seines Buches konnte Enzensberger sich nicht nur auf sein eigenes Gedächtnis und Gespräche mit Zeitzeugen stützen. Die Kommune 1 hatte ihr gut gefülltes Archiv. Wenn sie nicht auf der Straße waren und Action machten, bestand eine ihrer Haupttätigkeiten am Stuttgarter Platz darin, zu sammeln und zu dokumentieren, was über sie geschrieben wurde. Nicht zuletzt konnte man in den Zeitungen lesen, dass die Kommune 1 ein wildes Sexleben habe: eine Legende, die die Frauen der Kommune, mit denen ich sprechen durfte, gründlich zerstört haben. Ihre Leidenschaft galt den Medien, nicht dem Sex. Von Flugschriften über Zettel zu Broschüren, Zeitschriften und Büchern, nicht zu vergessen: Sitzungsprotokolle, unveröffentlichte Manuskripte, Tagebücher, Briefe – 68 wird oft als Chiffre für einen gesellschaftlichen Aufbruch gelesen, es ist aber auch eine Chiffre für Text.
Zwar haben die Menschen vom bösen Stutti keine Archive geschaffen. Ihre Spuren finden sich gleichwohl. Interessanterweise taucht er in der Literatur kaum auf. Die ungezählten Flaneure haben in West-Berlin fast jeden Stein umgedreht und beschrieben, aber um den Stuttgarter Platz haben sie einen Bogen gemacht. Anders der Film. Nicht nur die Abendschau vom Sender Freies Berlin hat berichtet, Dominik Graf und Will Tremper waren fasziniert vom Stutti und haben ihn in ihren Werken verewigt. Auch das sprechend: Will Tremper war nicht nur Filmregisseur, er war auch Reporter für den Berliner Boulevard. Denn natürlich findet man den bösen Stutti auch in der B.Z., der Bild Berlin oder einem vergessenen Blatt wie der Nacht-Depesche. Der Boulevard hat getan, was die Literatur unterlassen hat.
Und der böse Stutti schleicht sich gelegentlich in die Textur der anderen Seite ein: Auf dem Foto, das die Befreiung des Kommune-1-Mitglieds Fritz Teufel im August 1967 dokumentieren soll, grüßt neben dem Western-Club die Elefanten-Bar. In den Siebzigerjahren folgte ihr das Starlight. Heute ist eine Cocktailbar drin, deren Namen ich mir nicht merken kann und will. Die Bar strahlt nichts aus, einmal ging ich rein und trank ein Glas schlechten Merlot.
Was hat sich von der Elefanten-Bar erhalten? Was von diesem Teil des Stuttgarter Platzes? An einem der langen Abende im Lockdown gab ich bei YouTube den Suchbegriff »Stuttgarter Platz« ein. An erster Stelle erschien ein Video »Bernd Termer zum Wandel am Stuttgarter Platz«.[4] Unter dem Video schrieb eine Nutzerin: »Ich habe am Stutti gearbeited (sic!) von 1966–1970 es war die beste Zeit und ich habe viel Geld verdient in der Orchidee und im Blauen Engel! Ich habe versucht ein altes Bild von dem Stutti zu finden, ohne erfolg«. Es klingt wie von einer geschrieben, die englische Muttersprachlerin ist oder so lange Englisch spricht, dass sie das Deutsch verlernt hat. Vielleicht hatte sie sich in einen Offizier der britischen Armee verliebt und ist mit ihm durchgebrannt? Der Stuttgarter Platz war während der deutschen Teilung britische Besatzungszone. Aus den Beiträgen, die sie gelegentlich postete, geht hervor, dass sie sich einer christlichen Sekte angeschlossen hatte. Über Umwege erreichte ich die Enkelin. Sie fragte bei der Oma nach, ob sie mit mir sprechen wolle. Sie wollte nicht.
Aber der Mann aus dem Video über den Stuttgarter Platz wollte mit mir sprechen, er wurde der Erste in einer langen Reihe von Zeitzeugen. Im Internet gab es eine Telefonnummer. Eine Festnetznummer vom Stuttgarter Platz 13. Dort also, wo einmal der Elefant war. Der Anschluss war nicht einmal tot, es ging bloß keiner mehr ran. Schließlich gab mir ein Journalist der B.Z. die Handynummer von Bernd Termer.
Unser erstes Treffen fand in der Bäckerei Thoben statt. Sie befindet sich in dem Neubauriegel, der seit 1974 anstelle der Häuserzeile in der Kaiser-Friedrich-Straße steht, die auch die Lolita Bar beherbergte. Die Bars, die ihm gehörten, gab es schon lange nicht mehr, aber er kam trotzdem fast jeden Tag hierher. Im Thoben hatte er auch sein Buch Der König vom Stuttgarter Platz geschrieben und im Selbstverlag herausgegeben. Es wurde nicht der Erfolg, den er sich auch dank der Überredungskunst des Co-Autors, der inzwischen über alle Berge verschwunden war, erhofft hatte.
Jetzt saß er da in einer Lederjacke, kurzes Haar, Fitnessstudio auch mit siebzig, er lachte selten, seine Antworten waren leicht zynisch oder wenigstens schnodderig. Er schien leicht erregbar zu sein, und wenn er mit seinen stahlblauen Augen in die Welt blickte, schien er vor allem Feinde und nicht die Schönheit der Welt zu sehen. Später lernte ich auch eine andere, weichere Seite kennen.
Immer wieder kam er auf die »Ausländer« zurück, die seiner Meinung nach schuld waren, dass der Stutti nicht mehr das ist, was er einmal war. Was mich erstaunte: Von den polnischen Juden sprach er, der mit seiner Familie aus Ostpreußen nach dem Krieg nach West-Berlin gekommen war, überraschend gut. Sie hatten den Stutti aufgebaut, sie standen in seinen Augen für dessen beste Zeit. Er hatte jüdische Freunde, einer versteckte ihn sogar in seiner Wohnung, als er vom BKA gesucht wurde. Wenn er darüber sprach, klang das locker. Sollte es ausgerechnet hier, am Stutti, jenseits der anerkannten Institutionen, ein vitales deutsch-jüdisches Leben nach der Katastrophe gegeben haben?
Wer so fragt, stößt auf Bedenken. Auf die eigenen, aber auch auf die von Historikern: jüdische Besitzer anrüchiger Bars! Man möge bitte nicht Stereotype zeichnen und dem Antisemitismus Vorschub leisten. Es waren deutsche Historiker, nicht jüdische, die so sprachen. Die jüdischen Kontakte waren unverkrampfter, wussten aber selbst nichts oder nicht viel. Selbst eine Forscherin wie Atina Grossmann, die aus einer Berliner Familie stammt und in New York das Standardwerk Juden, Deutsche, Alliierte schrieb, kannte zwar den Stuttgarter Platz, ja, ihre Tochter war quasi auf dem Spielplatz im »Dorf« aufgewachsen, sie wusste aber nichts über den jüdischen Part in seiner Geschichte.
Woher kamen die ersten Juden am Stutti? Waren es Displaced Persons, D.P.s?
Eine dieser D.P.s ist Abraham »Abi« Springer. In dem 2009 uraufgeführten Dokumentarfilm Transit Berlin von Gabriel Heim sieht man ihn mit Freunden in einem Café in Charlottenburg sitzen und plaudern. Sie erinnern sich an den großen Schwarzmarkt, der um das Lager Schlachtensee herum entstand. Gab es zwischen dem Schwarzmarkt am Schlachtensee und dem am Stutti Verbindungen? Waren Leute aus den Lagern auch am Stutti aktiv? Abi Springer müsste es wissen. Theoretisch könnte er noch leben. Aber niemand schien ihn mehr zu kennen.
Ich kümmerte mich erst einmal um die Geschichte des Stuttgarter Platzes.
Der Graben
Es gibt eine Art Standardwerk zu unserem Thema, den Band 103 der Reihe Bruchstücke zu einzelnen Berliner Orten und Quartieren, den die Historikerin Birgit Jochens herausgegeben hat. Diesem Band entnehme ich, dass der Charlottenburger Bahnhof 1882 in Betrieb gegangen ist.[1] Ende des 19. Jahrhunderts wächst Berlin gewaltig an. Noch ist Charlottenburg allerdings kein Bezirk von »Groß-Berlin«, das wird es erst 1922, sondern eine eigenständige Stadt. Nachdem der Charlottenburger Bahnhof steht, werden in seiner Umgebung Brachen und Felder rasch bebaut. Was entsteht, ist kein bahnhofstypisches Milieu, das kommt erst viel später, sondern eine gutbürgerliche Gegend. Zeitweise hat Charlottenburg das höchste Steueraufkommen pro Kopf in Preußen.[2] Einen Kontrapunkt zu dieser Wohlhabenheit bildet die Gegend des Stuttgarter Platzes aber jetzt schon, noch vor dessen Geburt. Die verzögert sich nämlich durch ein »gen Himmel stinkendes« Etwas. Es ist ein Graben, der Abwässer von der Gemeinde Schöneberg in den Lietzensee leitet.
1889 wird der Graben kanalisiert.[3] Jetzt steigen die Bodenpreise an.
Am 30. Mai 1892 kommt der Stuttgarter Platz zur Welt. Seinen Namen verdankt er einer Fernverkehrsverbindung nach Süddeutschland.[4]
Jetzt wird rasch geplant und schnell gebaut. Treibende Kraft sind der Baumeister Alfred Schrobsdorff und die Familie Mugdan. Schrobsdorff ist ein preußischer Junker mit einem ebenso großen wie dicken Schädel, den seine Umwelt selten lachen sieht. Aus verarmtem Adel stammend, will Schrobsdorff in der bürgerlichen Gesellschaft hochkommen, und es gelingt ihm. Der Stuttgarter Platz wird zum Sprungbrett einer beachtlichen Karriere im Immobiliengeschäft, die ihren Höhepunkt in den Zwanzigerjahren erreicht.
Die Bauvorhaben am Stuttgarter Platz werden von der »Terraingesellschaft Stadtbahnhof Charlottenburg« mitfinanziert, da trifft es sich gut, dass Schrobsdorff zu den Gesellschaftern gehört. Es entsteht eine Bebauung, die den Bedürfnissen der Mittelschicht und des Großbürgertums folgt. Die Häuser sehen alle ähnlich aus, Gründerzeit wird man das später nicht ganz richtig nennen. Die Wohnungen in diesen Häusern sind groß, bis zu 300 Quadratmeter, haben zwischen sechs und neun Zimmer, mehrheitlich verfügen sie über zwei Bäder, einen Salon, manche sogar zwei Küchen.[5] Von dieser großzügigen Ausstattung wird später die Kommune 1 profitieren.
Auch das Eckhaus Stuttgarter Platz 13/Kaiser-Friedrich-Straße 54a wird nach Plänen von Schrobsdorff gebaut. Aber er ist nicht der Eigentümer. Schrobsdorff baut die Nummer 13 im Auftrag von Moritz Mugdan. Die Mugdans sind eine jüdische Familie, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Kempen nach Berlin und Charlottenburg migriert ist – in der langen Reihe von Zugereisten gehören die Mugdans zu den Ersten. Die kleine Stadt mit dem polnischen Namen Kępno war damals preußisch; die Mugdans kamen also als Preußen nach Berlin, wo viele sich als Kaufleute etablierten. Bekanntestes Mitglied der Familie ist Otto Mugdan, der 1862 in Breslau geboren wurde, sich 1885 als Arzt in Berlin niederließ und 1893 vom Judentum zum evangelischen Christentum konvertierte.
Bekannt wird Otto Mugdan als Reichstagsabgeordneter durch seine öffentlichen Einlassungen zu Gesundheitsreformen. Seine Kandidatur für die Berliner Stadtverordnetenwahlen löst 1908 den »Fall Mugdan« aus, der um die Frage kreist, ob jüdische Bürger ihn unterstützen sollen.[6]
Das Haus Stuttgarter Platz 13/Ecke Kaiser-Friedrich-Straße 54 wechselt bald von Moritz zu seinem Vetter David Mugdan, der nach Jahren in Hamburg nun als Kaufmann in Guatemala lebt, wo er für eine Import-Export-Firma seines Schwiegervaters arbeitet.[7]1913 erwirbt der Kaufmann Chaskel Eisenberg das Haus von David Mugdan, aber schon im November 1914 kommt es unter Zwangsverwaltung.[8] Dort bleibt es bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, dann erwirbt es abermals Moritz Mugdan. Häufige Besitzerwechsel gehören zur Geschichte des Platzes, es gibt sie in all seinen Epochen, oft bleibt der Wechsel von den Mietern unbemerkt.
Moritz Mugdan wird 1853 in Kempen, Provinz Posen, geboren, seit 1887 hat er seinen Wohnsitz in Berlin. Zwei Jahre später heiratet er die Tochter einer Cousine, später arbeitet er als Jurist. Auch dieses Mitglied der Familie Mugdan hat gute Beziehungen zu Lateinamerika, eine Zeit lang ist Moritz Mugdan Konsul von El Salvador in Berlin.[9] In Berlin besitzt er nun mehrere Häuser am Stuttgarter Platz.[10] Selbst wohnt er allerdings in Tiergarten; wenn er nach dem Rechten sehen will, muss er die Stadtbahn nehmen. 1897 zieht er in die Potsdamer Straße 121i.[11] Nur paar Häuser entfernt ist der alte Theodor Fontane zu Hause.
Als Moritz Mugdan 1929 stirbt, hinterlässt er drei Kinder. Hertha, Edith und Hans Mugdan erben unter anderem das Eckhaus am Stuttgarter Platz. Als es in ihren Besitz kommt, sind gewerbliche Mieter eine Bank, ein Friseursalon und gleich mehrere Kneipen.[12]
Am Vorabend des »Dritten Reichs« kommt eine Institution dazu, die den Platz für Jahrzehnte prägen wird: die Polizei. Anfang 1932 vermieteten die Erben Moritz Mugdans neun Zimmer und diverse weitere kleinere Räume an das 129. Revier. Der Platz hat zu diesem Zeitpunkt seine beste Zeit hinter sich. Die Weltwirtschaftskrise stürzt das herrschaftliche Wohnen in eine Krise, für die großen Wohnungen finden sich auch am Stuttgarter Platz oft keine Mieter mehr. Einige Wohnungen werden aufgeteilt.[13]
Mit dem Verschwinden der bürgerlichen Kultur kommt ein neues Milieu an den Platz. Es gibt etliche Spelunken, in denen auch Prostituierte verkehren, im Haus 13 ist es die Burgquelle, die nach dem Krieg ein Treffpunkt der organisierten Kriminalität wird; dazu später mehr. Ein Zentrum der Prostitution ist der Stuttgarter Platz damals aber noch nicht. Jedoch macht man sich heute kaum noch ein Bild, wie präsent Prostitution und Animierlokale während der Weimarer Republik fast im ganzen Stadtbild sind. Im Berlin der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre arbeiten geschätzt 150000 Männer und Frauen im Sexgewerbe.[14] Zu den Orten, die für das Gewerbe günstige Bedingungen bieten, zählen Bahnhofsgegenden: »Abends, kurz vor Geschäftsschluss. Riesenverkehr in allen Straßen rund um den Schlesischen Bahnhof. Lichtreklamen und Transparente: Hotel, Hotel, Hotel!! Parterre, erste Etage, zweite Etage. Alles ist ›Hotel‹. Ein sehr großer Teil von ihnen lebt fast ausschließlich von der Prostitution«.[15] So schildert es der Journalist Willi Proeger unter dem Pseudonym Weka in einer Serie von Reportagen, die 1930 erst in der Zeitung Berlin am Morgen und dann unter dem Titel Stätten der Berliner Prostitution in Buchform erscheinen.
Proeger führt den Leser ohne Sensationsgehabe und moralischen Zeigefinger in dunkle Hinterhöfe, feuchte Kellerlöcher bis in die »Straße der alten Mädchen« am Büschingplatz in Friedrichshain, wo Greisinnen noch ein paar Pfennige zu verdienen suchen. Vielleicht arbeiteten die früher sogar für ein paar Jahre in einem der Lokale, in denen die »Klassefrauen« ihr Geld machen, am Kurfürstendamm vorzugsweise. In der Stadt gibt es ein Wohlstandsgefälle von Westen nach Osten, besonders ausgeprägt zeigt sich das an der Prostitution. Aber auch innerhalb des Westens gibt es Unterschiede; am Bülowbogen zum Beispiel ist es »nicht ganz so hell und der Freier nicht so anspruchsvoll«.[16] Das Gleiche dürfte für den Stuttgarter Platz gelten. Proeger moralisiert nicht, er ist auf Verbesserung der Hygiene aus. Die Geschlechtskrankheiten bilden in seinen Augen das Hauptproblem der Prostitution. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Armut und Berufskrankheit sinnfällig. Syphilis, Gonorrhoe oder Tuberkulose sind bei den Frauen am Schlesischen Bahnhof verbreiteter als in den Salons des Westens, wo die Bettwäsche nach jedem Verkehr gewechselt wird. Proeger plädiert für eine Änderung der Gesetzeslage: Erst wenn die Prostitution legalisiert wird, können Hygienevorschriften greifen.[17]
Die Nationalsozialisten verfolgen eine komplett andere Strategie. Sie wollen das Gewerbe ausrotten. Nach der Machtübernahme steigt der Verfolgungsdruck. Moralische und hygienische Argumente greifen jetzt ineinander: Prostituierte sind asozial und Überträgerinnen von Geschlechtskrankheiten. Die Behörden werden angewiesen, bestehende Bordelle in Berlin zu schließen und neue nicht aufkommen zu lassen. 1934 existieren von einstmals 500 bekannten Orten der Prostitution noch zwanzig.[18] Die verbotene Straßenprostitution wird mit Razzien eingedämmt. Wie stark das 129. Revier am Stuttgarter Platz in die Bekämpfung der Prostitution eingebunden ist, lässt sich nicht mehr feststellen.
1937 bekommt das Revier einen neuen Nachbarn. Eine Schirmmanufaktur zieht in das Eckgebäude. Von den drei Mugdan-Erben lebt zu dieser Zeit einzig Hans noch in Berlin, Edith ist 1935 verstorben, Hertha nach London ausgewandert. An einem Wintertag bekommt Hans Besuch von einer Maklerin. Sie erkundigt sich, unter welchen Bedingungen die Immobilie am Stuttgarter Platz zu haben sei. Mugdan ist einem Verkauf nicht abgeneigt, da er keine Zukunft in Nazideutschland sieht. Er nennt einen Preis und fügt hinzu, dass der Betrag in Valuta an seine Verwandten in London auszuzahlen sei. Die Maklerin wendet sich mit dieser Information an Hans Spiegel, einen Hausverwalter, der sich mit Sophie Ueberreiter, geborene Krey, zusammengetan hat. Die beiden bilden ein schreckliches Gespann, das sich auf die Arisierung von jüdischem Besitz spezialisiert hat. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Spiegel fährt nach Holland, wo er ein Konto über vier Gulden eröffnet und die »4« auf dem Auszug in ein »24000« fälscht. Anschließend fliegt er nach London und legt den Mugdans das gefälschte Sparbuch vor, die wiederum nach Deutschland kabeln, dass alles seine Richtigkeit habe.[19]
Der Kaufvertrag wird unterzeichnet. Bald aber wird klar, dass nichts seine Richtigkeit hat, die 24000 Gulden werden nicht bezahlt. Hans, der immer noch in Berlin lebt, versucht den Vertrag anzufechten. Sein Anwalt wird aber von Ueberreiter und deren Anwalt so unter Druck gesetzt, dass kein Verfahren zustande kommt. Es gibt kein Recht mehr. Ueberreiters Anwalt, Madaus mit Namen, arbeitet für die Gestapo und wohnt in der Fennstraße in Moabit. Auch dieses Haus gehört den Mugdans. Mit dem Stuttgarter Platz 13 sind es insgesamt vier Immobilien, die das Duo Ueberreiter und Spiegel den Mugdans raubt.
Zwei Monate nach der »Kristallnacht« am 9. November 1938 emigriert auch Hans nach London.[20] (Was hält eigentlich Schrobsdorff von dem Ganzen? Wir wissen es nicht. Er, der sein ganzes Leben in Charlottenburg verbracht hat, stirbt am 2. Februar 1940.)
Sophie Ueberreiter informiert das 129. Revier, dass die Miete künftig nicht mehr an die Erben der Mugdans zu bezahlen sei, sondern an den neuen Verwalter, den Herrn Spiegel. Dem Schreiben legt sie eine Fotokopie des Kaufvertrags bei. Aber ist auch der Eintrag ins Grundbuch erfolgt? Ordnung muss sein, die Polizei verlangt einen Nachweis. Der Nachweis will und will nicht kommen. Sophie Ueberreiter sieht es als lästigen Verwaltungsakt.
Der 12. April 1943. In Salzburg bespricht Hitler mit dem rumänischen Präsidenten die Kriegslage, in Saarbrücken nimmt sich Friedrich Rosenthal aus Berlin-Dahlem das Leben, als er in seinem Versteck gestellt wird, im Frauengefängnis in der Barnimstraße kommt ein Mädchen zur Welt, und die Polizei am Stuttgarter Platz fragt ein letztes Mal nach: Wo ist der Nachweis?
Es dauert wieder viele Tage, dann kommt eine Antwort von Spiegel, der seine schlechte Laune nicht verhehlt.
»Ich teile Ihnen mit, dass Frau Sophie Ueberreiter, Berlin W 15, Pariserstr. 55, schon über 1 Jahr als Eigentümerin des Grundstücks Stuttgarter Platz 13 im Grundbuch eingetragen ist. Können derartige überflüssige Rückfragen nicht im Interesse der Arbeits- und Papierersparnis unterbleiben? Heil Hitler.«[21] Das ist dann wohl die Berliner Schnauze in der Diktatur: eine Renitenz, die sich in einen höheren Dienst stellt.
Am Mittag des 22. März 1944 ist Schluss mit der Polizeiarbeit am Stuttgarter Platz. Eine amerikanische Bombe trifft das Eckhaus und beschädigt es schwer.[22] Der Revierführer richtet einen Raum so weit her, dass der Unterführer darin hausen kann. Miete muss der Unterführer nicht entrichten. Sophie Ueberreiter erlässt sie ihm großzügig.[23]
Diese Großzügigkeit ist ihr nach dem Krieg nicht eigen. Zwei Jahre nach der Kapitulation beginnt, was später als Wiedergutmachung bezeichnet wird: Die Alliierten erlassen für die Westsektoren Berlins die Rückerstattungsgesetze.[24]1950 werden auch die Grundstücke am Stuttgarter Platz an die Familie Mugdan rückübertragen. Sophie Ueberreiter wird davon per Brief unterrichtet. Sie lebt nicht mehr in Berlin, sondern in Bayern, in der Nähe von Augsburg, genauer: in der Haftanstalt Aichach, wo sie und Spiegel wegen Betrugs und Urkundenfälschung einsitzen. Nach ihrer Entlassung aus der Haft versucht Sophie Ueberreiter die Enteignung anzufechten. Sie muss bald einsehen, dass sie damit nicht durchkommt. Eine Revision der Rückübertragung wäre nur möglich, wenn der Kauf auch unabhängig von der nationalsozialistischen Herrschaft hätte stattfinden können. Das war aber nicht der Fall, da die jüdischen Eigentümer ja erpresst wurden. So argumentiert Hans Gumpert. Dem engagierten Anwalt aus der Mommsenstraße ist zu verdanken, dass sich am Stuttgarter Platz ein bisschen Gerechtigkeit durchsetzt.[25] Aus dem fernen Bayern beklagt sich die Ueberreiter bitterlich »über das furchtbare Fehlurteil«.[26]
Das war’s für sie. Das Haus wird wieder hergerichtet. Das 129. Revier zahlt die Miete jetzt an die Erben der Mugdans.
Erstes Kapitel in einer kurzen Geschichte der Gewalt
Der Krieg ist verloren, Berlin liegt in Schutt und Asche. Wer überlebt hat, schaut, wo er bleibt. Es beginnt die Wolfszeit, die der Publizist Harald Jähner in seiner großen Studie beleuchtet hat. Zu diesem Überlebenskampf gehört das Treiben auf den zahlreichen Schwarzmärkten, die in den deutschen Städten entstehen.[1] Auch am Stuttgarter Platz mit seinem Bahnhof breitet sich rasch ein Schwarzmarkt aus. Im Februar 1945 wird Berlin von den Siegermächten in vier Besatzungszonen aufgeteilt, eine sowjetische, eine amerikanische, eine französische und eine britische. Der britische Sektor umfasst die Bezirke Spandau, Tiergarten, Wilmersdorf und Charlottenburg. Der Stuttgarter Platz steht also nun unter britischer Verwaltung. Um ein genaueres Bild von dem Stadtteil, den man besetzt hält, zu gewinnen, lässt die britische Kommandantur Berichte erstellen. Der Schwarzmarkt am Stuttgarter Platz wird in einem dieser Berichte zu den Top Drei des Geschäfts gezählt: »Die drei großen Schwarzmarktzentren scheinen Bahnhof Charlottenburg, Bahnhof Zoo und Schlüterstrasse zu sein«, schreiben die anonymen Reporter am 29. September 1948 und fügen hinzu: »Am Bahnhof Charlottenburg dominieren Polen, Jugoslawen, Bulgaren und andere Ausländer.«[2] Die Schwarzmärkte an den Bahnhöfen werden ergänzt durch die Schwarzmärkte, die es um die drei Lager für D. P. s in den westlichen Sektoren gibt.
Aus den Akteuren des Schwarzmarkts ragt die Figur des »Schiebers« heraus. Es gab Schieber schon im Nationalsozialismus, ihre Spur zieht sich bis in die migrantisch geprägten Stadtviertel der Gegenwart. Im Nationalsozialismus waren es »junge, anscheinend ohne Anstrengung zu Wohlstand gekommene Männer, die ihren Reichtum demonstrativ zur Schau stellten«, schreibt der Historiker Malte Zierenberg in seiner Studie Stadt der Schieber. Geschöpfe der damaligen Schattenwirtschaft, »Kriegswirtschaftsverbrecher«, die den Neid der »anständigen Bürger« erweckten. Und Neid meint hier auch: Sexualneid. »Immer wieder anklingende Bestandteile dieses Topos waren Promiskuität, gefährliche Verführungskünste, eine Vorliebe für junge und hübsche Mädchen und ›perverse Sexualpraktiken‹. Damit reihte sich der ›Schieber‹ in eine lange Ahnengalerie von innergemeinschaftlichen Feindbildern ein, die über sexuelle Devianz konstituiert wurden und zum Teil Wunschprojektionen waren. Dabei wurden die demonstrativen Konsumpraktiken des ›Schiebers‹ eng mit seinen sexuellen Erfolgen verknüpft: Durch ›Geschenke‹ aller Art, die er sich aufgrund seiner illegalen Praktiken leisten konnte, so diese Interpretation, war es ihm ein leichtes, junge und unerfahrene Mädchen für sich zu gewinnen, die damit – aus dieser Sicht – in den Stand der Prostituierten absackten.«[3]
Zwischen Zuhälter und Schieber herrscht also nur ein gradueller Unterschied. Der Schieber ist nicht nur eine Fantasie des Bürgers, seine Charakteristika finden sich in den Biografien der Menschen vom Stuttgarter Platz wieder. Da sind diese jungen Männer, die sich Mitte der Fünfzigerjahre auf Berlins Straßen und Plätzen breitmachen. Die Presse prägt für sie den Ausdruck »Halbstarke«. Adoleszente Schläger, in denen eine große Wut steckt, sie leiden unter schwachen Vätern und hilflosen Müttern, viele sind Mitläufer ohne Ambition, Kleinkriminelle auf Zeit, die sich bald in eine unglückliche Ehe verabschieden, aus der nur noch der Gang in die Eckkneipe ein wenig befreit, aber in einigen steckt eine große Sehnsucht und eine starke Erotik.
Freddy ist so ein Halbstarker mit beträchtlichem Charisma. Er wohnt schräg gegenüber einer Eisdiele in der Kantstraße 87. Und direkt neben der Leila-Klause. Wenn Freddy aus dem Haus tritt, die Kantstraße nach rechts geht und in die Windscheidstraße einbiegt, landet er am Stuttgarter Platz. Er kann aber auch nach links gehen und in die Leonhardtstraße einbiegen, auch dann landet er am Stuttgarter Platz. Doch vermutlich wird er weder das eine noch das andere tun, sondern eine Abkürzung nehmen: Neben dem Kino Mascotte gibt es einen Durchgang, der die Kantstraße und den Stuttgarter Platz verbindet.[4]
Freddy ist ein Kind des Stutti. Jetzt wohnt er mal da, mal dort, ist ausgebüxt, hat den Vater, einen verschuldeten Spießer, der seinen Frust an seiner Frau und den beiden Söhnen auslässt, nicht mehr ausgehalten.
Waren es zu Beginn eher harmlose Streiche, so driftet Freddy immer mehr ab in die schwere Kriminalität. Mittlerweile hat er sich eine Pistole beschafft; mit seinen Kumpels überfällt er einen Postwagen, aber anders als erhofft transportiert der kein Geld. Treibende kriminelle Kraft ist Freddys vorwitzige, intrigante junge Freundin Sissy, die vom Leben möglichst bald möglichst viel will. Sissy überredet die Bande dazu, die Villa des italienischen Besitzers der angesagten neuen Bar Garezzo in der Potsdamer Straße auszurauben. Beim Versuch, die Polizei zu alarmieren, wird der herzkranke Vater des Besitzers erschossen. Und auch Freddy wird in den Bauch geschossen. Es ist Sissy, die schießt.
Diesen Freddy gibt es nur im Film. Freddy, das ist der junge Schauspieler Horst, genannt Hotte, Buchholz. Sissy, das ist Karin Baal. Buchholz und Baal sind die Hauptdarsteller in Georg Tresslers Film Die Halbstarken, der im Hochsommer 1956 gedreht wird. Das Drehbuch hat Will Tremper geschrieben. Tremper, Sohn eines Gastwirts aus Braubach am Rhein, ist gerade 16, als er, noch im Krieg, noch zur Zeit der gleichgeschalteten Presse, Journalist werden will, allerdings nicht in der Provinz, sondern in der Reichshauptstadt.[5] Im April 1944 reist er im mit Fronturlaubern überfüllten Zug nach Berlin, um eine Stelle als »Bildberichterstatter« anzutreten. Zehn Jahre später hat er eine Karriere als Reporter bei der Springer-Presse hingelegt und drängt nun in den Film.[6]
Schon während der Dreharbeiten zu den Halbstarken schreibt die Presse die Baal, die eigentlich Blauermel heißt, und Buchholz zu Stars hoch. Dass eine unbekannte, gerade mal 15-Jährige aus dem Wedding die Rolle der Sissy bekommen und eine Masse von Bewerberinnen ausgestochen hat, ist eine kleine Sensation; sie scheint nicht einmal die hübscheste unter den Kandidatinnen, aber sie hat etwas enorm Keckes und Frivoles. Und der schwarzhaarige, vitale Horst Buchholz ist eh ein Sexsymbol, es zirkulieren Homestorys aus Pankow, Fanpostadressen werden veröffentlicht. Dass er schwul ist, liest man natürlich nicht. Die Nacht-Depesche begleitet die Dreharbeiten zu den Halbstarken mit einer eigenen Serie: »In der Kantstraße, vor einer kleinen italienischen Eisdiele, ist ein Menschenauflauf. Was gibt es da zu sehen? Halbstarke? Keine richtigen natürlich, nur Filmhalbstarke.«[7]
Die richtigen Halbstarken, nicht die »Filmhalbstarken«, gibt es um die Ecke, am Stuttgarter Platz. Anfang der 1950er-Jahre sind es noch spontane Schlägereien, »Trunkenheitsexzesse«,[8] die dem 129. Revier der Polizei zu schaffen machen. Aber mit dem zunehmenden Organisationsgrad der Banden wächst die Schwere der Delikte, wie in den Halbstarken. Wie sich die