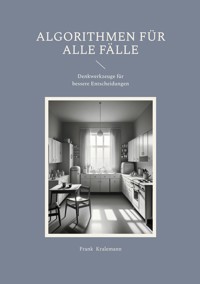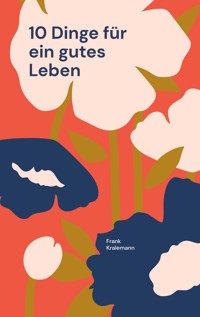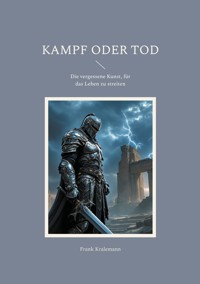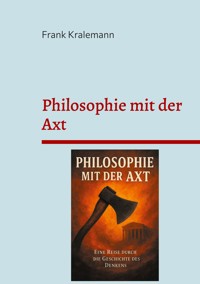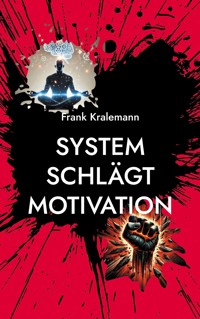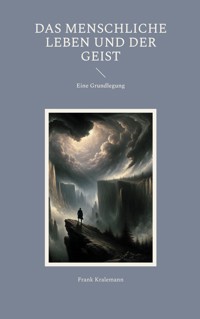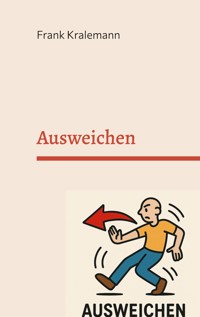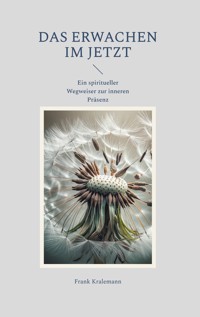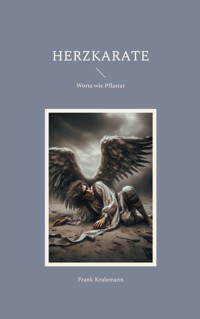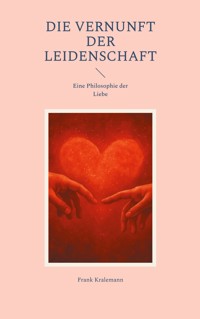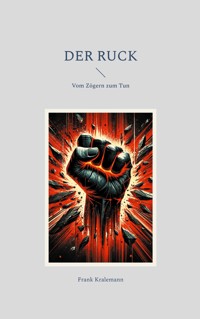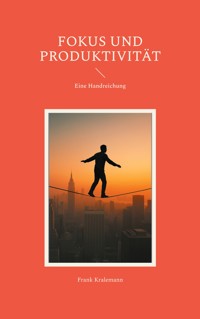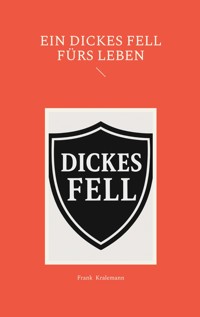
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein dickes Fell zu haben bedeutet nicht, gefühllos oder abgestumpft zu sein. Es geht nicht darum, eine emotionale Rüstung anzulegen, die nichts mehr an Sie heranlässt. Im Gegenteil ,wahre emotionale Stärke zeigt sich darin, berührbar zu blei-ben und trotzdem nicht bei jedem Windhauch um-zufallen. Ein dickes Fell im besten Sinne ist wie die Rinde eines Baumes: Sie schützt das empfindsame Inne-re, ohne den Austausch mit der Umwelt zu unter-binden. Der Baum kann weiterhin Nährstoffe aufnehmen, auf Jahreszeiten reagieren, wachsen und gedeihen aber er übersteht auch Stürme, ohne entwurzelt zu werden. In der Psychologie sprechen wir von Resilienz ,der Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen und an Herausforderungen zu wachsen. Und hier kommt die gute Nachricht: Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie ist eine Fähigkeit, die sich entwickeln lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
INHALT
Ein dickes Fell für's Leben
Wie Sie innere Stärke entwickeln und an Herausforderungen wachsen
Einleitung: Warum ein "dickes Fell" heute wichtiger denn je ist
Die Kunst, sensibel zu bleiben und trotzdem stark zu sein
Was bedeutet es wirklich, ein "dickes Fell" zu haben?
Die Revolution der Resilienzforschung
Ihre Reise zu mehr emotionaler Stärke
Wie Sie dieses Buch optimal nutzen
Eine persönliche Einladung
Kapitel 1: Die Wissenschaft der Resilienz – Was macht Menschen widerstandsfähig?
Die Kauai-Studie: Die Geburtsstunde der Resilienzforschung
Das Geheimnis der "unverwundbaren" Kinder
Aaron Antonovskys Revolution: Von der Pathogenese zur Salutogenese
Neuroplastizität: Die biologische Grundlage der Resilienz
Die sieben Säulen der Resilienz
Die Resilienz-Gene: Veranlagung trifft Entwicklung
MERKKASTEN: Die 7 Schlüsselfaktoren der Resilienz
Kapitel 2: Kränkungen verstehen – Warum treffen uns manche Dinge so tief?
Die Anatomie einer Kränkung: Was in unserem Gehirn passiert
Die vier Ebenen der Verletzlichkeit
Warum Hochsensible besonders betroffen sind
Der Kränkungs-Kreislauf: Wie aus kleinen Stichen große Wunden werden
Alte Wunden, neue Trigger: Die Rolle unserer Biografie
Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Kränkungen
Die versteckten Funktionen von Kränkungen
Der Unterschied zwischen Kränkung und konstruktiver Kritik
MERKKASTEN: Erste Hilfe bei akuten Kränkungen
Kapitel 3: Die Macht der Perspektive – Wie Bewertungen unsere Gefühle steuern
Das ABC-Modell: Der Schlüssel zu unseren Emotionen
Die drei Dimensionen des Erklärungsstils
Kognitive Verzerrungen: Die Saboteure unseres Denkens
Die Kunst des Reframings: Neue Rahmen für alte Bilder
Praktische Übungen zur Perspektivänderung
Fallbeispiele aus der Praxis: Transformation durch Perspektivwechsel
Die Grenzen des positiven Denkens
Die Neurobiologie der Perspektive
Integration in den Alltag: Die 3-2-1 Methode
MERKKASTEN: Die 5 häufigsten Denkfallen und ihre Gegenmittel
Kapitel 4: Emotionsregulation lernen – Praktische Techniken für den Alltag
James Gross' Revolution: Das Prozessmodell der Emotionsregulation
Die Hierarchie der Wirksamkeit
Achtsamkeitsbasierte Techniken nach Jon Kabat-Zinn
Matthias Berkings ART: Ein umfassendes Trainingsprogramm
Körperbasierte Methoden: Die Weisheit des Körpers nutzen
Der Notfallkoffer für emotionale Krisen
Integration in den Alltag: Das emotionale Fitnessstudio
Häufige Fallen und wie Sie sie vermeiden
Die Verbindung von Emotion und Bedürfnis
MERKKASTEN: Ihr persönlicher Emotionsregulations-Werkzeugkasten
Kapitel 5: Grenzen setzen ohne Schuldgefühle
Warum Grenzen für Sensitive besonders wichtig sind
Die Angst vor Ablehnung überwinden
Kommunikationstechniken für klare Grenzen
Der Unterschied zwischen Egoismus und Selbstfürsorge
Energievampire erkennen und meiden
Nein sagen lernen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die körperliche Dimension von Grenzen
Grenzen in verschiedenen Lebensbereichen
Der Umgang mit Grenzüberschreitungen
Schuldgefühle transformieren
Die Geschenke klarer Grenzen
MERKKASTEN: Die goldenen Regeln gesunder Grenzen
Kapitel 6: Kritik als Geschenk – Feedback konstruktiv nutzen
Die zwei Gesichter der Kritik: Destruktiv vs. Konstruktiv
Warum unser Gehirn auf Negatives fokussiert
Die Trennung von Person und Verhalten
Techniken zur emotionalen Distanzierung
Aus Feedback lernen ohne sich zu verbiegen
Der Umgang mit unfairer Kritik
Kritik in verschiedenen Kontexten
Die Kunst, Kritik zu geben
Vom Feedback zur persönlichen Entwicklung
Die versteckten Geschenke der Kritik
MERKKASTEN: Der 5-Schritte-Prozess zur Kritikverarbeitung
Kapitel 7: Die Kunst des Loslassens – Wenn Festhalten schadet
Warum wir an Verletzungen festhalten
Die Neurobiologie des Grübelns
Vergebung als Befreiung (nicht als Schwäche)
Praktische Loslassübungen
Rituale des Abschließens
Die Balance zwischen Verarbeiten und Weitergehen
Wann Festhalten angebracht ist
Die Freiheit des Loslassens
Petra's Transformation
Die tägliche Praxis des Loslassens
MERKKASTEN: Wann Loslassen angebracht ist und wann nicht
Kapitel 8: Selbstmitgefühl statt Selbstkritik
Die Forschung von Kristin Neff: Eine Revolution des Selbstbezugs
Die drei Komponenten des Selbstmitgefühls
Der innere Kritiker: Ursprung und Transformation
Selbstmitgefühl vs. Selbstmitleid: Der entscheidende Unterschied
Praktische Übungen für mehr Selbstfreundlichkeit
Die Verbindung zu anderen durch gemeinsame Menschlichkeit
Häufige Einwände und wie Sie damit umgehen
Carolin's Weg zum Selbstmitgefühl
Selbstmitgefühl in Beziehungen
Die dunkle Nacht der Seele: Selbstmitgefühl in Krisen
Integration in den Alltag: Der Selbstmitgefühls-Kompass
MERKKASTEN: Tägliche Selbstmitgefühlspraxis
Kapitel 9: Soziale Unterstützung richtig nutzen
Die vier Arten sozialer Unterstützung
Qualität vor Quantität: Was wirklich zählt
Unterstützung annehmen lernen: Die große Hürde
Die Kunst des Bittens: Wie wir Unterstützung erfragen
Das richtige Netzwerk aufbauen: Qualität kultivieren
Grenzen der Unterstützung respektieren
Online vs. Offline: Die richtige Balance
Nina's Durchbruch: Die Mauer fällt
Die Neurobiologie der sozialen Unterstützung
Unterstützung in verschiedenen Lebensphasen
MERKKASTEN: Ihr persönliches Unterstützungsnetzwerk kartieren
Kapitel 10: Rückschläge als Wachstumschancen
Post-traumatisches Wachstum: Die Forschung dahinter
Die fünf Bereiche möglichen Wachstums
Sinnfindung in schweren Zeiten
Resilienz-Vorbilder und ihre Geschichten
Der Unterschied zwischen Opfer- und Gestalterrolle
Praktische Strategien zur Krisenbewältigung
Die Phasen der Krisenbewältigung
Markus' Transformation: Vom Angestellten zum Unternehmer
Wann professionelle Hilfe wichtig ist
Die Geschenke der Krise
MERKKASTEN: Ihr Krisen-Wachstums-Plan
Kapitel 11: Das Training beginnt – Ihr persönlicher Resilienz-Plan
Die Wissenschaft der Gewohnheitsbildung
Ihr 30-Tage-Startprogramm
Anpassungen für verschiedene Lebensumstände
Fortschritte messen ohne Perfektionismus
Rückschläge im Training meistern
Langfristige Integration in den Alltag
Die Rolle von Selbstfürsorge
Erfolggeschichten aus der Praxis
Ihr individueller Weg
MERKKASTEN: Ihr individueller Trainingsplan
Abschluss: Mit dickem Fell und offenem Herzen
Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick
Ihre neue Beziehung zu Herausforderungen
Die Balance zwischen Schutz und Offenheit
Ein Brief an Ihr zukünftiges Ich
Weiterführende Ressourcen
Ein letztes Wort
Anhang: Werkzeuge für Ihre Resilienz-Reise
Anhang: Werkzeuge für Ihre Resilienz-Reise
Checkliste: Bin ich emotional dünnhäutig?
Übungssammlung: Die 20 wichtigsten Techniken auf einen Blick
Notfallplan bei emotionalen Krisen
Tagebuchvorlagen für Ihre Resilienz-Entwicklung
Literaturempfehlungen und Ressourcen
Wichtige Adressen und Anlaufstellen
Abschließende Gedanken
Ein dickes Fell fürs Leben
Wie Sie innere Stärke entwickeln und an Herausforderungen wachsen
Einleitung: Warum ein "dickes Fell" heute wichtiger denn je ist
Die Kunst, sensibel zu bleiben und trotzdem stark zu sein
"Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt." – Søren Kierkegaard
Stellen Sie sich vor, Sie könnten durch Ihr Leben gehen, ohne dass jede kritische Bemerkung Sie tagelang beschäftigt. Stellen Sie sich vor, ein abwertender Blick würde nicht mehr Ihre ganze Stimmung ruinieren. Und stellen Sie sich vor, Sie könnten "Nein" sagen, ohne sich danach stundenlang schuldig zu fühlen. Klingt das für Sie wie ein unerreichbarer Traum? Dann geht es Ihnen wie Millionen anderen Menschen, die sich wünschen, emotional widerstandsfähiger zu sein – ohne dabei ihre Sensibilität und Empathie zu verlieren.
In unserer hypervernetzten Welt sind wir täglich einer Flut von Bewertungen, Meinungen und Urteilen ausgesetzt. Soziale Medien haben aus dem Leben eine permanente Bühne gemacht, auf der jeder Fehltritt kommentiert wird. E-Mails und Nachrichten prasseln rund um die Uhr auf uns ein, jede mit der impliziten Erwartung einer schnellen Reaktion. Gleichzeitig sind die traditionellen Puffer – stabile Gemeinschaften, verlässliche Strukturen, gemeinsame Werte – in vielen Bereichen weggebrochen. Wir sind emotionaler Dauerbelastung ausgesetzt wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Besonders betroffen sind dabei die Sensiblen unter uns. Jene Menschen, die Stimmungen intensiver wahrnehmen, die sich Kritik mehr zu Herzen nehmen, die das Leid anderer tief mitfühlen. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung gelten als hochsensibel – sie verarbeiten Reize tiefer und gründlicher. Was für andere ein kleiner Kratzer ist, kann für sie eine tiefe Wunde sein. Doch auch wenn Sie sich nicht als hochsensibel bezeichnen würden: Die Anforderungen unserer Zeit machen uns alle verletzlicher.
Was bedeutet es wirklich, ein "dickes Fell" zu haben?
Lassen Sie mich gleich zu Beginn mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen: Ein dickes Fell zu haben bedeutet nicht, gefühllos oder abgestumpft zu sein. Es geht nicht darum, eine emotionale Rüstung anzulegen, die nichts mehr an Sie heranlässt. Im Gegenteil – wahre emotionale Stärke zeigt sich darin, berührbar zu bleiben und trotzdem nicht bei jedem Windhauch umzufallen.
Ein dickes Fell im besten Sinne ist wie die Rinde eines Baumes: Sie schützt das empfindsame Innere, ohne den Austausch mit der Umwelt zu unterbinden. Der Baum kann weiterhin Nährstoffe aufnehmen, auf Jahreszeiten reagieren, wachsen und gedeihen – aber er übersteht auch Stürme, ohne entwurzelt zu werden.
In der Psychologie sprechen wir von Resilienz – der Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen und an Herausforderungen zu wachsen. Und hier kommt die gute Nachricht: Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie ist eine Fähigkeit, die sich entwickeln lässt. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Menschen emotionale Widerstandskraft aufbauen können.
Die Revolution der Resilienzforschung
Noch vor 50 Jahren ging die Psychologie davon aus, dass traumatische Erfahrungen Menschen unweigerlich und dauerhaft schädigen. Dann kam Emmy Werner, eine Entwicklungspsychologin, die auf der hawaiianischen Insel Kauai eine Langzeitstudie durchführte. Sie begleitete 698 Kinder über 40 Jahre – viele von ihnen wuchsen unter schwierigsten Bedingungen auf: Armut, Vernachlässigung, Gewalt. Das Erstaunliche: Ein Drittel dieser Hochrisiko-Kinder entwickelte sich zu kompetenten, fürsorglichen und erfolgreichen Erwachsenen.
Werner hatte etwas Revolutionäres entdeckt: Menschen sind nicht passive Opfer ihrer Umstände. Es gibt Schutzfaktoren, die uns helfen, selbst widrigste Bedingungen zu überstehen und daran zu wachsen. Diese Erkenntnis läutete einen Paradigmenwechsel ein. Statt nur auf Defizite und Störungen zu schauen, begann die Wissenschaft zu erforschen, was Menschen stark macht.
Parallel dazu machte die Hirnforschung eine ebenso revolutionäre Entdeckung: Unser Gehirn ist plastisch. Es kann sich ein Leben lang verändern, neue Verbindungen knüpfen, alte Muster überschreiben. Das bedeutet: Selbst wenn Sie heute bei jeder Kritik zusammenzucken, können Sie lernen, anders zu reagieren. Ihre emotionalen Reaktionsmuster sind nicht in Stein gemeißelt.
Ihre Reise zu mehr emotionaler Stärke
Dieses Buch ist Ihr Wegweiser zu einem dickeren Fell – ohne dass Sie dabei Ihr weiches Herz verlieren. Es basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Resilienzforschung, der Neurobiologie und der Positiven Psychologie. Aber es ist kein theoretisches Werk. Es ist ein praktischer Ratgeber, der Ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand gibt.
Sie werden lernen, warum manche Ereignisse Sie so tief treffen und wie Sie diesen Mechanismus durchbrechen können. Sie werden verstehen, wie Ihre Bewertungen Ihre Gefühle steuern – und wie Sie das Steuer selbst in die Hand nehmen. Sie werden Techniken erlernen, um Ihre Emotionen zu regulieren, ohne sie zu unterdrücken. Und Sie werden entdecken, wie Sie Grenzen setzen, Kritik konstruktiv nutzen und aus Rückschlägen gestärkt hervorgehen können.
Dabei geht es nicht um schnelle Tricks oder oberflächliche Tipps. Echte Veränderung braucht Zeit und Übung. Aber ich verspreche Ihnen: Jeder kleine Schritt lohnt sich. Jede neue Erkenntnis, jede gemeisterte Übung macht Sie ein bisschen stärker, ein bisschen gelassener, ein bisschen freier.
Wie Sie dieses Buch optimal nutzen
Dieses Buch ist so aufgebaut, dass jedes Kapitel auf dem vorherigen aufbaut. Ich empfehle Ihnen daher, es der Reihe nach zu lesen. Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie die Inhalte wirken. Und vor allem: Wenden Sie die Übungen an. Wissen allein verändert nichts – erst durch die Praxis entsteht Transformation.
Am Ende jedes Kapitels finden Sie einen Merkkasten mit den wichtigsten Punkten und konkreten Handlungsschritten. Nutzen Sie diese als Orientierung und Erinnerung. Vielleicht möchten Sie sich auch ein Notizbuch zulegen, in dem Sie Ihre Gedanken, Erkenntnisse und Fortschritte festhalten.
Seien Sie geduldig mit sich. Emotionale Muster, die sich über Jahre oder Jahrzehnte gefestigt haben, ändern sich nicht über Nacht. Es wird Rückschläge geben. Tage, an denen Sie denken: "Es funktioniert nicht, ich bin immer noch genauso dünnhäutig wie vorher." Das ist normal und Teil des Prozesses. Entscheidend ist, dass Sie dranbleiben.
Eine persönliche Einladung
Bevor wir in die wissenschaftlichen Grundlagen eintauchen, möchte ich Ihnen noch etwas Persönliches sagen: Dass Sie dieses Buch in den Händen halten, zeigt bereits Ihre Stärke. Es zeigt, dass Sie bereit sind, sich Ihren Herausforderungen zu stellen. Dass Sie nicht aufgeben, sondern nach Wegen suchen, mit den Anforderungen des Lebens besser umzugehen.
Ihre Sensibilität ist keine Schwäche – sie ist eine Gabe. Die Welt braucht Menschen, die tief fühlen, die mitfühlen, die sich berühren lassen. Die Kunst besteht darin, diese Gabe zu bewahren und gleichzeitig eine innere Stabilität zu entwickeln, die Sie durch stürmische Zeiten trägt.
Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie in einem Jahr auf diese Zeit zurückblicken. Wenn Sie feststellen, dass die Dinge, die Sie heute aus der Bahn werfen, ihre Macht über Sie verloren haben. Wenn Sie spüren, dass Sie innerlich gewachsen sind, stärker geworden sind, ohne härter geworden zu sein. Diese Vision kann Wirklichkeit werden. Die Werkzeuge dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.
Lassen Sie uns gemeinsam diese Reise beginnen. Eine Reise zu einem dickeren Fell und einem offenen Herzen. Eine Reise zu der Person, die Sie sein können – resilient, authentisch und innerlich frei.
Kapitel 1: Die Wissenschaft der Resilienz – Was macht Menschen widerstandsfähig?
"In der Mitte der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit." – Albert Einstein
Stellen Sie sich zwei Geschwister vor, die in derselben schwierigen Familie aufwachsen. Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter überfordert, Geld ist knapp, Zuwendung noch knapper. Dreißig Jahre später: Das eine Geschwisterkind kämpft mit Depressionen und Suchtproblemen, das andere hat eine glückliche Familie gegründet und einen erfüllenden Beruf. Wie kann das sein? Warum zerbrechen manche Menschen an Schicksalsschlägen, während andere daran wachsen?
Diese Frage beschäftigte auch Emmy Werner, als sie 1955 ihre bahnbrechende Studie auf der hawaiianischen Insel Kauai begann. Was sie in den folgenden 40 Jahren entdeckte, revolutionierte unser Verständnis von menschlicher Widerstandskraft.
Die Kauai-Studie: Die Geburtsstunde der Resilienzforschung
Emmy Werner und ihr Team begleiteten 698 Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Etwa ein Drittel dieser Kinder wuchs unter extrem schwierigen Bedingungen auf: chronische Armut, Geburtskomplikationen, psychisch kranke oder suchtkranke Eltern, Vernachlässigung, Gewalt. Nach damaliger Lehrmeinung waren diese Kinder zum Scheitern verurteilt.
Doch Werner machte eine erstaunliche Entdeckung: Von den 201 Hochrisiko-Kindern entwickelten sich 72 zu kompetenten, selbstbewussten und fürsorglichen Erwachsenen. Sie hatten stabile Beziehungen, waren beruflich erfolgreich und gesellschaftlich engagiert. Viele von ihnen führten sogar ein erfüllteres Leben als Kinder aus behüteten Verhältnissen.
Was war ihr Geheimnis? Werner identifizierte mehrere Schutzfaktoren:
Persönliche Eigenschaften: Diese resilienten Kinder waren von Geburt an aktiver und kontaktfreudiger. Sie hatten eine positive Grundstimmung und konnten andere Menschen für sich gewinnen. Besonders wichtig: Sie entwickelten früh die Fähigkeit, sich Hilfe zu holen, wenn sie diese brauchten.
Eine verlässliche Bezugsperson: Fast alle resilienten Kinder hatten mindestens einen Menschen, der bedingungslos an sie glaubte. Das musste nicht unbedingt ein Elternteil sein – oft waren es Großeltern, Tanten, Lehrer oder Nachbarn. Diese eine stabile Beziehung reichte aus, um den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Wert zu vermitteln.
Sinnstiftende Strukturen: Viele der resilienten Kinder fanden Halt in Vereinen, Kirchengemeinden oder anderen Gruppen. Diese Strukturen gaben ihrem Leben Rhythmus und Bedeutung. Sie erfuhren: Ich bin Teil von etwas Größerem, ich werde gebraucht.
Verantwortung übernehmen: Paradoxerweise half es vielen Kindern, früh Verantwortung zu übernehmen – sei es für jüngere Geschwister oder im Haushalt. Dadurch entwickelten sie Selbstwirksamkeit: das Gefühl, ihr Leben aktiv gestalten zu können.
Das Geheimnis der "unverwundbaren" Kinder
Werner prägte für diese Kinder zunächst den Begriff "invulnerable" – unverwundbar. Doch das war irreführend. Diese Kinder waren nicht unverletzlich. Sie litten unter den schwierigen Umständen, sie weinten, sie hatten Angst. Der Unterschied war: Sie blieben nicht in der Opferrolle stecken.
Ein Junge aus der Studie, nennen wir ihn Keoni, wuchs mit einem gewalttätigen Vater auf. Mit acht Jahren fasste er einen Entschluss: "Ich werde niemals so werden wie er." Dieser Entschluss wurde zu seinem inneren Kompass. Wann immer der Vater tobte, sagte sich Keoni: "Das bin nicht ich. Ich werde anders." Er suchte sich Vorbilder – einen Lehrer, der an ihn glaubte, einen Nachbarn, der ihm zeigte, wie ein liebevoller Vater sein kann.
Jahre später, als erwachsener Mann mit eigener Familie, sagte Keoni: "Mein Vater hat mir gezeigt, wie ich nicht sein will. In gewisser Weise bin ich ihm dankbar dafür." Er hatte aus dem Negativbeispiel eine positive Lehre gezogen – eine klassische Resilienzstrategie, die Psychologen "Bedeutungsgebung" nennen.
Aaron Antonovskys Revolution: Von der Pathogenese zur Salutogenese
Während Werner in Hawaii forschte, machte der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky eine ähnlich bahnbrechende Entdeckung. Er untersuchte Frauen, die den Holocaust überlebt hatten. Zu seiner Überraschung fand er, dass 29 Prozent von ihnen trotz des unvorstellbaren Traumas bei guter psychischer Gesundheit waren.
Das brachte Antonovsky zu einer radikalen Frage: Statt immer nur zu fragen "Was macht Menschen krank?" (Pathogenese), sollten wir fragen: "Was hält Menschen gesund?" (Salutogenese). Seine Antwort: das Kohärenzgefühl – ein tiefes Vertrauen, dass das Leben verstehbar, handhabbar und sinnvoll ist.
Verstehbarkeit: Resiliente Menschen haben das Gefühl, dass die Welt nicht völlig chaotisch ist. Auch wenn schlimme Dinge passieren, folgen sie einer gewissen Logik. Eine Holocaust-Überlebende sagte: "Ich verstand, dass es nicht persönlich gegen mich gerichtet war. Es war ein wahnsinniges System, aber es hatte eine kranke Logik."
Handhabbarkeit: Es ist das Vertrauen, dass man Ressourcen hat oder finden kann, um mit Herausforderungen umzugehen. Das müssen nicht immer eigene Ressourcen sein – auch das Wissen, wo man Hilfe bekommt, zählt dazu. "Ich wusste, ich bin nicht allein", sagte eine andere Überlebende. "Es gab immer Menschen, die halfen, auch in der dunkelsten Zeit."
Sinnhaftigkeit: Das ist die Überzeugung, dass das Leben trotz allem lebenswert ist, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Viktor Frankl, selbst Holocaust- Überlebender und Begründer der Logotherapie, formulierte es so: "Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie."