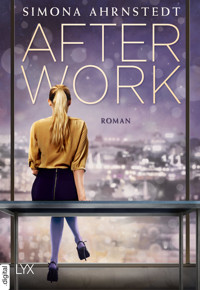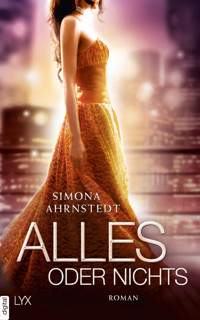9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Only One Night
- Sprache: Deutsch
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein:
Alexander de la Grip, Schwedens Jetset-Prinz, der vor allem für zwei Dinge bekannt ist: sein Aussehen und seine Frauengeschichten. Und Isobel Sørensen, eine leidenschaftliche Ärztin, die ihr Leben in Krisenregionen riskiert, um Menschen zu helfen.
Sie leben in verschiedenen Welten. Und sie verbindet nichts.
Doch als Isobels Hilfsorganisation Medpax plötzlich vor dem finanziellen Aus steht, kreuzen sich ihre Wege. Denn jetzt braucht Isobel das, was Alexander im Überfluss besitzt: Geld.
Je näher sie Alexander kennenlernt, desto deutlicher wird, dass sich hinter der Fassade des reichen Playboys ein ganz anderer Mann verbirgt. Ein Mann, der seine Nächte mit Sex und Partys verbringt, um der grausamen Leere in seinem Inneren zu entkommen.
Und bald ist es Isobel unmöglich, sich von ihm fernzuhalten ...
"Schnelles Tempo, spannende Intrigen, und eine knisternde Chemie zischen den Protagonisten." SYDSVENSKA DAGBLADET
Band 2 der schwedischen Bestseller-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Simona Ahrnstedt bei LYX
Impressum
SIMONA AHRNSTEDT
Ein einziges Geheimnis
Roman
Ins Deutsche übertragen von Antje Rieck-Blankenburg
Zu diesem Buch
Die dreißigjährige Isobel Sørensen lebt für ihren Job. Als Ärztin reist sie in die gefährlichsten Krisengebiete der Welt und leistet dort Hilfe, wo sie am dringendsten benötigt wird. Als sie erfährt, dass ihre Non-Profit-Organisation Medpax vor dem finanziellen Ruin steht, weil eine wichtige Stiftung ihre Spenden eingestellt hat, ist sie fassungslos. Noch fassungsloser ist sie allerdings, als sich herausstellt, wer der Inhaber dieser Stiftung ist: Alexander de la Grip, jüngster Sohn einer großen schwedischen Adelsfamilie, der in den letzten Jahren vor allem mit seinen unzähligen Frauengeschichten und ausschweifenden Partys auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber kann es wirklich sein, dass Medpax seinem verletzten Ego zum Opfer gefallen ist? Isobel ist von Alexanders verschwenderischem Lebensstil nämlich überhaupt nicht beeindruckt und hat den schwedischen Jetset-Prinzen bereits mehr als einmal abblitzen lassen. Doch jetzt will sie nichts unversucht lassen, um ihre Organisation zu retten, und lässt sich auf ein Date mit ihm ein. Schnell stellt sie fest, dass sich hinter der Fassade des sorgenfreien, reichen Playboys ein ganz anderer Mann verbirgt, ein Mann, der Isobel beeindruckt und von dem sie sich plötzlich nicht mehr fernhalten kann, sosehr sie es auch versucht. Doch Isobel hat selbst ein Geheimnis, das sie fest in ihrem Inneren verschlossen hält. Und dieses Geheimnis drängt immer stärker an die Oberfläche, je näher sie und Alexander sich kommen …
1
Als Alexander de la Grip aufwachte, wusste er nicht genau, wo er war. Der Helligkeit nach zu urteilen, war es bereits Morgen, aber in welchem Land er sich befand, in welcher Stadt, und mit wem er die Nacht verbracht hatte, war ihm entfallen.
Allerdings war dies nicht weiter ungewöhnlich.
Er checkte kurz seinen Zustand. Nackt. In einem fremden Bett, leicht verkatert. Er streckte seine Hand aus und suchte nach seinem Handy. Sah, dass es erst acht Uhr war, fühlte sich aber ausgeschlafen. Das war der Vorteil, wenn man regelmäßig trank und feierte: Mit der Zeit gewöhnte man sich daran und fühlte sich am Tag danach trotzdem relativ fit. Auch wenn jetzt allmählich die Erinnerung an sowohl den Champagner und die diversen Drinks als auch an die Mädels in den verschiedenen Clubs zurückkehrte, die er besucht hatte, bevor er hier gelandet war.
Wo auch immer hier nun war. Alexander versuchte, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Er hatte in Chelsea angefangen und war dann in den Meatpacking District weitergezogen, doch danach war das meiste in seiner Erinnerung verblasst. Er kratzte sich am Bartansatz. Verdammt, er musste heute noch nach Stockholm fliegen. Wo er, wenn auch nicht seinen Dämonen, dann zumindest einem Teil seiner Familie begegnen würde.
Er glitt aus dem Bett, in dem sein nächtliches Date noch tief schlief. Ihre Haare lagen ausgebreitet auf dem Kissen, und ihre Haut war leicht sonnengebräunt. Alexander blieb mit seinem Blick an ihrem nackten Rücken hängen. Sie hatte hübsch ausgesehen, als sie gestern auf der Dachterrasse angefangen hatten, miteinander zu flirten. Sexy auf diese energische Art und Weise, wie junge Frauen es oftmals waren, die auf der Suche nach dem Glück nach New York kamen. Schwedin, wie er meinte, sich zu erinnern. Bemerkenswert zielstrebig. Außerdem lispelte sie, was er unglaublich erregend fand. Eigentlich war sie etwas zu jung für ihn, doch Skrupel dieser Art hegte er nicht. Um die zwanzig, mit großen Kulleraugen und einem glucksenden Lachen. In ihrem Blick hatte etwas Brutales gelegen. Gestern war er zu betrunken gewesen, um sich darum zu kümmern, aber jetzt fiel es ihm wieder ein.
Sie waren sich in Romeos Restaurant begegnet und dort miteinander ins Gespräch gekommen. Sie war intelligent, witzig und geradeheraus, sodass aus dem Schlagabtausch ziemlich rasch mehr geworden war. Ihr Name war typisch schwedisch, Linda oder Jenny, und sie war … Er runzelte die Stirn, während er sich nach seiner Kleidung umsah. Journalistin? Nein, eher nicht. Er fand seine Unterwäsche und seine Hose, zog sie an und griff sich sein Hemd, die Lederjacke und die Schuhe. Studentin? Fotomodell? Nein, das auch nicht. Sie war zwar schmal genug, um Model zu sein, aber er meinte sich zu erinnern, dass ihr Beruf etwas mehr verlangte als lange Beine und Essstörungen. Er steckte sein Handy ein, vergewisserte sich, dass er sein Portemonnaie dabeihatte, zog ihr die Bettdecke über den Rücken hoch und ging hinaus in Richtung Wohnungstür. Öffnete sie leise und stand kurz darauf draußen auf der Straße, wo er innehielt. Richtig, sie wohnte in Brooklyn. Er setzte seine Sonnenbrille auf und orientierte sich. Definitiv im besseren Teil. Er kaufte sich einen Kaffee to go und hielt nach einem Taxi Ausschau.
Er war dankbar dafür, dass sie in Jessicas (genau, so hieß sie!) Wohnung und nicht in seiner gelandet waren, auch wenn er nun einen längeren Weg bis nach Hause zurücklegen musste. Nicht, dass er etwas dagegen gehabt hätte, Frauen mit zu sich nach Hause zu nehmen. Er liebte sein Appartement in der Upper West Side, und selbst die blasiertesten seiner Gäste waren jedes Mal beeindruckt von dem Portier, dem Luxus und der Aussicht über Manhattan. Aber er musste nach Hause, um zu packen, und sie hatten beide gewusst, dass es sich nur um einen One-Night-Stand handelte. Es war einfacher, wenn man selbst derjenige war, der sich davonstahl.
Als er in ein Taxi sprang, klingelte sein Handy. Er schaute aufs Display, spürte sofort das wohlbekannte Unbehagen in sich hochkommen, als er sah, dass seine Mutter anrief, und drückte den Anruf weg. Praktisch gesehen befand er sich bereits auf dem Weg nach Stockholm, und je länger er ein Gespräch mit ihr aufschieben konnte, desto besser.
Als sein Handy das nächste Mal klingelte, fuhren sie gerade über die Brooklyn Bridge. Diesmal stand auf dem Display Romeo, woraufhin er sich mit einem beschwingten »Talk to me baby« meldete, während er durchs Wagenfenster hinausschaute. In New York hatte der Frühling längst Einzug gehalten, und überall blühten Japanische Kirschen und Tulpen. Das morgendliche Verkehrsaufkommen hielt sich in Grenzen, und er spürte, wie die letzten Nachwirkungen seines nächtlichen Feierns mit dem Kaffee hinuntergespült wurden.
»Ich wollte nur hören, ob du okay bist«, vergewisserte sich Romeo Rozzi, Koch mit dem Beinamen »Das italienische Wunderkind«, Celebrity in der internationalen Gastronomieszene und Alexanders bester Freund.
»Warum sollte ich nicht okay sein?«
»Du warst ziemlich blau, als du mein Restaurant verlassen hast.«
»Das ist einer meiner besseren Zustände«, konterte Alexander abwehrend. »Weißt du übrigens, als was sie arbeitet? Mein Date?«
Romeo seufzte am anderen Ende der Leitung hörbar. »Erinnerst du dich etwa nicht mehr? Ich hab dir doch mehrfach gesagt, dass du vorsichtig mit ihr sein sollst.«
»Stimmt, als Bloggerin, oder?«
»Bei einem Super-Klatsch-Blog. Einem der schlimmsten. Und du hast ihr versprochen, ihr Material dafür zu liefern. Hast du das etwa?«
Alexander bemühte sich, die Fragmente seiner Erinnerungen an die Nacht zusammenzusetzen, die er mit der leidenschaftlichen Schwedin verbracht hatte. Er dachte an die Fragen, die sie ihm gestellt hatte, und die Dinge, die sie ausprobiert hatten.
»Schon möglich«, antwortete er.
»Sie ist total heiß auf Klickrekorde. Ich hab dich gewarnt. Sie ging geradezu ab wie ’ne Rakete, als sie dich sah. Willst du, dass ich das Ganze stoppe? Ich könnte mit ein paar Leuten reden.«
Alexander versuchte zu ergründen, ob es ihm etwas ausmachte, ein weiteres Mal in einem Klatsch-Blog oder Ähnlichem öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.
»Leuten?«, wiederholte er, während draußen der Eingang zum Central Park an ihnen vorbeizog. »Wenn das bedeutet, was ich glaube, würde ich dafür plädieren, die italienische Mafia noch rauszuhalten, okay? Es stört mich nicht, lass sie doch machen.«
Erneutes tiefes Seufzen. »Nimmst du denn gar nichts ernst?«
»Nun mach mal halblang. Meine Feierei beispielsweise nehme ich absolut ernst.«
»Du weißt genau, was ich meine.«
Alexander verstummte. Denn er wusste, worauf Romeo anspielte.
Im letzten halben Jahr hatte er ausschweifender als je zuvor gefeiert, und manchmal kam es ihm vor, als hätte er es nur darauf angelegt, für möglichst heftige Schlagzeilen zu sorgen, damit sie nach Europa gelängen und seine Eltern zu Hause in Schweden erreichten.
Im vergangenen Herbst hatte er eine Affäre mit der Popikone Zoe Taylor gehabt. Nach der kurzen, aber stürmischen Episode schrieb sie umgehend den Song My Favorite Swede, der einen Rekord auf Spotify erzielte. Ob der Song tatsächlich von Alexander handelte, blieb offen, doch Zoe, eine der bekanntesten Frauen weltweit, hatte dies nicht verneint, woraufhin die Presse ihn wie ein Tier zu jagen begann. Inzwischen war Zoe mit ihrem Bodyguard zusammen, aber My Favorite Swede war noch immer einer der meistgespielten Titel.
»Alessandro. Ich mach mir Sorgen um dich, und zwar ernsthafte.«
Romeo hegte Bedenken, dass Alexanders Alkoholkonsum, die Feierei und die ganzen Frauengeschichten womöglich doch etwas aus dem Ruder liefen, das wusste Alexander.
Aber mal ehrlich. Ein Blick in seine Vergangenheit und das Ganze war gar nicht mehr so abartig. Er betrachtete das Geschehen draußen vor dem Wagenfenster. Gelbe Taxis, Zeitungsstände und jede Menge Passanten. In jeder Straße dasselbe Bild.
Nach Zoe hatte er mit einer Reihe von Frauen etwas angefangen, bevor er Lana begegnete, der Erbin eines Immobilienimperiums. Es hatte ganze zweiundzwanzig Tage gehalten. Lana war die Skandalerbin in den USA schlechthin, und ihre Romanze mit dem schwedischen Jetset-Prinzen hatte in der amerikanischen wie auch europäischen Presse ein lautstarkes Echo ausgelöst. Aufrichtig gesagt, konnte sich Alexander nicht mehr so genau an ihre gemeinsame Zeit erinnern. Sie hatten ununterbrochen gefeiert, dann jedoch kurz vor Weihnachten in beiderseitigem freundschaftlichen Einvernehmen Schluss gemacht. Lana war auf ihre Familienranch in Texas zurückgekehrt, wo sie sich mit einem Jugendfreund verlobt hatte, und vor wenigen Wochen hatten die beiden erst geheiratet. Alexander hatte dem Brautpaar sogar ein Hochzeitsgeschenk spendiert. Es war ihm gelungen, den größten Teil des Ensembles eines der frivolsten Musicals am Broadway dafür zu gewinnen, und er hatte den Flug und Aufenthalt für die gesamte Truppe sowie einen exklusiven Auftritt beim Hochzeitsfest finanziert. Die Künstler, ausschließlich Männer, hatten einen der skandalösesten Songs aus dem Musical dargeboten, gespickt mit Flüchen, obszönem Sex und Blasphemie, und Alexander hatte extra etwas draufgelegt, damit sie nur in kurzen Shorts und Krawatte auftraten. Welchen Eindruck die Vorstellung bei der tiefreligiösen Familie des Bräutigams hinterlassen hatte, war ihm nicht bekannt. Doch er war sich sicher (beinahe jedenfalls), dass sein Gag Lana gefallen hatte.
Wie Alexander selbst Weihnachten gefeiert hatte, wusste er nicht mehr genau. Auf den Malediven? Seychellen? Vage Erinnerungen an nackte Frauen und Luxusjachten tauchten in seinem Kopf auf. Oder war das an Silvester gewesen?
Als das Taxi an einer Kreuzung abbog und die Upper West Side sichtbar wurde, kehrte Alexander in seinen Gedanken wieder in die Gegenwart zurück.
»Ich bin jetzt kurz vor meiner Wohnung, kann ich dich anrufen, wenn ich in Stockholm angekommen bin?«
»Ach richtig, du fliegst ja heute nach Hause. Und wie fühlt sich das an?«
Fucking wonderful.
Er schaute auf die Uhr. Kurz vor neun. »Als bräuchte ich dringend ’nen Drink.«
»Euer schwedischer Prinz ist übrigens ziemlich sexy. Ich würde ihn gern mal bekochen.«
»Wenn ich ihn treffe, werde ich es ihm ausrichten«, entgegnete Alexander und legte auf.
Frisch geduscht, rasiert und umgezogen kam Alexander frühzeitig in Newark an. Der Taxifahrer nahm das Trinkgeld mit einem Grinsen entgegen, und Alexander checkte sein Gepäck ohne Probleme ein. Er hatte nie irgendwelche Probleme mit derlei Dingen. Er schenkte einfach jeglichen Personen, die am Check-in saßen, sein blendendes Lächeln, und all seine Koffer entschwebten umgehend auf dem Gepäckband.
In der VIP-Lounge zwinkerte er der kräftig gebauten Dame hinter der Theke zu und registrierte, wie sich ihre stramme Haltung entspannte, während sie sich mit der Hand übers Haar strich und ihm dann einen Wodka on the rocks servierte. Die Frauen in New York waren im weltweiten Vergleich zwar außerordentlich schwer herumzukriegen, aber bislang war es ihm noch immer gelungen, sie zu bezirzen. Er musste nur alle Reize ausspielen, die er besaß. Es funktionierte ganz automatisch, und außerdem war es eine Win-win-Situation: Er erhielt guten Service, und sie freuten sich.
Als sein Gate fürs Boarding geöffnet wurde, ließ er höflich eine Mutter mit ihrem Säugling vorbei, half einer älteren Dame mit ihrer Tasche und stieg dann selbst an Bord. Dort ließ er sich vom unaufdringlichen Luxus der ersten Klasse einlullen, bestellte einen Drink vorm Essen und verschlief dann den Großteil der Flugzeit. Er buchte jedes Mal denselben Flug nach Stockholm, da dieser für ihn zeitlich ideal lag, und er achtete immer darauf, genügend Alkohol zu sich zu nehmen, um einschlafen zu können.
Als er am frühen Morgen in Arlanda landete, war er ausgeschlafen. Er rauschte förmlich mit seinem schwedischen Pass durch den Zoll, erhielt ohne Probleme seine Koffer, was ein weiterer Vorteil des Reisens in der ersten Klasse war, und winkte ein Taxi heran.
»Ganz schön kalt«, bemerkte er gegenüber dem Taxifahrer, der mit einem ausführlichen Bericht über Temperaturen und Sonnenstunden in den vergangenen Apriltagen antwortete. Das Wetter war das Lieblingsgesprächsthema aller Schweden. Sie passierten die Vororte. Während sich der Central Park in New York bereits in ein Meer aus Tulpen und Narzissen verwandelt hatte, war der Frühling hier noch längst nicht so weit fortgeschritten. Alexander brummte hin und wieder bestätigend zu den Monologen des Taxifahrers. Er mochte es, den Menschen zuzuhören, und er mochte das Land mit seiner sauberen Luft und entspannten Atmosphäre. Was er hingegen nicht mochte, war seine Familie. Er würde versuchen, die Begegnung mit ihr so lange wie möglich hinauszuschieben. Im besten Fall sogar bis zum Sonntag, an dem die Taufe stattfinden würde. Seit letztem Herbst war es ihm erfolgreich gelungen, alle Familienzusammenkünfte zu meiden, aber jetzt standen eine Taufe und eine Hochzeit an, die selbst er nicht verpassen wollte, sodass er in den sauren Apfel beißen und das Beste draus machen musste. Die Tage davor würde er damit zubringen, sich vom Jetlag zu erholen, und die Nächte den Frauen und dem Alkohol widmen, doch nicht zuletzt würde er gezwungen sein, alle seine Bankberater zu treffen – allein schon bei dem Gedanken daran entfuhr ihm ein Seufzer. Sie passierten Roslagstull und bogen in die Birger Jarlsgata ein. Die Straßen wirkten so schmal und sauber. Die Menschen waren gut gekleidet, auch wenn der Anteil an Bettlern in deprimierender Weise zugenommen hatte. Dann sausten Stureplan und das Finanzviertel an ihm vorbei. Nachtclubs und Kneipen schienen ihn augenzwinkernd willkommen zu heißen. Das hier war sein altes Lieblingsviertel. Es spielte keine Rolle, wie blasiert das Partyleben in New York, Bangkok oder London ihn hatte werden lassen, Stockholm war einfach besonders. Er würde gleich heute Abend ausgehen, entschied er, das war genau das, was er jetzt brauchte.
Das Taxi hielt vorm Hotel Diplomat, in dem Alexander immer abstieg, wenn er in Stockholm war. Das Wasser in der Bucht Nybrovik glitzerte, und trotz der kühlen Luft spazierten dünn gekleidete frühlingsberauschte Schweden am Kai des Strandväg entlang. Er griff sich eine Tasche und überließ dem Hotelpersonal die restlichen Gepäckstücke. Er würde ein paar Wochen bleiben und hatte für alle Eventualitäten gepackt. Obwohl er Stockholm liebte, war es schwierig, sich hier vernünftige Kleidung zu kaufen, jedenfalls wenn man maßgeschneiderte Spitzenqualität bevorzugte. Was er definitiv tat.
Er zog einen schwedischen Geldschein hervor und gab ihn der auf dem Gehweg hockenden Bettlerin. Während er das Foyer betrat, schämte er sich dafür, dass er sein schlechtes Gewissen auf diese Art und Weise zu betäuben versuchte. Mittlerweile hatte er eine Nichte in Schweden, sodass er sich wirklich eine Wohnung in Stockholm kaufen sollte, dachte er zum bestimmt zwanzigsten Mal in den vergangenen Monaten. Er lächelte die Frau an der Rezeption an und schob ihr einen Fünfhundert-Kronen-Schein zu, nachdem sie ihn eingecheckt hatte. Sie errötete, nahm ihn jedoch in dem Bewusstsein entgegen, dass bestimmte Regeln außer Kraft gesetzt waren, wenn Alexander de la Grip im Hotel logierte. Wenn er schon seine Familie treffen musste, konnte er seine Freiheit ebenso gut ein wenig mehr genießen.
Alexander würde nicht gerade behaupten, dass er seine Familie hasste. Denn das tat er nicht, zumindest nicht direkt und auch nicht alle Familienmitglieder. Es war … kompliziert. Und er verabscheute komplizierte Dinge, hatte sein ganzes Leben damit zugebracht, ihnen aus dem Weg zu gehen, noch dazu ziemlich geschickt. Er duschte, packte seine Koffer aus, steckte Handy und Portemonnaie ein und verließ das Hotel.
Sein Plan war natürlich, wieder zurückzukommen, aber man konnte nie wissen. Er setzte seine Sonnenbrille auf und begann in der Kontaktliste seines Handys zu blättern. Was auch immer man davon halten mochte, Alexander de la Grip war zurück in der Stadt. Und Stockholm liebte ihn.
2
Isobel Sørensen wich einem Autofahrer aus und hielt dann an einer roten Ampel im Valhallaväg an. Ihr war kalt, doch sie hoffte, dass ihr auf der Fahrt mit dem Fahrrad hinunter zum Nybroplan warm werden würde. Sie war auf dem Weg zum Meeting bei Medpax und spät dran, sodass sie in die Pedale trat, sobald die Ampel auf Gelb umsprang.
Sie schloss ihr Fahrrad ab, öffnete den Verschluss ihres Helms und lief die Treppen hinauf. Drinnen begrüßte sie Asta, die Volontärin, die sowohl als Rezeptionistin als auch als Assistentin tätig war, und erblickte dann Blanche Sørensen.
»Bonjour maman«, sagte Isobel, knöpfte sich die Jacke auf und gab ihrer Mutter zwei flüchtige französische Wangenküsschen.
»Du bist verschwitzt«, entgegnete Blanche irritiert.
Isobel strich sich die Haare aus dem Gesicht und wischte sich über die Stirn, während sie ihre Mutter mit dem Blick scannte. Sie registrierte, dass ihr blondes Haar frisch gelegt glänzte und ihr Chanel-Kostüm neu war, bestimmt eines aus der ersten Kollektion des Jahres. Ihre Mutter hegte keinerlei moralische Bedenken, wenn es darum ging, Geld für ihr Aussehen auszugeben. »Du siehst gut aus, wolltest du auch zum Meeting?«
Bei ihrer Mutter wusste man nie genau. Blanche war dreißig Jahre lang Vorsitzende von Medpax und dessen Aushängeschild gewesen. Obwohl sie sich vor zwei Jahren aus all ihren offiziellen Ämtern zurückgezogen hatte, besaß sie noch immer ein hohes Ansehen, und hin und wieder entschied sie sich, an den wöchentlichen Meetings teilzunehmen.
Die dann allerdings nicht zu den produktivsten zählten.
»Ich bin nur hier, um meine Post zu holen.«
Isobel unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung. Ihre Mutter war früher eine überwältigende Persönlichkeit gewesen, eine intellektuelle wie gesellschaftspolitische Vorreiterin, auf die man zählen konnte, doch die letzten Jahre waren, nun ja, turbulent gewesen.
»Isobel, da bist du ja«, begrüßte Leila, die Generalsekretärin von Medpax, sie, als sie zu ihnen an die Rezeption kam. Leilas dunkle Augen musterten Blanche, bevor sie eine ihrer schwarzen Augenbrauen hochzog. »Blanche, schön, dich wieder einmal zu sehen.« Sie sprach perfekt Schwedisch, doch der Akzent ihrer heiseren Stimme verriet ihren persischen Ursprung.
»Leila«, entgegnete Blanche nüchtern.
Offiziell hatte Blanche selbst entschieden, ihr Engagement bei Medpax zu beenden, als sie im Krankenhaus Huddinge den Dienst als Leitende Oberärztin niederlegte und in den Ruhestand ging. Inoffiziell hatte der Vorstand ihr jedoch nahegelegt, zurückzutreten. Sie hatte ganz einfach zu viel Chaos verursacht. Diesen Anlass hatte die damalige Geschäftsführerin, eine ältere Dame, die hauptsächlich als verlängerter Arm von Blanche fungierte, erleichtert als Gelegenheit genutzt, um selbst in Rente zu gehen und Geranien zu züchten. Der Vorstand hatte die Stelle neu ausgeschrieben, woraufhin Leila Dibah mit der Entschlossenheit einer persischen Heerführerin das Büro stürmte, und seitdem war nichts mehr wie zuvor. Die zweiundfünfzigjährige Psychologin, die Isobel einmal nach einer halben Flasche Rioja anvertraut hatte, dass sie die Stelle bei Medpax nur aufgrund einer Krise anlässlich ihres Fünfzigsten angenommen hätte, hatte sich innerhalb weniger Tage selbst zur Generalsekretärin ernannt. Des Weiteren hatte sie wöchentliche Meetings für das gesamte Personal eingeführt und damit begonnen, das Durcheinander zu entwirren, das jahrelange undurchsichtige und selbstherrliche Führungsarbeit hinterlassen hatte. Nur dank Leilas beharrlicher Arbeit hatte Medpax um Haaresbreite eine unangekündigte Wirtschaftsprüfung bestanden, die ihnen nach heftiger Kritik seitens der schwedischen Spendenaufsicht ins Haus stand. Mit anderen Worten, die Einstellung der intelligenten Psychologin war ein Geniestreich des zugegebenermaßen noch immer etwas gebeutelten Vorstands gewesen.
»Sorry für die Verspätung«, entschuldigte sich Isobel bei Leila, nachdem die beiden älteren Frauen kühle Blicke miteinander gewechselt hatten. »In der Praxis herrschte völliges Chaos.«
Blanche sagte nichts, doch Isobel wusste genau, was ihre Mutter dachte. Nämlich, dass Isobel vom Chaos geradezu angezogen wurde und selbst schuld war, wenn sie nicht damit umgehen konnte. Unausgesprochene Kritik war Blanches Paradedisziplin.
Es war Henri Pelletier, Isobels Großvater, der Medpax 1984 gegründet hatte. Der ursprüngliche Sitz des Unternehmens war in Paris gewesen, wo noch immer ein verschlafenes Verwaltungsbüro in einem alten Mietshaus am Rande der französischen Hauptstadt existierte. Isobel war gerade im vergangenen Winter dort gewesen und hatte die beiden angestellten Damen getroffen, mit ihnen Café noir getrunken und sich Geschichten über die gute alte Zeit angehört. Ihr Großvater Henri war ein brillanter Arzt gewesen, der seiner Zeit weit voraus war und sich für bessere Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung in den afrikanischen Ländern engagierte, die zu diesem Zeitpunkt noch französische Kolonien waren oder es zumindest einmal gewesen waren. Aus seinem Engagement heraus war die Hilfsorganisation Medpax entstanden. Dass seine Tochter Blanche einmal in seine Fußstapfen treten und Chirurgin werden sowie Medpax leiten würde, war für sie selbstverständlich gewesen. Die Tatsache, dass Isobel jedoch einen etwas anderen Weg gewählt hatte – eine andere medizinische Fachrichtung und anderweitige Engagements –, war noch immer ein Gesprächsthema zwischen ihnen, das einem afghanischen Minenfeld gleichkam.
»Du bist nicht zu spät«, entgegnete Leila und brachte Isobel gedanklich wieder zurück in die Gegenwart. »Wir wollten gerade anfangen. Danke für deinen Besuch, Blanche, und pass auf dich auf. Hejdå.«
Das waren deutliche Worte, und Isobel hielt die Luft an. Die verbalen Zusammenstöße zwischen Blanche und Leila in den letzten Jahren hatten mittlerweile zwar an Intensität verloren, doch die Beziehung zwischen den beiden Frauen war noch immer spannungsgeladen, und man durfte nicht immer darauf hoffen, einer Szene zu entkommen. Doch diesmal nahm Blanche bloß ihren Stapel Post an sich, sagte kühl Auf Wiedersehen und verschwand durch die Eingangstür aus Mahagoni.
Leila schaute Isobel mit festem Blick an. Ihre dunklen Augen erweckten den Eindruck, als hätten sie bereits jedwede menschliche Unzulänglichkeit gesehen und könnten sich nicht entscheiden, ob das Dasein eher einer Komödie oder Tragödie glich. »Sollen wir anfangen?« Sie hielt ihr die Tür zum Konferenzraum auf, in dem das Gros der kleinen und zumeist unbezahlten Belegschaft von Medpax bereits saß und wartete. Asta folgte ihnen. Isobel begrüßte zuerst Thea Nilson, die Finanzbeauftragte von Medpax, dann zwei Politologiestudentinnen mit kurzen Haaren, die ein Praktikum bei ihnen absolvierten und offenbar beide Katarina hießen, und schließlich Frau von Fersen, eine Dame mit blau gefärbten Haaren, die sich um alle Spenden kümmerte sowie Mittagstreffen, Abendveranstaltungen und Galas organisierte, die einen Großteil (einen viel zu großen Anteil, wenn man Isobel fragte) der Arbeit von Medpax ausmachten. Isobel setzte sich. Grundsätzlich war sie der Meinung, dass Meetings eine enorme Zeitverschwendung darstellten, aber die neu eingeführten Wochenmeetings waren erstaunlich lebhaft, wie sich herausgestellt hatte, sodass sich Isobel inzwischen darauf freute, dort Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen über humanitäre Hilfe, die Arbeit vor Ort und Zukunftsfragen zu diskutieren.
Sven, ein Chirurg mit Pferdeschwanz und Cowboystiefeln, kam herein und nach ihm Lin-Lin, eine Gesundheitswissenschaftlerin, die Leila für Medpax hatte gewinnen oder aggressiv von Ärzte ohne Grenzen abwerben können, je nachdem, wie man es betrachtete. Damit war das gesamte Personal von Medpax anwesend.
Während Leila die Tagesordnung verlas, nahm sich Lin-Lin einen Butterkeks von einem Teller in der Mitte des Tisches. Die beiden Katarinas machten sich eifrig Notizen, während sich Isobel, die den ganzen Tag noch nichts getrunken hatte, nach der Wasserkaraffe streckte.
Sie gingen diverse Fragen zu Wochenenddienstplänen und Unkosten durch und gerieten schließlich in eine Diskussion über Ethik innerhalb der humanitären Hilfe, die in einen hitzigen Meinungsaustausch zwischen Sven und Asta ausartete. Als Isobel lautstark dazu aufgefordert wurde, tat sie ihre Meinung kund und spürte, wie ihre Müdigkeit nach einem langen Arbeitstag verflog und durch Energie ersetzt wurde. Sie liebte das hier, empfand es als stimulierend. Diese leidenschaftlichen Diskussionen. Das ständige Hinterfragen ihrer Arbeit.
Asta war aufgesprungen und ereiferte sich nun über das Thema Moral und Verantwortung, sodass ihre Wangen glühten. Isobel nickte zustimmend. Humanitäre Hilfe und der Einsatz vor Ort durften niemals zu einer Art Hobby für reiche weiße Europäer mit schlechtem Gewissen werden.
»Es geht doch um eine moderne humanitäre Arbeit«, argumentierte Asta. »Bei der man die Menschen, die in diesen Ländern leben, als kompetente Individuen betrachtet.«
»Aber dabei spielt eben auch jahrelange Erfahrung eine Rolle«, wandte Sven ein.
»Isobel?« Asta wandte sich direkt an sie. »Bist du nicht auch meiner Meinung?«
Isobel war sich im Klaren darüber, dass sie eine Art Sonderstellung innehatte. In einer Welt, in der sich der Wert einer Person ausschließlich daran bemaß, wie viele Auslandseinsätze man bereits absolviert hatte und wie umfangreich diese gewesen waren, war sie nahezu einzigartig. Nur wenige hatten so viele Einsätze vor Ort geleistet wie sie, und allein das verlieh ihr einen Senior-Status. Aber alle wussten auch, dass Moral und Ethik die Themen waren, die Isobel besonders am Herzen lagen. Über die sie leidenschaftlich debattierte und bei denen sie sich weigerte, Kompromisse einzugehen.
»Nur Gutes tun zu wollen, reicht einfach nicht aus. Wir müssen auch das Richtige tun.«
Asta nickte, doch Sven schnaubte verächtlich.
»Es gibt aber nicht immer nur richtig oder falsch.«
Eigentlich konnte Isobel auch die Meinung des Chirurgen nachvollziehen. Manchmal gab es nur Falsches und noch Falscheres. Wie viele Menschen waren in Liberia unmittelbar vor ihren Augen gestorben? Wie viele Kinder hatte sie dort unten nicht mehr retten, geschweige denn überhaupt berühren können? Es war, als hätte sie im Kreuzfeuer gestanden. Kein Einsatz in einem Krisengebiet war leicht, denn der Sinn einer solchen Reise bestand schließlich darin, die bedürftigsten Orte der Welt aufzusuchen und den notleidenden Menschen dort zu helfen. Doch Liberia war für sie eine völlig neue Art von Hölle gewesen.
»Ich meine, dass wir in jeder einzelnen Situation darüber nachdenken müssen, was uns antreibt«, erklärte sie. »Es ist leicht, Entscheidungen aus einem Impuls heraus zu fällen, da sie sich in dem betreffenden Moment richtig anfühlen. Aber wir müssen immer im Auge behalten, welche Konsequenzen unsere Entscheidungen auf lange Sicht haben.«
»Aber das kann ein verdammt abgebrühtes Verhalten nach sich ziehen.«
Isobel pflichtete ihm bei. Die Grenze zwischen rationalen und unmenschlichen Entscheidungen war nicht immer leicht zu erkennen, am wenigsten für sie selbst. Hatte Sven also recht? Führten hohe innere Ansprüche an Moral und Integrität dazu, dass man gefühlloser handelte? Isobel wünschte, sie hätte eine Antwort darauf gehabt.
»Wir werden noch Gelegenheit haben, weiter darüber zu sprechen«, sagte Leila mit dem Blick auf Sven gerichtet. »Vielleicht, wenn du aus dem Tschad zurückkommst?«
Während seiner Blütezeit hatte Medpax drei Kinderkrankenhäuser betrieben. Jeweils eines in der Republik Tschad, im Kongo und in Kamerun. Im Lauf der Jahre waren zwei der Krankenhäuser vom jeweiligen Staat übernommen worden. Isobel fand dies ausgezeichnet und betrachtete es als natürliche und wünschenswerte Entwicklung. Für Blanche jedoch war das eine persönliche Kränkung. So sah sie die Dinge nunmal. Jedenfalls besaß man jetzt nur noch ein Kinderkrankenhaus. Es wurde von tschadischem medizinischen Personal, vereinzelten Volontären und hin und wieder von Ärzten anderer Hilfsorganisationen betreut, aber von Medpax betrieben. Seit dem vergangenen Herbst war niemand von Medpax mehr dort gewesen, doch laut Plan würde Sven demnächst hinfahren, sich einen Eindruck darüber verschaffen, welche Maßnahmen in Zukunft zu ergreifen wären, und einen formalen Handlungsplan erstellen.
»Apropos Tschad«, sagte Sven langsam. »Ich werde nicht hinfahren können.«
Am Tisch breitete sich Stille aus.
»Und warum nicht?«, fragte Isobel schließlich. Sie war bemüht, nicht anklagend zu klingen, aber Ärzte, die in ein Kinderkrankenhaus in den Tschad fahren konnten, wuchsen nicht gerade auf Bäumen. Sie war diejenige, die im vergangenen Herbst dort gewesen war, bevor sie nach Liberia weitergereist war, und sie wusste, dass Sven dort gebraucht wurde. Irgendjemand musste sich einen Überblick verschaffen.
»Meine Frau will nicht, dass ich fahre.«
Leila legte ihren Kopf schräg. »Ist das endgültig?«
»Tut mir leid, aber es ist absolut endgültig. Sie hat mir ein Ultimatum gestellt, und meine Ehe geht vor.«
Ein zynischer Gedanke veranlasste Isobel, sich zu fragen, warum Sven, der dafür bekannt war, mit fast jeder Krankenschwester, der er begegnete, im Bett zu landen, ausgerechnet jetzt die Meinung vertrat, dass seine Ehe vorginge. Doch sie sagte nichts. In ein Krisengebiet zu fahren, sollte der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen obliegen.
Leila nickte. »Wir müssen sehen, ob wir eine andere Lösung finden können. Aber ich würde gern noch eine weitere Sache besprechen.« Sie nahm einen zum Bersten gefüllten Aktenordner entgegen, den Asta ihr reichte. »Wir haben ein Problem mit einem Finanzier. Ein ernsthaftes Geldproblem.«
Die für Spenden zuständige Frau von Fersen, die bislang stumm dagesessen und ihre silberfarben lackierten Fingernägel betrachtet hatte, warf einen ernsten Blick in die Runde. Leila teilte Papierbögen mit diversen Tabellen darauf aus, die sich Isobel und die anderen umgehend ansahen. Isobel legte ihre Stirn in Falten. Sie war zwar keine Finanzexpertin, aber …
»Es scheint sich um irgendeine Stiftung zu handeln.« Sie schaute auf. »Sind wir denn so abhängig von denen? Von einem einzelnen Spender?«
Leila nickte bejahend. »Inzwischen sind wir das. Sie haben uns viel Geld gespendet, dann aber abrupt damit aufgehört. Wie ihr wisst, hatten wir ja bereits einige Sponsoren verloren, bevor ich anfing. Seitdem haben wir auf mehrere Anfragen hin abschlägige Bescheide erhalten und dies nicht wieder aufholen können.«
Als Leila zu Medpax gekommen war, hatte sie gerettet, was zu retten war, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass Blanche die wichtigen Beziehungen zu den Sponsoren im Lauf der Jahre immer nachlässiger gepflegt hatte. Ihre Mutter war mit zunehmendem Alter härter und kompromissloser geworden und hatte viele Leute vor den Kopf gestoßen. Isobel wusste natürlich rein verstandesmäßig, dass dies nicht ihr Fehler war, aber es war ihr dennoch fürchterlich unangenehm. Hätte sie ahnen müssen, wie übel sie dran waren? Wäre Isobel dem Willen ihrer Mutter nachgekommen und hätte sich mehr für Medpax engagiert, dann hätte sie dieser Entwicklung weitaus früher entgegenwirken können. Sie starrte hinunter auf ihre sauber geschrubbten, mit Sommersprossen übersäten Hände. Manchmal war es, als würde sie alles falsch machen, egal, was sie tat.
»Wir können es uns nicht leisten, diese Stiftung zu verlieren. Ich weiß allerdings nicht genau, warum sie aufgehört haben. Obwohl ich mehrere Nachrichten auf ihrem AB hinterlassen habe, ruft niemand zurück.«
Der Name der Stiftung sagte ihr nichts, aber die Adresse lag in einer der teuersten Straßen Stockholms, und vielleicht fanden sie es nicht der Mühe wert, eine Psychologin von einer kleinen humanitären Organisation zurückzurufen.
Isobel bemühte sich, den Inhalt der Tabellen zu deuten. »Und wann haben sie ihre Zahlungen eingestellt?«
»Kurz vor Weihnachten.«
Da war sie gerade in Liberia gewesen. Hatte mehr Tote, verlassene Dörfer und traumatisierte Krankenpfleger gesehen als je zuvor. Sie hatte schon in Flüchtlingslagern, Kriegsgebieten und von Naturkatastrophen betroffenen Krisenregionen gearbeitet, seit sie ein Teenager war. Aber Liberia … Es hatte Wochen gedauert, bis die schlimmsten Albträume nachließen.
»Du hättest etwas sagen sollen. Wie heißt er oder sie denn?«
»Wer?«
»Der oder die, die hinter der Stiftung stehen.«
»Hier«, sagte Leila und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Stelle im Ordner. »Ein Er. Alexander de la Grip.«
»Machst du Witze?«, fragte Isobel ungläubig.
Leila schaute auf. »Weißt du, wer das ist?«
Zugleich tauschten Thea, Lin-Lin, die beiden Katarinas und Asta vielsagende Blicke aus. Isobel nahm an, dass sie genau wussten, wer der blonde Partyprinz Alexander de la Grip war.
Die am besten gekleideten Junggesellen. Die reichsten Schweden unter dreißig. Die attraktivsten Männer der Welt. Isobel hatte aufgehört zu zählen, auf wie vielen Ranglisten sie seinen Namen schon gesehen hatte. In wie vielen Klatschblättern er abgebildet gewesen war. Nicht, dass sie bewusst nach seinem Namen suchte, aber er tauchte wie ein endlos langer, schauderhafter Fortsetzungsroman regelmäßig in der Presse auf.
»Ja«, antwortete sie kurz. Immerhin verband sie und Alexander de la Grip darüber hinaus eine ganz eigene kleine Geschichte.
Sie waren sich im vergangenen Sommer durch Zufall begegnet. Damals war sie viel unterwegs gewesen. In New York, Skåne und im Tschad. Und danach in Liberia. Er hatte mit ihr geflirtet, woraufhin sie ihn gebeten hatte, zur Hölle zu fahren.
Womöglich sogar mehrfach. Sie rieb sich müde die Stirn. Jedenfalls war sie jedes Mal, wenn Alexander sie angesprochen hatte, unhöflich zu ihm gewesen, das musste sie definitiv zugeben. Aber seine gesamte Erscheinung hatte sie irritiert. Der alkoholisierte Blick, sein versnobtes Auftreten. War er wirklich so leicht zu kränken? Dumme Frage, natürlich war er das. Sein Ego war wahrscheinlich empfindlicher als eine geschwächte Immunabwehr. Sie hatte ihn gekränkt, und er war nach Hause gefahren und hatte aus Rache den Geldhahn für die Spenden an Medpax zugedreht. So simpel war das Ganze.
Leila betrachtete sie über die schwarze Fassung ihrer Brille hinweg. »Kann man mit ihm reden? Ihn möglicherweise dazu bringen, seine Meinung zu ändern, vielleicht bei einem Mittagessen?«
Isobel fummelte an dem Papier herum. »Ich nehme an, man könnte es versuchen«, antwortete sie widerwillig. Es war nichts Ungewöhnliches, sich mit potenziellen Geldgebern zu einem Mittag- oder Abendessen oder in einzelnen Fällen auch zu einem Frühstück zu treffen. Sie hatte dies schon viele Male getan und wusste, dass sie geschickt war und die Leute beeindruckte. Doch der Gedanke daran, diesem verwöhnten Oberschichtschnösel wegen Geld Honig um den Bart zu schmieren, verursachte ihr beinahe Übelkeit.
»Übernimmst du das?«
Isobel überlegte bereits, wie sie mit einem so schnell eingeschnappten Jetset-Prinzen am besten verfahren würde, setzte jedoch eine neutrale Miene auf. Sie bedachte Leila mit einem ruhigen Blick und sagte nur: »Selbstverständlich.«
»Gut. Wenn wir nicht mehr Geld reinbekommen, sind wir geliefert. Dann können wir Medpax noch vor dem Sommer dichtmachen.«
Die anderen am Tisch tauschten unruhige Blicke aus.
»Jetzt übertreibst du aber«, sagte Isobel.
Leila besaß eine leicht melodramatische Ader. Ganz so übel konnte es doch wohl nicht sein, oder?
Leila deutete auf die Papiere. »Ihr könnt es gerne nachrechnen. Ich habe es bereits getan. Ohne Geld keine weitere Hilfsarbeit. Das ist einfache Mathematik.«
Nachdem Leila das Meeting beendet hatte und die anderen gegangen waren, wandte sie sich an Isobel: »Kannst du noch kurz bleiben?«
Die Tür wurde geschlossen, und sie waren allein.
»Ja?«, fragte Isobel.
Leila betrachtete sie eine Weile lang. »Ich wollte nur wissen, wie es dir eigentlich geht.«
Isobel stützte sich mit der Hand auf den Tisch. Sie trommelte leicht mit den Fingern auf die Platte, hörte jedoch umgehend wieder auf. »Gut«, antwortete sie. Das entsprach im Großen und Ganzen der Wahrheit.
»Kannst du nachts wieder besser schlafen?«
Isobel betrachtete sie misstrauisch. »Ist das eine psychologische Beurteilung?«
Leila verzog keine Miene. »Benötigst du denn eine?«
Isobel zwang sich, still zu sitzen und keinerlei psychomotorische Unruhe zu zeigen. Sie atmete ein. Und aus. Es gab Gerüche und Bilder, die sie noch immer nicht abschütteln konnte. Doch die ersten Wochen zu Hause waren erfahrungsgemäß die schlimmsten, und inzwischen war sie seit drei Monaten wieder hier. Das Leben war im Großen und Ganzen wieder wie immer.
»Die Schlaftabletten habe ich inzwischen abgesetzt. Alles weist also in die richtige Richtung.«
Sie saßen eine Weile schweigend da.
»Wir brauchen dringend jemanden im Kinderkrankenhaus, das weißt du ja so gut wie ich«, sagte Leila schließlich.
Isobel hatte geahnt, dass sie das Thema ansprechen würde. »Ich bin keine Kinderärztin.« Doch das war ein lächerlicher Einwand, und das wussten sie beide. Denn mit ihren Fähigkeiten und der Erfahrung, die sie besaß, gab es nicht ein Krankenhaus weltweit, das keinen Nutzen von ihr gehabt hätte.
»Du kannst ja mal drüber nachdenken.«
»Ja.«
»Und wenn du über den Tschad nachdenkst, könntest du dann auch gleich über Skåne nachdenken?«
Isobel war es gelungen, dieses Spektakel erfolgreich zu verdrängen. Medpax würde irgendwo in Skåne auf dem platten Land an einem großen Wohltätigkeitsevent teilnehmen. Reiche Leute, Repräsentanten großer Unternehmen, Politiker und ein gemischtes Publikum der Oberschicht würden sich in einem repräsentativen Schloss versammeln. Dort würden sie Small Talk betreiben, edlen Wein trinken, exklusive Speisen zu sich nehmen und sich hoffentlich davon überzeugen lassen, möglichst viel Geld zu spenden.
»Reicht es nicht aus, dass ich Herrn de la Grip anbetteln muss?«
»Aber alle lieben dich, Isobel. Die dritte Generation Medpax, ein hervorragendes Weltgewissen und all das. Und du bist eine junge Frau, das zieht immer. Stell dir nur vor, wie viel Geld wir lockermachen könnten, wenn du hingingest.«
»Ist das nicht gefühlsmäßige Erpressung?«
»Absolut«, pflichtete Leila ihr bei. Sie tippte mit dem Zeigefinger auf das Papier mit den Tabellen. »Wenn du die Sache mit Alexander de la Grip nicht klärst, wird es ohnehin nur wie ein Pflaster auf einer klaffenden Wunde sein. Wir müssen regelmäßige Spenden einnehmen, einen Puffer aufbauen.«
Von ihr wurde also erwartet, zuerst hier in Stockholm einen der unmoralischsten Männer weltweit zu umgarnen und dann nach Skåne zu fahren, um sich bei weiteren reichen Leuten einzuschmeicheln. Jetzt war ihr richtig schlecht.
»Schaffst du das, Isobel?«
»Ja.«
Sie schaffte es, weil sie im Prinzip immer alles schaffte. Aber sie dachte, dass sie es vielleicht dennoch vorgezogen hätte, in Liberia zu bleiben.
3
Alexander verbarg ein Rülpsen hinter vorgehaltener Hand.
Er war total verkatert.
Genau genommen war er immer noch betrunken.
Er atmete tief durch. Zwei Nächte lang Wodka, Drinks und Champagner in Kombination mit dem Jetlag hatten ihm zuletzt seine Grenzen aufgezeigt. Verdammt. So hatte er sich nicht mehr gefühlt, seit er dreizehn war und Åsa Bjelke ihm gezeigt hatte, wie man am effektivsten den Barschrank seiner Eltern leerte.
Er streckte sich auf seinem Bürostuhl. Er trug einen Anzug, hatte es jedoch nicht geschafft, eine Krawatte herauszusuchen oder gar ein Oberhemd zu knöpfen, sodass er nur ein T-Shirt unterm Jackett trug. Die Blicke der vier Männer mittleren Alters, die ihn von der anderen Seite des Konferenztisches aus betrachteten, waren voller Widerwillen.
Er legte eine Handfläche auf den Tisch und hoffte, dass ihm die kühle Oberfläche ruhige Nerven verleihen würde.
»Dann fangen wir an«, begann er und schluckte.
Einer der Männer zog eine Mappe hervor, und die übrigen folgten seinem Beispiel, sodass der Tisch vor Alexander bald mit jeder Menge wichtiger Unterlagen bedeckt war. Die vier waren seine Bankberater und Juristen, mit anderen Worten Männer, die den schwedischen Anteil seines ansehnlichen Vermögens verwalteten. Sie waren viel beschäftigte verantwortungsbewusste Bürger der Gesellschaft, und ihren Mienen nach zu urteilen schätzten sie es keinesfalls, dass Alexander sie genötigt hatte, hierher ins geräumige Büro seiner Stiftung zu kommen. Es lag mitten in der City, in der Smålandsgata. Vor einer Stunde hatte Alexander ihnen allen eine SMS geschickt, in der er sie aufgefordert hatte, hier zu erscheinen, anstatt, wie es anfänglich sein Plan gewesen war, selbst in deren jeweilige Büros zu kommen. In seinem Zustand hätte er es nicht geschafft, sich nach Öfvre Östermalm zu schleppen, geschweige denn, vier verschiedene Adressen nacheinander aufzusuchen. Verflucht, er hatte es ja kaum hierher geschafft, obwohl seine Stiftung nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt lag.
Jetzt saßen sie hier und sahen aus, als hätten sie gerade in eine saure Zitrone gebissen oder eine Fliege verschluckt. Doch er pfiff darauf, ihre Terminpläne durcheinandergebracht zu haben. Wenn es ihnen nicht passte, konnten sie ja jederzeit kündigen.
»Sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, aber Sie erhalten bestimmt ein Honorar von mir, dessen Höhe irgendwo zwischen skandalös und astronomisch anzusiedeln ist, oder?«, fragte er in kühlem Ton.
Zur Antwort erhielt er gerunzelte Stirnen und zusammengepresste Lippen.
»Entschuldigung?«, sagte der Mann links von Alexander, dessen Name ihm leider entfallen war.
»Ich denke, wir sollten die Feindseligkeit für eine Weile ruhen lassen. Und es vielleicht mal mit einem Lächeln versuchen.«
Die Männer wanden sich nervös auf ihren Bürostühlen, und er beschloss, sie allesamt zu feuern, wenn sie ihm nicht Folge leisteten. Vermögensberater gab es schließlich wie Sand am Meer.
Die Männer warfen einander unsichere Blicke zu. Dann strafften sich ihre Lippen, und ihre Gesichtszüge glätteten sich, bis ihre Zähne sichtbar wurden.
Alexander seufzte. Letztlich war ihm das alles völlig gleichgültig. Er schüttelte den Kopf. »Lassen Sie es uns einfach hinter uns bringen.«
Es klopfte an der Tür, und herein kam eine Frau mit einem Tablett. Kaffee, zum Glück. Sie schenkte ihn aus einer silbernen Kanne in dünnwandige Tassen und stellte einen Teller mit kleinen runden Pfefferminzschokoladentalern in bunter Alufolie daneben, die Alexander verabscheute. Gab es wirklich Leute, die so etwas aßen? Er nahm eine Tasse entgegen, während die Männer ihre Stifte zückten und ihre Dokumente akkurat aufschichteten. Alexander trank seinen Kaffee und warf einen finsteren Blick auf die Stapel, die er offenbar zu unterzeichnen hatte. Der dickste war fast zehn Zentimeter hoch.
»Auf diesen Unterlagen benötigen wir Ihre Unterschrift«, sagte einer der Männer und deutete auf die Papierstapel. »Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen«, fügte er hinzu, als ahnte er bereits, dass Alexander am liebsten aufgestanden wäre und den Raum auf Nimmerwiedersehen verlassen hätte.
Er wusste nicht, warum ihm dies so verhasst war. In New York hatte er den vollen Überblick über seine Geschäfte. Vielleicht lag es daran, dass diese Männer ihn mit ihren anklagenden Blicken an seinen Vater erinnerten, an einen Mann, der ihn als Kind systematisch gemaßregelt und heruntergeputzt hatte. Vielleicht hasste er aber auch alles, was mit der schwedischen Finanzbranche zu tun hatte. Nach all dem, was im vergangenen Sommer geschehen war, hatte er sich gezwungen gesehen, eine gewisse Distanz zu Schweden aufzubauen – und dies umgesetzt, indem er den Kopf in den Sand gesteckt und seine Pflichten ignoriert hatte. Jetzt musste er den Preis dafür bezahlen.
»Dann geben Sie schon her«, brummte er.
Mit finsterer Miene begann er sich durch den Stapel zu arbeiten. Unterzeichnete ein Dokument nach dem anderen.
»Unterschreiben Sie hier, hier und hier«, hörte er in einer Art Endlosschleife.
Investitionen. Auszahlungen. Vollmachten.
Als es Mittag wurde und sie noch nicht einmal halbwegs damit durch waren, merkte Alexander, dass er etwas anderes zu trinken benötigte als Kaffee und dringend den Konferenzraum verlassen musste, um frische Luft zu schnappen.
»Wir machen zehn Minuten Pause«, entschied er, floh aus dem Zimmer, schloss die Augen und atmete tief durch. Er wünschte, er hätte sagen können, dass es sich gut anfühlte, die Dinge in Angriff genommen zu haben, und der Kaffee seinen Kater ein wenig vertrieben hätte, aber … Als er Stimmen hörte, öffnete er die Augen und erblickte in einiger Entfernung eine groß gewachsene rothaarige Dame, die ihm den Rücken zugewandt hatte. Sie gestikulierte wild vor der Frau am Empfangstresen.
»Aber ich darf seine Nummer nicht herausgeben«, hörte er die Empfangsdame sagen, als er näher kam. Ihre Stimme klang irritiert, als wiederholte sie gerade etwas, das sie schon mehrfach gesagt hatte.
»Aber befindet er sich denn zurzeit in Stockholm, können Sie mir wenigstens das sagen? Ich habe ihm mehrfach gemailt, erhalte aber keine Antwort. Wird er demnächst nach Schweden kommen? Und wissen Sie, wie ich ihn dann erreichen kann? Er muss doch irgendwo anzutreffen sein.«
Alexanders Augen verengten sich. Diese Stimme hatte er schon einmal gehört.
Die Empfangsdame hob ihren Kopf, erblickte Alexander und warf ihm einen warnenden Blick zu. Doch die Rothaarige musste es gemerkt haben, denn sie drehte sich um, und jetzt erkannte er sie sofort.
Isobel Sørensen.
Kaum zu glauben. Seine Mundwinkel zuckten. Das hier war weitaus interessanter, als Dokumente zu unterschreiben, dachte er und näherte sich dem Empfangstresen. Selbst aus einiger Entfernung war Isobel genauso hübsch, wie Alexander sie in Erinnerung hatte. Obwohl hübsch nicht das richtige Wort war. Isobel Sørensen war schön. In derselben Art und Weise, wie Lauffeuer, Explosionen und Katastrophen schön anzusehen waren. Er bedachte sie mit einem breiten Lächeln, und nach einer kleinen Weile erwiderte sie es, höflich, aber ohne dass es ihre Augen erreichte.
»Ich habe versucht, Sie zu kontaktieren«, sagte sie und streckte ihm ihre Hand entgegen. Er erhielt einen festen Händedruck, bevor sie ihre Hand wieder zurückzog und ihn forschend betrachtete. Er widerstand dem Impuls, sich über seinen Bartansatz zu streichen. Jetzt wünschte er, dass er sich wenigstens rasiert hätte.
»Ich habe Ihnen gemailt. Und dann bin ich vorbeigekommen, um nach Ihrer Telefonnummer zu fragen. Es ist unmöglich, Sie zu erreichen.«
»Und dennoch ist es Ihnen gelungen.« Es war nicht weiter verwunderlich, dass sie solche Probleme gehabt hatte. Alle Mails an seine Stiftung wurden direkt vom Posteingang in einen Ordner weitergeleitet, den er lange nicht mehr geöffnet hatte. Er wusste nicht einmal mehr, wie lange. Darin befanden sich inzwischen bestimmt mehrere Hundert ungelesene Mails, wie ihm jetzt bewusst wurde. »Ist schon okay«, beruhigte er die Empfangsdame, bevor er sich wieder Isobel zuwandte. Er ließ seinen Charme spielen. »Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen so sehr daran gelegen war, mich zu treffen. Was kann ich für Sie tun?«
In ihren Augen blitzte es auf.
Die Tür des Konferenzraumes wurde geöffnet. »Alexander?«
Verdammt, seine mies gelaunten Finanzleute hatte er bereits verdrängt.
»Wir machen nach der Mittagspause weiter«, fertigte er den Mann ab, der nach ihm Ausschau gehalten hatte. »Ich muss hier noch etwas klären.« Er war aufrichtig neugierig darauf, was Isobel Sørensen wohl von ihm wollte. Nicht, dass er auch nur einmal im vergangenen halben Jahr an sie gedacht hätte, aber er erinnerte sich dennoch sehr gut an sie. Hätte ihn jemand danach gefragt, was Isobel von ihm hielt, hätte er geantwortet: Sie ist eine der wenigen Frauen, die meinem Charme nicht erlegen sind, was ich beim besten Willen nicht begreife. Bei den Gelegenheiten, wenn sie sich begegnet waren, war Isobel entweder abweisend, feindlich gesinnt oder sogar unhöflich zu ihm gewesen. Das war natürlich absolut unwiderstehlich. Er warf der Empfangsdame einen fragenden Blick zu. »Gibt es einen Raum, in den wir uns setzen können?« Er schaute Isobel an. »Kaffee?«
»Nein danke.«
Die Empfangsdame ging mit klackernden Absätzen an ihnen vorbei, und Alexander streckte in einer Geste einen Arm aus, um Isobel den Vortritt zu lassen. Das gebot ihm seine gute Erziehung, die wie auf natürliche Weise in seinem Rückenmark verankert war. Er konnte nicht unhöflich zu einer Frau sein, nicht einmal, wenn er es versuchte. Es verschaffte ihm außerdem eine hervorragende Gelegenheit, Isobel von hinten zu begutachten. Er inspizierte ihre Windjacke, ihren Pferdeschwanz und ihre langen Beine. Ihre sackartige Hose wies Flecken auf, und es dauerte eine Weile, bis Alexander darauf kam, dass es sich um Spritzwasser vom Fahrradfahren handeln musste. Wann war er eigentlich das letzte Mal Fahrrad gefahren? Dazu trug sie flache praktische Schuhe. Es war so ungefähr das unerotischste Outfit, das er je gesehen hatte, und er fragte sich, ob er sich ihre Attraktivität möglicherweise nur eingebildet hatte. Isobel setzte sich, und nein, er hatte es sich ganz und gar nicht eingebildet. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er je eine so schöne Frau gesehen hatte, wenn überhaupt. Er hätte alles dafür gegeben, sie in einem eng anliegenden Kleid zu sehen. Oder am liebsten natürlich nackt. Unter den diversen Lagen raschelnder praktischer Stoffe und unauffälliger Farben ahnte er eine Menge interessanter Kurven und spannender Geheimnisse. Er setzte sich ebenfalls. Sein Tag, der so jämmerlich angefangen hatte, war plötzlich entschieden angenehmer geworden.
Isobel schlug ihre langen Beine übereinander, und er konnte es nicht lassen, sich zu fragen, wie sie wohl nackt aussahen. Bestimmt muskulös, wenn sie überallhin mit dem Fahrrad fuhr. Sie schaute ihn auffordernd an. Was konnte sie nur von ihm wollen? Dann kam ihm ein Gedanke. Er hatte doch wohl nicht mit ihr geschlafen? Mein Gott, daran hätte er sich ja wohl erinnert, oder? Er kramte in seiner Erinnerung und bekam deshalb gar nicht mit, dass sie bereits zu reden begonnen hatte.
»Sorry«, sagte er. »Könnten Sie das noch einmal wiederholen?«
Sie blinzelte. Sie wirkte gefasst, aber in ihren Augen blitzte etwas auf. Dieser Gesichtsausdruck verschwand jedoch ebenso rasch, wie er gekommen war, wie wenn sich darin ein Gefühl widergespiegelt hätte, das gerade energisch zurückgedrängt wurde. Sie begann von Neuem, diesmal langsam und überdeutlich, als wäre Alexander ein kleines Kind.
»Sie können natürlich mit Fug und Recht tun, was Sie wollen. Es ist schließlich Ihr Geld, das verstehe ich. Aber ich möchte mich gern bei Ihnen entschuldigen. Und ich hoffe, dass Sie hier den größeren Zusammenhang sehen können. Dass Ihr Handeln auf so viel mehr Menschen als nur mich Einfluss nimmt. Dass es sich um Individuen aus Fleisch und Blut handelt.«
Alexander kratzte sich an der Stirn. Isobel hätte genauso gut irgendeine längst ausgestorbene Sprache sprechen können, so wenig begriff er.
Er öffnete den Mund, schloss ihn jedoch wieder, als sie fortfuhr.
»Es wäre nichts Geringeres als eine Katastrophe für die Betroffenen. Das, was zwischen uns vorgefallen ist, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Aber die Lage ist ernst, nicht zuletzt für die Kinder. Und ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen sage, dass es um Leben und Tod geht.«
Sie nahm eine Mappe zur Hand und breitete Fotos von unterernährten Kindern und provisorischen Krankenbetten sowie Unterlagen mit Tabellen darauf aus.
»Isobel …«, sagte Alexander und musste sich räuspern. »Sie müssen entschuldigen, aber ich habe einen stressigen Morgen hinter mir und kann Ihnen nicht ganz folgen.«
Sie legte ihre Hände in den Schoß und betrachtete ihn eingehend. Dann holte sie tief Luft. Auf ihre Wangen waren rosafarbene Flecken getreten, und zwischen ihren Augenbrauen hatte sich eine tiefe Furche gebildet, die im Übrigen absolut faszinierend war. Sie leuchtete feuerrot auf der blassen Stirn. Isobel war eine außergewöhnliche Schönheit, und er sah bereits vor seinem inneren Auge, wie er mit ihr untergehakt einen der Clubs in New York betrat. Oder noch besser, Isobel unter ihm, wie sie sich in seinem Bett oder auf einem Fell rekelte. Mist, jetzt hatte er schon wieder verpasst, was sie gesagt hatte. Er zwang sich zur Konzentration.
»Wir sind völlig abhängig von unseren Geldgebern.«
»Okay«, sagte er, jedoch ohne zu verstehen, was das Ganze mit ihm zu tun hatte. Er blinzelte und wünschte, dass der Kaffee, den er vorhin getrunken hatte, den Nebel in seinem Hirn in gewisser Weise gelichtet hätte. »Wenn ich es recht verstehe, fehlt es also irgendwo an Geld?«, fasste er zusammen, doch noch während er die Worte aussprach, spürte er, dass er irgendetwas grundlegend missverstanden hatte.
Isobel blinzelte zum wiederholten Mal. Ein gespannter Zug um ihren Mund herum ließ den letzten Rest ihrer professionellen Miene verblassen. »Lassen Sie mich das Wichtigste wiederholen«, entgegnete sie verbissen. Sie verlor sich in einem erneuten Monolog über Hunger, Kinder und Gelder.
Diesmal unternahm Alexander einen ernsthaften Versuch, ihr zu folgen. Unabhängig davon, was Isobel von ihm dachte, war er keineswegs zurückgeblieben. Endlich gelang es ihm, den Sinn ihrer Worte zu entschlüsseln.
»Wir hatten Ihrer Organisation Geld gestiftet. Und jetzt haben wir die Zahlungen eingestellt. Und Sie sind – äh – aufgebracht«, formulierte er letztlich.
»Ich weiß, dass Sie es getan haben, um sich zu rächen. Aber ich …«
»Rächen?«, unterbrach er sie. Es war wirklich nicht ganz leicht, ihr zu folgen.
»Ja, Sie wissen schon. Weil ich …«
An dieser Stelle errötete sie leicht. War er gestört, wenn ihn eine Frau, die errötete, sexuell antörnte? Aber sie sah aus wie eine verdammte Amazone, und ihre Verletzlichkeit ließ sie besonders sexy erscheinen.
»Weil ich unhöflich war.«
»Unhöflich? Ah, als Sie mich baten, zur Hölle zu fahren?«, fragte er behilflich. »Oder Sie mir in Arlanda einfach den Rücken gekehrt haben? Oder vielleicht, als Sie vorgaben, kein Schwedisch zu verstehen? Sorry, aber es waren so viele Situationen, dass ich nicht genau weiß, auf welche davon Sie anspielen.«
Jetzt hatten sich entlang ihres Halses mehrere rote Streifen gebildet. Sie hatte eine fast durchsichtige, seidig glänzende Haut, die weiß wie Sahne und mit goldenen Sommersprossen übersät war.
»Der Grund dafür, dass Sie hier sind und mich anpöbeln …« fuhr er fort.
»Ich pöbele Sie nicht an«, unterbrach sie ihn.
»Der Grund für dieses Gespräch ist also: Sie haben etwas Gemeines zu mir gesagt, ich wurde stinksauer, habe den Geldhahn für Ihre Lebensrettungsorganisation zugedreht und damit ein Massensterben von Kindern in Afrika verursacht, oder?«, fasste er die Situation zusammen.
»Nicht Afrika. Im Tschad.«
»Waren Sie auf dem Weg dorthin, als wir uns in Arlanda begegnet sind?«
»Ja.«
»Damals haben Sie aber Afrika gesagt«, erklärte er.
»Ich hatte wahrscheinlich angenommen, dass Sie nicht wüssten, wo der Tschad liegt«, entgegnete sie säuerlich.
»Hm«, meinte er.
Das meiste von dem, was sie ihm erzählt hatte, klang in seinen Ohren völlig neu, aber was wusste er schon. Viele seiner Erinnerungen aus dem letzten halben Jahr waren eher diffus.
»Medpax leistet eine außerordentlich wichtige Arbeit im Tschad. Aber wir sind eine kleine Organisation und somit leicht verwundbar. Es tut mir wirklich leid, wenn ich Sie gekränkt habe. Aber ich zeige Ihnen gerne, wie wir arbeiten.« Sie begann, weitere Mappen aus ihrem Stoffbeutel zu ziehen, doch Alexander hob abwehrend die Hand.
»Bitte nicht«, stöhnte er. »Nicht noch mehr Papiere.«
Sie hielt inne und bedachte ihn mit einem steifen Lächeln.
»Könnten Sie denn zumindest über das nachdenken, was ich Ihnen erzählt habe?«
»Auf alle Fälle.«
Sie betrachtete ihn misstrauisch. »Es ist wirklich wichtig.«
»Ich habe doch gesagt, dass ich es tun werde«, gab er unfreundlich zurück.
Vielleicht lag es daran, dass er gerade einen Vormittag hinter sich hatte, an dem er von nicht weniger als vier Männern mit missbilligenden Blicken abgestraft worden war, für deren gesamten Familienunterhalt er höchstwahrscheinlich aufkam. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er den Umgang mit Frauen wie Isobel einfach nicht gewöhnt war. Jedenfalls schwirrte ihm der Kopf, und er hatte langsam genug von all dieser Feindseligkeit.
Er war schließlich nicht nach Stockholm gekommen, um sich von Leuten verunglimpfen zu lassen, denen er nichts getan hatte. Jedenfalls nicht bewusst.
»Medpax hat außerdem diverse Impfprogramme gestartet. Wir verrichten eine ungemein wichtige Arbeit im Hinblick auf Malaria und Unterernährung. Wir haben …«
»Isobel, ich werde darüber nachdenken«, unterbrach er sie. Wenn er noch ein Wort über sterbende Kinder und heroische Ärzte zu hören bekäme, würde er explodieren.
»Denn es handelt sich dabei keineswegs um ein Hobbyprojekt. Unsere Ärzte machen den Unterschied aus. Sie müssen einsehen, dass …«
Alexander streckte sich in seinem Sessel. Er legte eine Hand auf den Tisch und bedachte sie mit einem ernsten Blick. »Die Sache ist die, Isobel: Ich muss gar nichts.«
Er war sich noch immer nicht ganz sicher, worum es genau ging, schließlich hatte er verflucht noch mal einen Kater, aber zumindest begriff er, dass es sich bei dem, was diese erzwungen höfliche Ärztin von ihm haben wollte, vermutlich um viel Geld handelte. »Ich werde die Sache untersuchen, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe.« Er hätte eigentlich hinzufügen wollen, dass es elementar wichtig war, den Menschen gegenüber, die man um Geld anging, seine Verachtung nicht derart offen zu zeigen, doch er bemühte sich erst gar nicht.
»Ich denke dennoch, dass …«, begann sie.
»Das reicht«, sagte er kurz angebunden, stand auf und musste angesichts eines Schwindelanfalls heftig blinzeln. Er müsste dringend etwas essen. »Ich rufe Sie an«, teilte er ihr so entschlossen, wie er konnte, mit.
Sie sah aus, als wollte sie noch etwas sagen, doch schließlich nahm sie ihre Dokumente wieder an sich, schob sie zurück in ihre ausgeblichene Leinentasche und stand ebenfalls auf.
»Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben«, sagte sie und streckte ihm erneut die Hand entgegen.
Alexander ergriff sie und drückte sie fest, verspürte dann allerdings den äußerst sonderbaren Impuls, ihre Hand zum Mund zu führen und zu küssen. Doch er begnügte sich damit, den Blick zu senken und zuzuschauen, wie sich ihre Hände umschlossen. Sie hatte lange Finger, kurz geschnittene Fingernägel und trug keinen Schmuck. Kompetente Arzthände.
»Ich rufe Sie an«, wiederholte er.
Sie zog ihre Hand zurück und ging mit der verschlissenen Tasche über der Schulter zur Tür. Der Stoff ihrer Windjacke raschelte leise.
Er beeilte sich, ihr die Tür zu öffnen und sie ihr aufzuhalten.
Sie bedachte ihn mit einem langen Blick. Obwohl sie nichts sagte, sah er in ihren grauen Augen, die dieselbe Farbe hatten wie ein wolkenverhangener Novembertag, dass er in ihrem Ansehen nach dieser Begegnung noch weiter gesunken war. Aus irgendeinem Grund störte ihn das.
»Hejdå, Isobel«, sagte er leise.
Sie verschwand ohne ein weiteres Wort, und er sah ihr lange nach.
4
Isobel verließ das Sprechzimmer, um ihre nächste Patientin hereinzubitten, eine Frau in ihrem Alter, die zum einen unter Schlafstörungen und Stress litt und zum anderen Probleme mit ihrer Mutter hatte. Bei Letzterem könnte sie selbst ebenfalls ein wenig Hilfe gebrauchen, dachte Isobel, während sie sich anhörte, was die Patientin zu erzählen hatte. Isobel überlegte, ob sie ihr eine Überweisung zu einem Psychologen ausstellen sollte, beschloss jedoch abzuwarten. Unterdessen merkte sie, dass es ihr trotz intensiver Bemühungen nicht gelang, das nagende Gefühl abzuschütteln, die gestrige Begegnung mit Alexander de la Grip ziemlich ungeschickt gehandhabt zu haben.
Sie stellte der Patientin ein Rezept aus, riet ihr zu weniger Interaktion mit ihrer Mutter und empfing dann den nächsten Patienten. Doch wie sehr Isobel auch versuchte, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, sie wurde das unangenehme Gefühl nicht los, die Sache mit der Stiftung vergeigt zu haben. Und zwar auf ganzer Ebene.
Wie war dies nur möglich, fragte sie sich, während sie Blutdruck maß und ein Medikament gegen Magengeschwüre verschrieb. Ausgerechnet sie, die für ihre diplomatische Herangehensweise und ruhige Art bekannt war. Normalerweise war sie diejenige, bei der alle hysterisch veranlagten und unbequemen Patienten eingetragen wurden; sie war es, die genervte Krankenschwestern und aufgebrachte Ärzte beruhigte und die überdies vor Medizinstudenten Vorlesungen über die Bedeutung der sozialen Kompetenz hielt. Und dann fuhr sie zu Alexander de la Grip und benahm sich wie ein trotziger Teenager. In seinem mondänen Büro. Seiner exklusiven Stiftung, von der das Überleben von Medpax abhing.
Welches Adjektiv beschrieb ihr Vorgehen am besten?
Dämlich.
Aber sie war nervös geworden. Alexander war so attraktiv gewesen, dass sie es kaum hatte aushalten können. Kein Mann hatte das Recht, derart gut auszusehen; es war geradezu unnatürlich. Trotz seiner zerzausten blonden Haare, des Dreitagebarts und des zerknitterten Anzugs war er so sexy, dass es ihr schwergefallen war, ihn anzuschauen, ohne rot zu werden. Alexander de la Grip war, um das Ganze noch zu toppen, auch noch reich und adelig. Nicht einfach nur wohlhabend, sondern richtig steinreich. Nicht, dass sie sich jemals eingebildet hätte, dass das Leben fair wäre, aber trotzdem: Wie konnte es nur so verdammt ungerecht sein? Die Tatsache, dass er rot unterlaufene Augen und eine Fahne gehabt hatte, hatte das Fass für sie schließlich zum Überlaufen gebracht. Er hatte tatsächlich die Frechheit besessen, dort im Büro seiner Stiftung zu stehen, umschwänzelt von seinen Untergebenen, und auszusehen, als hätte er in der vergangenen Woche nichts anderes getan, als Party zu machen, während sie sich für das Überleben von Medpax den Arsch aufriss. Das war einfach zu viel für sie gewesen. Folglich hatte sie sich von Dingen beeinflussen lassen, die sie nichts angingen, hatte ihr Verhalten von bornierten Gefühlen steuern lassen, und das Ganze war in eine Katastrophe ausgeartet. Sie schloss die Tür, griff nach dem Telefon, seufzte und rief Leila an.
»Hat Alexander de la Grip zufällig angerufen?«, fragte sie, als sich Leila meldete.
»Nein, hätte er das tun sollen?«
Isobel lehnte sich zurück und legte ihre Füße auf den Schreibtisch. Sie hatte noch mindestens acht, möglicherweise sogar mehr Patienten zu behandeln, doch ein kurzes Telefonat zwischendurch musste drin sein. »Ich habe ihn gestern auf den Pott gesetzt. Unter Umständen habe ich ihn sogar beleidigt. Schon wieder. Also nehme ich an, dass er es nicht hätte tun müssen.«
»Ich verstehe. Und wie geht es dir heute?«
»Ich bin höchstwahrscheinlich irgendwie gestört. Du kannst mich ja psychisch analysieren, wenn du willst. Was ist los mit mir?«
Leila schnaubte. »Es stellt wirklich keine große Herausforderung dar, dich zu durchschauen, dafür brauch ich dich nicht extra analysieren. Du hast vermutlich schon im Mutterleib unter Leistungsdruck gestanden und leidest noch immer unter der ständigen Angst zu versagen. Dir ist es enorm wichtig, deinen Mitmenschen und Kollegen begreiflich zu machen, dass sie dir nicht egal sind. Du wirst von allen, denen du begegnest, bewundert, merkst es aber nicht, da du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, wie du deine selbstgerechte Mutter und deinen verstorbenen Vater dazu bringen könntest, stolz auf dich zu sein. Habe ich noch irgendwas vergessen?«
Isobel schloss die Augen und fragte sich, ob es wirklich eine so gute Idee war, Leila anzurufen. »Das war ja recht … umfassend«, sagte sie matt.
»Isobel, du bist eine Frau, die jeder in seinem Team haben möchte.«
»Aber ich habe mich danebenbenommen.«
»Ja. Willkommen in der Wirklichkeit, in der man sich eben manchmal danebenbenimmt. Lass es jetzt einfach hinter dir.«
»Hör auf mit diesem blöden Psychologengeschwätz. So einfach ist das nicht.«