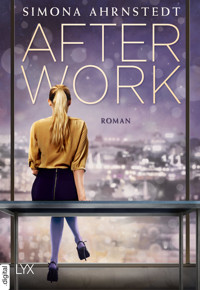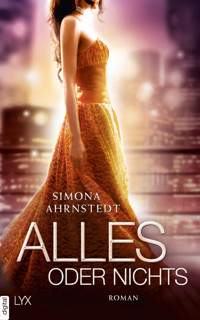9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gefährliche Liebschaften vor üppiger schwedischer Kulisse
Graf Gabriel de la Grip ist einer der reichsten Männer Schwedens, sein skandalöser Ruf eilt ihm stets voraus. Er bereist lieber die Weltmeere oder vergnügt sich mit seiner Mätresse, als sich in adligen Kreisen zu bewegen. Als er bei einem Fest der verarmten Madgalena Swärd begegnet, ist er trotz ihres steifen Auftretens fasziniert von ihrer Scharfzüngigkeit und Intelligenz. Und obwohl Magdalena Männer wie ihn zutiefst verabscheut, bringt eine gedankenlose Wette beide dazu, einen gewagten Pakt zu schließen. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt, die ihrer beider Herzen in Gefahr bringt ...
"Eine emotionale, mitreißende Liebesgeschichte voller Dramatik." BIBLIOFELES BÜCHERBLOG ÜBER EIN UNGEZÄHMTES MÄDCHEN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
InhaltTitelZu diesem BuchWidmung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334EpilogDankeDie AutorinSimona Ahrnstedt bei LYXImpressumSIMONA AHRNSTEDT
Eine unerhörte Affäre
Roman
Ins Deutsche übertragen von Corinna Roßbach
Zu diesem Buch
Graf Gabriel de la Grip ist einer der reichsten Männer Schwedens. Nach dem Tod seiner Brüder muss er sich der Verantwortung eines Erbes stellen, das er nie wollte. Die Gesellschaft gelangweilter Adliger ist ihm zuwider, viel lieber würde er weiterhin die Weltmeere besegeln, Handel treiben und leidenschaftliche Stunden mit schönen Frauen verbringen. Doch als er auf einem Fest der verarmten Magdalena Swärd begegnet, ist er trotz ihres steifen Auftretens fasziniert von der intelligenten und scharfzüngigen jungen Frau. Sie ist das Gegenteil der weltgewandten und lasterhaften Damen, deren Gesellschaft er sonst sucht. Magdalena hingegen verabscheut Männer wie ihn aus tiefster Seele. Männer, die sich nicht darum scheren, wem sie das Herz brechen oder ob sie eine Frau in den Ruin treiben. Doch dann bringt eine gedankenlose Wette die beiden dazu, einen gefährlichen Pakt zu schließen. Und obwohl sie sich dagegen wehrt, kann sich Magdalena Gabriels Anziehungskraft immer weniger entziehen. Je besser sie ihn kennenlernt, desto mehr begreift sie, dass sich hinter der Fassade des arroganten Grafen ein Mann verbirgt, der den Zwängen der Gesellschaft ebenso entfliehen möchte wie sie selbst. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt, die ihrer beider Herzen in Gefahr bringt …
Für meine Freundinnen, in Liebe.
Ihr wisst, wen ich meine und ihr wisst, warum.
1
Stockholm, im Juli 1685
Magdalena Swärd saß im Wohnzimmer ihrer kleinen Mietwohnung und betrachtete die Wassertropfen, die von der Decke auf den Fußboden fielen. Der Regen trommelte auf die Dachschräge, und die Tropfen bildeten einen sich stetig vergrößernden Fleck zu ihren Füßen. In den übrigen Räumen der Wohnung war es genauso: im Schlafzimmer, im Dienstbotenzimmer und in der Küche. Mit jedem Tropfen wuchs der Fleck vor ihren Füßen und breitete sich unregelmäßig weiter aus. Seine Form glich den Umrissen eines Landes. Magdalena legte den Kopf schief.
Vielleicht Frankreich …
»Jetzt ist das Dach auch hier undicht«, sagte sie.
Ihr Dienstmädchen, Beata Jensdotter, starrte auf das herabtropfende Wasser, das sich weiter ausbreitete.
»Ich werde einen Eimer darunterstellen«, meinte sie.
»Werden nicht alle schon benutzt?« fragte Magdalena und überlegte, wie viele Eimer sie besaßen. Das Platschen der Regentropfen in den anderen Räumen war deutlich im Wohnzimmer zu vernehmen. Die Wohnung war sehr klein, selbst für eine alleinstehende Frau, die nur ein Dienstmädchen hatte. Der Regen, der durch das undichte Dach in Eimer, Schüsseln und andere Gefäße tropfte, war überall zu hören. Seit Tagen regnete es in Stockholm. Der Regen goss in Strömen über Straßen und Häfen und hämmerte auf die Dächer. Inzwischen war es schwer geworden, sich an etwas anderes als ständige Nässe und Kälte zu erinnern. Die Straßen und Gassen glichen lehm- und schmutzgefüllten Bächen. Wer nicht gezwungen war, das Haus zu verlassen, blieb drinnen. Wer hinausmusste – Angestellte, Dienstboten, Hafenarbeiter und alle anderen, die den komplizierten Mechanismus der Hauptstadt am Laufen hielten – dem blieb nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden, dass ihm Dreck und Abfälle Kleidung und Schuhe verschmutzten. Es war ein Regen biblischen Ausmaßes. Alles war feucht. Auch drinnen. Jedenfalls dann, wenn man wie Magdalena direkt unter einem undichten Dach wohnte. Ganz oben, wo schräge Decken und dicke Balken das Möblieren erschwerten, aber auch die Miete niedrig hielten. Magdalena nahm ihr Taschentuch, kniete nieder und versuchte, einen Teil des Regenwassers aufzuwischen. Viele, viele Male hatte sie während des letzten Jahres ihr Mantra wiederholt: Es könnte schlimmer sein. Doch das undichte Dach und die Nässe erschienen ihr nun unerträglich.
Außerdem fror sie.
Gott, wie sie fror!
»Haben wir Tee?«, fragte sie hoffnungsvoll. Eine Tasse warmen Tees konnte Wunder vollbringen.
Doch Beata schüttelte den Kopf. »Und auch keine Milch«, fügte sie auf ihre gewohnt praktische Art hinzu. Sie wies mit dem Kinn auf Magdalenas Wischversuche und sagte: »Das Einzige, was Ihr damit bewirkt, ist, ein vortreffliches Taschentuch zu zerstören.«
Magdalena erhob sich. Sie legte das durchnässte Taschentuch in Beatas ausgestreckte Hand. »Gut, damit ist die Sache entschieden«, sagte sie. »Ich werde den Atlas verkaufen.«
Beata hob eine rotblonde Augenbraue. »Den großen ausländischen? Von Eurem Vater? Den Ihr unbedingt behalten wolltet?«
Doch die Sehnsucht nach einer Tasse warmen Tees konnte einen Menschen dazu bringen, seine letzten Prinzipien über Bord zu werfen. Magdalenas Leben hatte seine Höhen und Tiefen gehabt. Sie konnte sich an Zeiten erinnern, wo frisches Brot und trockene Kleidung eine Selbstverständlichkeit gewesen waren. Sie erinnerte sich auch an andere, deutlich härtere Zeiten. Aber jetzt schien es ihr, als sei es ihr noch nie schlechter gegangen. Der Atlas war das Letzte, was ihr noch von ihren Eltern geblieben war. Ansonsten waren ihre Mittel aufgebraucht. »Dafür kann ich eine Menge verlangen«, antwortete sie und setzte ein Lächeln auf, von dem sie hoffte, dass es beruhigend und selbstbewusst wirkte, als hätte sie einen Plan für die Zukunft. Einen Plan, der trockene Dielen, heißen, starken Tee und Lohn für eine viel zu loyale Dienstmagd beinhaltete. Beata hätte schon längst das sinkende Schiff verlassen und sich eine andere Stellung suchen können.
Das Dienstmädchen erwiderte nichts, sondern ging in die Küche und begann dort, mit Töpfen und Geschirr zu hantieren.
Magdalena blickte aus dem Fenster. Der Regen auf den bleieingefassten Fensterscheiben glich Tränen. Wütenden Tränen. Den Atlas hatte sie wirklich behalten wollen. Alle anderen Bücher ihres Vaters hatte sie nacheinander verkauft, doch sie hatte sich geschworen, das in Leder gebundene geografische Werk mit den vielen Abbildungen zu behalten. Sie schluckte. Würde sie den Tränen freien Lauf lassen, die so locker saßen, war sie sich nicht sicher, ob sie wieder zu weinen aufhören würde können. Magdalena betrachtete die Dächer und die Stadt außerhalb des dicken Fensterglases. Sicherlich gab es Dinge, die schlimmer waren, als ohne Milch und Tee auszukommen. Sie besaß ein Dach über dem Kopf – auch wenn es undicht war –, und sie war nicht allein. Sie hatte Beata, die treue, gute Beata. Dankbar sollte sie sein, und sich nicht selbst bedauern.
»Morgen gehe ich hin«, rief Magdalena in Richtung des Gescheppers.
Beata kramte noch eine Weile in der Küche herum und erschien dann mit einem verbeulten Topf, den sie unter der undichten Stelle platzierte. Zusammen betrachteten beide die Regentropfen, die munter weiter in das Gefäß plumpsten. »Das war der letzte Topf«, sagte Beata. »Jetzt muss es ganz einfach aufhören zu regnen.«
Magdalena lächelte. Das vergangene Jahr hatte Beata und sie zusammengeschweißt. Es hatte Zeiten gegeben, in denen eine Freundschaft mit einer Magd undenkbar gewesen wäre. Doch wenn es etwas gab, worüber sie in allem Elend aufrichtig froh war, so war es die Gemeinschaft mit Beata. Magdalena hob leicht den Kopf und lauschte. »Hast du gehört?«, fragte sie. Jemand kam die schiefe, steile Stiege hinauf, die zu ihrer Wohnung führte.
»Erwartet Ihr jemanden?«, fragte Beata. Die Schritte waren immer deutlicher zu vernehmen. Wer immer es war – er oder sie war eindeutig auf dem Weg zu ihnen.
»Nein«, antwortete Magdalena mit einem Kopfschütteln. Die Miete war bezahlt. Wenn man von ihrem Vermieter absah, der einmal im Monat kam und misstrauisch herumschnüffelte (es war unklar, wonach), pflegte sie keinen Besuch zu bekommen. Um ehrlich zu sein, war es geradezu niederschmetternd, wie wenige Leute sie besuchten.
Ein energisches Klopfen war zu hören. Magdalena blieb halb erwartungsvoll, halb beunruhigt im Wohnzimmer, während Beata zur Tür ging, um zu öffnen. Gemurmel war zu hören, und dann das Geräusch der Tür, die wieder geschlossen wurde. Beata kam zurück und überreichte ihr einen Brief. Er war fleckig und gewellt vor Feuchtigkeit. Magdalena brach das Siegel. Der Lack war zäh, und sie konnte die Umrisse des Wappens nicht identifizieren, das in die Lackmasse gedrückt worden war. Als sie den Brief öffnete, drang ein schwacher Parfümduft an ihre Nase. Sie schloss die Augen. Ihre Mutter hatte Parfüm benutzt, und als Kind hatte Magdalena es geliebt, auf ihrem Schoß zu sitzen und ihren Duft in sich aufzusaugen.
»Wartet der Bote auf eine Antwort?«, fragte Magdalena und schüttelte die plötzliche Kindheitserinnerung ab.
Beata schielte mit unverhohlener Neugier nach dem Brief und nickte. »Er wartet auf der anderen Straßenseite, bis er die Antwort mitnehmen kann. Offensichtlich eilt es.«
Magdalena las hastig den Inhalt des Briefes. Runzelte die Stirn. Las ihn erneut.
Beata sagte nichts, doch Magdalena spürte ihre Ungeduld und wusste, dass das Dienstmädchen vor Neugier fast platzte. Weil sie seit vielen Monaten mehr für einander waren als Herrin und Magd – es waren gegenseitige Fürsorge und gemeinsame Schicksalsschläge, die sie zusammenhielten und nicht ein Lohnverhältnis –, las sie Beata den Brief vor:
Verehrtestes, entzückendes Fräulein Magdalena Swärd,
Beata prustete los, und Magdalena lächelte entschuldigend. »So steht es hier, ich lese es bloß vor«, verteidigte sie sich. ›Entzückend‹ war nicht die gängige Beschreibung ihrer Person, das wussten sie beide.
»Ja, ja … Lest weiter!«, sagte Beate mit einer ungeduldigen Handbewegung.
Magdalena fuhr fort:
ich bitte Euch – nein, ich flehe Euch an – mir zur Hilfe zu kommen. Ich setze meine ganze Hoffnung in Euch. Meine ganze! Könnt Ihr mir die große Ehre erweisen, für einige Wochen im Sommer die Gesellschaftsdame meiner Tochter – Fräulein Venus – zu sein? Der hochwohlgeborene Graf de la Grip (der neue, nicht der alte, möge Gott sich seiner Seele erbarmen) hat durch seine Mutter mehrere Damen adeligen Geschlechts auf sein Schloss einladen lassen (und nicht etwa auf eines der kleinen, sondern auf das große Schloss, Wadenstierna). Venus ist eine der Auserwählten! Das ist eine wirklich große Ehre, wie Ihr sicher versteht. Doch es ging alles so schnell. Mein Gemahl und ich haben bereits unwiderrufliche Pläne. Oh weh, warum musste mir das passieren? Meine außerordentlich liebreizende Tochter kann nicht allein verreisen. Unmöglich! Und ich kann sie nicht begleiten. Die Qualen, die ich durchleide, sind unbeschreiblich. Venus ist das entzückendste Mädchen, das man sich vorstellen kann, doch wie alle Sechzehnjährigen braucht sie eine feste Hand, die ihr den Weg weist. Unsere Gesellschaftsdame, die wir für gewöhnlich engagieren, ist krank. Die andere, die ich gebeten habe, konnte nicht, was sehr egoistisch von ihr war. In meiner Verzweiflung erinnerte ich mich daran, dass meine gute Freundin Sally van der Meer (Ehre gebühre ihrem Angedenken) erwähnte, dass Ihr eine Frau von höchsten moralischen Grundsätzen seid.
»Jetzt verdreh nicht deine Augen, Beata«, sagte Magdalena. »Ich habe hohe moralische Ansprüche.«
»Ja. Das und noch vieles mehr«, antwortete Beata trocken. »Man bekommt sozusagen einiges mitgeliefert.«
»Sie kannte Sally«, sagte Magdalena und spürte eine Welle der Trauer in sich aufsteigen. Sally van der Meer war ihre Freundin gewesen. Sally hatte ihr ein Zuhause gegeben, als Magdalena völlig am Boden gewesen war. Trotz des großen Altersunterschieds hatten sie sich sehr nahegestanden. Leider war Sally im letzten Jahr verstorben.
»Ja«, sagte Beata sanft. »Fräulein van der Meer war ein Engel. Aber seid so nett und lest weiter!«
Venus muss den Grafen natürlich treffen. Man sagt, er beabsichtige, sich eine Ehefrau auszuwählen, und meine Tochter wäre selbstverständlich perfekt für ihn. Aber wie Ihr vielleicht wisst, ist die rechtschaffene Gräfinnenwitwe de la Grip recht melancholisch veranlagt. Die Schwestern des Grafen sind sicher tadellose Frauenzimmer, doch die eine ist hochschwanger, und die andere … Nein, mein Taktgefühl verbietet es mir, etwas über sie zu sagen. Ich bitte Euch! Ich flehe Euch auf Knien an!! Ihr versteht sicher, wie verzweifelt ich bin. Ich bin natürlich bereit, Euch für Eure Mühen zu entlohnen. Nennt mir nur einen (angemessenen) Preis.
Es grüßt Euch die dankbarste aller Frauen
Catharina Sophia Euphrosyne Freifrau von Tag und Nacht
Magdalena verstummte und legte den Brief in ihren Schoß.
Beata runzelte die Stirn. »Ist das alles?«
»Was, glaubst du, bedeutet das?«, fragte Magdalena, noch ganz benommen vom überschwänglichen Tonfall des Briefes.
»Ich denke, das sind gute Neuigkeiten«, antwortete das Dienstmädchen zögernd.
»Vermutlich«, sagte Magdalena, während sie den Brief drehte und wendete. Erneut legte sie ihn in den Schoß. Sah hinaus aus dem Fenster in den Regen und redete sich ein, dass sie dankbar sein sollte. Dass sie das Angebot, Gesellschafterin einer jungen Frau zu werden, nicht als Zeichen dafür sehen sollte, dass sie selbst niemals mehr heiraten würde. Selbst auf ewig unverheiratet zu bleiben.
»Was sind das für Leute?«
Magdalena überlegte, was sie über das herrschaftliche Geschlecht derer von Tag und Nacht wusste. Sie waren, wenn sie sich recht erinnerte, eine sehr alte und weitverzweigte Familie, eine der ältesten im Lande. »Sie gehören natürlich zum Hochadel«, begann sie und betrachtete die verschnörkelte Schrift des Briefes. »Ich glaube, ihre Ahnenlinie reicht bis zurück ins Mittelalter.« Graf war natürlich der edelste Adelstitel, doch viele der älteren schwedischen Freiherrengeschlechter waren äußerst vornehm und stolz auf ihre Abstammung. »Aber ich weiß nicht viel über sie. Wir haben uns nie getroffen.«
Das war nicht weiter verwunderlich. Auch als Magdalenas Leben noch unbeschwerter gewesen war, hatte der Hochadel mit seinen Grafen und Freiherren derselben unerreichbaren Sphäre angehört wie Könige und Engel. Sie hatte sich nie in diesen Kreisen bewegt. Sally van der Meer war eine Ausnahme gewesen: eine eigensinnige Aristokratin mit ausreichend Geld und Ansehen, um alles tun zu können, was sie wollte. Dazu gehörte auch, eine Freundschaft mit einer verarmten Frau ohne Familie oder Hoffnung zu pflegen, und diese bei sich wohnen zu lassen.
»Die liebe Sally … Denk nur, dass sie so gut über mich gesprochen hat«, sagte Magdalena und strich mit dem Finger über die Buchstaben des Namens ihrer Freundin im Brief. »Ich glaube, ohne sie wäre ich gestorben.« Sie blickte Beata an. »Und ohne dich natürlich.«
Beata machte wieder eine abwehrende Handbewegung. Sie mochte ein Herz aus Gold haben, aber sentimental war sie nicht. »Heißt das Mädchen wirklich Venus?«, fragte sie stattdessen skeptisch. »Welch ungewöhnlicher Name!«
»Ich glaube, sie haben alle ihre Kinder nach römischen Göttern und Göttinnen benannt«, sagte Magdalena, während sie sich an das wenige zu erinnern versuchte, was sie über das Geschlecht derer von Tag und Nacht wusste. »Sowohl der Freiherr als auch seine Frau sind sehr an Kunst und Mythologie interessiert.«
Im Grunde gab es nicht viel zu überlegen. Magdalena wollte sich nur noch etwas sammeln. Danach würde sie sich an den abgenutzten Schreibtisch setzen und ein Rückschreiben verfassen. Es gab nur eine denkbare Antwort.
»Die Bedenkzeit ist sehr kurz«, bemerkte Beata mit bekümmerter Stimme. Offensichtlich spürte das Dienstmädchen Magdalenas Vorbehalte und teilte sie.
»Ja«, stimmte Magdalena ihr zu. Die Bedenkzeit war kurz. Nur ein paar Stunden, um eine Entscheidung zu treffen, die so vieles verändern, so viele Dämonen wecken und sie in ganz neue Verhältnisse zwingen würde.
»Aber«, fuhr Beata fort, »es klingt, als würde die Freifrau dir eine Entlohnung anbieten. Ist die Familie reich?«
»Verglichen mit uns sind alle reich«, antwortete Magdalena trocken. Doch heutzutage konnte man nie wissen. Viele der vornehmsten Familien standen am Rande des Konkurses, auch wenn sie die Fassade aufrechterhielten. Diese Familie hatte vermutlich viele Töchter, die es galt zu verheiraten. Magdalena erhob sich, ging zum Tisch und nahm Papier und Tinte zur Hand.
»Warum lehnen sie die Einladung nicht einfach ab, wenn es so ungünstig ist?«, fragte Beata. »Wenn die Mutter ihre Tochter nicht selbst begleiten kann?«
Diese Eigenschaft schätzte Magdalena an Beata am meisten: Das Dienstmädchen war vollkommen unbeeindruckt, was Herkunft und gesellschaftliche Stellung betraf. Für Beata waren es die Handlungen, die einen Menschen ausmachten, nicht Geld oder Macht. Die Dienstmagd begegnete jedem, den sie traf, mit demselben Misstrauen, ob es nun der Gemüsehändler auf dem Markt war oder Sally van der Meers hochnäsige Verwandten, die sie einen Tag nach dem Tod der alten Dame hinausgeworfen hatten.
»Man sagt nicht Nein zu einer Einladung des Grafen de la Grip nach Schloss Wadenstierna«, erklärte Magdalena zerstreut. Nicht, wenn man eine Tochter im heiratsfähigen Alter hatte. Magdalena vermutete, dass die Einladung des Grafen beim Hochadel heiß begehrt war. Es gab viele mittellose Töchter zu verheiraten und viel zu wenige wohlhabende Junggesellen. Ein Graf konnte alt, fett und gemein sein. So lange er nur reich war, würde jede Familie darüber hinwegsehen. Magdalena atmete tief ein und zwang sich, sich zu entspannen. Was spielte es für eine Rolle? Die Welt des Adels war ihr zuwider. Die meisten Adeligen führten sich auf, als wären sie selbst kleine Götter. Und je höher ihre Stellung war, desto schlechter führten sie sich auf – das wusste Magdalena aus leidvoller Erfahrung.
»Ihr werdet also zusagen?«, fragte Beata. Die Dienstmagd nahm einen Staubwedel vom Kaminsims. Sie hatte eine Falte zwischen den Augenbrauen und kniff den Mund unzufrieden zusammen. Magdalena lächelte. Niemand konnte Beata vorwerfen, dass sie einen Hehl aus ihrer Stimmung machte oder dass sie illoyal war. Wie gerne hätte Magdalena gesagt, dass sie nicht gedachte, Anstandsdame für ein verwöhntes Mädchen zu spielen, das vermutlich mehr Geld als Verstand besaß und nichts kannte außer der eigenen privilegierten Welt. Dass sie nicht vorhatte, in die höhere Gesellschaft zurückzukehren. Sie hatte kein Bestreben, jemals wieder Grafen, Freiherren oder andere, die sich als etwas Besseres ansahen, zu treffen. Schon gar nicht in der Rolle der Bediensteten. Es war ihr bewusst, dass es hochmütig von ihr war, so zu denken. Am liebsten hätte sie mit den Achseln gezuckt und gesagt, dass der ganze Adel und die adeligen Herren ihr zum Hals heraushingen und sie ihr Geld und ihre arrangierten Ehen für sich behalten sollten. Aber falls das Leben Magdalena etwas gelehrt hatte, so war es, dass sie sich um ihr Wohlergehen selbst kümmern musste, auch wenn das bedeutete, den Stolz beiseitezuschieben und Anstandsdame einer Adeligen zu werden. Die Freifrau konnte von Gesellschaftsdame, fester Hand und Wegweisung reden, wie sie wollte. Magdalena wusste, was es im Grunde bedeutete. Der Brief mit der verschnörkelten Handschrift und den überschwänglichen Sätzen war ganz einfach das Angebot einer Anstellung. Es ging darum, einen Arbeitgeber zu bekommen und Befehlen zu gehorchen. Sich unterzuordnen.
»Ich sehe nicht, dass ich eine Wahl habe«, sagte Magdalena. Denn so war es. Noch ein paar Monate, und sie würde auf der Straße stehen. »Wir könnten uns Tee und die Miete leisten. Du würdest Lohn bekommen.«
»Aber da werden so viele Leute sein, so viele, die …« Beata unterbrach sich und wedelte wortlos weiter mit dem Staubwedel, doch Magdalena wusste, wovon sie sprach. So viele, die möglicherweise wussten, was letztes Jahr passiert war. Was Magdalena getan hatte.
»Bestimmt haben die Leute inzwischen Interessanteres, über das sie klatschen können«, sagte Magdalena, ohne selbst richtig daran zu glauben.
»Wahrscheinlich«, antwortete Beata, doch der Zweifel war deutlich in ihrer Stimme zu vernehmen.
»Wenn wir reisen, kann ich es mir leisten, dich zu entlohnen«, fuhr Magdalena bestimmt fort. »Du musst auch anfangen, an deine Zukunft zu denken.«
Und damit war es beschlossen. Magdalena war sich beinahe sicher, dass niemand über sie lästern würde. Jedenfalls nicht auf Wadenstierna, dort würde es bestimmt spannendere Dinge zu besprechen geben als einen Skandal aus dem Vorjahr. Sie musste ganz einfach daran glauben. Magdalena schüttelte den Kopf, während sie das Dienstmädchen betrachtete, das ein Tuch hervorgeholt und begonnen hatte, einen Kerzenständer so gründlich zu bearbeiten, dass der Belag sich zu lösen schien. »Du bist noch jung, Beata, du solltest daran denken, zu heiraten. Noch ist es nicht zu spät.«
Beata blickte Magdalena äußerst skeptisch an, ohne dabei mit dem Putzen aufzuhören. Sie schien der Ansicht zu sein, dass Magdalenas Leben an dem Tag in die Binsen gehen würde, an dem Beata anfing, an ihre eigene Zukunft zu denken. Vermutlich hatte sie damit sogar recht. So sehr Magdalena die betagte Sally van der Meer auch geliebt hatte, so war es doch Beatas Fürsorge gewesen, die sie das letzte Jahr hatte überleben lassen. Sally war liebenswert gewesen, doch nicht sonderlich praktisch veranlagt. Es war Beata, die dafür gesorgt hatte, dass Sallys geringe Hinterlassenschaft so lange reichte.
Magdalena beobachtete Beatas energische Bewegungen. »Wie gefällt dir eigentlich deine Arbeit?«, fragte sie. »Für mich zu arbeiten, meine ich?«
Auch wenn sie einander inzwischen sehr nahestanden, so waren sie doch – abgesehen vom nicht gezahlten Lohn – Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin. Magdalena hatte bisher nicht länger darüber nachgedacht. Vielleicht verabscheute Beata es genauso, für sie zu arbeiten, wie sie den Gedanken hasste, in den Dienst der Freifrau zu treten. Diese Einsicht erschien ihr beinahe unerträglich.
Beata blickte sie an, als wüsste sie genau, was Magdalena gerade bewegte. Die Magd war desinteressiert an allem, was nicht in irgendeiner Form mit Seife, Wasser und Scheuerlappen zu tun hatte. Sie besaß aber ein messerscharfes Gespür für die abwegigsten Details. »Es ist nichts gegen eine ehrliche Arbeit einzuwenden«, sagte sie kurz, und Magdalena hatte nicht den Mut, weitere Fragen zu stellen, auf die sie nicht unbedingt eine Antwort haben wollte.
»Diese Familie de la Grip, also … Kennt Ihr sie?«, fragte Beata, während sie ein fadenscheiniges Sofakissen aufschüttelte, ein Halstuch zusammenlegte und ein unsichtbares Staubkorn mit Daumen und Zeigefinger auflas.
»Ich habe von ihr gehört«, antwortete Magdalena.
Es gehörte zur Allgemeinbildung, die vornehmsten Familien des Landes zu kennen. Magdalena wusste, wer die Familie de la Grip war, so wie sie wusste, wer Galileo und Molière waren: leuchtende Sterne am Himmel. »Man sagt, Schloss Wadenstierna sei sehr schön«, fuhr sie fort. »Und es soll eine Menge interessanter Einrichtungsgegenstände dort geben. Der alte Graf hat das Schloss damals ordentlich aufgerüstet, und scheinbar haben sie das meiste behalten können.« Viele adelige Familien waren in den letzten Jahren ruiniert worden. König Karl XI. hatte wegen Geldnöten des Reiches in einer umfassenden Reduktion einen Großteil der Güter und Ländereien des Adels zurückgefordert und auch erhalten. Doch Schloss Wadenstierna war offenbar verschont geblieben. Es hieß, es sei nie prächtiger gewesen. Tatsächlich wollte Magdalena das Schloss gerne sehen, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurückreichte.
»Wir werden jedenfalls etwas Luxus im Sommer erleben«, sagte Beata. Als Magdalena den sehnsuchtsvollen Unterton in ihrer Stimme bemerkte, versetzte es ihr einen Stich in der Brust. Beata war jung, gerade zwanzig, dachte sie beschämt. Sie sollte nicht ihre ganze Zeit mit einer verbitterten und verarmten Jungfer verbringen müssen. Ihnen beiden würde die frische Luft auf dem Land guttun. Die Stadt war grässlich im Juli, ob es nun in Strömen goss oder heiß war wie im Hades.
Vielleicht sollte Magdalena selbst darüber nachdenken, was sie gedachte, den Rest ihres Lebens zu tun. Wie sie die einsamen Jahre ausfüllen sollte, die sich vor ihr erstreckten. Vielleicht war das doch das Beste, was ihr passieren konnte. Sie brauchte ein Einkommen, war jedoch nicht dazu erzogen worden, praktische Arbeiten auszuführen. Außerdem war sie zu alt, um mit den jungen, tüchtigen Bauernmädchen konkurrieren zu können, die in die Stadt strebten und sich um Arbeit bewarben. Sie besaß keine praktischen Fähigkeiten und hatte keine Kontakte. Doch sie besaß Bildung, auch wenn sie auf keinem Gebiet spezialisiert war. Es war sehr aufmerksam von Sally gewesen, sie weiterzuempfehlen. Magdalena wusste, was sie zu tun hatte. Sie wollte das nicht, aber diese Tatsache spielte keine Rolle – in ihrem Leben war es nie wirklich darum gegangen, was sie sich wünschte. Eigentlich war er ein Segen, dieser Brief einer Frau, die sie noch nie getroffen hatte. Sally hätte sie ermuntert, diese Gelegenheit, sich selbst zu versorgen, zu ergreifen. Sie wäre verrückt gewesen, wenn sie es nicht tat.
Und ungeachtet dessen, was einige Menschen über sie sagten, war sie nicht verrückt.
»Vielleicht kann ich ja meinen Lebensunterhalt damit verdienen, die Gesellschaftsdame junger, heiratswilliger Frauen zu sein«, sagte Magdalena ironisch und versuchte, tapfer zu lächeln.
Sie würde ihre Antwort schreiben. Und dann würde sie nach Kleidern suchen, die zu einer Anstandsdame passten, einer alten Jungfer, einer Zofe. Hässliche, schlichte Kleider, die ihre Stellung verdeutlichten und dafür sorgten, dass man über sie hinwegsah. Das jedenfalls sollte nicht allzu schwierig sein. Die wenigen Kleider, die sie besaß, waren schlicht und hässlich.
Im Brief hatte es nicht ausdrücklich gestanden, aber Magdalena wusste sehr genau, worin ihr Auftrag bestehen würde: Ihre Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass Fräulein Venus ihren guten Ruf während der Wochen voller Feste und Geselligkeit behielt. Dass das Mädchen einen guten Eindruck auf den Grafen und dessen Familie machte. Und vor allem, dass Venus nicht in die Gesellschaft unzuverlässiger Männer geriet.
Das war eine Aufgabe, für die sie gewissermaßen wie geschaffen war – wie Sally van Meer gewusst hatte. Wenn Venus’ Mutter jemanden benötigte, der die Falschheit der Männer durchschaute, so hatte sie ohne Zweifel die Richtige gefunden. Magdalena hatte auf bittere Weise erfahren müssen, was passieren konnte, wenn eine Frau allzu gutgläubig war.
Sie führte die Feder zum Papier und begann schnell und in eleganten Schwüngen zu schreiben, ohne mit der Tinte zu klecksen.
Sie hasste sie. Die Männer.
2
Stockholm, am selben Tag an einem anderen Ort
Als Graf Gabriel Magnus Christian de la Grip zum ersten Mal seit vielen Monaten Stockholm erblickte, die Stadt, in der er geboren war, lag der Regen wie ein schwerer Teppich über ihm. Gabriel entstammte einer Familie, deren Vorväter weit zurückzuverfolgen waren. Seit einiger Zeit war er Graf von Lilliesund und Freiherr von Storö und Bjelknäs. Außerdem gehörte ihm seit weniger als einem Jahr das sagenumwobene Schloss Wadenstierna in Uppland sowie der italienisch inspirierte Palast Goldener Grip auf Riddarholmen und ein luxuriöser Herrenhof auf Norra malmen. Weiterhin besaß er rund zwanzig Gutshöfe samt den dazugehörigen Gütern in den fruchtbarsten Teilen Schwedens und Finnlands.
Kurz gesagt: Gabriel de la Grip war einer der prominentesten und reichsten Männer Schwedens.
Doch heute fühlte sich Gabriel de la Grip weder gräflich noch hochwohlgeboren und noch nicht einmal sonderlich prominent.
Mehr als alles andere fühlte er sich nass.
Der Regen, der keinen Standesunterschied kannte, prasselte jedoch nicht nur auf Gabriel nieder. Er ergoss sich auch über seinem Schiffer Lars, der mit gewohnt düsterem Blick Richtung Horizont blickte, über ihren Steuermann Sven und die übrige Besatzung des Schiffes Delphin hinweg. Trotzdem war das alles nichts gegen die Erlebnisse der letzten Wochen. Gabriel liebte die Elemente der Natur, gerade weil sie niemanden verschonten, aber zwischendurch waren ihm Zweifel gekommen, ob sie es diesmal überleben würden. Seine Hand strich über die glatte Reling, und er lächelte in sich hinein. Selbst in diesem grauen, kalten Regenwetter schimmerte das Holz. Er sah sich um und spürte, wie seine Brust vor Liebe anschwoll. Es war ein wohlbekanntes, beinahe beschämendes Gefühl. Delphin, die schnelle, elegante Pinasse, das beste Schiff in Gabriels Flotte, war in Holland gebaut worden und besaß perfekte Proportionen. Schiffer, Steuermann und der Rest der Besatzung hatten geschuftet wie die Tiere. Gabriel war ihnen zutiefst dankbar, doch er wusste auch, dass sie es nicht durch den Sturm geschafft hätten, wären sie mit einem anderen Schiff als der Delphin gesegelt. Die Delphin war wie Poesie im Wasser. Im Vergleich zu den holländischen Dreideckern, den Handelsschiffen, die auf denselben Routen unterwegs waren, war die Pinasse nicht groß, aber sie war leicht und elegant. Beständig und verlässlich. Zusammen hatten sie die meisten der Weltmeere durchsegelt. Von der Ostsee im Norden bis zu den wärmeren Ozeanen des Südens. Sie hatten Stürmen in der Karibik und Wolkenbrüchen über dem Mittelmeer getrotzt. Mehr als einmal waren sie den berüchtigten Seeräubern entkommen, die vor der Küste Nordafrikas ihr Unwesen trieben. Wenn man einen Gegenstand lieben konnte, dann empfand Gabriel für das erste Schiff, das er jemals gekauft hatte, genau das: Liebe.
»Danke«, flüsterte er. Denn während einiger Tage draußen auf der Ostsee hatte er tatsächlich geglaubt, für seinen Übermut mit dem Leben zahlen zu müssen. Doch die Delphin, die noch vor weniger als einem Tag Sturm und mannshohe Wellen bezwungen hatte, ließ sich munter und beinahe eifrig in den Hafen Stockholms steuern.
Wenn man Stockholm auf dem Seeweg aus östlicher Richtung erreichte – so wie sie es jetzt taten, mit der Ostsee und der Bucht Saltsjön im Rücken –, dann dominierte die Festung Tre Kronor das Stadtbild. Türme und Zinnen, Wimpel, Verteidigungswehre und hohe, unbezwingbare Burgmauern erwarteten geduldig den Besucher. Um diese Jahreszeit war die Handelssaison in vollem Gang und der Hafen voller Schiffe. Doch das spielte keine Rolle, da die Delphin nicht im allgemein zugänglichen Hafen vor Anker gehen sollte. Die Pinasse würde sich direkt zu Gabriels Stadtpalast begeben und in seinem privaten Hafen draußen bei Riddarholmen einlaufen.
Der Schiffer gab seinem Steuermann ein paar Befehle, bevor er den Blick hob, um den Zustand der regennassen Segel zu überprüfen. Mit geübter Hand wurde das Schiff in nördliche Richtung gesteuert, zum Schleusentor.
Nach Hause.
Er war zu Hause.
Mochte Gott ihm nun beistehen.
Kurze Zeit später erhielt die Delphin, deren Segel nun eingezogen waren, Hilfe beim Passieren der bemannten Schleuse, welche die salzwasserhaltige Bucht Saltsjön mit dem Brackwasser des Mälarsees verband. Das Holz des Schiffsrumpfes knarrte und knirschte, während sich die Besatzung mit den Hafenarbeitern kabbelte, die das Schiff durch die Schleuse zogen. Alle waren gerädert und durchnässt bis auf die Haut, aber guten Mutes, jetzt, wo sie sich dem sicheren Land näherten. Noch ein letztes Ruckeln, und die Delphin befand sich im Mälarsee. Kurz darauf befahl der Schiffer, die Segel wieder zu setzen und in den sicheren Hafen vor Gabriels Stadtpalast einzulaufen.
Der Palast war ein monströses Gebäude mit Säulen, Portalen und Skulpturen aus dem grausten Marmor, den Gabriel je gesehen hatte. Sein Großvater väterlicherseits hatte ihn bauen lassen. Danach hatten Gabriels Vater und sein älterer Bruder weitere Säulen sowie eine Menge unpraktischer und teurer Einrichtungsgegenstände hinzufügen lassen. Nun war es Gabriels Aufgabe, das Ganze zu verwalten. Widerwillig betrachtete er den Steinkoloss und dachte nicht zum ersten Mal, dass er vermutlich sämtliche Bettler und Bedürftigen von Stockholm versorgen könnte, wenn er dieses Haus verkaufte. Der Gedanke ließ ihn lächeln. Sein Vater würde sich im Grab umdrehen. Allein das würde die Sache wert sein.
Die Schlossbediensteten waren hinunter in den Hafen geströmt. Jetzt warfen ihnen die Matrosen die Fangleinen zu, damit sie die Seile einziehen und das Schiff vertäuen konnten. Unterdessen blickte Gabriel zu dem großen Mast hinauf. Das Segel hing schlaff und nutzlos herunter, zusammengebunden mit dicken Lederriemen. Der Sturm hatte es schwer beschädigt.
»Wir müssen das hier reparieren«, sagte er durch das Heulen des Winds und den prasselnden Regen hindurch zu Ossian Bergman, seinem besten Freund, der auf wackeligen Beinen aus der Kajüte an Deck gekommen war. Ossian war nicht direkt ein Seemann, um es vorsichtig auszudrücken. Während ihrer Segelfahrten hielt er sich meist in seiner Kajüte auf, aber er war ein fähiger Wissenschaftler, ein guter Schütze und phänomenal im Kartenlesen. Gabriel nickte in Richtung des Mastes. Das Segel war am Querbalken des Großmastes eingezogen worden. Die Risse, die der Sturm verursacht hatte, waren nicht zu sehen, aber sie waren da und hatten beinahe der gesamten Besatzung das Leben gekostet.
Ossian folgte Gabriels Blick. »Eine Zeit lang dachte ich, das wär’s gewesen«, sagte er. »Das war der schlimmste Sturm, den ich jemals erlebt habe.« Er wischte sich den Regen von der Stirn, auch wenn das ein hoffnungsloses Unterfangen war. Es war so nass, als hätten sie sich alle vollständig unter Wasser befunden. Ossian sah mit sehnsuchtsvollem Blick in den Hafen.
»Aber ich habe noch nie ein Schiff verloren«, antwortete Gabriel lächelnd, auch wenn er in Wahrheit dieselbe Befürchtung gehabt hatte. »Die Delphin hält viel aus«, setzte er stolz hinzu. Ossian sehnte sich immer danach, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, aber Gabriel wollte nicht an Land gehen, noch nicht. Er wollte an Bord seines Schiffes bleiben, wo das Leben unkompliziert war.
»Man kann über Lars sagen, was man will. Aber als Schiffer weiß er, was er tut«, fuhr Ossian fort.
Gabriel nickte zustimmend. Als Sechzehnjähriger war er zur See gegangen. Während der ersten Jahre – Herrgott, war er wirklich schon zweiunddreißig? – hatte er alles erlebt: von grausamen Schiffern und unfähigen Steuermännern bis hin zu kompetenten und rechtschaffenen Seeleuten. Er selbst war auch ein durchaus geschickter Segler. Doch er war äußerst dankbar dafür, dass sie gerade Lars Larsson auf dieser stürmischen Seefahrt als Schiffer bei sich gehabt hatten.
Gabriel lächelte Ossian an und spürte den Schauer, der ihn immer überlief, wenn er etwas geschafft hatte, was nur wenige andere geschafft hätten. Viele hielten ihn für unverantwortlich und unzuverlässig, einige sogar für rücksichtslos, doch seine Waghalsigkeit hatte sich gelohnt. Die Fracht der Delphin, die nun von erleichterten Seeleuten und neugierigen Palastdienern an Land gebracht wurde, war von nahezu unschätzbarem Wert: Seidenteppiche aus Persien und dem Osmanischen Reich, dicht gewebt und schimmernd wie Regenbögen. Gewürze aus warmen Ländern, so weit entfernt, dass die meisten niemals von ihnen gehört hatten, Edelsteine vom anderen Ende der Welt und Goldschmuck aus den besten Schmieden Europas. Stoffe aus Italien, die so kunstvoll gewebt und bestickt waren, dass sie ein Vermögen einbringen würden, wenn sich die luxusversessenen Aristokraten erst auf den Samt und die Seide stürzten. Und, das Wertvollste von allem: glänzendes, dünnes Porzellan aus China – eingebettet in Stroh und quer über den halben Erdball transportiert.
Gabriel schickte Ossian an Land. Dann half er dabei, Kisten, Tonnen und Stoffballen im immer noch herabströmenden Regen zu entladen.
»Der Schiffer wird in Stockholm bleiben«, sagte Gabriel zu Ossian, nachdem er Lars nachgewunken hatte. »Offenbar hat er hier eine Frau. Ich kenne ihn seit zehn Jahren, aber nie hat er irgendetwas erwähnt.«
Ossian war auf eine Tonne niedergesunken und schüttelte den Kopf. Er schloss die Augen und stöhnte. »Es fühlt sich an, als würde es niemals aufhören zu schaukeln.«
»Du weißt, dass das nicht die günstigste Eigenschaft für einen Wissenschaftler auf Entdeckerfahrt ist«, sagte Gabriel trocken. »Anfällig für die Seekrankheit zu sein, meine ich.«
Ossian, der die letzten Tage über einem Eimer zugebracht hatte, machte eine abwiegelnde Handbewegung. »Das bin ich nur, wenn es stürmt und wenn wir uns dem Land nähern. Bald bin ich wie neugeboren.«
Gabriel sah sich um. Er betrachtete den Hafen und das entladene Schiff. Menschen hasteten gebeugt durch das Unwetter. Sobald er trockene Kleidung angelegt hatte, würde er die Waren durchsehen und verteilen. Ein Teil davon, wie etwa Glas, Teppiche und Bücher, würde direkt weiter nach Wadenstierna geschickt werden. Einen anderen Teil, wie zum Beispiel Edelsteine, Kräuter und ein paar Kuriositäten, würde er mit Gewinn verkaufen. Einige der kostbarsten Gegenstände würde er dem Königspaar schenken. Auch wenn der König Prunk verabscheute, so würde der Militarist in ihm die mit Perlmutt verzierten Pistolen zu schätzen wissen, die Gabriel für ihn gekauft hatte. Der Königin würde er feine Krüge aus Porzellan schenken, mit glänzender Glasur und ausgefallenen Mustern. Gabriel mochte die junge, freundliche Königin Ulrika Eleonora sehr. Es war immer von Vorteil, sich mit der Königin und dem Herrscher des Reichs gut zu stellen, besonders wenn man wie Gabriel eine Tendenz dazu hatte, mit anderen einflussreichen Männern in Konflikt zu geraten. Viele verabscheuten Gabriel, sei es, weil er vermied, in den Krieg zu ziehen, oder weil er die Höfe und Herrensitze verarmter Adeliger aufkaufte und sie mit seinen eigenen Reichtümern füllte, ohne sich dafür zu schämen. Natürlich gab es auch Leute, die ihn für das, was vor langer Zeit geschehen war, verachteten.
Und das konnte man ihnen nicht wirklich verübeln.
»Wie fühlt es sich an, wieder zu Hause zu sein?«, fragte Ossian.
Es war seltsam: Jedes Mal, wenn Gabriel nach Hause kam, hatte er das Gefühl, dass Stockholm geschrumpft war. Ein Teil von ihm wäre gerne im Ausland geblieben und hätte darauf verzichtet, nach Hause zu kommen. »Es wird sich bedeutend besser anfühlen, wenn ich trocken bin und mich rasiert habe«, erwiderte er. Auch wenn Ossian sein bester Freund war, wollte er nur ungern über seine Gefühle mit ihm sprechen. »Leistest du mir nachher beim Essen Gesellschaft?«, fragte er stattdessen.
Ossian schüttelte den Kopf und erhob sich von der Tonne, auf der er gesessen hatte. Sie verließen den Hafen und schlugen den kurzen Weg hinauf zum Palast ein.
»Ich habe in der Stadt zu tun«, erklärte Ossian, als Gabriel auf dem gepflasterten Hofplatz stehen blieb. Er scheute sich, hineinzugehen, obwohl der Regen immer noch auf sie niederrauschte. »Wann wolltest du nach Wadenstierna aufbrechen?«, fragte Ossian.
»Ich segle die Delphin selbst dorthin«, antwortete Gabriel. »Aber du begleitest mich doch?«
Sie hatten schon ausgemacht, dass Ossian mit nach Wadenstierna kommen und ihre Errungenschaften sichten und sortieren würde. Auch wollte er Gabriels Bibliothek kennenlernen und den schwedischen Sommer genießen, während er auf sein eigenes Schiff wartete, das in Göteborg vor Anker lag und repariert wurde. Ossian würde im Spätsommer Richtung Karibik aufbrechen, und Gabriel kämpfte mit dem Neid. Er wollte auch in die Karibik.
»Ich erwäge, den Landweg zu nehmen«, sagte Ossian sehnsüchtig. »Allerdings vermute ich, dass die Wege in schlechtem Zustand sind. Wenn es allzu holperig ist, werde ich auch seekrank. Per Schiff geht es immerhin schneller.«
Als Gabriel zuletzt in Schweden gewesen war, auf einem der vielen beklemmenden Begräbnisse, die er besuchen musste, hatte er einige Gasthäuser gekauft. Sie befanden sich entlang der Strecke von Stockholm nach Wadenstierna. Auch die Wege hatte er freiräumen lassen, sodass sie inzwischen passierbar sein mussten. Zudem hatte er einige Rastplätze einrichten lassen. Doch natürlich war der Seeweg am schnellsten und bequemsten.
Gabriel blickte hinaus auf das stürmische Wasser, das er soeben verlassen hatte. Wieder verspürte er die altbekannte Sehnsucht. So hätte es nicht werden sollen, dachte er.
»Ich reise in ein oder zwei Wochen«, sagte er seufzend. Er freute sich nicht auf das, was ihn erwartete.
Nachdem er sich von Ossian verabschiedet hatte, blieb Gabriel auf dem Vorplatz stehen und betrachtete düster das enorme Bauwerk. Das Grundstück, auf dem es stand, war ein Geschenk von Königin Christina gewesen. Keine Kosten waren gescheut worden, um den teuersten und prahlerischsten Palast überhaupt zu bauen. Das hatte die Familie ruiniert. Gabriels Vater hatte das Haus geerbt und eine Hypothek darauf aufgenommen, nur um es mit noch mehr sinnlosem Prunk auszustatten. Nun erwartete man von Gabriel, dem letzten männlichen Nachkommen, dass er hier residierte, wenn er in der Hauptstadt war.
Er verabscheute den Palast. Sosehr er sich auch bemühte, ihm etwas Positives abzugewinnen – er war stets unglücklich, wenn er hier war. Jetzt trat er langsam durch die Tür, die von einem Diener mit angstvollem Blick und fahler Gesichtsfarbe aufgehalten wurde. Unter absolutem Schweigen – immer dieses Schweigen – nahm der Bedienstete Gabriels durchnässte Kleidung entgegen. Marmorskulpturen und überdimensional große Porträts schmückten die Wände der weitläufigen Halle. Gabriel reichte seine Handschuhe einem Knaben, der mit gesenktem Kopf vorbeihuschte.
»Wo ist Eskil?«, fragte Gabriel und sah sich nach seinem ältesten Diener um, der für den Haushalt verantwortlich war. Beinahe hoffte er, dass der alte, griesgrämige Mann inzwischen gestorben war.
»Hier, Herr«, hörte er eine wohlbekannte Stimme sagen. »Willkommen zu Hause, Herr.«
Gabriel drehte sich um und blickte in Eskils Gesicht.
Kein Anzeichen von Freude war darin zu entdecken.
Offensichtlich befand er sich noch immer in Ungnade.
»Danke, Eskil«, erwiderte Gabriel mit kühlerem Ton als beabsichtigt. Er war kurz davor gewesen, ihm die Hand zu reichen, doch Eskils verschlossene Miene hatte ihn aus dem Konzept gebracht. Also verschränkte Gabriel stattdessen die Hände auf dem Rücken. Einen Augenblick lang hatte er zu denken gewagt, dass es anders sein würde, wenn er heimkehrte. Dass die Schatten der Vergangenheit zusammen mit dem Vater und den Brüdern verblichen waren. Dass er eine zweite Chance bekommen, ihm verziehen werden würde.
»Ich esse im Arbeitszimmer«, sagte er, um das kompakte Schweigen zu durchbrechen. »Etwas Einfaches«, fügte er hinzu.
Eskils Gesicht verriet nichts, aber Gabriel war sich sicher, was der Mann dachte: Der alte Graf hätte niemals in seinem Arbeitszimmer gegessen. Gabriels Vater hatte sein Essen stets im Speisesaal eingenommen, wie es sich für einen Grafen gehörte. Mehrere Gänge bei vollzähliger Dienerschaft, unabhängig davon, ob er Gäste hatte oder alleine war. Ein Graf hielt sich an die Tradition, Herkunft und die eigene Überlegenheit, und zwar immer und unter allen Umständen.
All das las Gabriel aus dem grimmigen Blick des Alten. Daher wiederholte er trotzig seine Anweisung: »Bitte die Köchin, etwas ganz Einfaches zuzubereiten. Etwas Kaltes.«
Eskil verneigte sich mit einem Gesicht, als hätte Gabriel ihm befohlen, eine tote Ratte aus der Latrine zu fischen. »Habt Ihr Euren Kammerdiener bei Euch?«, fragte er steif.
Gabriel strich mit der Hand über seine Bartstoppeln. »Ich bin in den letzten Monaten ohne ihn ausgekommen«, gab er zu.
Eskil betrachtete Gabriels Haar, sein unrasiertes Gesicht und seine schmutzige Kleidung. »Ich kümmere mich darum, Herr.«
»Danke«, antwortete Gabriel. Warum nicht? Er hatte nichts dagegen, rasiert und gepflegt auszusehen. Wenn er an Land bleiben und sich gräflich benehmen wollte, würde er wohl einen Kammerdiener benötigen.
»Und ich werde dafür sorgen, dass das Abendessen im Speisesaal serviert werden wird«, fuhr Eskil fort. »Das ist bequemer für Euch.«
»Tu das«, sagte Gabriel seufzend. Er, das schwarze Schaf der Familie, würde einen Machtkampf gegen Eskil kaum gewinnen, ob er nun Graf war oder nicht. »Sei so lieb und lass mir warmes Wasser bringen«, fügte er hinzu. Er hatte seit vielen Wochen kein warmes Bad mehr genommen.
»Das ist bereits geschehen«, antwortete Eskil reserviert. Mit einer Reihe von Gesten brachte er die Dienerschaft dazu, hinfort zu eilen. »Soll ich Euch helfen, oder soll ich eine der Mägde hineinschicken?«
Die Vorstellung, vom alten Eskil gewaschen zu werden, ließ Gabriel vor Abscheu erschauern. »Ich wasche mich selbst«, sagte er mit Nachdruck, in der Hoffnung, dass er dadurch seine Autorität untermauern würde. Niemand auf seinem Schiff – noch nicht einmal der Schiffer Lars Larsson – hätte es gewagt, einem Befehl in diesem Tonfall zu widersprechen.
»Ja, Herr«, antwortete Eskil, ohne eine Miene zu verziehen.
Und Gabriel wusste, dass er verloren hatte. Er konnte es in Eskils Augen sehen. Kein Graf in diesem Haushalt – alt oder jung – würde sich entkleiden, ein Bad nehmen oder sich abtrocknen, ohne die Hilfe von mindestens zwei Dienern in Anspruch zu nehmen. Nicht, solange Eskil noch lebte und atmete.
Gabriel beschloss, so schnell wie möglich Richtung Wadenstierna aufzubrechen. Aber nun war er gezwungen, die Frage zu stellen, die er so lange wie möglich hinausgezögert hatte:
»Wie geht es meiner Mutter?«
»Eure Mutter und Eure Schwestern befinden sich auf Wadenstierna«, sagte Eskil noch reservierter. »Ich bin sicher, dass es ihnen allen ausgezeichnet geht.«
Nachdem er gebadet, sich umgezogen und gegessen hatte, ließ sich Gabriel endlich in einen Sessel im Arbeitszimmer fallen. Er betrachtete die Regale und Möbel, die hier schon seit der Zeit seines Großvaters standen, und fragte sich, wie oft er hierherbeordert worden war. Wie oft er hier für irgendein Vergehen bestraft worden war. Als Kind hatte er dieses Zimmer verabscheut, doch nun, als Erwachsener, gefiel es ihm unerwartet gut. Es besaß harmonische Proportionen, und mit einem knisternden Feuer im Kamin und den dicken Teppichen und Tüchern über Fußboden und Tischen war es behaglich eingerichtet. Gobelins und eingebundene Prachtwerke erzeugten einen Duft nach Stoff und Leder. Gabriel schenkte sich Cognac in eines der venezianischen Gläser ein, die er eigentlich seiner Mutter geschenkt hatte. Offenbar hatte sie entschieden, dass dieses Geschenk es nicht wert war, nach Wadenstierna mitgenommen zu werden. Während er trank, bewunderte er die neuste Seekarte, die er gekauft hatte. Er hatte keinen Grund zu klagen. Besaß er nicht alles, was ein Mann sich nur wünschen konnte? Mit dem Finger fuhr er die Küstenlinie entlang. Vielleicht würde er die Karte einrahmen und auf Wadenstierna aufhängen lassen. Die militärischen Kunstwerke, die sein Vater so bewundert hatte, wollte er abhängen lassen. Die Wände auf Wadenstierna sollten Gemälde mit maritimen Motiven zieren, beschloss er. Auf der Tischplatte vor ihm hatte er einige seiner Navigationsinstrumente aufgestellt. Es waren schöne Geräte aus Messing, Holz und Glas. Sie würde er auch mitnehmen. Er strich über einen Sextanten und schaute mit leerem Blick ins Feuer. Weniger als einen halben Tag befand er sich jetzt an Land, und schon vermisste er das Meer so sehr, dass es wehtat.
Es klopfte. Eskil öffnete die Tür, ohne auf Antwort zu warten und kündigte an:
»Ihro Gnaden, Frau Gräfin von Hessen.« In der Stimme des Dieners schwang Missbilligung mit.
»Bon soir«, hörte Gabriel Marie-Thérèse Saint-Aubin von Hessen sagen. Sie drängte sich an Eskil vorbei und trat ein.
Gabriel bedeutete Eskil durch ein Nicken, dass er den Raum verlassen sollte. Die Tür fiel zu, und ein leises Klicken war zu hören. Marie hielt lächelnd den Schlüssel hoch.
»Guten Abend, Frau von Hessen«, sagte Gabriel und erwiderte ihr Lächeln. Seit langer Zeit schon war Marie seine Geliebte. Wie durch eine Wolke aus knisternder Seide, parfümiertem Puder und leise klirrendem Geschmeide glitt sie über die persischen Teppiche hin zu ihm.
»Ich habe deinen Brief bekommen«, sagte sie. »Eigentlich wollte ich dich warten lassen. Das hätte ich wirklich tun sollen. Wir haben Gäste.«
Sie hatten sich nicht mehr gesehen, seit Gabriel das letzte Mal in Schweden gewesen war, und schon beim Klang ihrer Stimme reagierte sein Körper. Maries französischer Akzent ließ jeden Mann schwach werden. Irgendetwas an ihren Diphthongen und heiseren Konsonanten ließ unwillkürlich Gedanken an dunkle Nächte und heiße Umarmungen aufkommen.
»Da bin ich aber froh, dass Ihr vernünftig genug wart, Frau von Hessen, und hergekommen seid«, erwiderte Gabriel.
Maries schlanke Schultern erbebten unter dem schimmernden Seidenbrokat. »Ich auch«, sagte sie und streckte ihre parfümierte Hand aus. Sie hatte schlanke, lange Finger mit Nägeln, die perfekt modellierten, perlmuttfarbenen Ovalen glichen. Gabriel presste seinen Mund gegen ihre kühle Handfläche. »Was soll ich denn heute mit dir anfangen, hm?«, fragte er und küsste ihre Finger, einen nach dem anderen.
»Bon dieu, du bist so erfinderisch, dir fällt sicher etwas ein«, murmelte Marie. »Aber ich habe nicht viel Zeit«, fuhr sie fort. »Wollen wir?« Sie wandte ihm den Rücken zu und Gabriel ließ sich nicht zweimal bitten. Er legte eine Hand auf ihre Hüfte und begann, ihr Korsett aufzuschnüren. Die Seidenbänder glitten durch seine Finger. Maries schmaler Brustkorb hob und senkte sich heftig, als sie tiefer einatmen konnte. Kleid und Unterröcke glitten zu Boden. Sie wandte sich zu ihm um und stieg aus dem Berg aus Stoff und Spitze.
»Ich habe dich vermisst, mon amour«, sagte sie. Trotz ihres schmeichlerischen Tonfalls registrierte Gabriel den Ernst in ihrem Blick. Marie bewegte sich in den vornehmsten Kreisen, und Leute waren bereit, für eine Einladung zu einem ihrer Feste über Leichen zu gehen. Aber sie gehörte zu den einsamsten Menschen, die er je getroffen hatte.
»Komm«, sagte er und nahm sie in seine Arme.
Danach lagen sie noch eine Weile auf dem Boden vor dem Feuer, gesättigt und befriedigt. Gabriel tauchte einen Finger in den goldfarbenen Alkohol, strich damit Maries kühle Haut entlang und küsste die Tropfen weg.
Marie erschauderte. »Das kitzelt!«, sagte sie. »Hör auf damit.« Ohne jede Scheu erhob sie sich. Ihr Körper war vollkommen, und dessen war sie sich auch bewusst. »Zeig mir lieber, was du für mich gekauft hast.«
Gabriel holte den Sextanten und zeigte ihn ihr. »Ich habe ihn in Italien gekauft«, erklärte er. »Italiener sind phänomenale Seeleute.«
»Faszinierend«, entgegnete sie trocken. »Du und deine merkwürdigen Gegenstände. Zeig mir jetzt etwas unfassbar Teures, bevor ich böse werde und zurück zu meinen langweiligen Gästen gehe. Eigentlich sind sie die Gäste meines Mannes, aber irgendwann werden auch sie merken, dass ich fort bin.«
Lachend griff Gabriel nach einer flachen, schwarzen Schatulle und reichte sie ihr. Marie öffnete sie und zog ihre kleine Nase kraus. »Was ist das?«, fragte sie misstrauisch.
»Perlen«, antwortete er.
Marie rollte mit den Augen. »Das sehe ich, dass es Perlen sind. Aber warum sind sie nicht eingefasst und haben so eigentümliche Farben?« Die Perlen waren nicht weiß, sondern glänzten in allen Farben, von Rosa über Blau bis zu Schwarz. Einige schimmerten wie Pfauenfedern, andere leuchteten in einem kühlen Violett.
»Sie sind aus Tahiti«, sagte Gabriel. Er fand sie wunderschön, auch wenn sie ganz anders aussahen, als Perlen es für gewöhnlich taten. Er hatte selbst am Strand gestanden und den jungen Burschen mit bronzefarbener Haut dabei zugesehen, wie sie nach ihnen tauchten. Auf all seinen Reisen hatte er nie zuvor solche Perlen gesehen. Er hatte sie gekauft, weil sie anders und absolut einzigartig waren. Aber jetzt sah er ein, dass sie Marie nicht stehen würden. Ihre warme Hautfarbe passte nicht zum kühlen Glanz der Perlen aus Tahiti.
Maries Augen waren schmal geworden. Sie blitzte ihn an, als hätte er versucht, ihr faulen Fisch zu verkaufen. Sie wäre eine vorzügliche Haushälterin geworden, misstrauisch und praktisch. »Tahiti? Flunkerst du? Gibt es wirklich ein Land, das so heißt?«
Gabriel nickte. Er ließ sich zurücksinken, verschränkte die Arme hinter dem Kopf, winkelte ein Bein an und atmete tief aus. Er fühlte sich behaglich und entspannt. Schon bald würde die Pflicht wieder rufen, doch im Augenblick erlaubte er es sich, das wärmende Feuer, den Cognac und die Gesellschaft einer schönen Frau zu genießen. »Es gibt sie nur dort. Im Wasser vor den Inseln.«
»Pah«, sagte Marie und schloss die Schatulle mit einem kleinen Knall. »Ich mag Perlen nur in Form von Halsbändern. Was hast du noch? Sag, dass du mir etwas anderes gekauft hast. Ich vergehe vor Langeweile! Nichts passiert, wenn du weg bist. Die Leute in Stockholm sind unglaublich uninteressant.«
»Und dein Mann?«, fragte Gabriel, während er sich aufrichtete und eine weitere Schatulle hervorholte. Er reichte sie Marie. Sie öffnete sie, und ihr Blick hellte sich auf, als sie die französischen Haarkämme erblickte, die er speziell für sie hatte anfertigen lassen. Sie bewunderte die Diamanten in den Kämmen, bevor sie eine Grimasse schnitt, wie immer, wenn die Rede auf ihren Gemahl, Graf von Hessen, kam. »Von Hessen ist der langweiligste von allen«, sagte sie. Sie steckte sich einen der Kämme ins Haar und drehte den Kopf, sodass die Steine aufblitzten.
»Die meisten Menschen sind ziemlich langweilig«, behauptete Gabriel.
»Außer mir«, sagte Marie und strecke sich auf der Seite aus, sodass ihre Schönheit voll zur Geltung kam. Bekleidet mit der neusten Mode war Marie eine ausgesprochene Schönheit. Nackt war sie eine Offenbarung.
Gabriel grinste. »Nein, niemand, der bei Verstand ist, könnte sich darüber beschweren, dass du langweilig bist«, pflichtete er ihr bei.
»Schlimmer noch: Die meisten Menschen sind auch furchtbar hässlich«, fuhr Marie zufrieden fort, die sich ihrer einzigartigen Schönheit wohl bewusst war. »Und so steif und pompös«, fügte sie mit einem Schütteln hinzu, das zeigte, dass sie lieber tot sein wollte als pompös.
»Und trotzdem hast du einen der Pompösesten geheiratet«, konnte Gabriel sich nicht verkneifen festzustellen.
Er und Graf von Hessen zogen es vor, sich aus dem Weg zu gehen. Doch die wenigen Male, die er den Mann getroffen hatte, war er beinahe eingeschlafen, so eintönig war das Gespräch gewesen.
»Sei nicht albern«, sagte Marie und wackelte mit den Zehen. »Ehe hat nichts mit Zuneigung zu tun. Von Hessen war nicht besser oder schlechter als irgendjemand anderes. Meine Eltern mochten ihn. Und er lässt mich tun und lassen, was ich will.«
»Das mag ich am meisten an dir: deinen unverstellten Blick auf das Leben.«
Marie lächelte träge. Falls das Desinteresse ihres Mannes an ihren Beschäftigungen sie verletzte, so zeigte sie es jedenfalls nicht.
»Wo wir gerade von tristen Menschen sprechen«, fuhr Gabriel fort, »ich muss meine Familie auf Wadenstierna besuchen. Meine Mutter und meine Schwestern sind dort und haben wohl eine Art Sommerfest arrangiert. Man erwartet offenbar meine Anwesenheit.«
Marie machte einen Schmollmund und kniff ihn in den Arm. »Ich habe schon von dem Fest gehört. Ganz Stockholm spricht davon. Warum bin ich nicht eingeladen?«
Gabriel überlegte, ob er darauf hinweisen sollte, dass es vermutlich genau an dem lag, was sie gerade getan hatten. Seine Mutter war fast schon fanatisch auf Sittsamkeit bedacht und besaß unumstößliche Prinzipien.
»Möchtest du kommen?«, fragte er stattdessen. An diese Möglichkeit hatte er bisher gar nicht gedacht. Vielleicht, weil es sogar ihm provokant vorkam, seine Geliebte einzuladen, die dann unter dem gleichen Dach wie Mutter und Schwestern wohnen würde. Aber wenn man schon als berüchtigt galt, warum sollte man sich nicht entsprechend benehmen? Marie bei sich auf Wadenstierna zu haben, Marie mit ihrer flinken Zunge und den erfinderischen Fingern, würde ihm den Aufenthalt erträglich machen. Außerdem führte Marie sich besser auf als alle anderen, die Gabriel getroffen hatte. Ihre Ahnen reichten sogar noch weiter zurück als seine. Sie war praktisch mit allen Königshäusern Europas verwandt, und man konnte Marie von Hessen an jeden beliebigen Hof bringen – sie wusste genau, wie man sich zu benehmen hatte. Seine Mutter würde es nicht wagen, das weiter zu kommentieren.
Zudem war er nun das Oberhaupt der Familie. Er konnte zum Teufel tun, was er wollte.
»Vielleicht«, antwortete Marie und strich mit den Fingern über seinen Arm. Sie runzelte die Stirn. »Du bist so braun gebrannt und muskulös«, sagte sie missgelaunt. »Was hast du getan? Du siehst ja beinahe aus wie ein Hafenarbeiter.«
Gabriel stand auf, legte Holz ins Feuer, füllte ihr Glas mit Wein und legte sich wieder zu ihr. Das Feuer wärmte ihn, und der Alkohol begann ihn auf behagliche Art zu benebeln. »Und woher weiß die Frau Gräfin von Hessen, wie ein Hafenarbeiter aussieht?«, zog er sie auf.
Marie schnaubte. »Ich bin schon im Hafen gewesen. Aber du bist ein Graf, Gabriel.« In Maries Welt führten Männer seiner Stellung keine körperlichen Arbeiten aus. Doch Gabriel hatte in den letzten Jahren hart gearbeitet, und es hatte ihm gut getan. Manchmal schien es ihm, als ob schwere, physische Anstrengung die einzige Möglichkeit war, sich wie ein Mensch zu fühlen. Trotzdem hatte Marie irgendwo recht, dachte er.
»Wer ist der beste Schneider in Stockholm?«, fragte er.
»Dieser französische Mann unten an Skeppsbron. Aber es ist unmöglich, dort einen Termin zu bekommen.«
Gabriel grinste. Also würde er Stockholms besten Schneider mit nach Wadenstierna locken, mochte es kosten, was es wollte. Und einen Burschen, der sein Kammerdiener sein konnte, wenn er schon mal dabei war. Es war Zeit, zu Hause das Kommando zu übernehmen. Er streichelte Marie über die Hüfte. »Was meinst du, wie es wohl gewesen wäre, wenn wir geheiratet hätten?«, fragte er.
»Welch seltsame Frage«, sagte sie uninteressiert, nahm die Kämme aus ihrem Haar und legte sie zurück in die Schatulle. »Dann hätten wir uns wohl gegenseitig betrogen, nehme ich an«, fuhr sie fort und erhob sich. »Ich bin direkt hergeeilt, als ich hörte, dass du wieder da bist, doch jetzt muss ich mich beeilen.« Sie lächelte schief. »Wir haben Gäste zum Essen.«
»Ich hatte gedacht, du scherzt«, lachte Gabriel. »Wer ist da?«
Marie machte eine ihrer eleganten, französischen Gesten. »Eine Menge langweiliger Männer. Oxenstierna. Wrangel und Bonde. Brahe und dieser pompöse Bielke. Der eine trister als der andere. Hässlich gekleidet. Ernst. Sie reden nur über Politik, niemandem fällt es auf, wenn ich verschwinde.« Sie suchte nach ihrem Korsett und reichte es Gabriel. »Ich habe nie verstanden, warum Männer, die alle für furchtbar begabt halten, nicht begreifen können, dass sie unglaublich pompös und uninteressant sind«, sagte sie. »Aber so sind die Schweden.« Geduldig wartete sie, während er sie einschnürte.
»Meine Mutter hat mit Sicherheit alle langweiligen Menschen, die Gott geschaffen hat, nach Wadenstierna eingeladen«, sagte Gabriel.
»Deine Mutter ist froh, dass du wieder zu Hause bist. Sie möchte, dass du dich zur Ruhe setzt. Dass du heiratest.«
Gabriel stöhnte. Natürlich hatte Marie recht, doch deswegen war es nicht weniger qualvoll. Er schnürte das Band durch das letzte Loch im Korsett, band einen eleganten Knoten und half ihr anschließend in ihr Kleid.
»Du kannst das gut«, lobte sie ihn. »Du hättest vielleicht Kammerzofe werden sollen statt Graf.«
»Mein einziger Wunsch ist es, Euch zu dienen, Madame«, sagte er und biss sie leicht in die Schulter. Lachend entzog sie sich ihm. »Nun muss ich mich beeilen.«
»Begleitest du mich nach Wadenstierna?«, fragte Gabriel. »Und rettest mich vor den unerträglichen Menschen, die Gott geschaffen hat?«
Marie wartete, während er ihr die Tür öffnete. Eskil stand stocksteif auf der anderen Seite.
Marie lächelte Gabriel lieblich an. »Ich komme mit«, sagte sie. »Weil du so lieb gebeten hast.« Ohne Eskil eines Blickes zu würdigen huschte sie davon.
Der Diener blieb still in der Türöffnung stehen. Sein ganzes Wesen strahlte Missbilligung aus. Gabriel erfasste Wut. Was bildete Eskil sich ein, Meinungen und Ansichten über das Leben seines Herrn zu haben? Zum Teufel, dachte Gabriel. Er würde sich nicht darum scheren, was ein alter Diener über ihn dachte.
»Ich würde es begrüßen, wenn du in Zukunft nicht mehr heimlich an meiner Tür lauschen würdest«, sagte Gabriel kalt. »Ansonsten kannst du dich nach einer anderen Arbeit umsehen.«
Eskil erstarrte, als hätte Gabriel nach ihm geschlagen. Dann verbeugte er sich und ging davon, wie ein Märtyrer, alt und leicht hinkend. Gabriel schlug fluchend die Tür zu.
3
Schloss Wadenstierna, Juli 1685
Zwei Wochen nachdem sie den Brief der Freifrau erhalten hatte, steckte Magdalena Swärd ihre Nase aus dem offenen Kutschenfenster. Tags zuvor, beim Verlassen der Stadt, hatte es noch geregnet, doch hier, zehn Meilen nördlich von Stockholm, schien die Sonne. Vor ihnen türmte sich das sagenumwobene Wadenstierna gegen den blauen Sommerhimmel auf. Das Schloss war beinahe überirdisch schön. Nicht einmal der Wettergott schien es zu wagen, eine der vornehmsten Familien des Landes dadurch zu verärgern, dass er Regen über ihrem weißen Märchenschloss niederrauschen ließ.
Sie und Beata hatten in einer Herberge auf halber Strecke übernachtet, die Pferde gewechselt und die Fahrt Richtung Norden anschließend in gemütlichem Tempo fortgesetzt. Wenn Magdalena den stolzen Besitzer der Herberge richtig verstanden hatte, so hatte der Graf Höfe entlang der Strecke von Stockholm bis zum Schloss gekauft und extra für seine Gäste Wege anlegen lassen.
»Wohnen sie hier nur im Sommer?«, fragte Beata, die sich weit aus dem Fenster gelehnt hatte.
»Ich glaube schon«, antwortete Magdalena.
»Es ist wunderschön«, sagte Beata mit großen Augen.
Magdalena musste ihr beipflichten. Wimpel mit dem Familienwappen der de la Grips – eine goldene Klaue auf blauem Grund – flatterten auf den Türmen, und die weiße Fassade leuchtete wie frisch verputzt. Wohin sie auch blickte, überall sah sie vergoldete Ranken und Figürchen, weiße Skulpturen und riesige Tonkrüge mit kunstvoll gestutzten Büschen. Magdalena traute ihren Augen kaum. Es war ganz einfach das Schönste, was sie je in ihrem Leben gesehen hatte. Unabhängig vom Anlass ihres Besuches war sie froh, das Schloss sehen zu dürfen.
Nachdem die Kutsche angehalten hatte, der Kutscher hinabgesprungen war und ihnen die Tür aufgehalten hatte, stiegen die beiden Frauen aus, streckten sich und sahen sich neugierig um.
»So viele Leute«, flüsterte Beata. Der mit Steinen gepflasterte Vorhof war voller Menschen, Wagen und Tieren. Beatas Worte waren bei dem Lärm kaum zu hören. Kutschen, die vor ihnen angekommen waren, wurden unter lautem Rufen entladen. Diener schleppten Taschen und Gepäck, Bekannte riefen einander Grüße zu.
Magdalena sah sich um, unsicher, was von ihr erwartet wurde. Sie kannte niemanden hier, und niemand schien gekommen zu sein, um sie zu empfangen. Beata hatte ihre einzige Reisetasche bereits vom Wagen gehoben. Magdalena trug eine kleinere Tasche und eine Hutschachtel – das war alles, was sie bei sich hatten. Die Kutsche hatte sie hinauf zum Haupteingang gebracht. Unterhalb von ihnen glitzerte das Wasser, vor ihnen lag das riesige Schloss. Es war atemberaubend. Doch mit einem Mal kam Magdalena der Gedanke, dass der Kutscher sie wohl eher zum Eingang für die Dienerschaft hätte bringen sollen.
Wo immer dieser sich befand.
Während Magdalena noch überlegte, ob sie dem Strom der Gäste hinein ins Gebäude folgen oder lieber nach einem Eingang für die Bediensteten suchen sollte, bemerkte sie eine elegante Frau, die dabei war, aus einer glänzenden Kutsche mit hohen Rädern zu steigen. Trotz des Chaos’ ringsum zog sie die Aufmerksamkeit auf sich. Drei weitere Kutschen in den gleichen Farben fuhren herbei. Magdalena konnte ihre Augen nicht von der formvollendeten Eleganz der Dame abwenden. Sie trug ein hellgraues Reisekostüm und einen dazu passenden Hut mit langen Federn. Die Fremde war in etwa gleich groß wie Magdalena, jedoch deutlich schlanker. Ihre Haltung war aufrecht und selbstsicher wie die einer Königin. Magdalena drückte automatisch die Schultern durch und richtete sich auf. Die Frau stellte ihre elegant beschuhten Füße auf den Boden und wartete, während ihr eine Zofe die Kleider ordnete. Eine andere rief dem Kutscher etwas zu, wieder eine andere reichte ihr einen Fächer. Die drei grauen Kutschen, die nachgekommen waren, öffneten sich eine nach der anderen und entließen einen ganzen Strom an Bediensteten.