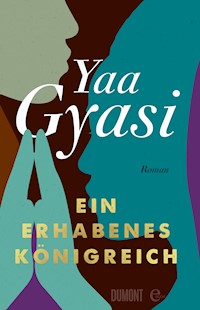
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Auftauchen ihrer Mutter, die sich ins Bett legt und auf nichts mehr reagiert, kehren in Gifty die schmerzhaftesten Kindheitserinnerungen zurück: das Verschwinden des Vaters, der in seine Heimat Ghana zurückging, der Tod des geliebten Bruders und die Depression der Mutter angesichts dieser Verluste. Ihre Familiengeschichte hat dazu geführt, dass Gifty als erwachsene Frau ihren Glauben gegen die Neurowissenschaften eingetauscht hat. Sie ist davon überzeugt, dass sich Depression und Abhängigkeit, und damit Trauer und Leid, durch entsprechende Behandlung verhindern lassen. Doch die Angst um ihre Mutter, die fest verankert in ihrer Religion stets allen Schwierigkeiten im weißen Amerika gewachsen war, lässt Gifty an beidem zweifeln: Kann nur die unbestechliche, aber seelenlose Wissenschaft ihr die Mutter zurückbringen oder gelingt das allein den herzerwärmenden Erlösungsversprechen der Kirche? Die bewegende Geschichte einer Familie, exemplarisch für die vom Rassismus geprägte amerikanische Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mit dem Auftauchen ihrer Mutter, die sich ins Bett legt und auf nichts mehr reagiert, kehren in Gifty die schmerzhaftesten Kindheitserinnerungen zurück: das Verschwinden des Vaters, der in seine Heimat Ghana zurückging, der Tod des geliebten Bruders und die Depression der Mutter angesichts dieser Verluste. Ihre Familiengeschichte hat dazu geführt, dass Gifty als erwachsene Frau ihren Glauben gegen die Neurowissenschaften eingetauscht hat. Sie ist davon überzeugt, dass sich Depression und Abhängigkeit, und damit Trauer und Leid, durch entsprechende Behandlung verhindern lassen. Doch die Angst um ihre Mutter, die fest verankert in ihrer Religion stets allen Schwierigkeiten im weißen Amerika gewachsen war, lässt Gifty an beidem zweifeln: Kann nur die unbestechliche, aber seelenlose Wissenschaft ihr die Mutter zurückbringen oder gelingt das allein den herzerwärmenden Erlösungsversprechen der Kirche?
© Peter Hurley/The Vilcek Foundation
Yaa Gyasi, 1989 in Ghana geboren, ist im Süden der USA aufgewachsen. Sie hat Englische Literatur an der Stanford University studiert und einen Abschluss des Iowa Writers’ Workshop. Ihr Debüt ›Heimkehren‹ (DuMont 2017), das in den USA und England wochenlang auf den Bestsellerlisten stand, wurde in über 20Sprachen übersetzt und ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, u.a. dem Pen/Hemingway Award. Yaa Gyasi lebt in Brooklyn/New York.
Anette Grube 1953 in München geboren, hat Anglistik studiert. Sie hat u.a. Chimamanda Ngozi Adichie, T.
Yaa Gyasi
Ein erhabenes Königreich
Roman
Aus dem Englischen von Anette Grube
Von Yaa Gyasi ist bei DuMont außerdem erschienen:
Heimkehren
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›Transcendent Kingdom‹ bei Alfred A.Knopf, New York.
© 2020 by YNG Books, Inc.
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Anette Grube
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotive: © whelytoncosta/istockimages und © silhouettegarden
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7110-0
www.dumont-buchverlag.de
Die Welt ist aufgeladen mit der Großartigkeit Gottes.
Sie blitzt auf, wie Metall im Licht aufleuchtet.
1
Wann immer ich an meine Mutter denke, sehe ich vor mir, wie sie in einem Doppelbett liegt, eine versierte Reglosigkeit den Raum erfüllt. Monatelang nahm sie dieses Bett in Beschlag wie ein Virus, zum ersten Mal, als ich ein Kind war, und dann wieder, als ich promovierte. Das erste Mal wurde ich nach Ghana geschickt, um es auszusitzen. Als ich dort mit meiner Tante über den Kejetia-Markt ging, packte sie mich am Arm und deutete mit dem Finger. »Schau, ein Verrückter«, sagte sie auf Twi. »Siehst du ihn? Ein Verrückter.«
Ich schämte mich in Grund und Boden. Meine Tante sprach so laut, und der Mann, der groß war und staubverkrustete Dreadlocks hatte, befand sich in Hörweite. »Ich sehe ihn. Ich sehe ihn«, antwortete ich leise. Der Mann ging an uns vorbei, murmelte vor sich hin und machte mit den Händen Gesten, die nur er verstand. Meine Tante nickte zufrieden, und wir setzten unseren Weg fort, an den Horden von Menschen auf diesem Platzangst verursachenden Markt vorbei, bis wir den Stand erreichten, wo wir den ganzen Morgen versuchen würden, billige Kopien von Handtaschen zu verkaufen. Während der drei Monate, die ich dort verbrachte, verkauften wir nur vier Taschen.
Auch jetzt verstehe ich noch nicht ganz, warum meine Tante mich auf diesen Mann hinwies. Vielleicht glaubte sie, dass es in Amerika keine verrückten Menschen gab, dass ich nie zuvor einen gesehen hatte. Oder vielleicht dachte sie an meine Mutter, an den wahren Grund, warum ich in diesem Sommer in Ghana festsaß und an einem Stand schwitzte mit einer Tante, die ich kaum kannte, während meine Mutter zu Hause in Alabama genas. Ich war elf, und ich wusste, dass meine Mutter nicht krank war, nicht auf die Weise, wie ich es kannte. Ich verstand nicht, wovon meine Mutter genesen musste. Ich verstand es nicht, und doch verstand ich es. Und meine Verlegenheit wegen des lauten Sprechens meiner Tante hatte genauso viel damit zu tun, dass ich es verstand, wie mit dem Mann, der an uns vorbeiging. Meine Tante sagte: »So. So sieht Verrücktsein aus.« Doch stattdessen hörte ich den Namen meiner Mutter. Ich sah das Gesicht meiner Mutter vor mir, reglos wie das Wasser in einem See, die Hand des Pastors sacht auf ihrer Stirn, sein Beten ein leises Geräusch, das das Zimmer zum Summen brachte. Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, wie Verrücktsein aussieht, aber auch heute noch sehe ich einen geteilten Bildschirm vor mir, wenn ich das Wort höre, den Mann mit den Dreadlocks auf dem Kejetia-Markt auf der einen Seite, meine Mutter im Bett auf der anderen. Ich denke daran, wie niemand auf dem Markt auf den Mann reagierte, weder ängstlich noch angewidert, niemand außer meiner Tante, die wollte, dass ich ihn ansah. Mir schien, er war völlig mit sich im Reinen, obwohl er wild gestikulierte und vor sich hin murmelte.
Aber in meiner Mutter, die vollkommen reglos in ihrem Bett lag, ging es drunter und drüber.
2
Als es zum zweiten Mal passierte, erhielt ich einen Anruf, während ich in meinem Labor an der Stanford University arbeitete. Ich hatte zwei Mäuse trennen müssen, weil sie sich gegenseitig in der Schuhschachtel, in der wir sie hielten, in Stücke rissen. Ich fand ein Stückchen Fleisch in einer Ecke der Schachtel, doch zuerst sah ich nicht, von welcher Maus es stammte. Beide bluteten und waren hektisch, rasten davon, wenn ich sie zu greifen versuchte, obwohl sie nicht entkommen konnten.
»Hör mal, Gifty, sie war seit fast einem Monat nicht mehr in der Kirche. Ich habe bei ihr angerufen, aber sie nimmt nicht ab. Manchmal schaue ich vorbei und kümmere mich darum, dass sie etwas zu essen hat und so, aber ich glaube … ich glaube, es passiert wieder.«
Ich schwieg. Die Mäuse hatten sich weitgehend beruhigt, aber ich war noch immer erschüttert von ihrem Anblick und machte mir Sorgen um meine Forschungsarbeit. Um alles.
»Gifty?«, sagte Pastor John.
»Sie sollte zu mir kommen.«
Ich weiß nicht, wie der Pastor meine Mutter ins Flugzeug verfrachtete. Als ich sie am SFO abholte, war ihr Blick vollkommen leer, ihr Körper schlaff. Ich stellte mir vor, dass Pastor John sie wie einen Overall zusammengefaltet hatte, die Arme überkreuzt vor der Brust wie ein X, die Beine nach oben gezogen, und sie dann in einem Koffer mit dem Aufkleber VORSICHT! ZERBRECHLICH! sicher verstaut und einer Stewardess übergeben hatte.
Ich nahm sie steif in die Arme, und sie wich vor meiner Berührung zurück. Ich holte tief Luft. »Hast du Gepäck?«, fragte ich.
»Daabi«, sagte sie.
»Okay, kein Gepäck. Super, dann können wir direkt zum Auto gehen.« Die zuckersüße gute Laune in meiner Stimme ärgerte mich so sehr, dass ich mir auf die Zunge biss. Ich schmeckte einen Blutstropfen und schluckte ihn.
Sie folgte mir zu meinem Prius. Unter besseren Umständen hätte sie sich über mein Auto lustig gemacht, das ihr, die an Alabamas Pick-ups und SUVs gewöhnt war, wie eine Kuriosität erscheinen musste. »Gifty, mein sentimentaler Gutmensch«, nannte sie mich manchmal. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen war, aber ich dachte mir, dass Pastor John und diverse Fernseh-Prediger, die sie gern sah, wenn sie kochte, den Ausdruck abschätzig benutzten, um Leute wie mich zu beschreiben, die sich aus Alabama abgesetzt hatten, um unter den Sündern der Welt zu leben, vermutlich weil uns unsere liberale Einstellung zu sehr geschwächt hatte, um es zwischen den zähen Auserwählten Christi im Bible Belt auszuhalten. Sie liebte Billy Graham, der Dinge sagte wie: »Ein wahrer Christ ist jemand, der dem Klatschmaul der Stadt seinen Papagei schenkt.«
Grausam, dachte ich als Kind, den eigenen Papagei wegzugeben.
Das Komische an den Ausdrücken, die meine Mutter aufschnappte, ist, dass sie sie sich immer ein bisschen falsch einprägte. Ich war ihr Gutmensch, nicht ein Gutmensch. Etwas war eine klare Schande, nicht eine wahre Schande. Sie hatte einen kleinen Südstaatenakzent, der ihren ghanaischen Akzent färbte. Es erinnerte mich an meine Freundin Anne, deren Haar braun war, außer an manchen Tagen, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel darauf schien und es plötzlich rot schimmerte.
Im Wagen schaute meine Mutter still wie eine Kirchenmaus aus dem Fenster auf der Beifahrerseite. Ich versuchte mir vorzustellen, wie die Landschaft auf sie wirkte. Nach meiner Ankunft in Kalifornien war mir alles so wunderschön erschienen. Sogar das Gras, gelb und verbrannt von der Sonne und der scheinbar endlosen Trockenheit, hatte wie nicht von dieser Welt ausgesehen. Das muss der Mars sein, dachte ich, denn wie konnte auch das Amerika sein? Ich sah die langweiligen grünen Weiden meiner Kindheit vor mir, die niedrigen Hügel, die wir Berge nannten. Die Weite dieser Westküstenlandschaft überwältigte mich. Ich war nach Kalifornien gekommen, um mich zu verlieren, zu finden. Im College hatte ich Walden gelesen, weil ein Junge, den ich toll fand, das Buch toll fand. Ich verstand nichts, aber ich unterstrich alles, unter anderem: Erst wenn wir uns verloren haben, mit anderen Worten, erst wenn wir die Welt verloren haben, finden wir langsam zu uns selbst und begreifen, wo wir sind und wie unendlich weit unsere Beziehungen reichen.
Ob meine Mutter ebenfalls von der Landschaft beeindruckt war, konnte ich nicht sagen. Wir kamen aufgrund des Verkehrs nur langsam voran, und ich sah, dass mich der Mann im Auto neben uns anschaute. Er blickte schnell weg, dann wieder zu mir und wieder weg. Ich wollte, dass ihm unbehaglich wurde, oder vielleicht wollte ich auch nur mein eigenes Unbehagen auf ihn übertragen, jedenfalls starrte ich ihn weiterhin an. Ich sah an der Art und Weise, wie er sich ans Lenkrad klammerte, dass er sich bemühte, nicht noch einmal zu mir zu blicken. Seine Knöchel waren weiß, von Adern überzogen und rot umrandet. Er gab auf, schaute mich ärgerlich an und sagte lautlos: »Was?« Ich habe immer den Eindruck, dass der Verkehr auf einer Brücke die Menschen näher an ihre eigenen Abgründe bringt. In jedem Wagen ein Schnappschuss der persönlichen Belastungsgrenze, Fahrer, die aufs Wasser hinausschauen und sich fragen: Was wäre, wenn? Gibt es einen anderen Ausweg? Wir fuhren wieder ein paar Meter. Im Gedränge der Autos schien der Mann fast so nah, dass ich ihn hätte berühren können. Was würde er tun, wenn er mich berühren könnte? Wenn er seinen Zorn in seinem Honda Accord nicht eindämmen müsste, wogegen würde er sich richten?
»Hast du Hunger?«, fragte ich meine Mutter und wandte mich endlich von ihm ab.
Sie zuckte die Achseln und starrte weiter aus dem Fenster. Beim letzten Mal hatte sie dreißig Kilo in zwei Monaten verloren. Als ich aus meinem Sommer in Ghana zurückkehrte, erkannte ich sie fast nicht wieder, diese Frau, die magere Menschen als Beleidigung empfand, als würde sie Faulheit oder ein Charakterfehler davon abhalten, die schiere Freude eines guten Essens zu genießen. Dann wurde sie eine von ihnen. Ihre Wangen waren eingesunken; ihr Bauch war flach. Sie war ausgehöhlt, verschwand.
Ich war entschlossen, das nicht wieder passieren zu lassen. Ich hatte online ein ghanaisches Kochbuch gekauft, um die Jahre, in denen ich die Küche meiner Mutter gemieden hatte, wiedergutzumachen, und in den Tagen vor der Ankunft meiner Mutter ein paar Gerichte geübt in der Hoffnung, sie zu perfektionieren. Ich hatte eine Fritteuse gekauft, obwohl mir mein Promotionsstipendium kaum Raum ließ für Extravaganzen wie Bofrot oder Kochbananen. Frittiertes aß meine Mutter am liebsten. Ihre Mutter hatte Essen an einem Stand am Straßenrand in Kumasi frittiert. Meine Großmutter war eine Fante-Frau aus Abandze, einer Küstenstadt, sie war dafür bekannt, die Asante zu hassen, und weigerte sich auch nach zwanzig Jahren in der Asante-Hauptstadt, Twi zu sprechen. Wenn man ihr Essen kaufte, musste man sich ihren Dialekt anhören.
»Wir sind da«, sagte ich und beeilte mich, um meiner Mutter beim Aussteigen zu helfen. Sie ging ein paar Schritte vor mir, obwohl sie noch nie in dieser Wohnung gewesen war. Sie hatte mich nur wenige Male in Kalifornien besucht.
»Entschuldige die Unordnung«, sagte ich, aber es herrschte keine Unordnung. Jedenfalls nicht in meinen Augen, aber meine Augen waren nicht ihre. Jedes Mal, wenn sie mich im Lauf der Jahre besucht hatte, fuhr sie mit dem Finger über Dinge, die zu putzen mir nie in den Sinn gekommen wäre, die Rückseiten der Jalousien, die Angeln der Türen, und zeigte mir anschließend vorwurfsvoll ihrem staubigen schwarzen Finger, und ich konnte nur die Achseln zucken.
»Sauberkeit ist Gottesfurcht«, sagte sie stets.
»Sauberkeit kommt gleich nach Gottesfurcht«, korrigierte ich sie, und sie sah mich finster an. Wo war der Unterschied?
Ich deutete auf das Schlafzimmer, und sie legte sich wortlos ins Bett und schlief ein.
3
Kaum hörte ich sie leise schnarchen, schlich ich mich aus der Wohnung, um nach meinen Mäusen zu sehen. Ich hatte sie zwar getrennt, aber die mit den schlimmsten Wunden saß schmerzgekrümmt in der Ecke einer Schachtel. Ich hatte sie nicht aus den Augen gelassen und bezweifelt, dass sie noch lange leben würde. Es erfüllte mich mit einer unerklärlichen Traurigkeit, und als zwanzig Minuten später mein Laborkollege Han gekommen war, saß ich weinend in der Zimmerecke und wusste, dass ich mich zu sehr schämen würde, zuzugeben, dass der Gedanke an den Tod einer Maus der Grund meiner Tränen war.
»Mieses Date«, sagte ich. Er blickte entsetzt drein, als er ein paar klägliche tröstende Worte zustande brachte, und ich konnte mir vorstellen, was er dachte: Ich habe Naturwissenschaften studiert, damit ich nicht in Gesellschaft emotionaler Frauen sein muss. Plötzlich weinte ich nicht mehr, sondern lachte, laut und verschleimt, und er blickte noch entsetzter drein, seine Ohren liefen so rot an wie ein Stoppschild. Ich hörte auf zu lachen und lief auf die Toilette, wo ich mich im Spiegel anstarrte. Meine Augen waren rot und geschwollen; meine Nase sah wund aus, die Haut um die Nasenflügel war trocken und schuppig von den Taschentüchern.
»Krieg dich in den Griff«, sagte ich zu der Frau im Spiegel, aber es war so ein Klischee, und ich hatte das Gefühl, als würde ich eine Szene aus einem Film nachspielen und als gäbe es kein Ich, das ich in den Griff kriegen könnte, oder vielmehr als gäbe es eine Million Ichs, zu viele, um sie in den Griff zu kriegen. Eins stand in der Toilette und spielte eine Rolle; ein anderes war im Labor und betrachtete die verletzte Maus, ein Tier, für das ich nichts empfand, dessen Schmerzen mich jedoch irgendwie reduziert hatten. Oder multipliziert. Ein anderes Ich dachte noch immer an meine Mutter.
Der Mäusekampf hatte mich so erschüttert, dass ich die Mäuse öfter als nötig kontrollierte in dem Versuch, diesem Gefühl zu entkommen. Als ich am Tag der Ankunft meiner Mutter ins Labor kam, war Han schon da und operierte seine Mäuse. Wann immer Han als Erster ins Labor kam, drehte er das Thermostat herunter. Ich fröstelte, und er blickte von der Arbeit auf.
»Hallo«, sagte er.
»Hallo.«
Obwohl wir uns diesen Raum seit Monaten teilten, sagten wir kaum mehr als Hallo zueinander, außer an dem Tag, an dem er mich weinend vorgefunden hatte. Jetzt lächelte mich Han öfter an, aber seine Ohren wurden noch immer feuerrot, wenn ich versuchte, das Gespräch nach der anfänglichen Begrüßung weiterzutreiben.
Ich kontrollierte meine Mäuse und meine Experimente. Keine Kämpfe, keine Überraschungen.
Ich fuhr zurück zur Wohnung. Meine Mutter lag noch immer unter einem Berg Decken im Bett. Ein Geräusch wie ein Schnurren drang aus ihrem Mund. Ich lebte schon so lange allein, dass mir selbst dieses leise Geräusch, kaum lauter als ein Summen, auf die Nerven ging. Ich hatte vergessen, wie es war, mit meiner Mutter zusammenzuwohnen und mich um sie zu kümmern. Lange Zeit, die meiste Zeit meines Lebens, hatten wir nur zu zweit gelebt, aber diese Paarbildung war unnatürlich gewesen. Sie wusste es, und ich wusste es, und wir versuchten beide, die Wahrheit zu ignorieren – dass wir vier gewesen waren, dann drei, dann zwei. Wenn meine Mutter geht, ob aus freien Stücken oder nicht, wird es nur noch eine geben.
4
Lieber Gott,
ich frage mich, wo du bist. Ich meine, ich weiß, dass du da bist, bei mir, aber wo genau bist du? Im Weltraum?
Lieber Gott,
Die Schwarze Mamba macht meistens großen Lärm, aber wenn sie wütend ist, bewegt sie sich langsam und geräuschlos, und dann ist sie ganz plötzlich da. Buzz sagt, das ist so, weil sie eine afrikanische Kriegerin ist, und deswegen muss sie so verstohlen sein.
Buzz kann sie auf echt komische Weise nachahmen. Er schleicht herum, und dann macht er sich ganz plötzlich echt groß, hebt etwas vom Boden auf und sagt: »Was ist das?« Den Chin-Chin-Mann macht er nicht mehr nach.
Lieber Gott,
wenn du im Weltraum bist, wie kannst du mich dann sehen, und wie sehe ich für dich aus? Und wie siehst du aus, wenn du überhaupt irgendwie aussiehst? Buzz sagt, dass er nie ein Astronaut werden will, und ich glaube, ich will das auch nicht, aber ich würde in den Weltraum fliegen, wenn du dort bist.
5
Als wir zu viert waren, war ich noch zu jung, um es schätzen zu können. Meine Mutter erzählte Geschichten über meinen Vater. Mit einem Meter fünfundneunzig war er der größte Mann, den sie je gesehen hatte; sie meinte, dass er vielleicht der größte Mann in ganz Kumasi war. Er trieb sich in der Nähe des Stands ihrer Mutter herum, scherzte mit meiner Großmutter über ihr eigensinniges Fante, brachte sie dazu, ihm umsonst eine Tüte mit Achomo zu geben, das er wie die Nigerianer in der Stadt Chin Chin nannte. Meine Mutter war dreißig, als sie sich kennenlernten, einunddreißig, als sie heirateten. Nach ghanaischen Standards war sie bereits eine alte Jungfer, aber sie behauptete, Gott habe sie angewiesen zu warten, und als sie meinen Vater traf, wusste sie, worauf sie gewartet hatte.
Sie nannte ihn wie ihre Mutter den Chin-Chin-Mann. Und als ich klein war und Geschichten über ihn hören wollte, tippte ich mir ans Kinn, bis meine Mutter nachgab. »Erzähl mir vom Chin-Chin-Mann«, sagte ich. Ich nahm ihn so gut wie nie als meinen Vater wahr.
Der Chin-Chin-Mann war sechs Jahre älter als sie. Da er von seiner eigenen Mutter verhätschelt wurde, hatte er es nicht für nötig befunden zu heiraten. Er war katholisch erzogen worden, aber kaum hatte meine Mutter ihn sich geangelt, zerrte sie ihn zum Christus ihrer Pfingstkirche. Dieselbe Kirche, in der sie in der sengenden Hitze heirateten mit so vielen Gästen, dass sie nach zweihundert aufhörten zu zählen.
Sie beteten für ein Baby, aber Monat um Monat, Jahr um Jahr vergingen, und es kam kein Baby. Es war das erste Mal, dass meine Mutter an Gott zweifelte. Nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen, und mein Herr ist auch alt?
»Du kannst mit jemand anderem ein Kind haben«, bot sie an und übernahm die Initiative, da Gott schwieg, doch der Chin-Chin-Mann tat es mit einem Lachen ab. Meine Mutter fastete und betete drei Tage im Wohnzimmer meiner Großmutter. Sie muss so erschreckend ausgesehen haben wie eine Hexe und gerochen haben wie ein streunender Hund, doch als sie ihr Gebetszimmer verließ, sagte sie zu meinem Vater: »Jetzt.« Und er ging und legte sich zu ihr. Neun Monate später wurde mein Bruder Nana, der Isaak meiner Mutter, geboren.
Meine Mutter sagte immer: »Du hättest sehen sollen, wie der Chin-Chin-Mann Nana angelächelt hat.« Übers ganze Gesicht. Seine Augen leuchteten, er zog die Lippen bis zu den Ohren, die Ohren gingen nach oben. Nanas Gesicht erwiderte das Kompliment und lächelte ebenso. Das Herz meines Vaters war eine Glühbirne, die mit dem Alter matter wurde. Nana war reines Licht.
Mit sieben Monaten konnte Nana gehen. So wussten sie, dass er groß werden würde. Er war der Liebling ihres Compounds. Nachbarn wollten, dass er zu ihren Partys kam. »Bringt ihr Nana mit?«, fragten sie, weil sie ihre Wohnung mit seinem Lächeln, seinem krummbeinigen Babytanzen erfüllen wollten.
Jeder Straßenhändler hatte ein Geschenk für ihn. Eine Tüte mit Koko, einen Maiskolben, eine kleine Trommel. »Was er nicht alles haben könnte«, sagte meine Mutter. Warum nicht die ganze Welt? Sie wusste, dass ihr der Chin-Chin-Mann zustimmen würde. Nana, geliebt und liebevoll, verdiente das Beste. Aber was war das Beste, das die Welt zu bieten hatte? Für den Chin-Chin-Mann war es das Achomo meiner Großmutter, das Treiben auf dem Kejetia, der rote Lehm, das perfekt gestampfte Fufu seiner Mutter. Es war Kumasi, Ghana. Meine Mutter war sich da nicht so sicher. Sie hatte eine Cousine in Amerika, die der Familie regelmäßig Geld und Kleidung schickte, was nur bedeuten konnte, dass es über dem Atlantik Geld und Kleidung im Überfluss gab. Mit der Geburt Nanas begann sich Ghana beengt anzufühlen. Meine Mutter wollte Raum, damit er wachsen konnte.
Sie stritten und stritten und stritten, doch die unbeschwerte Natur des Chin-Chin-Mannes bedeutete, dass er meine Mutter gewähren ließ, und innerhalb einer Woche hatte sie sich bei der Greencard-Lotterie angemeldet. Damals wanderten nicht viele Ghanaer nach Amerika aus, was hieß, dass man gute Chancen bei der Verlosung hatte. Ein paar Monate später erhielt meine Mutter eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Amerika. Sie packte ihre wenigen Habseligkeiten, nahm Baby Nana und zog nach Alabama, einem Staat, von dem sie nie gehört hatte, wo sie aber bei ihrer Cousine wohnen wollte, die gerade ihre Promotion beendete. Der Chin-Chin-Mann sollte später nachkommen, nachdem sie genug für ein zweites Flugticket und eine eigene Wohnung gespart hatten.
6
Meine Mutter schlief den ganzen Tag und die ganze Nacht, jeden Tag, jede Nacht. Sie war unbeweglich. Wann immer möglich versuchte ich, sie zu überreden, etwas zu essen. Ich war dazu übergegangen, Koko zu machen, das Lieblingsgericht meiner Kindheit. Ich musste in drei Läden gehen, um die richtige Hirse zu finden, die richtigen Maiskolben, die richtigen Erdnüsse zum Drüberstreuen. Ich hoffte, dass sie den Brei ohne nachzudenken schlucken würde. Ich stellte morgens, bevor ich zur Arbeit ging, eine Schale neben das Bett, und wenn ich zurückkehrte, war er oben von einem Film überzogen und darunter so hart, dass ich ihn nur mit Mühe ins Spülbecken kratzen konnte.
Meine Mutter kehrte mir immer den Rücken zu. Es war, als hätte sie einen inneren Sensor dafür, wann ich ins Schlafzimmer kam und den Brei brachte. Ich konnte mir die Filmmontage vorstellen: die Tage unten auf dem Bildschirm gezählt, ich in wechselnder Kleidung, die Handlung war immer die gleiche.
Nach ungefähr fünf solcher Tage betrat ich das Zimmer, und meine Mutter war wach und sah mich an.
»Gifty«, sagte sie, als ich die Schüssel mit Brei hinstellte. »Betest du noch?«
Es wäre netter gewesen zu lügen, aber ich war nicht mehr nett. Vielleicht war ich es nie gewesen. Ich erinnerte mich vage an Nettigkeit in meiner Kindheit, aber vielleicht brachte ich Unschuld und Nettigkeit durcheinander. Ich empfand kaum Kontinuität zwischen der Person, die ich als kleines Kind gewesen war, und der, die ich jetzt war, sodass es mir völlig sinnlos erschien, meiner Mutter so etwas wie Erbarmen entgegenzubringen. Wäre ich als Kind barmherziger gewesen?
»Nein«, antwortete ich.
Als Kind betete ich. Ich las die Bibel und führte ein Tagebuch mit Briefen an Gott. Was das Tagebuch betraf, war ich paranoid und erfand Codenamen für alle Personen in meinem Leben, die Gott bestrafen sollte.
Das Tagebuch lässt keinen Zweifel daran, dass ich eine wahre »Sünder in den Händen eines zornigen Gottes«-Christin war und an die erlösende Kraft von Strafe glaubte. Denn es heißt, dass ihr Fuß straucheln wird, wenn ihre Zeit oder die festgesetzte Zeit kommt. Dann werden sie fallen, so wie es ihr Gewicht vorsieht.
Meiner Mutter gab ich den Codenamen »Die Schwarze Mamba«, weil wir in der Schule gerade Schlangen durchgenommen hatten. In dem Film, den uns die Lehrerin damals zeigte, kam eine zwei Meter lange Schlange vor, die aussah wie eine schlanke Frau in einem hautengen Lederkostüm und durch die Sahara glitt und ein Buschhörnchen verfolgte.
An dem Tag, an dem wir die Schlangen durchnahmen, schrieb ich in mein Tagebuch:
Lieber Gott,
Die Schwarze Mamba war in letzter Zeit echt gemein zu mir. Gestern hat sie gesagt, wenn ich mein Zimmer nicht aufräume, wird mich niemand heiraten wollen.
Mein Bruder Nana hatte den Codenamen Buzz. Ich weiß nicht mehr, warum. In den ersten Jahren, in denen ich Tagebuch führte, war Buzz mein Held:
Lieber Gott,
Buzz ist heute dem Eiswagen hinterhergelaufen. Er hat ein Feuerwerk-Eis für sich und ein Familie-Feuerstein-Eis für mich gekauft.
Oder:
Lieber Gott,
auf dem Sportplatz wollte heute kein Kind mein Partner beim Dreibeinlauf sein, weil ich ihnen zu klein war, aber dann ist Buzz gekommen und hat gesagt, dass er mit mir läuft! Und stell dir vor, wir haben gewonnen, und ich habe einen Pokal gekriegt.
Manchmal ärgerte ich mich auch über ihn, aber damals waren seine Vergehen harmlos, trivial.
Lieber Gott,
Buzz kommt immer in mein Zimmer, ohne anzuklopfen! Ich kann ihn nicht leiden!
Doch nach ein paar Jahren veränderten sich meine Bitten um Gottes Eingreifen grundlegend.
Lieber Gott,
als Buzz gestern Abend nach Haus kam, hat erDSMangeschrien, und ich habe gehört, dass sie geweint hat, und ich bin nach unten gegangen, um nachzusehen, obwohl ich eigentlich im Bett liegen sollte. (Es tut mir leid.) Sie hat zu ihm gesagt, dass er leise sein soll, sonst würde er mich wecken, aber dann hat er den Fernseher genommen und ihn auf den Boden geschmettert und ein Loch in die Wand geschlagen, und seine Hand hat geblutet, undDSMhat geweint, und dann hat sie mich gesehen, und ich bin in mein Zimmer zurückgelaufen, und Buzz hat geschrien: »Verschwinde, du blöde neugierige Fotze.« (Was ist eine Fotze?)
Ich war zehn, als ich diesen Eintrag schrieb. Ich war schlau genug, die Codenamen zu benutzen und neue Wörter zu notieren, aber nicht schlau genug, um zu erkennen, dass jeder meinen Code sofort entschlüsseln konnte. Ich versteckte das Tagebuch unter meiner Matratze, aber da meine Mutter jemand ist, der unter Matratzen sauber macht, muss sie es irgendwann gefunden haben. Wenn ja, hat sie es nie erwähnt. Nach dem Vorfall mit dem Fernseher war meine Mutter hinauf in mein Zimmer gelaufen und hatte die Tür abgeschlossen, während Nana unten weiter tobte. Sie zog mich an sich, und wir knieten uns beide vors Bett, und sie betete auf Twi.
Awurade, b me ba barima ho ban. Awurade, b me ba barima ho ban. Herr, beschütze meinen Sohn. Herr, beschütze meinen Sohn.
»Du solltest beten«, sagte meine Mutter und griff nach dem Brei. Ich sah zu, wie sie zwei Löffelvoll davon aß, bevor sie die Schale wieder wegstellte.
»Ist es okay?«, fragte ich.
Sie zuckte die Achseln und wandte mir wieder den Rücken zu.
Ich ging ins Labor. Han war nicht da, im Raum herrschte also eine annehmbare Temperatur. Ich hängte meine Jacke über eine Stuhllehne, machte mich fertig, nahm zwei Mäuse und bereitete sie für den Eingriff vor. Ich rasierte das Fell auf ihren Köpfen, bis ich die Kopfhaut sah. Ich bohrte vorsichtig hinein, wischte das Blut weg, bis ich auf ihr hellrotes Gehirn traf, während die betäubten Nagetiere mechanisch atmeten und sich ihre Bäuche hoben und senkten.
Obwohl ich es schon unzählige Male getan hatte, flößte mir der Anblick eines Gehirns immer noch Ehrfurcht ein. Wenn ich dieses kleine Organ in dieser winzigen Maus verstehen könnte, würde dieses Verständnis nicht ausreichen, die volle Komplexität des vergleichbaren Organs in meinem Kopf zu erklären. Und doch musste ich versuchen zu verstehen, dieses begrenzte Verständnis extrapolieren und es auf die Gattung Homo sapiens anwenden, das komplizierteste Tier, das einzige Tier, das glaubt, sein Reich zu transzendieren, wie es eine Biologielehrerin in meiner High School ausgedrückt hat. Diese Überzeugung, diese Transzendenz, befand sich in diesem Organ. Unendlich, unverständlich, seelenvoll, erhaben, vielleicht sogar magisch. Ich hatte die Pfingstbewegung meiner Kindheit gegen diese neue Religion ausgetauscht, diese neue Suche, wohlwissend, dass ich nie alles wissen würde.
Ich war Doktorandin im sechsten Jahr in Neurowissenschaft an der medizinischen Fakultät der Stanford University. Ich erforschte die neuronalen Schaltkreise von nach Belohnung strebendem Verhalten. Bei einem Date in meinem ersten Promotionsjahr hatte ich einen Typen zu Tode gelangweilt, als ich ihm versuchte zu erklären, was ich den ganzen Tag tat. Er hatte mich ins Tofu House in Palo Alto eingeladen, und während ich zusah, wie er mit seinen Stäbchen kämpfte und mehrere Stückchen Bulgogi auf die Serviette in seinem Schoß fielen, erzählte ich ihm alles über den medialen präfrontalen Cortex, den Nucleus accumbens und die 2-Photonen-Kalzium-Bildgebung.
»Wir wissen, dass der mediale präfrontale Cortex eine kritische Rolle bei der Unterdrückung nach Belohnung strebenden Verhaltens spielt, allerdings verstehen wir die neuronalen Schaltkreise kaum, die es ihm ermöglichen.«
Ich hatte ihn auf OkCupid kennengelernt. Er hatte strohblondes Haar und eine Hautfarbe, als würde gerade ein Sonnenbrand abklingen. Er sah aus wie ein SoCal-Surfer. Die ganze Zeit, in der wir uns Nachrichten schickten, hatte ich mich gefragt, ob ich das erste schwarze Mädchen war, mit dem er ausging, oder ob er ein Kästchen auf einer Liste mit neuen und exotischen Dingen abhakte, die er ausprobieren wollte, wie das koreanische Essen vor uns, das er bereits aufgegeben hatte.
»Hm«, sagte er. »Klingt interessant.«
Vielleicht hatte er etwas anderes erwartet. In meinem Labor arbeiteten achtundzwanzig Personen, davon waren nur fünf Frauen, und ich war eine von drei schwarzen Doktorandinnen in der ganzen medizinischen Fakultät. Ich hatte SoCal-Surfer erzählt, dass ich promovierte, aber nicht, worin, denn ich wollte ihn nicht abschrecken. Neurowissenschaften schrien vielleicht »schlau«, aber sie schrien nicht unbedingt »sexy«. Dazu kam mein Schwarzsein, vielleicht war ich eine zu große Anomalie für ihn. Er rief nie wieder an.
Von da an erzählte ich meinen Dates, dass ich beruflich Mäuse kokainsüchtig machte und ihnen das Kokain dann wegnahm.
Zwei von drei stellten die gleiche Frage: »Also, hast du dann jede Menge Kokain?« Ich gab niemals zu, dass wir von Kokain zu Ensure gewechselt hatten. Es war leichter zu bekommen und ausreichend suchterzeugend für die Mäuse. Ich genoss den Nervenkitzel, diesen Männern, die ich nie wiedersah, nachdem ich meistens einmal mit ihnen geschlafen hatte, etwas Interessantes und Illegales erzählen zu können. Es gab mir ein Gefühl der Macht, wenn ihre Namen auf dem Bildschirm meines Handys aufleuchteten, Tage, Wochen, nachdem sie mich nackt gesehen und ihre Fingernägel manchmal bis aufs Blut in meinen Rücken gegraben hatten. Wenn ich ihre Nachrichten las, tastete ich gern die Spuren ab, die sie hinterlassen hatten. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich sie dort behalten, nur Namen auf meinem Bildschirm, doch nach einer Weile hörten sie auf anzurufen und zogen weiter, und auch ihr Schweigen gab mir ein Gefühl der Macht. Zumindest eine Zeitlang. Ich war es nicht gewohnt, Macht in Beziehungen, sexuelle Macht zu haben. In der High School war ich nie um ein Date gebeten worden. Kein einziges Mal. Ich war nicht cool genug, nicht weiß genug, nicht genug. Im College war ich schüchtern und unbeholfen gewesen, musste erst die Haut eines Christentums abwerfen, das darauf bestand, dass ich mich für die Ehe aufsparte, und mir Angst vor Männern und meinem Körper einjagte. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe; wer aber hurt, der sündigt an seinem eigenen Leibe.
»Ich bin hübsch, oder?«, fragte ich meine Mutter einmal. Wir standen vor dem Spiegel, und sie schminkte sich für die Arbeit. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, nur, dass ich mich noch nicht schminken durfte. Ich musste es heimlich tun, wenn meine Mutter nicht da war, aber das war nicht allzu schwierig. Meine Mutter arbeitete die ganze Zeit. Sie war nie da.
»Was für eine Frage ist das denn?«, sagte sie. Sie packte mich am Arm und zerrte mich vor den Spiegel. »Schau«, sagte sie, und ich dachte, sie wäre wütend auf mich. Ich versuchte wegzublicken, aber jedes Mal, wenn ich den Blick abwandte, zerrte meine Mutter erneut an mir. So viele Male, dass ich fürchtete, sie würde mir den Arm auskugeln.
»Schau, was Gott geschaffen hat. Schau, was ich geschaffen habe«, sagte sie auf Twi.
Wir starrten uns lange im Spiegel an. Wir starrten, bis der Wecker klingelte, der meine Mutter zur Arbeit rief, der ihr bedeutete, dass sie von einem Job zum nächsten musste. Sie trug Lippenstift auf, warf ihrem Spiegelbild einen Kussmund zu und hastete davon. Ich starrte mich weiterhin an und warf meinem Spiegelbild schließlich auch einen Kussmund zu.
Ich sah zu, wie meine Mäuse groggy wieder zum Leben erwachten, sich von der Betäubung erholten, benommen von dem Schmerzmittel, das ich ihnen verabreicht hatte. Ich hatte einen Virus in ihren Nucleus accumbens injiziert und eine Linse in ihr Gehirn implantiert, sodass ich bei meinen Experimenten das Feuern der Neuronen beobachten konnte. Manchmal fragte ich mich, ob sie das zusätzliche Gewicht auf ihren Köpfen spürten, aber ich versuchte solche Gedanken zu vermeiden, sie nicht zu vermenschlichen, denn ich sorgte mich, dass es meine Arbeit erschweren würde. Ich räumte auf und ging in mein Büro, um zu schreiben. Ich sollte einen Fachaufsatz verfassen, vermutlich den letzten vor der Promotion. Für den schwierigsten Teil, das Zusammenstellen der Zahlen, brauchte ich normalerweise nur ein paar Wochen, aber ich hatte Däumchen gedreht, die Sache hinausgeschoben, meine Experimente ständig wiederholt, bis die Vorstellung, damit aufzuhören, zu schreiben, zu promovieren, unmöglich schien. Ich hatte eine Warnung an der Wand über meinem Schreibtisch angebracht, um mich anzutreiben. JEDEN TAG ZWANZIG MINUTEN SCHREIBEN SONST. Sonst was?, fragte ich mich. Jeder sah, dass es eine leere Drohung war. Nach zwanzig Minuten Gekritzel holte ich das Tagebuch von vor vielen Jahren heraus, das ich tief im Inneren meines Schreibtischs versteckte und las, wenn mich meine Arbeit frustrierte und ich mich elend und einsam und nutzlos und hoffnungslos fühlte. Oder wenn ich wünschte, ich hätte einen Job, bei dem ich mehr verdiente als die siebzehntausend Dollar meines Stipendiums, die in dieser teuren Universitätsstadt ein Vierteljahr reichen mussten.
Lieber Gott,
Buzz geht zum Abschlussball, und er trägt einen Anzug! Er ist marineblau, dazu eine rosa Krawatte und ein rosa Einstecktuch.DSMmusste den Anzug extra bestellen, weil Buzz so groß ist, dass sie im Laden nichts für ihn gefunden haben. Wir haben den ganzen Nachmittag Fotos von ihm gemacht und gelacht und uns umarmt, undDSMhat geweint und immer wieder gesagt: »Du siehst so schön aus.« Dann kam das Auto, das Buzz abgeholt hat, damit er das Mädchen abholen konnte, und er hat den Kopf durch das Schiebedach gesteckt und uns zugewinkt. Er sah normal aus. Bitte, lieber Gott, lass ihn immer so sein.
Mein Bruder starb drei Monate später an einer Überdosis Heroin.
7
Als ich die ganze Geschichte hören wollte, warum meine Eltern nach Amerika ausgewandert waren, wollte meine Mutter die Geschichte nicht mehr erzählen. Die Version, die ich bekam – dass meine Mutter Nana die ganze Welt geben wollte, dass der Chin-Chin-Mann widerwillig zustimmte –, erschien mir nie ausreichend. Wie viele Amerikaner wusste ich sehr wenig über den Rest der Welt. Jahrelang hatte ich meinen Mitschülern ausgefeilte Lügen erzählt, dass mein Großvater ein Krieger war, ein Löwenbändiger, ein High Chief.
»Ich bin eigentlich eine Prinzessin«, sagte ich zu Geoffrey, der mit mir in die Vorschule ging und dessen Nase immer lief. Geoffrey und ich saßen an einem Tisch ganz hinten im Klassenzimmer. Ich vermutete, dass die Lehrerin mich als Strafe dorthin gesetzt hatte, damit ich ständig die Rotzschnecke auf Geoffreys Oberlippengrübchen ansehen und noch deutlicher spüren würde, dass ich nicht hierher gehörte. Ich ärgerte mich darüber und tat mein Bestes, Geoffrey zu quälen.
»Nein, bist du nicht«, sagte Geoffrey. »Schwarze Menschen können keine Prinzessinnen sein.«
Ich ging nach Hause und fragte meine Mutter, ob das stimmte, und sie sagte, ich solle still sein und sie nicht länger mit Fragen nerven. Das sagte sie immer, wenn ich sie um eine Geschichte bat, und damals fragte ich sie nach nichts anderem als Geschichten. Ich wünschte mir, dass ihre Geschichten über ihr Leben mit meinem Vater in Ghana erfüllt wären von all den Königinnen und Königen und Flüchen, die erklären würden, warum mein Vater nicht da war, und grandioser und eleganter wären als die schlichte Geschichte, die ich kannte. Und wenn unsere Geschichte kein Märchen sein konnte, dann war ich willens, eine Geschichte zu akzeptieren, wie ich sie damals im Fernsehen sah, als die einzigen Bilder aus Afrika Menschen darstellten, die unter Kriegen und Hungersnöten litten. Aber in den Geschichten meiner Mutter gab es keinen Krieg, und wenn Hunger herrschte, dann eine andere Art Hunger, der einfache Hunger von jemandem, der eine Sache zu essen bekam, aber eine andere wollte. Ein schlichter Hunger, unmöglich zu befriedigen. Auch ich hatte Hunger, und die Geschichten, die mir meine Mutter erzählte, waren nie exotisch genug, nie verzweifelt genug, nie genug, um mir die Munition in die Hand zu geben, die ich brauchte, um gegen Geoffrey, seine Rotzschnecke, meine Vorschullehrerin und den Platz ganz hinten zu kämpfen.
Meine Mutter erzählte mir, dass der Chin-Chin-Mann, ein paar Monate nachdem sie nach Alabama gezogen waren, zu ihr und Nana nach Amerika kam. Er saß zum ersten Mal in einem Flugzeug. Er war mit einem Tro-Tro nach Accra gefahren, mit nur einem Koffer und einem Beutel mit dem Achomo meiner Großmutter. Die Passagiere im Bus drückten gegen ihn, seine Beine waren müde und schmerzten, weil er fast drei Stunden stehen musste, aber er war dankbar, dass er so groß war, weil über den Köpfen aller anderer die Luft zum Atmen frischer war.
Im Flughafen Kotoka wünschte ihm das Personal Glück, als sie sahen, wohin er flog. »Lass mich als Nächstes nachkommen, chale«, sagten sie. Im JFK wurde ihm bei der Einreise der Beutel mit Chin Chin abgenommen.
Zu dieser Zeit verdiente meine Mutter zehntausend Dollar im Jahr als Pflegerin und Haushaltshilfe für einen Mann namens MrThomas.
»Ich kann nicht glauben, dass mir meine idiotischen Kinder eine Niggerin aufgedrängt haben«, sagte er oft. MrThomas war in den Achtzigern und hatte Parkinson im frühen Stadium. Der Tremor betraf jedoch nicht sein unflätiges Mundwerk. Meine Mutter wischte ihm den Arsch ab, fütterte ihn, sah Jeopardy! mit ihm, grinste, da er bei fast jeder Antwort danebenlag. MrThomas’ idiotische Kinder hatten vor meiner Mutter bereits fünf andere Pfleger engagiert. Alle hatten gekündigt.
»SPRECHEN. SIE. ENGLISCH?«, brüllte MrThomas jedes Mal, wenn meine Mutter ihm das gesunde Essen brachte, für das seine Kinder zahlten, statt des gebratenen Specks, um den er gebeten hatte. Der häusliche Krankenpflegedienst war der einzige Arbeitgeber, der sie eingestellt hatte. Sie ließ Nana bei ihrer Cousine oder nahm ihn mit zur Arbeit, bis MrThomas anfing, ihn »den kleinen Affen« zu nennen. Danach ließ sie Nana meistens allein während ihrer zwölfstündigen Nachtschicht und hoffte, dass er bis zum Morgen durchschlafen würde.
Für den Chin-Chin-Mann war es schwieriger, Arbeit zu finden. Der häusliche Krankenpflegedienst hatte ihn zwar eingestellt, aber zu viele Leute erschraken, wenn sie ihn durch die Tür kommen sahen.
»Ich glaube, die Leute hatten Angst vor ihm«, sagte meine Mutter einmal, aber sie wollte mir nicht erklären, wie sie zu dieser Schlussfolgerung gelangt war. Sie gestand fast nie Rassismus ein. Sogar MrThomas, der meine Mutter nie anders genannt hatte als »diese Niggerin«, war für sie nur ein alter verwirrter Mann. Doch wenn sie mit meinem Vater unterwegs war, sah sie, wie sich Amerika beim Anblick großer schwarzer Männer veränderte. Sie sah, wie er zu schrumpfen versuchte, den langen stolzen Rücken krümmte, wenn er mit meiner Mutter durch den Walmart ging, wo er in vier Monaten dreimal des Diebstahls bezichtigt wurde. Jedes Mal nahmen sie ihn mit in einen kleinen Raum neben dem Ausgang des Ladens. Er musste sich an die Wand stellen, wo sie ihn abtasteten, ihre Hände fuhren ein Hosenbein hinauf und das andere hinunter. Heimwehkrank, gedemütigt, verließ er das Haus nicht mehr.
Zu diesem Zeitpunkt fand meine Mutter die First Assemblies of God Church in der Bridge Avenue. Seit ihrer Ankunft in Amerika war sie nicht mehr in die Kirche gegangen und hatte stattdessen jeden Sonntag gearbeitet, weil Sonntag der Tag in der Woche war, den die meisten Menschen in Alabama für zwei heilige Handlungen freihaben wollten – um in die Kirche zu gehen und Football zu schauen. Football bedeutete meiner Mutter nichts, aber sie vermisste die Kirche. Mein Vater erinnerte sie an alles, das sie Gott verdankte, an die Macht ihrer Gebete. Sie wollte ihn aus seiner Niedergeschlagenheit holen, und dafür, das wusste sie, musste sie sich freischwimmen.
Die First Assemblies of God Church war ein kleines Backsteingebäude, nicht größer als ein Haus mit drei Schlafzimmern. Davor stand eine große Informationstafel mit kitschigen Sprüchen, die die Leute anlocken sollten. Manchmal waren es Fragen. Hast du Ihn schon gefunden? Oder Gott gefunden? Oder Fühlst du dich verloren? Manchmal waren es Antworten. Jesus macht die Jahreszeiten! Ich weiß nicht, ob es die Sprüche waren, die meine Mutter anzogen, aber ich weiß, dass die Kirche ihr zweites Zuhause wurde, ihr ganz privater Ort der Gottesverehrung.
An dem Tag, als sie hineinging, drang Musik aus den Lautsprechern. Die Stimme des Sängers rief sie, und meine Mutter schritt auf den Altar zu. Meine Mutter gehorchte. Sie kniete sich vor den Herrn und betete und betete und betete. Als sie den Kopf hob, war ihr Gesicht tränenüberströmt, und sie glaubte, dass sie sich an das Leben in Amerika gewöhnen könnte.
8
Als Kind dachte ich immer, dass ich Tänzerin oder Lobpreisleiterin in einer Pfingstkirche, die Frau eines Predigers oder eine glamouröse Schauspielerin werden würde. In der High School hatte ich so gute Noten, dass die Welt diese Wahl auf eine einzige Möglichkeit zu reduzieren schien: Ärztin. Ein Einwandererklischee, nur dass mir die Eltern fehlten, die mich dazu drängten. Meiner Mutter war es gleichgültig, was ich werden wollte, und sie hätte mich zu nichts gezwungen. Ich vermute, dass sie heute stolzer auf mich wäre, wenn ich auf der Kanzel der First Assemblies of God stehen, gottergeben Nummer 162 aus dem Gesangbuch singen würde und die Gemeinde mit mir dahinstolperte. Alle in dieser Kirche hatten eine schreckliche Stimme. Als ich alt genug war, um in die »große Kirche« zu gehen, wie die Kinder im Kindergottesdienst es nannten, graute mir jeden Sonntagmorgen vor dem flötenden Sopran der Lobpreisleiterin. Er jagte mir auf eine vertraute Weise Angst ein. Wie damals, als ich fünf und Nana elf war und wir ein Vögelchen fanden, das aus dem Nest gefallen war. Nana nahm es in seine großen Hände, und wir liefen nach Hause. Das Haus war leer. Das Haus war immer leer, aber wir wussten, dass wir uns beeilen mussten, denn wenn unsere Mutter nach Hause kam und den Vogel sah, würde sie ihn auf der Stelle umbringen oder ihn irgendwo in die Wildnis werfen, wo er gestorben wäre. Sie würde uns auch genau erzählen, was sie damit gemacht hatte. Sie war keine Mutter, die log, damit sich ihre Kinder besser fühlten. Meine ganze Kindheit über schob ich abends Zähne unter das Kopfkissen, wo ich sie am Morgen wiederfand. Nana gab mir den Vogel und füllte eine Schale mit Milch. Als ich ihn in den Händen hielt, spürte ich seine Angst, das beständige Zittern des kleinen runden Körpers, und ich begann zu weinen. Nana steckte seinen Schnabel in die Milch und versuchte, ihn zum Trinken zu bewegen, aber er trank nicht, und das Zittern des Vogels ging auf mich über. So klang die Stimme der Vorsängerin für mich – der zitternde Körper eines Vogels in Not, ein Kind, das plötzlich Angst hatte. Ich entfernte diese Berufswahl sofort von meiner Liste.
Als Nächstes stand Frau eines Predigers darauf. Pastor Johns Frau tat nicht viel, soweit ich es beurteilen konnte, doch ich beschloss, für die Stelle zu üben, indem ich für die Haustiere meiner Freundinnen betete. Da war Katies Goldfisch, den wir in der Toilette bestatteten. Ich sagte mein Gebet, und wir sahen zu, wie ein orangefarbener Wirbel weggespült wurde und verschwand. Da war Ashleys Golden Retriever, Buddy, ein nervöser energiegeladener Hund. Buddy warf gern die Mülltonnen um, die die Nachbarn jeden Dienstagabend vors Haus stellten. Am Mittwoch lagen auf unserer Straße Apfelgehäuse, Bierflaschen, Müslischachteln herum. Die Müllmänner beschwerten sich, doch Buddy blieb unbeirrt seiner Natur treu. Einmal fand MrsCaldwell ein Höschen neben ihrer Tonne, das nicht ihr gehörte und den Verdacht bestätigte, den sie bereits hegte. In der nächsten Woche zog sie aus. Am Dienstagabend nach ihrem Auszug setzte sich MrCaldwell neben seiner Tonne auf einen Gartenstuhl, ein Gewehr auf den Knien.
»Wenn der Hund noch mal in die Nähe von meiner Tonne kommt, brauchst du ’ne Schaufel.«
Ashley, die Angst um Buddy hatte, bat mich, für ihn zu beten, da ich mir im Haustierbegräbnisgeschäft bereits einen Namen gemacht hatte.
Sie brachte den Hund vorbei, als meine Mutter in der Arbeit und Nana beim Basketballtraining waren. Ich hatte sie gebeten zu kommen, wenn niemand zu Hause war, denn ich wusste, was wir taten, befand sich in einem Graubereich, was Sakramente anbelangte. Ich räumte Platz frei im Wohnzimmer, das ich zum Allerheiligsten erklärte. Buddy kam uns auf die Schliche, kaum hatten wir angefangen »Heilig, Heilig, Heilig« zu singen, und wollte nicht stillhalten. Ashley hielt ihn fest, und ich legte ihm die Hand auf den Kopf und bat Gott, einen Hund des Friedens statt der Zerstörung aus ihm zu machen. Jedes Mal, wenn ich Buddy lebend auf der Straße sah, glaubte ich, dass das Gebet erfolgreich gewesen war, dennoch war ich nicht überzeugt, dass ich für ein geistliches Amt geschaffen war.
Es war meine Biologielehrerin in der High School, die mich zu den Naturwissenschaften drängte. Ich war fünfzehn, genauso alt wie Nana, als wir entdeckten, dass er süchtig war. Meine Mutter putzte Nanas Zimmer, als sie es merkte. Sie hatte eine Leiter aus der Garage geholt, damit sie die Deckenlampe auswischen konnte, und als sie mit der Hand in die Schale fasste, fand sie ein paar einzelne Pillen. OxyContin. So wie sie dalagen, sahen sie aus wie tote Insekten, die das Licht angezogen hatte. Jahre später, nachdem alle Trauergäste endlich gegangen waren und Jollof, Waakye und Erdnussbuttersuppe dagelassen hatten, sagte meine Mutter zu mir, dass sie sich schuldig fühlte, weil sie an dem Tag, als sie die Lampe putzte, nicht mehr getan hatte. Ich hätte etwas Freundliches erwidern sollen. Ich hätte sie trösten, zu ihr sagen sollen, dass es nicht ihre Schuld war, aber irgendwo, knapp unter der Oberfläche, gab ich ihr die Schuld. Und auch mir. Schuld und Zweifel und Angst hatten sich in meinem jungen Körper bereits eingerichtet wie Gespenster, die in einem Haus spukten. Ich zitterte, und in der Sekunde, die das Zittern brauchte, um durch meinen Körper zu fahren, hörte ich auf, an Gott zu glauben. So schnell passierte es, eine Abrechnung so lang wie ein Zittern. In der einen Minute gab es Gott, der die ganze Welt in Händen hielt, in der nächsten stürzte die Welt unaufhaltsam in einen sich ständig verändernden Abgrund.
MrsPasternack, meine Biologielehrerin, war Christin. Alle Menschen in Alabama, die ich kannte, waren Christen, doch sie sagte Dinge wie: »Ich glaube, wir bestehen aus Sternenstaub, und Gott hat die Sterne geschaffen.« Damals klang es lächerlich, heute seltsam tröstlich. Damals fühlte sich mein ganzer Körper ständig wund an, als würde die offene Wunde meines Fleisches pochen, wenn man mich berührte. Jetzt habe ich überall Schorf gebildet, bin abgehärtet. MrsPasternack sagte in jenem Jahr noch etwas, das ich nie vergessen habe. Sie sagte: »Die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Wir kennen nicht einmal die Fragen, die wir stellen müssten, um es herauszufinden, aber wenn wir eine winzige Kleinigkeit lernen, geht in einem dunklen Flur ein mattes Licht an, und plötzlich taucht eine neue Frage auf. Wir brauchen Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, um diese Frage zu beantworten, und dann geht ein weiteres mattes Licht an. Das ist Wissenschaft, aber das ist auch alles andere, nicht wahr? Macht Versuche. Experimentiert. Stellt zahllose Fragen.«
Das erste Experiment, an das ich mich erinnere, war das Experiment mit einem rohen Ei im Physikunterricht der Mittelschule. Ich erinnere mich unter anderem daran, weil ich meine Mutter bitten musste, Maissirup auf die Einkaufsliste zu setzen, und sie deswegen die ganze Woche über ununterbrochen murrte. »Warum kauft eure Lehrerin keinen Maissirup, wenn sie diesen Unsinn mit euch machen will?«, sagte sie. Ich erklärte meiner Lehrerin, dass meine Mutter wahrscheinlich keinen Maissirup kaufen würde, und mit einem Augenzwinkern schenkte sie mir eine Flasche, die sie von ganz hinten aus ihrem Vorratsschrank nahm. Ich dachte, dass sich meine Mutter freuen würde. Schließlich hatte sie genau das gefordert, doch stattdessen war es ihr höchst unangenehm. »Sie wird denken, dass wir uns keinen Maissirup leisten können«, sagte sie. Es waren die schwierigsten Jahre, der Anfang der Nur-wir-beide-Jahre. Wir konnten uns keinen Maissirup leisten. Meine Lehrerin ging in unsere Kirche; sie wusste von Nana, von meinem Vater. Sie wusste, dass meine Mutter jeden Tag außer Sonntag Zwölf-Stunden-Schichten arbeitete.





























