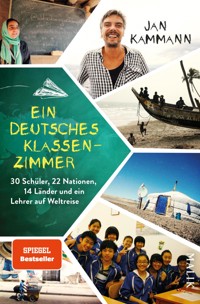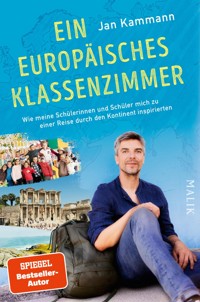
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gelebtes Europa vor Ort entdecken Auf der Suche nach Antworten auf die Fragen seiner Schülerinnen und Schüler geht Jan Kammann, Lehrer an einer Europaschule, auf Europareise. Sie führt ihn nach Griechenland, Nordmazedonien, Ungarn, Serbien, Tschechien, Nordirland, in die Türkei und die Ukraine. Das Klassenzimmer als Brennglas eines Kontinents Unterwegs lernt er, wie das Gefüge »Europa« funktionieren kann, erlebt Gastfreundschaft, hält auch harte Realität aus und stößt mitunter an seine Grenzen. Neben vielen Fragen hat er von den Jugendlichen gestaltete, wunderbare kleine Reiseführer mit im Gepäck. »Ein Erzähler, dem es gelingt, Augen zu öffnen.« SZ Nach dem Erfolg seines Bestsellers »Ein deutsches Klassenzimmer« lässt sich Jan Kammann auch in seinem zweiten Buch neugierig und unbefangen auf besondere Begegnungen, Kulturen, Sprachen und kulinarische Hochgenüsse ein und entdeckt Europas unterschätzte Seiten. Der empathische Bericht eines unkonventionellen und warmherzigen Lehrers gibt den Jugendlichen eine Stimme und zeigt, worin Europas Zukunft liegen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ein europäisches Klassenzimmer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 55 farbigen Abbildungen und einer farbigen Karte
Von Jan Kammann liegt im Malik Verlag vor:
Ein deutsches Klassenzimmer
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Antje Steinhäuser
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Andreas Hornoff; Jan Kammann und hudiemm / Getty Images
Redaktion: Antje Steinhäuser
Bildteilfotos: Jan Kammann
Karte: Birgit Kohlhaas, München
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
((Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte))
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Karte von Europa
Hamburg
Geografie in der 7b: Was ist Europa?
Türkei
Kaman
Im Laubengang, erster Çay
Im Laubengang, zweiter Çay
Das Treffen mit Bilal in Hamburg, Teil 1
Im Laubengang, dritter Çay
Das Treffen mit Bilal in Hamburg, Teil 2
Im Laubengang, vierter Çay
Ankara
Ihlara-Tal
Westwärts
Eğirdir
Zweifel
Ephesos
Grenzen
Griechenland
Die Geschichte von Zahra
Athen, Viktoria-Platz
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Deutschland 2024
Thessaloniki
Grenzen: Thessaloniki – Skopje
Nordmazedonien
Skopje: Ljupčo erzählt
Hip-Hop-Nostalgie
Ljupčo erzählt weiter
Grenzen: Skopje – Tetovo
Tetovo: Salo und Flora
Tetovo: Hochzeitssaison
Mit Salo in den Šar-Bergen
Wieder in Skopje
Serbien
Von Skopje nach Niš
Niš
Nišville: Fortbildung in Sachen Popkultur
Belgrad
Belgrad City-Tour
Belgrad by bike
Serbischer Abgang
Belgrad – Budapest
Ungarn
Budapest
Rückfahrt nach Hamburg
Tschechien
Klassenfahrt!
Ukraine
Rückblick: Zeitenwende November 2022
Ein Roadtrip: Groß Ippener – Kyiv
Taraschtscha
Ein Schultag in Kivshovata
Rückblick: Russland 2017
Katja und Sergej
Valentina
Yeva
Nowosibirsk
Überall in Russland
Das ist nicht normal
Svit – Normal
Svetlana
Ein unzureichend kurzer Exkurs zur jüngeren Geschichte der Ukraine, weil es ohne nicht geht
Reifenpanne
Raus hier
Outro Ukraine
Nordirland
Derry-Londonderry
Ankommen
Bogside: Mickey I
Hamburg: Hannah I
Bogside: Mickey II
Draußen: Hannah
Bogside: Mickey III
Hamburg: Hannah II
Bogside: Mickey IV
Dirty Old Town: Oliver
Bogside: Mickey V
Hamburg: Oliver
Bogside: Mickey VI
Die Welt zu Füßen: Oliver
County Donegal
Danke
Bildteil
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
The kids are alright
(The Who)
Karte von Europa
Hamburg
Geografie in der 7b: Was ist Europa?
In der siebten Klasse geht es um Europa. Sowohl um seine Geografie als auch um die Europäische Union als Staatenverbund. Zum Reinkommen frage ich die Schülerinnen und Schüler, ob sie sich europäisch fühlen.
»Nein, auf keinen Fall«, lautet die Antwort unisono.
»Wieso nicht? Wir sind doch eine Europaschule. Steht vorne am Tor auf einem Schild.«
Das scheint den Schülerinnen und Schülern neu zu sein. Dazu haben sie offenbar keinen Bezug – haben womöglich noch nie drüber nachgedacht, und das Stichwort löst offensichtlich kein großes Gefühl in ihnen aus. Sie verstehen nicht so richtig, weshalb ich überhaupt so eine Frage stelle.
»Wie fühlt ihr euch denn dann? Deutsch vielleicht?«
»Neee, deutsch nicht«, rufen einige sofort und energisch, andere sind eher zögerlich und wissen nicht so genau.
»Hamburgisch vielleicht«, versuche ich ihnen eine Brücke zu bauen.
»Na ja, hamburgisch … vielleicht«, kommt es nach einer Bedenkpause von einigen zurück.
»Und wenn ich euch jetzt frage, welchem Land ihr euch zugehörig fühlt, welches wäre das dann? Ihr könnt auch mehrere Länder schreiben.«
Ich starte eine App, mit der man Schülerantworten auf das Smartboard projizieren kann. Alle tippen ihre Antworten in Handys und Tablets und drücken auf »Senden«. An der Tafel steht: Ich fühle mich
bulgarisch, arabisch, indisch, albanisch, bosnisch, deutsch, serbisch, moldawisch, portugiesisch, ukrainisch, russisch, türkisch, persisch.
Ich will niemanden auf eine Identität festnageln, frage aber doch: »Weshalb fühlt sich niemand europäisch?«
»Fühlen Sie sich denn europäisch?«, wollen die Kids von mir wissen.
»Oha«, erschrecke ich. »Gute Frage«, gebe ich zu und merke, dass sie überhaupt nicht leicht zu beantworten ist, wenn sie einem so direkt gestellt wird.
»Hm, tja, na ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin Europäer und fühle mich auch so«, mühe ich mich holpriger ab als geplant. Ich merke selbst: Die Frage nach der Identität ist nicht fair, in einer siebten Klasse regelrecht unlauter. Verkneifen konnte ich sie mir nicht, obwohl ich weiß, dass auch erwachsene Menschen mitunter um eine Antwort ringen. Dabei wäre es doch schön, aus dem Bauch heraus im Brustton der Überzeugung sagen zu können »Ja, ich bin Europäer!«
Das ist hier nicht der Fall, womöglich auch deshalb, weil Geschichte und Vorzüge der EU erst in nächsten Schuljahren thematisiert werden. Fürs Erste können wir nur festhalten, dass sich, jedenfalls im Moment noch, niemand so wirklich europäisch fühlt, obwohl wir Europaschule sind – und das sind wir, Schild hin oder her, durch und durch.
Während meiner mittlerweile zwölf Jahre an dieser Schule, habe ich in meinen Klassen junge Europäerinnen und Europäer aus fast allen Ländern des Kontinents getroffen. Nicht erinnern kann ich mich an Schülerinnen oder Schüler aus
Norwegen, Lettland, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Zypern, Malta und dem Vatikan.
Das sind zehn aus 47 europäischen Staaten, die Wikipedia auflistet. In diesem Jahr bin ich Tutor in der Oberstufe, Klassenlehrer in einer Internationalen Vorbereitungsklasse und unterrichte eine Achte in Englisch und eben diese Siebte in Geografie, und allein hier lernen Kids aus oder mit Wurzeln in
der Türkei, Nordmazedonien, Serbien, Kroatien, Polen, der Ukraine, Russland, Ungarn, Bosnien, Albanien, Kosovo, Portugal, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Schweden und Deutschland.
Mehr Europa geht nicht. Viele Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland geboren, andere fanden den Weg über die Vorbereitungsklassen, in denen sie zunächst Deutsch lernten, in die regulären Klassen.
Auf einer Weltkarte vergrößere ich Europa für die 7b, so wie Gallien in den Asterix-Comics unter einer Lupe vergrößert wird, markiere die Länder, die in dieser Klasse vertreten sind, um allen klarzumachen, wie europäisch wir sind.
Diejenigen, die von außerhalb Europas kommen, sind natürlich genauso wichtig. In diesem Fall aus Syrien, Indien und Ghana. In meinen anderen Klassen befinden sich Schülerinnen und Schüler aus Pakistan, Brasilien, dem Libanon, Guinea-Bissau und Afghanistan. Alles Länder, die historisch mit Europa zu tun hatten und es bis heute haben. Darauf gibt es eindeutige Hinweise: Gloria[1] aus Brasilien spricht Portugiesisch genauso wie Mamadu aus Guinea-Bissau. Natalie aus Ghana ist aufgewachsen mit Englisch und Twi, Ali aus dem Libanon kann neben Arabisch auch ein bisschen Französisch und Nadi und Sunil aus Indien sprechen Malayalam und Marathi und können sich außerdem sehr gut mit Natalie auf Englisch verständigen.
Warum das so ist, ist in der siebten Klasse noch kein Thema. Hier geht es zunächst mal um harte naturgeografische Fakten. Dabei hilft eine Karte mit dem Titel Europa – physische Geografie. Die Schülerinnen und Schüler legen Listen an mit Ländern und Hauptstädten. Auch die Türkei ist dabei und Ankara, die Hauptstadt. Aber Moment mal: Gehört die Türkei überhaupt zu Europa? Das wissen die allermeisten. Ein kleiner Teil im Nordwesten sowie die Hälfte von Istanbul gehört zu Europa, der Rest des Landes gehört zu Asien. Aber wieso ist das eigentlich so?
Kurze und stark vereinfachte Antwort: Der griechische Urgeograf Herodot hat die Grenze irgendwann im fünften vorchristlichen Jahrhundert in seinen Historien mehr oder weniger willkürlich durch den Bosporus gezogen. Vor der Klasse räume ich ein, dass in meinen Ausführungen ein bisschen Halbwissen mitschwingen könnte. Historiker bin ich nicht, aber ich weiß, dass die Fachwelt sich nicht einig ist. Europa war scheinbar noch nie leicht zu fassen. Ich weiß, dass Herodot aus der griechischen Stadt Halikarnassos, dem heutigen Bodrum, an der türkischen Ägäisküste stammte, dass er also nach eigener Definition Asiate war und kein Grieche, also Europäer, wobei er sich ganz sicher als Letzteres begriff, denn von jenseits der Küste aus dem Osten kamen ja die Barbaren, allen voran die Perser.
Provozierend sage ich, die Europakarte hinter mir: »Alle diejenigen, die von weiter östlich der türkischen Westküste kommen, sind also Barbaren und keine Europäer.«
Laute Buhrufe, Tumult. Aber was ist überhaupt ein Barbar? Ein Schüler fragt das Internet und findet bei Google eine griffige Definition: roher, empfindungsloser Mensch ohne Kultur. Dies lässt sich offenbar auch anwenden auf Menschen, die von diesseits des Bosporus kommen, denn schnell wird jede Nation als barbarisch verunglimpft, und die Kids haben ihren Spaß daran.
»Bulgaren sind auf jeden Fall Barbaren, Serben auch und Albaner sowieso.«
»Schaut mal. Da sitzt Sveta. Sie kommt aus Bulgarien. Sieht sie etwa aus wie eine Barbarin?«
»Nee, keine Barbarin.«
»Und dort Mia. Aus Serbien. Barbarin?«
»Nee, auch nicht.«
»Und dort Aylin und Helin aus der Türkei. Barbarinnen? Vielleicht sind alle diejenigen Barbaren, die zu faul sind, sich mit anderen Menschen, Sprachen und Kulturen zu beschäftigen, die außerhalb der bekannten Grenzen leben«, hole ich die große Keule raus.
Und ja, tatsächlich, darauf können sich Siebtklässler einigen. Damit, finde ich, habe ich das heutige Lernziel auf jeden Fall erreicht.
Nach ein paar weiteren heiteren europäischen Stunden, in denen ich regelmäßig abschweife entlang interaktiver Karten, Anekdoten und Spekulationen über das Ende und den Anfang Europas, meldet sich Helin zu Wort.
»Herr Kammann! Sie müssen unbedingt mal nach Kaman.«
Kaman spricht man wie Kammann, die Klasse wiehert vor Lachen.
»Wo soll das denn sein? In Kammannistan?«
»Nein«, sagt Helin. »Das ist eine kleine Stadt in der Mitte der Türkei. Da kommt mein Opa her.«
Spannend. Sofort schauen wir nach, finden eine kleine Stadt mit ein bisschen über 20 000 Einwohnern und einer riesigen Walnussskulptur, die in ihrem Zentrum steht und damit fast genau in der Mitte der Türkei. Von dort, wo diese Walnuss steht, ist die Ägäis, also Europa, noch recht weit entfernt, aber ich bin mir sicher, dass man aus dem Osten (nichts anderes heißt Anatolien auf Altgriechisch) einen guten Blick darauf hat. Da kann man sicher was lernen über Europa und darüber, wie wir alle zusammenhängen, und ich beschließe noch während der Stunde: Da muss ich hin.
Türkei
Kaman
Kaman liegt in der Provinz Kırşehir in Zentralanatolien. Für die knapp 150 Kilometer von Ankara braucht der Bus gute zwei Stunden auf der fast leeren Straße D 260. Aus dem Fenster wirkt es, als hätten Giganten diesen Streifen aus Asphalt in die grandiose, fast menschenleere Landschaft gelegt. Wir fahren durch die Hügellandschaften des Hochplateaus und ihre Täler, vorbei an endlosen Feldern, nur ganz selten durchbricht ein verlassen wirkender Rastplatz die Weite. Hier und da sitzt ein Tankwart gelangweilt vor seinem Kabuff und wartet auf Kundschaft.
Anfang Mai ist die Vegetation spärlich, nur die Felder beginnen in hellem Grün zu schimmern, der Blick zum Horizont ist unverstellt, der Himmel strahlend blau, verziert mit ein paar Schäfchenwolken. Eine Landschaft wie ein Kunstwerk. Der Frühling kommt langsam in Schwung, abzulesen an den Walnussbäumen mit ersten, vorsichtigen Knospen, die kurz vor Kaman vor dem Fenster auftauchen. Im Bus wird mir noch einmal erklärt, dass diese Region in der ganzen Türkei berühmt ist für ihr erstklassiges Schalenobst.
Auf jeden Fall möchte ich ein Selfie mit Ortsschild, und deswegen bitte ich den Busfahrer, mich schon weit vor dem Ortseingang rauszulassen. Ich will es auf keinen Fall verpassen, immerhin muss ich meinen Schülern zeigen, dass ich es bis nach Kammannistan geschafft habe. Außerdem habe ich Lust, ein bisschen entlang dieser kaum genutzten Straße durch die grandiose Landschaft zu laufen. Die Route des Busses habe ich auf der Fahrt mit meiner App verfolgt und versucht, einen guten Zeitpunkt abzupassen, um auszusteigen. Als ich den Busfahrer mit meinem Gepäck in der Hand anspreche, schaut er mich mit einem Was-will-der-Mann-spinnt-er?-Blick irritiert an, bringt den komfortablen Reisebus aber trotzdem zum Stehen. Er öffnet die Tür, ich steige aus und der Bus fährt weiter. Deutlich zu früh, wie ich auf dem Asphalt der Landstraße schnell feststelle. Bis zum ersehnten Ortsschild sind es noch einige Kilometer und bis zur Walnussskulptur noch mal drei mehr. Trotzdem: Allein unter freiem Himmel, die Lungen voll anatolischer Landluft und ein Abenteuer in Aussicht. Ein herrliches Gefühl.
Nach dem Einchecken im Kaman Apart Otel laufe ich etwas unsicher in der Stadt umher und frage mich, nach was genau ich eigentlich suche, bis ich am zentralen Platz der Stadt, vis-à-vis der Walnussskulptur, in ein Spalier alter Männer gerate. Ich komme gar nicht mehr dazu, mich ausreichend über die drei überdimensionierten Walnüsse zu wundern, die ich noch vor Kurzem mit den Schülerinnen und Schülern der 7b im Unterricht bestaunt hatte.
Im Laubengang, erster Çay
Die Männer winken mir schon von Weitem zu, scheinbar bin ich leicht als Tourist zu erkennen und eine willkommene Abwechslung. Sie sitzen in einer Art Laubengang zwischen einer Moschee und dem Marktplatz mit einer großen Statue des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Hoch zu Ross überblickt er das Stadtzentrum Kamans und die drei riesigen Walnüsse. Sie rufen »Hey, come over!« und gestikulieren wild. Ich gehorche und stehe plötzlich inmitten sympathisch dreinblickender Herren, die alle auf einmal ihre Fremdsprachenkenntnisse an mir ausprobieren wollen. Auf Französisch, Englisch und Deutsch werde ich gefragt, woher ich komme.
»Aus Deutschland«, sage ich und werde übermäßig herzlich willkommen geheißen.
Viele der Herren sprechen sehr gutes Deutsch und freuen sich sichtlich, dass sie es mal wieder ausprobieren können.
»Ich habe zwanzig Jahre lang in Berlin gearbeitet«, sagt einer.
»Und ich dreißig in Stuttgart.«
»Ich war in Köln.«
»Ich in Dortmund.«
Ein anderer war zum Arbeiten in Frankreich und ein weiterer in England.
Der redefreudigste von ihnen, Mehmet, besteht darauf, mir einen Tee zu holen. Er hat ein freundliches Gesicht mit neugierigen Augen, das umrahmt wird von einem weißen Rauschebart. Dazu ein einnehmendes Lachen und eine Schirmmütze auf dem Kopf. Er läuft zu einem Café am Ende des Ganges und kommt zurück mit einem dieser typisch bauchigen Gläser, Würfelzucker und einem Löffel zum Rühren.
»Çay. Für dich«, sagt er und fordert mich auf, mich zu setzen.
Und hier sitze ich – inmitten von achtzehn Best Agern (ich habe nachgezählt), die mich erwartungsfroh ansehen. Sie wollen wissen, was um Gottes willen ich in Kaman verloren habe. Es passiert selten bis nie, dass sich ein einsamer Tourist in dieser Stadt verliert. Sie sei klein und außer Landwirtschaft sei hier nicht viel los.
»Doch«, sage ich schmeichelnd. »Sie hat euch zu bieten. Und die Walnüsse da gegenüber. Hier zu sitzen ist ziemlich schön.«
Und das ist es wirklich. Die Herren strahlen regelrecht, wirken zufrieden und gelassen, sind aufgeschlossen, respektvoll und ruhen scheinbar in sich selbst. Der Tee ist süß und das Wetter ist gut. Wunderbar unaufgeregt ist es hier. Ein kleiner Traktor tuckert vorbei, der Fahrer grüßt freundlich, alle grüßen zurück und machen Scherze. Nur auf der Straßenkreuzung mit der Walnussskulptur wird es ab und an unruhig. Kurze Hupkonzerte erregen zuweilen die Aufmerksamkeit der Herren. Aber immer nur kurz.
Mit meiner Antwort will Mehmet sich nicht zufriedengeben.
»Was machst du denn jetzt hier?«
Ich merke, wie absurd das, was jetzt kommt, in seinen Ohren klingen muss.
»Okay, ich versuch’s mal. Ich bin Lehrer in Hamburg.«
»Hamburg! Da war ich auch mal für ein paar Jahre«, fällt mir jemand von der gegenüberliegenden Bank ins Wort. »In Billstedt!«
»Ah«, antworte ich. »Kenne ich!«
Und so ein bisschen hat Billstedt damit zu tun, weshalb ich heute hier bin.
»Ich bin also Lehrer in Hamburg und ich habe viele Schülerinnen und Schüler aus der Türkei. Einige von ihnen wohnen sogar in Billstedt, und ich möchte das Land kennenlernen, von dem die Kids immer so schwärmen.«
Sie schwärmen wirklich. Viele von ihnen sind nach den Sommerferien immer ganz beseelt von der Türkei und ihren Besuchen bei der Verwandtschaft.
»Aber die Türkei ist groß, und es gibt schönere Ecken. Fahr nach Istanbul, Antalya oder Kappadokien. Da ist mehr los«, entgegnen sie.
Die Herren können nicht fassen, dass ich ausgerechnet in ihrem Laubengang gelandet bin.
»Wartet ab. Es geht weiter: Eine meiner Schülerinnen, Helin, hat mir von ihrer Familie erzählt. Ihr Opa stammt aus Kaman. Sie meinte, ich müsse dringend mal herfahren. Warum? Weil ich mit Nachnamen Kammann heiße. Ich heiße wie eure Stadt. Der Name wird anders geschrieben, aber gleich ausgesprochen. So ganz ernst gemeint hat sie das natürlich nicht. Ich hab’s trotzdem gemacht.«
Diese Information braucht ein bisschen, um anzukommen. Das finde ich nicht verwunderlich, auch in meinen Ohren klingt das auf einmal ziemlich schräg.
»Also, du heißt Kammann und bist deshalb nach Kaman gekommen?«
»Ja, kann man so sagen.«
Mehmet erklärt diesen Umstand allen Umsitzenden, die kein Deutsch sprechen. Erstauntes Gemurmel, die Alten schauen mich an, als wäre ich gerade mit einem Raumschiff vor der Walnussskulptur gelandet.
»Herzlich willkommen in Kaman«, ruft einer freudig.
Jemand steht auf und holt mehr Çay.
»Mein Name ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb ich hierhergekommen bin«, erkläre ich weiter. »Ich möchte die Türkei besser kennenlernen, und vor allem will ich wissen, was die Türkei mit Deutschland und Europa zu tun hat. Warum nicht in Kaman anfangen? Ist doch spannend, ich war noch nie hier, und zu Hause habe ich von netten Menschen gehört, die hier leben. Und siehe da? Mit wem sitze ich hier? Mit netten Menschen. Für mich hat sich die Reise jetzt schon gelohnt.«
So richtig zufrieden ist bisher niemand mit meiner Antwort. Noch nicht mal ich selbst, irgendwie kommt mir das sehr konstruiert vor. Die alten Herren finden das alles eher kurios, und das ist es ja auch.
Der Muezzin der hinter uns liegenden Moschee unterbricht uns. Alle halten inne, es rührt sich aber niemand. Für eine Unterhaltung ist es zu laut, und ich nutze die Gelegenheit, um kurz darüber nachzudenken, was ich hier wirklich mache. Als der Gebetsrufer fertig ist, erzähle ich von Helin aus der 7b. Ich habe ihre Geschichte dabei. Sie hat sie mir aufgeschrieben, und sie geht so:
Die Geschichte, wie mein Opa von Kaman nach Hamburg kam
Am 23. März 1963 ist mein Opa mit dem Zug nach Deutschland gekommen. Es war gar nicht so einfach, denn man musste sich registrieren, und dann wurde man gemustert. Die Aufnahme war nur möglich, wenn man gesund und leistungsfähig war. Sogar die Reise musste man selbst bezahlen. Meinem Opa fehlte das Geld, jedoch hatte meine Oma noch Brautgold von ihrer Hochzeit, das sie komplett verkaufen musste. Mein Opa versprach ihr, alles zurückzugeben, was er auch tat. Sie fuhren mit dem Bus nach Istanbul, und von dort aus sollte mein Großvater mit dem Zug nach Deutschland fahren. Mein Uropa hat ihn begleitet, und das war auch für ihn etwas Besonderes, da sie beide das erste Mal das Meer gesehen haben. Anschließend beteten sie in der großen Sultan-Ahmed-Moschee, die man auch Blaue Moschee nennt.
Der Abschied war der zweite zwischen ihnen beiden, weil man damals zwei Jahre zum Militärdienst eingezogen wurde. Das war auch bei meinem Opa so, und das hat ihm sehr geholfen, in der Ferne zu überleben und zu arbeiten.
Kaum angekommen wurde er im Männerheim untergebracht. Die Arbeit war zwar hart, wie er sagt, aber man bekam wenigstens die Hälfte von einem einheimischen Bauarbeiter. Schöne Lohntüte in bar! Dann gab’s Essen aus der Heimat und Abwechslung mit fröhlichen Kindergeburtstagen.
Seine Entscheidung, wieder zurückzukehren nach Kaman, stand trotzdem fest.
Und anfangs war alles wieder gut in der Heimat, bis mein Papa sehr krank wurde. Die Ärzte sagten, bring ihn nach Deutschland, wir können ihm nicht helfen. Er könnte sterben. Da er schon zwei Söhne verloren hatte, kamen alle wieder nach Hamburg. Fünf Kinder mit Opa und Oma in einer Zweizimmerwohnung. Langweilig wurde es da nicht!
Mittlerweile ist Opa seit sechzig Jahren in Deutschland, hat sechs Kinder großgezogen mit achtzehn Enkelkindern. Meine Oma hat er überlebt. Er hat immer noch Haare auf dem Kopf und noch immer ein Lächeln im Gesicht.
Danke schön, Almanya.
(Helin, 7b im März 2023, genau sechzig Jahre nach der Ankunft ihres Opas.)
Diese Geschichte finde ich rührend, geradezu unglaublich, wie sie die Biografien von so vielen Menschen bestimmt hat, und von ihr berichte ich den Herren von Kaman.
Im Laubengang, zweiter Çay
»Vielleicht wollte ich mal sehen, wie es ist, irgendwohin aufzubrechen, wo ich komplett fremd bin.«
Das versuche ich zu erklären und die alten Herren verstehen, nicken anerkennend, und jemand schenkt Tee nach. Viele werden ganz nachdenklich, und ich bekomme zum ersten Mal das Gefühl, dass meine Reise einen Zweck erfüllt. Ein bisschen Wehmut wabert durch den Laubengang.
»Ach, wir sind alt geworden«, bedauert der Mann neben Mehmet.
»Ja, die Jahre sind schnell vergangen«, bestätigt ein anderer.
Das Erschrecken über das eigene Alter währt aber nur kurz, dann kehrt die Heiterkeit zurück, und die bauchigen Gläser werden noch mal aufgefüllt. Einer meint sogar, Helins Familie zu kennen. So ganz sicher ist er sich aber nicht. Die Geschichten ähneln sich, nur dass diejenigen, die hier sitzen, sich für den Weg zurück nach Kaman entschieden haben.
Helins Opa kam früh nach Deutschland. Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei wurde 1961 geschlossen, zwei Jahre später, mit 23 (geboren wurde er am 9. Februar 1940), war er schon da. In den Dörfern und Städten der Zentraltürkei wurde die neue Möglichkeit beworben – sie bot einen Ausweg aus einer wirtschaftlich schwierigen Lage und verhieß ein gutes Auskommen in der Ferne. Finanziert hat er die Reise mit dem Burma Bilezik, einem gewundenen Armreif aus Gold, der eine Mitgift war, aber auch eine Absicherung für schlechte Zeiten.
Meine Gesprächspartner im Laubengang traten ihre Reise ebenfalls in den 1960er- und frühen 70er-Jahren an. Mehmet ist 79, sieht aber deutlich frischer aus. An das aus heutiger Sicht zweifelhafte Prozedere für die Einreise nach Almanya erinnern sich einige der alten Herren. An die vielen Dokumente, die man bereits in Istanbul prüfen lassen musste, die quälend lange Zugfahrt über Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn und Österreich mit zu wenigen Sitzplätzen bis nach Deutschland. Und dann die Musterung: Die Ankommenden wurden auf alles Mögliche getestet. Arbeitstauglichkeit, Fitness, Krankheiten. Mich schaudert bei diesen Geschichten – Helins Opa vergleicht das mit dem Militär. Auch die Unterbringung in einem Männerheim ist wohl nicht unbedingt das, was er sich vorgestellt hatte. Hier teilte er sich ein Zimmer mit anderen türkischen Arbeitern. In Stockbetten lagen sie dort wie Ölsardinen. Das war eng, bedrückend, klaustrophobisch.
Warum hat sich eigentlich der Begriff Gastarbeiter durchgesetzt? Schön ist er nicht, beschönigend allemal, denn er enthält das Wörtchen Gast. Und einem Gast darf doch, auch wenn er oder sie zum Arbeiten gekommen ist, nicht die Gastfreundschaft vorenthalten werden. Hier in Kaman ist genau diese sprichwörtlich: Freundliche, interessierte Gesichter, aus denen Herzenswärme spricht, schauen mich an, und frischer Çay wird nachgefüllt, sobald die bernsteinfarbene Flüssigkeit in meinem Glas zu versiegen droht. Tee gab es bei Ankunft an den deutschen Bestimmungsorten nicht, und auch sonst klingen die Beschreibungen nicht besonders wohlig.
Ich finde einen Auszug mit Regeln, die in einem Wohnheim in München galten.
(…) 3. Es ist streng verboten, die Möbel zu verrücken (…) 8. Es ist nicht erlaubt, angezogen im Bett zu liegen (…) 10. Es ist nicht erlaubt, Fotografien oder Zeitungsausschnitte auf den Mauern oder Möbeln der Zimmer anzuheften (…) 16. Bevor Sie das Licht im Zimmer anmachen, müssen Sie die Vorhänge zuziehen (…) 20. Den Besuch von Frauen oder anderen Fremden können wir in den Gemeinschaftsunterkünften nicht erlauben.[2]
Um das ins Licht des Zeitgeists zu rücken: Es wehte Anfang der 1970er-Jahre offenbar ein recht autoritärer und nicht minder prüder Wind durch das Land, der nicht nur den Bewohnern von Wohnheimen ins Gesicht blies. Bis 1973 galt der sogenannte Kuppelparagraf, der es unverheirateten Paaren, egal welcher Herkunft, untersagte, gemeinsam in ein Hotelzimmer einzuchecken.
Rıfat, so heißt Helins Opa, und die Herren von Kaman scheinen im Alter recht milde auf diese Zeit zurückzublicken.
Das Treffen mit Bilal in Hamburg, Teil 1
Bilal, Helins Vater und Rıfats Sohn, hat mir vor meiner Reise ein paar weitere Dinge über seinen Vater und seine Familie erzählt. Auf mein Bitten hin, haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und nicht über Schule und Noten gesprochen, sondern über die Geschichte der Familie. Nachdem wir uns vorgestellt hatten, musterte Bilal mich zunächst grundlegend, weil ich sagte, dass ich kein Hamburger Original bin, sondern aus der Nähe von Bremen komme.
»Bremen? Echt jetzt?«, fragte er in breitem Hamburgisch. Bremer und Hamburger pflegen aus guter Tradition eine schwierige Beziehung.
»Ja, ja, vorsichtig, sonst reiße ich eine Stunde lang Witze über den HSV«, antwortete ich, und wir verstanden uns. Seine Tochter saß neben ihm und schaute ein wenig nervös zwischen uns hin und her.
Bilal ist gelernter Koch, ausgebildet in einem Restaurant im noblen Stadtteil Uhlenhorst, und sein Lieblingsgericht ist Labskaus. Dazu muss man wissen, dass Labskaus eine optisch ausgesprochen gewöhnungsbedürftige Spezialität Norddeutschlands ist. Eine breiige Masse, hergestellt aus Rindfleisch, Roter Bete und Kartoffeln. Obendrauf ein Spiegelei und an der Seite eine Gewürzgurke.
»Kenn’ ich von zu Hause. Gibt’s in Bremen auch«, sagte ich.
»Aber nicht das Admiralslabskaus mit Wachtelei obendrauf«, schwärmte Bilal weiter. Mehr Hamburger geht nicht, dachte ich und fand sehr sympathisch, wie er total begeistert von seiner Zeit als Koch erzählte.
Rıfat konnte zu unserem Treffen leider nicht mitkommen. Er war gesundheitlich angeschlagen, freute sich aber über das Interesse an seiner Geschichte und ließ schöne Grüße ausrichten.
»Mein Vater kam nach Hamburg, weil er sein eigenes Ding machen wollte«, erzählte mir sein Sohn im Klassenzimmer seiner Tochter, wo wir uns verabredet hatten. »Er entschied sich gegen die Region Köln/Bonn und Berlin, wohin viele Freunde und Verwandte wollten. Er hatte vor, es alleine zu schaffen, und ging deshalb nach Hamburg. Mit dem Zug kam er direkt hier an, wurde gemustert und landete in einem Männerwohnheim in Jenfeld, außerhalb der Stadt.«
»Männerwohnheim«, fragte ich nach. »Das klingt hart.«
»Ja«, überlegte Bilal. »Für uns klingt das krass, für meinen Vater war das aber normal. Am Anfang war er wohl ganz froh über den Raum, den er mit anderen Türken teilen konnte. Draußen war ja Kulturschock, und drinnen und auf der Arbeit waren sie meistens unter sich. In Kaman hatte er nie eine blonde Frau gesehen. Als sie sich etwas gewöhnt hatten und mutiger wurden, gingen er und seine Mitbewohner nach Feierabend ab und zu up’n Swutsch und sahen das richtige Deutschland. Das war spannend, wie Ausflüge in eine andere Welt. In erster Linie ging es aber ums Geldverdienen. Bis 1970 hat er dort gelebt.«
Trotz gelegentlicher Ausflüge bedeutete das deutsche Wirtschaftswunder für Rıfat zuallererst also harte Arbeit. Sein Job auf dem Bau war anstrengend. In seinem Arbeitsvertrag mit dem W. Wagenhuber Betonsteinwerk aus dem Jahr 1965 wurde der formale Alltag geregelt. Darin stand und steht bis heute auf Türkisch und Deutsch:
Der Arbeitnehmer erhält für seine Arbeit denselben Lohn wie ein vergleichbarer deutscher Arbeiter. Sein Bruttolohn beträgt zur Zeit 3,71 DM stündlich.
Helin und Bilal haben mir eine Mappe mit persönlichen Unterlagen ihres Großvaters beziehungsweise Vaters anvertraut. Darin findet sich Rıfats Leben ab den frühen 1960er-Jahren. Fein säuberlich abgeheftete Dokumente aus fast 65 Jahren deutscher und türkischer Geschichte.
Bei W. Wagenhuber musste Rıfat 42 Stunden in der Woche als Betonfacharbeiter bzw. Maurer oder Zimmerer arbeiten. Natürlich gab es Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. Nach sechs Monaten ununterbrochener Betriebszugehörigkeit erwarb der Arbeitnehmer Urlaubsanspruch von 1,25 Tagen für jeden vollendeten Beschäftigungsmonat.
Auch Rıfats Unterbringung war Vertragsgegenstand:
Dies war ein Folgevertrag, und trotzdem musste er von der Deutschen Verbindungsstelle für Arbeitsvermittlung in Ankara und der Türkischen Arbeitsverwaltung unterschrieben werden. Die Unterschriften holte man offenbar auf dem Postweg ein – der Vertrag ist frankiert mit Briefmarken im Wert von 71 türkischen Lira. Von den Formalia hat Rıfat selbst womöglich nicht viel mitbekommen.
»Er bekam eine Schaufel in die Hand gedrückt, und los ging’s«, erzählte Bilal im Namen seines Vaters. »Wenn er sich heute an diese Zeit erinnert, fällt ihm Müdigkeit ein. Er hat sich eigentlich nie beklagt, aber wenn, dann über Müdigkeit und den schlechten Schlaf. Am Ende eines Arbeitstages war er so kaputt, dass er nicht mehr träumte. Das jedenfalls erzählt er, wenn wir ihn nach den ersten Jahren in Deutschland fragen. Er muss an einigen Tagen total fertig gewesen sein«, überlegte Bilal während unseres Gesprächs.
»Manchmal berichtet er von schlimmen Schmerzen in Händen und Beinen und vom Heimweh nach Kaman. Es dauert aber nie lange, dann berappelt er sich und spricht davon, dass er in dieser Zeit die engsten und schönsten Freunde kennengelernt habe. Deutsche und türkische, mit denen er die beste Zeit seines Lebens geteilt hat. Für die Deutschen empfindet mein Vater sowieso hohe Wertschätzung. Es war manchmal hart, gelohnt hat es sich aber auch.«
Im Laubengang, dritter Çay
Ähnliches haben auch die Männer im Laubengang erlebt. Wie denken die Männer im Laubengang in Kaman heute über Deutschland? Vorsichtig frage ich nach.
»Deutschland ist gut. Viel Arbeit, gut organisiert«, höre ich als Erstes.
Klingt nicht so sexy.
»Und die Deutschen?«
»Ach, die Deutschen sind super«, höre ich einen sagen. »Nehmen aber immer alles so ernst.«
Lautes Lachen.
Frankreich und England kommen in den Beschreibungen ähnlich gut weg. In Westeuropa konnte man gut Geld verdienen, und darum ging es.
Mehmets Nachbar fasst das so zusammen: »Für mich war Deutschland Arbeit. Aber auch schön. Ich habe viele gute Erinnerungen, viele Jahre waren das. Heimat war aber immer hier, in Kaman.«
Das klingt wie Rıfat.
Mit dem in Deutschland verdienten Geld konnte er sich ein hübsches Häuschen bauen. Er hat seine Schäfchen im Trockenen, und das sieht man ihm an: Er lacht pausbäckig und ist offenbar hochzufrieden mit sich und seiner Welt.
So hatte Helins Opa sich das auch vorgestellt. Vielleicht würde er jetzt hier bei uns sitzen und Tee trinken, wären einige Dinge anders gelaufen. Aber Moment mal, nein, er würde hier sitzen, aber ich sicher nicht, denn ich hätte ja nicht von seiner Enkelin erfahren können, dass es diesen Ort überhaupt gibt.
Das Treffen mit Bilal in Hamburg, Teil 2
Im Hamburg der späten 1960er-Jahre musste Rıfat als junger Mann aus gesundheitlichen Gründen einen anderen Job finden. Die Arbeit im W. Wagenhuber Betonsteinwerk wurde zu anstrengend. Ein Freund gab ihm den Tipp, dass die Post Leute für ihre Lager suchte. Er ging dorthin, stellte sich vor, hatte im nächsten Moment einen Blaumann mit Posthorn an und war bei der Arbeit. Hier verdiente er zwar etwas weniger, aber er blieb gesund und hatte noch was vom Leben. So formuliert er es heute, berichten Bilal und Helin.
»Die Post war ein guter Arbeitgeber. Bis heute schwärmt mein Vater davon. Er war einfach nur froh, dass er nicht mehr so hart schuften musste.«
Noch besser wurde das Leben für Rıfat dann ab 1973. Ein bisschen Heimat kam aus Kaman. In Rıfats Unterlagen findet sich das Ergebnis der Ausländeruntersuchung seiner Frau Şerife. Im Mai 1973 stellt die Freie und Hansestadt Hamburg 8,30 DM für ein Gesundheitszeugnis in Rechnung.
Die Liebe seines Lebens war zwar bei ihm, aber die Sehnsucht nach Kaman blieb trotzdem. Den Urlaub, den Rıfat nun bei der Post nehmen konnte, und das Geld, das er dort verdiente, nutzten er und Şerife, um nach Kaman zu reisen und dort zusammen mit Freunden und Verwandten ein Haus zu bauen. Das steht bis heute, wurde aber nur sporadisch von seinem Erbauer bewohnt. Heute lebt dort eine Nichte von Bilal mit ihrer Familie, und für Rıfat ist es nach wie vor ein Sehnsuchtsort: Trotz Pflegestufe hegt er noch immer den Wunsch, in seinem Garten unter dem Kirschbaum zu sitzen. Ich würde es ihm sehr wünschen.
Als Bilal das erzählte, wurde er nachdenklich. Eigentlich hatte die Familie geplant, in das fertige Haus zu ziehen und in Kaman zu bleiben. Aber es kam anders.
»Dass mein Vater sich diesen Traum bis heute nicht hat erfüllen können, hat sicher nicht zuletzt mit mir zu tun. Wir waren ja schon wieder zurück in Kaman. Ich war noch ganz klein und wurde sehr krank. Die ärztliche Versorgung in Deutschland war besser, und so beschlossen meine Eltern, meinetwegen zurückzukehren, und mein Vater war gezwungen, wieder hier zu arbeiten. Wir blieben, bis ich wieder gesund war und noch länger. Ein bisschen zu lange, denn spätestens als Teenager war es für mich undenkbar, zurückzugehen und in der Türkei zu leben. Ich kannte dort ja niemanden, und mein Deutsch war besser als mein Türkisch.«
Als er das sagte, schaute er zu seiner Tochter Helin hinüber, die selbst noch nie in Kaman war.
»Wären wir zurückgegangen, hätte ich Heimweh nach Hamburg gehabt. Auf keinen Fall wollte ich meine Freunde verlieren. Ich war hier zu Hause. Papa nicht. Der wollte lieber wieder in der Türkei leben. Für mich ist er geblieben.«
Ich finde das beeindruckend, und es nötigt mir den größten Respekt ab. Helins Opa hat nicht nur an seinem eigenen Traum gearbeitet, wenn er ihn dann auch nicht verwirklichte, sondern er hat bei den Deutschen daran mitgewirkt, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder zu ermöglichen, und er hat Rücksicht genommen auf die Träume seiner Kinder. Darin steckt eine gehörige Portion Tragik, aber ebenso Hoffnung und Aufbruch, denn seine Entscheidungen und die seiner Frau Şerife haben viele Menschen aus drei Generationen in einem positiven Sinne geprägt. Das ist jedenfalls das, was mir seine Nachfahren Bilal und Helin berichteten. Wenn man den Gedanken noch weiterspinnen wollte, könnte man sagen, die Rıfats von einst haben dem Deutschland von einst ein Facelift verpasst und die Menschen gezwungen, ihren Horizont ein wenig zu weiten.
Bilal und Helin sagen, dass ihr Vater und Großvater trotz Krankheit ein zufriedener Mann ist und trotz gelegentlichen Heimwehs ohne Groll auf die Vergangenheit zurückblickt. Sie hoffen, noch einmal mit ihm nach Kaman zurückkehren zu können, um gemeinsam mit der ganzen Familie unter dem Kirschbaum zu sitzen. Inschallah[3], Rıfat.
Im Laubengang, vierter Çay
Im Laubengang wollen die Alten von mir wissen, was ich eigentlich für ein Lehrer bin und was ich noch so vorhabe in der Türkei.
»Ich unterrichte Englisch, Geografie und Deutsch für Anfänger«, sage ich.
Geografie finden sie interessant.
Ich habe Ferien, also nur begrenzt Zeit, außerdem zwei kleine Kinder, die ich unendlich vermisse, aber auch diese Neugier, die an mir nagt. Trotzdem: Ich bin das erste Mal seit fünf Jahren wieder alleine unterwegs. Ich muss das erst neu lernen.
»Ich habe noch zehn Tage in der Türkei. Am Ende will ich an der Ägäis rauskommen und von dort nach Europa schauen«, sage ich.
»Warum mietest du nicht ein Auto?«
Eigentlich war das nie meine Art des Reisens. Andererseits haben die Alten schon recht: Busse und Kleinbusse, die Kleinstädte miteinander verbinden, Dolmuş genannt, sind langsam und mühselig.
Effizienter sei ein Auto – als Deutschem sollte mir das doch eigentlich klar sein. Wenn ich ein Auto hätte, sagen die Alten, könnte ich von hier aus nach Kappadokien und ins Ihlara-Tal fahren, eine vulkanische Schlucht nicht weit entfernt vom Vulkan Hasan Dağı. Für Geografen besonders interessant. Dort solle ich wandern und die Natur genießen.
Ja, das ist bestimmt schön, denke ich mir.
Im Laubengang kursieren plötzlich unendlich viele Reisetipps. Ich notiere vor allem diejenigen Orte, die westlich von hier liegen, quasi en route nach Europa, und beschließe, die Wahl der Stationen in die Hände der Herren von Kaman zu legen. Besonders interessant neben Ihlara seien der Salzsee Tuz Gölü, die Großstadt Konya, eine Kleinstadt namens Eğirdir im Taurus-Gebirge, Pamukkale und das historische Ephesos an der Ägäis. Verbindungen mit Europa gebe es überall, höre ich raus. Wirklich ernst nehmen die Alten meine Fragen nach Europa aber nicht, als ich versuche zu erklären, dass ich auf dieser Reise vorhabe, den Kontinent besser zu verstehen. Ist auch egal, alles ist im Fluss.
Aber vom Mietwagen-Vorschlag bin ich noch nicht ganz überzeugt.
»In einem Auto ist man eingekapselt und hat keine Gesprächspartner. Außerdem ist es teuer«, lehne ich mich ein letztes Mal gegen die Idee auf.
»In einem Auto kommst du viel schneller an den Ort, an den du willst«, insistieren die Alten. »Und dort findest du sicher auch gute Gesprächspartner.«
Außerdem sei ich schneller wieder zu Hause bei meiner Familie, und Familie sei das Wichtigste. Sie haben mich überzeugt. Auf meinem Weg nach Westen in Richtung Europa werde ich ein Auto nehmen.
Bevor unsere Wege sich trennen, muss ich alle Sehenswürdigkeiten in Kaman fotografieren. Mehmet instruiert mich. Zunächst der Laubengang. Es entstehen viele Porträts von freundlichen alten Herren. Es geht weiter zur Statue Mustafa Kemal Atatürks, zur Moschee und, als besonderes Highlight, zur Walnussskulptur, nicht ohne vorher von einem Walnusshändler auf der anderen Straßenseite ein paar Früchte zum Probieren bekommen zu haben. Auch Restaurants werden mir wärmstens empfohlen und ich bekomme Tipps für den Erwerb eines Bustickets nach Ankara, denn dorthin muss ich zurück, um mir einen Wagen zu besorgen. Herzallerliebst, diese Alten.
Der Ausflug nach Kaman hat sich gelohnt. Ich bin regelrecht überwältigt von den Eindrücken und den inspirierenden Unterhaltungen, als ich am Abend in meinem gesichtslosen Zimmer des Kaman Apart Hotels stehe, das auf seine Art mit der grellen Deckenbeleuchtung, der spärlichen Möblierung und dem abgelaufenen Teppich schon wieder charmant ist. Noch inspirierender als zuvor finde ich die Geschichte von Rıfat und seiner Familie. Großen Respekt habe ich vor den Entscheidungen, die sie trafen und davor, dass sie sich einließen auf das Ungewisse. Meine Anwesenheit in Kaman ist in der großen Saga der Familie nicht mehr als eine Randnotiz, und trotzdem finde ich es faszinierend, dass mich eine transeuropäische Reise, die 1963 begann, über sechzig Jahre später an diesen Ort führte. Ich freue mich schon darauf, in der Schule über Kammannistan, seine herzlichen Menschen und seine Verbindungen nach Deutschland und Europa zu berichten.
Ankara
Die Entscheidung, mir ein Auto zu leihen, beschert mir einen Extratag in Ankara. Auf Anraten der Alten habe ich mir drei Dinge vorgenommen:
Essen und Zitadelle von Ankara
Museum für anatolische Geschichte
Auto besorgen, schlafen, losfahren
Bilal hat sich als großer Fan der Hamburger Küche geoutet. Gut, er hat das professionell gemacht, hier frage ich mich trotzdem, was um Gottes willen an Birnen, Bohnen, Speck, Pannfisch oder Franzbrötchen raffiniert sein soll. Das ist total unoriginell, jedenfalls verglichen mit dem, was es hier gibt. Das Bashen der heimatlichen Küche ist unoriginell, denke ich, als ich meinen üppig gedeckten Tisch in einem Lokal zu Füßen der auf einem die Stadt überblickenden Hügel gelegenen Zitadelle von Ankara betrachte. Da stehen eingelegte Oliven, prächtige Paprikaschnitze und Peperoni, Schafskäse, Dips und Soßen (eine mit Walnüssen), Brot und natürlich Kebab. Das sind im Grunde die Zutaten für das täglich Brot vieler Schülerinnen und Schüler.
Einige von ihnen hätten Diskussionsbedarf mit Mustafa, den ich mit seiner Familie auf dem Weg nach oben zur Zitadelle treffe. Wir smalltalken, und es stellt sich raus, dass sie aus Ankara kommen, aber noch nie gemeinsam hier oben waren. Seine Frau, er selbst und die beiden kleinen Kinder sind in fröhlicher Ausflugs- und Plauderlaune. Mustafa spricht hervorragend Englisch, und ich renne offene Türen ein, als ich unter dem Eindruck meines fürstlichen Mahls die türkische Küche preise. Nach einigem Geplänkel und dem Austausch von Höflichkeitsfloskeln sagt er: »Der Döner ist hier erfunden worden«, wohl wissend, dass dieser auch in Deutschland sehr beliebt ist.