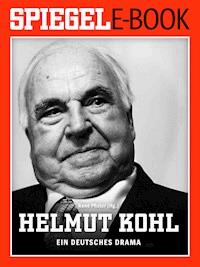9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das Beste, was ich bislang zur neuen linken Glaubenskultur gelesen habe« (Jan Fleischhauer): der Bestseller jetzt im Taschenbuch
Eine linke Revolution hat Amerika erfasst: Im Namen von Gerechtigkeit und Antirassismus greift dort eine Ideologie um sich, die neue Intoleranz erzeugt - in liberalen Medien kann ein falsches Wort Karrieren beenden, an den Universitäten herrscht ein Klima der Angst, Unternehmen feuern Mitarbeiter, die sich dem neuen Zeitgeist widersetzen. In seinem Bestseller beschreibt René Pfister, Büroleiter des SPIEGEL in Washington, diese neue politische Religion - und zeigt auf, warum die amerikanische Demokratie nicht nur von rechts unter Druck kommt. Er erklärt, wie Dogmatismus, Freund-Feind-Denken und Mob-Mentalität in Internet die Meinungsfreiheit in den USA schon gefährlich eingeschränkt haben. Eindrücklich warnt er vor diesem Fundamentalismus, dem wir uns widersetzen müssen, um auch in Deutschland die offene Gesellschaft zu verteidigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der erbitterte Kampf um Identität und Meinungsfreiheit – ein Report aus den USA
Eine linke Revolution hat Amerika erfasst: Im Namen von Gerechtigkeit und Antirassismus greift dort eine Ideologie um sich, die neue Intoleranz erzeugt – in liberalen Medien kann ein falsches Wort Karrieren beenden, an den Universitäten herrscht ein Klima der Angst, Unternehmen feuern Mitarbeiter, die sich dem neuen Zeitgeist widersetzen. In vielen Porträts und Geschichten beschreibt René Pfister, Büroleiter des SPIEGEL in Washington, diese neue politische Religion – und zeigt auf, warum die amerikanische Demokratie nicht nur von rechts unter Druck kommt. Er erklärt, wie Dogmatismus, Freund-Feind-Denken und Mob-Mentalität in Internet die Meinungsfreiheit in den USA schon gefährlich eingeschränkt haben. Eindrücklich warnt er vor diesem Fundamentalismus, dem wir uns widersetzen müssen, um auch in Deutschland die offene Gesellschaft zu verteidigen.
René Pfister, geboren 1974, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften in München und arbeitete nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule für die Nachrichtenagenturen ddp und Reuters. 2004 wechselte er zum SPIEGEL, wo er vor allem über die Unionsparteien und Angela Merkel schrieb. Ab 2015 leitete er das Hauptstadtbüro des SPIEGEL, seit 2019 ist er Büroleiter des SPIEGEL in Washington. 2014 erhielt er gemeinsam mit Kollegen den Henri-Nannen-Preis für eine Recherche über den Lauschangriff auf das Handy von Kanzlerin Merkel.
RENÉ PFISTER
EIN
FALSCHES
WORT
Wie eine neue
linke Ideologie
aus Amerika
unsere
Meinungsfreiheit
bedroht
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München,
und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG,
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Covergestaltung: total italic/Thierry Wijnberg
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29745-9V003
www.dva.de
INHALT
1 Warum die Demokratie auch von links bedroht wird – ein Vorwort
2 Ian Buruma oder: Es kann jeden treffen
3 Alles ist Diskurs oder: Die neue Sprache der Macht
4 Dorian Abbot oder: Der Terror der Minderheit
5 Campus Culture oder: Wie Universitäten zu geistigen Klöstern werden
6 Die Medien oder: Wie Parteilichkeit zur Tugend wird
7 David Shor oder: Wie sich das linke Lager von der Realität abschottet
8 Woke Capitalism oder: Ausbeutung, aber politisch korrekt
9 Ibram X. Kendi oder: Antirassismus als bürokratisches Perpetuum mobile
10 Eine neue Religion oder: Meine große Schuld
11 Chris Rufo oder: Cancel Culture von rechts
12 Identitätspolitik oder: Wie sich die Linke ihr Grab selbst schaufelt
13 Die Mühen der Demokratie oder: Warum wir den produktiven Streit brauchen
Dank
Anmerkungen
1 WARUM DIE DEMOKRATIE AUCH VON LINKS BEDROHT WIRD – EIN VORWORT
Das Erste, was mir auffiel, waren die Regenbogenflaggen. Als ich im April 2019 nach Washington flog, um für meine Familie ein Haus zu suchen, empfahl mir die Maklerin den Stadtteil Chevy Chase, einen stillen Vorort mit ordentlichen öffentlichen Schulen für unsere beiden Söhne. Ein Viertel, das mir so hipp wie Friedrich Merz erschien – und doch flatterte an fast jeder dritten Veranda die Fahne der Schwulen- und Lesbenbewegung.
Als ich meine Maklerin danach fragte, sagte sie, die Flaggen seien gehisst worden, nachdem sich der designierte republikanische Vizepräsident Mike Pence im November 2016 entschieden hatte, in die Gegend zu ziehen. Eigentlich steht dem amerikanischen Vizepräsidenten die Residenz auf dem Gelände des Observatoriums der US-Marine zu. Aber für eine Übergangszeit suchte er sich ein Mietshaus in Chevy Chase. Die Regenbogenflaggen, sagte meine Maklerin, seien als Zeichen des stummen Protests gegen den neuen Nachbarn gehisst und später nicht mehr abgenommen worden. Pence, muss man dazu wissen, ist ein Christ, der die Bibel sehr wörtlich interpretiert. Als Kongressabgeordneter für den US-Bundesstaat Indiana hatte er sich darüber beklagt, dass im Schulunterricht nicht die Schöpfungsgeschichte gelehrt wird. Als in Berlin einmal ein Text über Pence auf meinem Schreibtisch landete, schrieb ich »Ajatollah aus Indiana« darüber.
Ich muss gestehen, dass mich die Fahnen mit Chevy Chase versöhnten. Bevor meine Frau und ich beschlossen, für den SPIEGEL als Korrespondenten in die USA zu ziehen, hatten wir über zehn Jahre in einer Stadtwohnung in Berlin gelebt. Ich hatte immer einen Widerwillen gegen Vororte, und die Regenbogenflaggen in Chevy Chase gaben mir das Gefühl, nicht vollends in einer Spießerhölle gelandet zu sein. Drei Tage später unterschrieb ich den Mietvertrag für ein Haus mit einer hübschen Veranda und einem kleinen Garten.
Ich freute mich auf die USA, ich kann es nicht anders sagen – ein Land, für das ich immer eine tiefe Sympathie empfand. Meine Eltern hatten nie etwas mit der säuerlichen Amerikaskepsis vieler Deutscher am Hut. Noch heute schwärmen sie von einer Reise nach San Francisco, die sie Mitte der Siebzigerjahre unternommen hatten. Als Kind bin ich mit Colt Seavers und dem »Trio mit vier Fäusten« aufgewachsen, meine erste große Liebe war Melissa aus »Falcon Crest«. Der erste Film, den ich abends im Kino sah, war »Top Gun« mit Tom Cruise, der dafür sorgte, dass die Jungs an meinem Gymnasium braune Pilotenlederjacken mit »Navy«-Aufnähern trugen. Ich mochte die Lakonie Hemingways und die erotischen Selbsterkundungen Philip Roths, und nichts heiterte mich schneller auf als der anarchische Humor von Larry David.
Als wir im Sommer 2019 in Washington ankamen, schickten wir unsere Kinder auf amerikanische Schulen, obwohl sie nur ein paar Brocken Englisch sprachen. Es war eine Entscheidung, die wir nicht bereuten. Die Lehrer nahmen sich der beiden Jungs mit einer Energie an, wie man sie von deutschen Schulen nicht unbedingt gewohnt ist. Ms. Lamers, die Klassenlehrerin meines jüngsten Sohnes, lud sich ein Sprachprogramm auf ihr Handy, um die Wörter zu verstehen, die er noch nicht übersetzen konnte. Mein ältester Sohn besuchte eine Middle School und fand schon nach ein paar Tagen amerikanische Freunde. Nach einem halben Jahr sprachen die beiden so gut Englisch, dass sie mich baten, in ihrer Gegenwart darauf zu verzichten, weil mein deutscher Akzent in ihren Ohren schmerze.
Unsere neuen Nachbarn hießen uns auf rührende Art und Weise willkommen. Judith, eine jüdische Rechtsanwältin in fünfter Generation, lud uns zum Thanksgiving-Dinner ein; weiter oben in unserer Straße zog Kapil mit seiner Frau Madhura ein, ein Kardiologe und eine Biologin, deren Kinder bald auf dem Trampolin in unserem Garten hüpften. Und dann waren da noch Tim und Megan, das Juristenehepaar, in deren Garten wir amerikanisches Craft Beer tranken und die immer wissen wollten, was ich auf meinen Recherchereisen durch Amerika erlebt hatte.
Wenn ich davon erzählte, kam ich mir vor, als berichtete ich aus einem fernen Land. Was ich bei den Wahlkampfveranstaltungen von Trump sah, hatte nichts mit der weltoffenen Freundlichkeit zu tun, die wir in Chevy Chase erlebten: die Meute, die »USA, USA« schrie, sobald Trump die Bühne betrat; die wütenden Männer, die »Lügner« zischten, wenn sie an dem abgesperrten Bereich vorbeizogen, in dem wir Journalisten von Trumps Presseleuten eingepfercht worden waren. Es gehörte zum Standardrepertoire des Präsidenten, in seine Reden einen Seitenhieb auf die Medien einzubauen. Im Ton der Entrüstung erzählte er davon, wie Journalisten das amerikanische Volk belügen würden. »Seht ihr, das senden sie jetzt nicht, das rote Licht an den Kameras ist aus«, sagte der Präsident dann, während die Halle wie mit einer Stimme »CNN sucks« zu brüllen begann – »CNN kotzt uns an«.
Zurück in Chevy Chase erschienen mir die Wut und der Hass, die das Land so furchtbar plagen, wie ein ferner Donnerhall. Wenn ich meinen Nachbarn von Trump und seinen Fans erzählte, waren sie peinlich berührt. In ihren Gesichtern standen Wut und auch eine Spur Scham über den Mann, der nun auch ihr Präsident war. Es war eine merkwürdige Erfahrung: Amerika, dieses so stolze und mächtige Land, das die Welt mit von den Nazis befreit, den ersten Mann auf den Mond geschickt und den Kommunismus in die Knie gezwungen hatte, wurde nun von einer ebenso lächerlichen wie gefährlichen Figur regiert – einem Aufschneider und Hochstapler, dessen Talent darin bestand, sich die dunklen Gefühle einer Nation zunutze zu machen.
Von Chevy Chase zum Weißen Haus sind es nur sechs U-Bahn-Stationen. Aber politisch war Trump Lichtjahre von meiner neuen Heimat entfernt. In den Vorgärten unserer Nachbarn standen Schilder, die an ihrer fortschrittlichen Gesinnung keinen Zweifel ließen: »Biden/Harris«, »Moms demand action«, das Motto der Waffengegnerinnen in den USA. Oder schlicht: »Bernie«. Nach dem Mord an George Floyd prangte plötzlich ein riesiges »I can’t breathe«-Graffiti auf dem Basketball-Platz neben der Grundschule meines Sohnes. Als Donald Trump im Oktober 2019 das Baseball-Stadion der »Washington Nationals« besuchte, wurde er aus tausend Kehlen ausgebuht.
In Chevy Chase konnte man leicht den Eindruck bekommen, als existiere Trump gar nicht. Am Eingang der Grundschule meines Sohnes hing ein Porträt Barack Obamas, der jeden Morgen so freundlich lächelnd die Schüler begrüßte, als sei er noch immer im Amt. Als wir im Dezember 2019 eine Party in unserer Nachbarschaft besuchten, war es das große Tuschelthema, dass unter den 40 Gästen auch ein republikanischer Lobbyist war. »He’s a Trump voter«, flüsterte mir ein Bekannter mit dem leicht erregten Unterton eines Forschers zu, der eine seltene Spezies entdeckt hat.
Der Riss, der durch das Land ging, schien das idyllische Chevy Chase nicht erreicht zu haben. Das jedenfalls war über Monate mein Eindruck. Wenn jemand die Schuld daran trug, dass die USA immer unversöhnlicher wurden, dann der Wüterich im Weißen Haus, der täglich per Tweet seinen Zorn mit der Nation teilte: der Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle beschimpfte und der Millionen Dollar aus dem Verteidigungshaushalt abzweigte, um eine Mauer an der Südgrenze der USA zu bauen. Würde das ganze Land die Toleranz und Menschenfreundlichkeit von Chevy Chase aufbringen, das war mein Eindruck, dann würde Trump bald verschwinden wie ein böser Alptraum.
Dieses Bild wurde zum ersten Mal getrübt, als ich im Frühjahr 2020 mit einem Freund auf einer Bank saß und wir unseren Söhnen beim Fußballtraining zuschauten. Mein Freund ist Österreicher mit amerikanischem Pass, und er berichtete mir von seinem Sohn, der in der Schule zurechtgewiesen worden war, weil er gesagt hatte, er finde nichts dabei, wenn sich Weiße Dreadlocks wachsen lassen. Dreadlocks sind in den USA seit einigen Jahren Gegenstand eines erbittert geführten Kulturkampfes, weil sie – so das Argument – einen Teil der afroamerikanischen Kultur bildeten und es deshalb eine »kulturelle Aneignung« sei, wenn sie von Weißen getragen werden. Inzwischen vergeht in den USA keine Woche, in der nicht der Vorwurf der »cultural appropriation« erhoben wird. Die Debatte treibt bisweilen kuriose Blüten. Im Jahr 2015 veröffentlichte das Gourmetmagazin »Bon Appétit« einen Artikel mit der Überschrift »So gelingen Ihnen wirklich gute Hamantaschen«. (Hamantaschen sind ein Süßgebäck aus der jüdischen Küche.)
Das Rezept stand jahrelang auf der Website des Magazins, ohne dass jemand daran Anstoß genommen hätte – bis sich eine New Yorker Foodbloggerin auf Twitter darüber beklagte, dass die Autorin des Rezepts keine Jüdin sei. Es dauerte nicht lange, bis »Bon Appétit« eine zerknirschte Entschuldigung veröffentlichte. »Die Originalversion dieses Artikels war in einer Sprache abgefasst, die unsensibel gegenüber der traditionellen jüdischen Küche war und die nicht den Standards unserer Marke entsprach«, schrieb die Redaktion unter den Text und kündigte an, sich in einem »Archive Repair Project« auf die Suche nach ähnlichen Sünden in anderen Rezepten zu machen.1
Die Idee der »kulturellen Aneignung« war schon immer eine abschüssige Bahn. Denkt man das Konzept konsequent zu Ende, stellen sich schnell komplizierte Fragen: Darf ein chinesischer Klaviervirtuose Bach spielen? Ist es nicht ein Zeichen von kultureller Überheblichkeit, wenn ein britischer Koch ein indisches Currygericht zubereitet? Und müssen sich nicht die Münchener wehren, wenn jedes Jahr Tausende Japaner, Italiener und Norddeutsche zum Oktoberfest in Lederhosen und Haferlschuhe steigen? Auch der Streit um die Dreadlocks wird komplizierter, je näher man hinschaut: Sie waren bei den aztekischen Priestern verbreitet und werden noch heute von einigen hinduistischen Mönchen getragen. Es ist also schwer zu argumentieren, dass sie allein Ausdruck der afroamerikanischen Kultur seien.
Das nächste irritierende Ereignis folgte um den 12. Oktober 2020, als in den USA der »Columbus Day« gefeiert wurde und auch im Unterricht meines Sohnes die Sprache auf den italienischen Seefahrer kam. Natürlich war Kolumbus in der Erzählung der Schule nicht mehr die Heldenfigur, zu der er über viele Jahrzehnte gemacht worden war. Er war nicht der Mann, der Amerika »entdeckt« hat, sondern der ruchlose Geschäftemacher, der unzählige Menschen in Sklaverei und Tod gestürzt hatte.
Es ist richtig und notwendig, über die Schrecken zu reden, die mit der Ankunft der »Santa Maria« für die Ureinwohner Amerikas begonnen hatten. Aber ist es nicht dennoch eine epochale Leistung, sich mit drei Schiffen auf die unbekannten Weiten des Atlantiks zu wagen? Im Gespräch mit meinem Sohn wurde mir klar, wie zögerlich er und seine Mitschüler waren, in der Schule solche Ambivalenzen auch nur zu diskutieren. Als mein Sohn einen amerikanischen Freund fragte, ob er im Unterricht sagen solle, dass Kolumbus – trotz all seiner Fehler – eben doch auch ein Kind seiner Zeit gewesen sei, sagte der, diese Meinung solle er besser für sich behalten. »It will bring you into trouble.« Kinder haben ein feines Gespür für das geistige Klima, in dem sie sich bewegen. So gerne meine Söhne in amerikanische Schulen gingen, so klar war ihnen auch, dass diese Orte sind, wo man Worte sehr genau wägen sollte.
In den USA wird inzwischen eine heftige Debatte darüber geführt, ob öffentliche Schulen zu einem Hort linker Indoktrination geworden sind. Sie wird bestimmt von Dogmatikern auf beiden Seiten. Während die Republikaner in vielen Bundesstaaten dabei sind, ihre Vorstellung von patriotischer Erziehung per Gesetz festzuschreiben, verschließen die Demokraten oft ihre Augen vor der Gefahr, die eine ideologisch durchtränkte Erziehung mit sich bringt. Natürlich ist es notwendig, an den Schulen über das Verbrechen der Sklaverei zu sprechen und wie es die USA von Anfang an geprägt hat. Aber ich verstehe Eltern, die sich dagegen wehren, wenn ihren Kindern in der Schule beigebracht wird, dass das wahre Gründungsdatum der USA nicht etwa die Verkündung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 war, sondern die Ankunft der ersten Sklaven in Virginia im Jahr 1619. Es macht Eltern noch nicht zu reaktionären Hinterwäldlern, wenn sie darauf bestehen, dass das amerikanische Projekt nicht allein aus Gewalt und Unterdrückung besteht.
Der Journalist Damon Linker hat in einem viel beachteten Artikel geschrieben, dass die amerikanische Linke derzeit denselben Fehler wiederhole, den sie in der Ära des republikanischen Kommunistenfressers Joseph McCarthy begangen habe. Statt dessen antidemokratische Hysterie zu bekämpfen und gleichzeitig die Gefahren des Kommunismus ernst zu nehmen, habe sie den McCarthyismus als alleinige Gefahr betrachtet – und die autoritäre Bedrohung von links vernachlässigt.2 Hat er damit recht?
Ich habe keinen Zweifel daran, dass Trump – wenn er noch einmal an die Macht käme – keine Sekunde zögern würde, die USA in eine Autokratie zu verwandeln. Als ich mit meinen Kollegen in Washington im August 2020 eine SPIEGEL-Titelgeschichte mit der Zeile »Operation Wahlbetrug« schrieb, mussten wir uns danach zum Teil hämischen Spott anhören. Uns wurde der Vorwurf gemacht, wir würden die Gefahr für die amerikanische Demokratie maßlos übertreiben. Als am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt wurde, spottete niemand mehr.3
Als SPIEGEL-Korrespondent habe ich das gesamte Wahljahr 2020 damit zugebracht, die existenzielle Gefahr für die amerikanische Demokratie zu beschreiben. Und diese Gefahr ist noch nicht gebannt. Trumps Versuch, Joe Biden den Wahlsieg zu stehlen, ist erst einmal gescheitert. Aber inzwischen haben viele republikanisch dominierte Staaten ihre Wahlgesetze geändert. Das Ziel ist eindeutig: Es geht darum, im Jahr 2025 Trump oder einen anderen rechten Populisten auch dann ins Oval Office zu bugsieren, wenn er keine Mehrheit hinter sich hat.
Warum also dieses Buch? Warum sich aufhalten mit einer Pädagogik, die rigide und dogmatisch sein mag, aber doch nur das Beste will? Warum Tinte verschwenden wegen ein paar Männern und Frauen, die nach einem unbedachten Satz in einer Vorlesung oder nach einem provokanten Tweet ihren Job verloren haben? Warum sich Gedanken machen über das geistige Klima in der »New York Times«, dem großen Schlachtschiff des liberalen Journalismus, wenn doch gleichzeitig einflussreiche rechte Fernsehsender wie »Fox News« zu Propagandatröten verkommen sind, die sich nicht mehr um die Wahrheit scheren?
Weil ich glaube, dass es fahrlässig wäre, vor dem Fundamentalismus von Teilen der amerikanischen Linken die Augen zu verschließen, nur weil Trump und die Republikaner die viel größeren Sünder sind. Wie kann es sein, dass die Schulaufsicht von San Francisco auf die Idee kommt, die »Dianne Feinstein-Grundschule« umzubenennen, weil die demokratische Senatorin in den Achtzigerjahren gegen die Heirat von Schwulen und Lesben war? Weshalb kommt es an amerikanischen Universitäten zu einem Aufstand von Studenten, wenn Frauen wie Christine Lagarde oder die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice als Rednerinnen eingeladen werden? Und wie konnte es geschehen, dass Teile der #MeToo-Bewegung ein so laxes Verhältnis zu einem Grundpfeiler des Rechtsstaates entwickelten – der Unschuldsvermutung?
Es ist wichtig, sich diesen Fragen zu widmen, weil es um den Kern der liberalen Demokratie geht. Sie wird nicht nur angegriffen von einer populistischen Rechten. Sondern auch von einer doktrinären Linken, die im Namen von Antirassismus, Gleichberechtigung und des Schutzes von Minderheiten versucht, Prinzipien zu untergraben, die essenziell sind: die Rede- und Meinungsfreiheit; die Idee, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist; den Grundsatz, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder seines Geschlechts benachteiligt werden sollte.
Ich werde in diesem Buch die geistigen Wurzeln dieses neuen Dogmatismus beschreiben. Ich werde erklären, wie abstrakte akademische Ideen, die Denker wie Michel Foucault im Frankreich der Sechziger- und Siebzigerjahre entwickelt hatten, später in den USA zu effektiven Waffen im politischen Meinungskampf verwandelt wurden. Ich werde erläutern, wie diese Waffen dazu benutzt wurden, den offenen Diskurs an amerikanischen Universitäten zu ersticken. Ich werde zeigen, wie der Geist der Illiberalität Hörsäle und Bibliotheken verließ und in Institutionen eindrang, die das alltägliche Leben in den USA prägen: in Medienhäuser wie die »New York Times« oder CNN; in Konzerne wie Amazon oder McDonald’s; aber auch in Schulen und die öffentliche Verwaltung.
Das Phänomen, das ich in diesem Buch zu beschreiben versuche, wird unter vielen Schlagworten diskutiert: »Identitätspolitik«, »Wokeness«, »Cancel Culture«. Ich werde später auf diese Begriffe eingehen und auf die Frage, wie präzise und sinnvoll sie sind. Aber ein häufiger Einwand von linker Seite lautet, dass es so etwas wie »Cancel Culture« gar nicht gebe; dass es ein Mythos sei, dass man wegen eines falschen Wortes oder eines umstrittenen Artikels seinen Job oder seine Reputation verlieren könne. Dieses Buch ist deshalb zum Teil auch eine Reise durch Amerika.
Ich habe mit Menschen gesprochen, die zu Opfern, aber auch zu Profiteuren dieses neuen Zeitgeistes geworden sind. Im Hudson Valley traf ich Ian Buruma, einen freundlichen älteren Herren, der nach einem Empörungssturm von #MeToo-Aktivistinnen im Netz als Chefredakteur der »New York Review of Books« gefeuert worden war. In einem Café in New York sprach ich mit David Shor, einem jungen demokratischen Meinungsforscher, den ein nach allen vernünftigen Maßstäben vollkommen harmloser Tweet den Job gekostet hatte. In einem Hotel in Orlando begegnete ich Chris Rufo, einem rechten Aktivisten, der mit seiner Kampagne gegen das »woke« Amerika zu einem wohlhabenden Mann geworden ist.
Was hat das alles mit Deutschland zu tun? Dieses Buch ist auch eine Warnung. Alle kulturellen und geistigen Trends aus den Vereinigten Staaten prägen über kurz oder lang auch uns. Wie in den USA ist auch das linke Lager in Deutschland seit dem Zusammenbruch des Kommunismus auf der Suche nach einer neuen Welterklärungsformel. Karl Marx hat Religion als »Opium des Volkes« bezeichnet, was nicht ohne Ironie ist, denn seine Lehre konnte im Laufe der Zeit auch deshalb eine solche Wirkung entfalten, weil sie in der praktischen Anwendung so deutliche Analogien zu religiösen Heilslehren hervorbrachte.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Ideologie, die ich in diesem Buch zu beschreiben versuche. Auch sie kommt im Gewand einer durch und durch weltlichen Emanzipationsbewegung daher, steckt aber voller religiöser Anleihen: die Ursünde des Weißseins, die auch mit einer steten und kritischen Selbstbefragung nicht zu tilgen ist; die manichäische Spaltung der Welt, in der weiße Männer alle anderen Menschen (Frauen, Schwarze, Homosexuelle, Transgender) unterdrücken. Die öffentlichen Selbstgeißelungen, die selbst nach den geringfügigsten Verfehlungen notwendig sind.
Wer glaubt, ich male an dieser Stelle mit einem zu groben Pinsel, dem sei die Lektüre der Bücher von Robin DiAngelo und Ibram X. Kendi empfohlen, die zu den einflussreichsten Autoren der amerikanischen Antirassismus-Schule zählen und die auch in Deutschland enorm populär geworden sind. »Eine positive weiße Identität ist nicht möglich«, schreibt DiAngelo in ihrem Bestseller »White Fragility«. »Eine weiße Identität ist inhärent rassistisch; es gibt keine weißen Menschen außerhalb des Systems weißer Dominanz.«4 Kendis Bücher wiederum sind zum Teil bewusst aufgebaut wie religiöse Anleitungen zur Gewissenserforschung.
Man mag das für Entwicklungen halten, die so nur in den USA möglich sind. Aber auch in der Bundesregierung wird der notwendige Kampf gegen die Diskriminierung von nichtweißen Menschen inzwischen als »Antirassismus« bezeichnet – eine Ideologie, die in den USA entwickelt wurde und die strengen Glaubenssätzen folgt, wie ich später zeigen werde. Auch in Deutschland gibt es die Tendenz, dass die Medien ihren Nachwuchs aus dem immer gleichen Milieu rekrutieren. Ich habe mit Professoren gesprochen, die sehr anschaulich beschreiben, wie sich an deutschen Universitäten ein unangenehmer Dogmatismus breitmacht.
Wir in Deutschland haben es noch in der Hand, jene Polarisierung zu verhindern, die die politische Kultur in den USA vergiftet. Dazu ist der Kampf gegen eine politische Rechte notwendig, die den Boden des Grundgesetzes verlassen hat. Aber um eine lebendige Demokratie zu erhalten, braucht es auch ein waches Auge für die illiberalen Entwicklungen in der politischen Linken. Es wäre ein Fehler, wenn wir in Deutschland derselben Dynamik folgen wie in den USA, wo sich die Extreme gegenseitig hochschaukeln und eine dogmatische Linke zum Antrieb und Lebenselixier einer radikalen Rechten geworden ist.
Dieses Buch ist nicht aus einer konservativen, sondern einer liberalen Perspektive geschrieben. Ich werde in den beiden Schlusskapiteln darlegen, warum sich das demokratische Lager selbst schadet, wenn es zu illiberalen Methoden greift. Ich halte es für verhängnisvoll, wenn nicht mehr das Gewicht eines Argumentes zählt, sondern die Hautfarbe oder das Geschlecht einer Person, die es ausspricht. Ich glaube, dass nur die Demokratiefeinde davon profitieren, wenn der offene Diskurs mit dem Vokabular der Empörung unterdrückt wird; wenn Menschen das Gefühl bekommen, sie können nicht mehr ihre Meinung sagen, weil sie dann sofort abgestempelt werden: als Rassisten, als Querdenker, als Corona-Leugner, als Putin-Versteher.
Noch gibt es in Deutschland keinen Trump. Aber im Bundestag und in 15 Landesparlamenten sitzt eine rechtspopulistische Partei, die auch deshalb so stark geworden ist, weil viele Wähler das Gefühl bekommen haben, sie würden mit ihren Anliegen von den Medien und den etablierten Parteien nicht ernst genommen. Im Sommer 2021 hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach auch im linken Lager für ein kurzes Innehalten gesorgt. Demnach glaubten nur noch nur 45 Prozent der Deutschen, frei ihre politische Meinung äußern zu können: 44 Prozent widersprachen. Für einen kurzen Moment schien es so, als würde eine Debatte in Gang kommen, ob es nicht ein Problem für die Demokratie sein könnte, wenn die Bürger nicht mehr offen artikulieren, was sie denken.5
Aber dann wurden solche Gedanken mit dem Argument beiseite gewischt, dass die Erhebung im Grunde gar keine Aussagekraft besitze. Denn die Frage der Allensbach-Forscher lautete: »Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann, oder ist es besser, vorsichtig zu sein?« In einem Kommentar auf »Zeit Online« hieß es, diese Frage ließe schon deshalb keinen Rückschluss auf die Meinungsfreiheit zu, weil Vorsicht immer angeraten sei, »allein aus Selbstschutz«. Das Problem ist nur, dass die Demokratie jedem die Möglichkeit lässt, Unmut und Protest anonym in der Wahlkabine zu artikulieren, wenn sie oder er das Gefühl hat, es nicht offen tun zu können.6
Ein paar Monate nach meiner Ankunft in Washington traf ich an der U-Bahn-Station Friendship Heights einen älteren Herrn in einem Cordsakko, der neben mir sein schickes italienisches Rennrad abschloss. Wir kamen schnell ins Gespräch, weil wir gefühlt die beiden einzigen Radfahrer in Chevy Chase waren. Ich dachte zuerst, Milton – so lautet der Name des Mannes – sei ein Geschichtsprofessor an der Georgetown University oder ein liberaler Beamter im State Department. Aber auf der U-Bahnfahrt in die Stadt stellte sich heraus, dass er ein tiefgläubiger Katholik ist, den es sehr beeindruckt hat, wie es Trump gelungen war, den Katholiken Brett Kavanaugh an den Supreme Court zu bugsieren.
Milton war sein ganzes Leben lang ein überzeugter Republikaner. Doch es gab Zeiten, in denen er noch die liberale »Washington Post« abonniert hatte und sich mit seinen Nachbarn angeregt über Politik unterhielt. Das ist vorbei.
Die »Post«, sagte mir Milton, sei zu einem linken Propagandablättchen verkommen, und im gegenwärtigen politischen Reizklima verkneife er sich lieber Debatten mit den Nachbarn. »Wenn die wüssten, dass ich Trump wähle, würden sie mir einen Stein durchs Fenster werfen.«
Inzwischen gibt es Millionen Menschen wie Milton, und zwar nicht nur in den USA. Männer und Frauen, die aufgehört haben, Blätter wie die »Washington Post«, »Le Monde« oder den »SPIEGEL« zu lesen und die sich entweder von den etablierten Parteien abgewendet haben – oder im Stillen Populisten wie Trump, Marine Le Pen oder Alexander Gauland wählen. Man mag die Methodik der Allensbach-Studie zur Meinungsfreiheit hinterfragen. Aber sie offenbart einen Trend, der sich auch in anderen westlichen Ländern zeigt. Laut einer YouGov-Umfrage aus dem November 2021 erklärten 57 Prozent der Briten, dass sie manchmal nicht ihre Auffassung zu politischen oder sozialen Themen äußern, weil sie negative Konsequenzen fürchten.7
Im März 2022 veröffentlichte die »New York Times« einen langen Kommentar mit der Überschrift »Amerikas Problem mit der Meinungsfreiheit«. Darin heißt es, den Amerikanern entgleite gerade ein Recht, »das fundamental ist für Bürger einer freien Gesellschaft: das Recht, öffentlich seine Gedanken auszusprechen und seine Meinung zu artikulieren, ohne Angst haben zu müssen, beschimpft oder gemieden zu werden«. Der Artikel war begleitet von einer Umfrage, wonach es 84 Prozent der Amerikaner für ein Problem halten, dass manche Mitbürger ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nicht mehr ausüben, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. 55 Prozent sagten, sie hätten in den vergangenen Jahren schon ihren Mund gehalten, weil sie harsche Kritik oder gar Vergeltung fürchteten.8
Woran liegt das? Wie kommen solche Zahlen zustande? Man kann die Gegenwart und das geistige Klima, in dem wir leben, nur dann erfassen, wenn man die neue Orthodoxie zu verstehen versucht, die in den vergangenen Jahrzehnten an amerikanischen Universitäten entwickelt wurde und die auch den Diskurs in Deutschland mitbestimmt. Wer sich fragt, warum inzwischen schon der Satz »Wir sind alle Menschen« eine Grenzüberschreitung darstellt, muss sich in das Werk des New Yorker Psychologieprofessors Derald Wing Sue vertiefen. Wer wissen will, warum Feministinnen wie Alice Schwarzer plötzlich als »transphob« beschimpft werden, wenn sie sagen, dass Menschen mit Vagina Frauen sind, der muss sich mit den verschlungenen Texten von Judith Butler beschäftigen. Es hat einen tieferen Grund, warum Menschen plötzlich ihren Job verlieren, die noch vor Kurzem dachten, sie würden mit ihrer Meinung und ihrer politischen Einstellung in der Mitte der Gesellschaft stehen.
2 IAN BURUMA ODER: ES KANN JEDEN TREFFEN
Das Schlimmste, sagt Ian Buruma, sei nicht die Angst vor dem finanziellen Absturz. Oder die Sorge, plötzlich ohne Krankenversicherung dazustehen. Das Schlimmste sei das Gefühl, ein Ausgestoßener in einer Welt zu sein, zu der er über so viele Jahrzehnte wie selbstverständlich gehört hatte. Der Redakteur, der sagt, er würde ja gerne weiter seine Artikel drucken. »Aber die jungen Kollegen, du verstehst …« Die renommierte Zeitung, die einfach nicht mehr anruft, obwohl er jahrelang für sie geschrieben hat. »Es dauert sehr lange, bis man das psychologisch verarbeitet«, sagt Buruma.
Der Tag, an dem sein Leben kollabierte, war Mitte September 2018. Der Eigner der »New York Review of Books« (NYRB), Rea Hederman, hatte Buruma in sein Büro bestellt. Aber dass er an diesem Tag – nach nur 16 Monaten als Chefredakteur – seinen Job verlieren würde, hätte er sich niemals träumen lassen. »Ich war völlig geschockt«, sagt Buruma. Hatte Hederman ihm nicht immer wieder versichert, er würde dem Sturm trotzen?
Der Ärger fing an, als Buruma sich dazu entschieden hatte, einen Text von Jian Ghomeshi abzudrucken. Es war ein Risiko, das war Buruma klar. Ghomeshi, Kind iranischer Eltern, war ein Star in Kanada, ein Rockmusiker, der zu einem gefeierten Radiomoderator aufstieg, bis seine Karriere im Oktober 2014 jäh endete. Der Absturz begann mit einer Artikelserie im »Toronto Star«, in der drei Frauen davon berichteten, wie Ghomeshi sie geschlagen, gewürgt und nach dem Sex verbal attackiert haben soll. Sie sorgte dafür, dass sich sein Arbeitgeber, der öffentlich-rechtliche Sender CBC, von Ghomeshi trennte. Innerhalb kurzer Zeit brachte über ein Dutzend Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen ihn vor, und am Ende wurde Ghomeshi wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe in mehreren Fällen angeklagt.
Der Prozess begann am 1. Februar 2016 – und endete mit einem Freispruch. Wie so oft in diesen Fällen, in denen es nur zwei Beteiligte gibt und Aussage gegen Aussage steht, blieb die Beweislage schwierig. Was am Ende den Ausschlag für Ghomeshi gab, war die Tatsache, dass die Frauen, die ihn beschuldigt hatten, sich in offene Widersprüche verstrickten. Der Richter sprach davon, dass sie das Gericht getäuscht und zum Teil den Schwur ignoriert hätten, die Wahrheit zu sagen. Ein weiterer Anklagepunkt wurde später zurückgezogen, nachdem Ghomeshi eingewilligt hatte, sich öffentlich bei einer der Frauen zu entschuldigen.9
Ghomeshis Essay in der »New York Review of Books« trug die Überschrift »Reflections from a Hashtag«. Es war der Erfahrungsbericht eines Mannes, der von einem ordentlichen Strafgericht entlastet worden war, nicht aber vom Gerichtshof der öffentlichen Moral – und dem deshalb die Rückkehr in sein altes Leben verwehrt blieb. »Mein Freispruch ließ nicht nur meine Anklägerinnen, sondern auch viele Beobachter zutiefst unbefriedigt zurück«, schrieb Ghomeshi. »Es gab das Gefühl, dass ich – trotz der juristischen Entlastung – mit großer Sicherheit ein Premium-Arsch sei, vielleicht sogar ein sexuell übergriffiger Tyrann, für den es nicht genügt, wenn er nur seine Karriere und sein Ansehen verliert.«10
Es war ein weinerlicher Text, und ganz sicher ließ Ghomeshi die Vorwürfe gegen sich in einem milden Licht erscheinen. Andererseits: Ist es die Aufgabe eines Erfahrungsberichtes, Vorwürfe zu wiederholen, die Ghomeshi immer bestritten hat und die von einem Gericht nicht erhärtet werden konnten? Ghomeshi hat sich nicht als moralisch einwandfreier Mensch dargestellt. Er schildert, wie das Daten von Frauen und Sex eine Art Statussymbol für ihn geworden seien. Es gäbe alle möglichen Wörter, um Männer wie ihn zu beschreiben, schreibt Ghomeshi: »Spieler, Fiesling, Schuft, Schürzenjäger.«
Buruma war 65 Jahre alt, als er die »New York Review of Books« übernahm, eine der führenden intellektuellen Zeitschriften der englischsprachigen Welt. Der Neffe des Regisseurs und Oscar-Gewinners John Schlesinger war in Den Haag aufgewachsen und hatte viele Jahre seines Lebens in Asien als Journalist und Dokumentarfilmer verbracht. Er hatte für den britischen »Guardian« geschrieben und die »New York Times«; Buruma forschte als Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und an der Universität Oxford. Bevor er als Chefredakteur der NYRB begann, war er über zehn Jahre lang Professor am Bard College gewesen, einer Hochschule im Hudson Valley nördlich von New York City, die in den Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts etlichen Intellektuellen aus Europa eine neue Heimat geboten hatte und auf deren Friedhof die Philosophin Hannah Arendt begraben liegt. Er habe sich sein ganzes Leben lang als Liberaler verstanden, sagt Buruma in seinem Büro am Bard College, wo er wieder Zuflucht fand, nachdem der Sturm der Entrüstung über ihn hinweggefegt war.
Schon vor der Veröffentlichung des Textes von Ghomeshi habe es in der NYRB