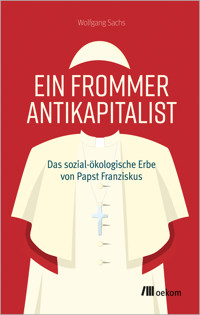
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Papst Franziskus war ein besonderer Papst. Aus dem Globalen Süden kommend, rückte er die Armen und Machtlosen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, ins Zentrum seiner kirchlichen Verkündigung. Mit der Enzyklika Laudato si’ setzte er Maßstäbe für eine sozialökologische Kirche und wurde zu einer moralischen Stimme der globalen Klimabewegung. Zugleich blieb er in Fragen der Familienmoral auf traditionelle Positionen festgelegt, hielt jedoch Distanz zu christdemokratischen Parteien, denen es an glaubwürdigen Leitlinien für Gerechtigkeit und Erdpolitik mangelte. Dieses Buch beleuchtet das sozialökologische Erbe von Franziskus aus umweltsoziologischer Perspektive und richtet den Blick auf seinen Nachfolger Leo XIV. Wird er den Weg fortsetzen und sich als Anwalt der Mittellosen und der Natur erweisen? Oder lässt sein Pontifikat zu, dass ein kultureller Rechtsruck die Stimmen der Armen und die Sorge um die Erde übertönt? Unter all den Streitfragen, mit denen er konfrontiert ist, wird auch diese darüber bestimmen, wie die Geschichtsschreibung dereinst seine Amtsführung beurteilen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Sachs
Ein frommer Antikapitalist
Das sozial‐ökologische Erbe von Papst Franziskus
Diese Publikation wurde von der Selbach‐Umwelt‐Stiftung und dem Förderverein des Wuppertal Instituts unterstützt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gem. § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHGoethestraße 28, 80336 München+49 89 544184 – [email protected]
Layout und Satz: oekom verlagKorrektorat: Maike SpechtUmschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlagUmschlagabbildung: © Adobe Stock: DiogenesDruck: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978‑3‐98726-499-3DOI https://doi.org/10.14512/9783987264993
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Mach schon, Leo XIV.! Eine Einleitung
Papst vs UNO Über den Aufstieg und Niedergang des Entwicklungszeitalters
Fratelli tutti
im Schatten des Anthropozäns
Revolutionär oder doch Reaktionär? Zum Vermächtnis von Papst Franziskus
Literatur
Dokumente der Kirche
Über den Autor
Anmerkungen
»Gelobt seist du, mein Herr,durch unsere Schwester, Mutter Erde,die uns erhält und lenktund vielfältige Früchte hervorbringtund bunte Blumen und Kräuter.«
(Franz von Assisi, aus dem Sonnengesang)
Mach schon, Leo XIV.! Eine Einleitung
Noch ist er ein unbeschriebenes Blatt: Papst Leo XIV. Am Nachmittag des 8. Mai 2025 stieg weißer Rauch aus dem Kamin über der Sixtinischen Kapelle auf. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass den Kardinälen ein ausgesprochen cleveres Manöver gelungen war: Das Oberhaupt der Katholiken würde ein Panamerikaner sein! Es war nicht ein Europäer und schon gar kein Italiener, der das Rennen machte, sondern ein Mann vom amerikanischen Kontinent, dessen Namen kaum jemand auf dem Zettel hatte. Welch eine Klatsche für Europa, das sich noch immer als die Heimat des Christentums versteht! Ähnlich war es bei der Wahl von Papst Franziskus im Jahr 2013, dessen Herkunft eine Sensation war: ein Papst aus dem Globalen Süden!
Auch der 267. Nachfolger des heiligen Petrus kommt aus dem Globalen Süden, aber obendrein auch aus dem Globalen Norden. Robert Francis Prevost stammt aus Chicago, er studierte dort und in Philadelphia und ist somit US‑Bürger. Ebenso besitzt er die peruanische Staatsangehörigkeit, da er als Missionar und später als Bischof rund 25 Jahre lang in der nordwestlichen Küstenregion Perus tätig war. Zählt man die Jahre in Rom als Leiter des Augustinerordens hinzu, kann man ihn gut und gerne als Kosmopoliten bezeichnen. Gefördert von Papst Franziskus, der ihn zum Bischof von Chiclayo und dann zum Kurienkardinal ernannt hatte, kennt er wie Franziskus die Welt der Campesinos und der Slums. Er wird wohl ebenso den Riss zwischen Reich und Arm auf der Welt anprangern. Mit der Wahl seines Namens – Papst Leo XIII. hat 1891 die christliche Soziallehre begründet – gibt er bereits zu verstehen, dass das soziale Engagement für sein Pontifikat von zentraler Bedeutung ist. Allerdings nicht nur für die Industriearbeiter, an die Leo XIII. dachte, sondern auch die informationbasierte Arbeit. Leo XIV. will nach eigenem Bekunden die Revolution der künstlichen Intelligenz kritisch begleiten, die nicht wenige Lebensbereiche umwälzen wird. Obwohl Papst Franziskus darüber bereits 2024 beim G7‐Gipfel in Apulien eine Rede gehalten hat (augenscheinlich erfolglos), verspricht Leo XIV., der Soziallehre eine neue Wendung zu geben.
Da der neue Papst gleichzeitig ein Nordamerikaner ist, wartet auf ihn die Aufgabe, Brückenbauer zwischen den beiden verfeindeten Lagern der Katholiken in den USA zu sein. Auf der einen Seite stehen die progressiven und sozial tätigen Katholiken, die sich um Minderheiten und Umwelt kümmern. Auf der anderen Seite stehen die national gesinnten und familienzentrierten Katholiken, die Migranten verunglimpfen und den Abbau von Ressourcen für ein Gebot Gottes halten. Nicht umsonst stimmte die Hälfte der US‑Katholiken bei der letzten Wahl für Donald Trump. Ob die Aussöhnung gelingt, ist völlig offen. Dabei pflegt der Vizepräsident der USA, JD Vance, der vor einigen Jahren zum Katholizismus übergetreten ist, ein nationalistisches Kirchenverständnis, nach dem die Nächstenliebe stufenweise angeordnet ist: Zunächst gelte es, seine Familie zu lieben, dann die Nachbarschaft, dann Amerika und schließlich den Rest der Welt. Immerhin rüffelte Kardinal Prevost, der später Papst Leo XIV. wurde, ihn im Februar 2025 öffentlich, indem er ihm ausrichtete, Nächstenliebe kenne keine Rangordnung. Überhaupt gelang dem Konklave ein schlauer Schachzug, indem es die ultrakonservativen Katholiken in den USA, die das Amt von Franziskus stets behindert haben, durch einen sozial‐progressiven Amerikaner kaltstellte. Jedenfalls zollte der Vizepräsident der USA ihm als Amerikaner pflichtschuldig Respekt nach dessen Inthronisation, obwohl er die universalen Werte der Kirche bestreitet.
Welchen Kurs Papst Leo XIV. für die Kirche einschlagen wird, ist noch weitgehend unbekannt. Was man aber jetzt schon sagen kann: Er muss sich mit dem Vermächtnis seines Vorgängers auseinandersetzen. Wie verhält sich der neue Papst zum Erbe von Papst Franziskus? Jeder Papst hat ein Leitmotiv, das sein gesamtes Pontifikat durchzieht. Es ist noch zu früh, um ein solches für das Pontifikat von Leo XIV. herauszukristallisieren. Europa wird es nicht sein, so viel ist jetzt schon klar. Das unterscheidet ihn sowohl von Papst Johannes Paul II. als auch von Papst Benedikt XVI.: Der polnische Papst machte die Freiheit vom kommunistischen Joch in Osteuropa zur Signatur seiner Amtszeit, genauso wie der deutsche Papst den Kampf gegen den Relativismus der säkularen Gesellschaften Europas. Mit Franziskus wurden Leitmotive, die den Fokus auf Europa legen, obsolet. Sein Leitmotiv war das Schicksal der Armen angesichts des Systems weltweiter Ungleichheit. Dabei hatte er nicht nur die globalen Klassenverhältnisse im Blick, sondern vielmehr die Ausgegrenzten und Marginalisierten: diejenigen, die ihr Leben im informellen Milieu der Großstädte fristen; diejenigen, die als Landarbeiter oder als Mitglieder traditioneller Gemeinschaften sozial deklassiert werden. Es war spektakulär, die Armen und Machtlosen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, in den Mittelpunkt der kirchlichen Verkündigung zu stellen! Es bleibt abzuwarten, wie Leo XIV. mit dem Vermächtnis von Franziskus umgehen wird.
Dieses Büchlein kann unmöglich den ganzen Franziskus charakterisieren. Das wäre ein unermessliches Unterfangen. Weder seine Christologie oder Ekklesiologie noch die Kurienreform oder die Behandlung der Missbrauchsfälle spielen in diesem Buch eine Rolle. Im Zentrum des Interesses steht stattdessen das sozialökologische Erbe von Papst Franziskus. Sein Lebensthema waren die Empörung über Ungerechtigkeit in Lateinamerika und in der Welt sowie die Ermunterung der Armen, die eigene Kultur in Selbstbestimmung zu leben. Erst viel später, im Seniorenalter, kam ihm das Verständnis für Ökologie, als er erkannte, wie sehr sich das Los der Armen durch die Erderwärmung und den anwachsenden Artenschwund verschlechtern würde. So wurde er unerwartet zu einem Champion der Umweltpolitik und ist der bisher einzige Papst, der den Schutz der Erde zum Hauptanliegen gemacht hat. Vor allem die Enzyklika Laudato si’ ist ein unzweideutiger Aufruf zur sozialökologischen Transformation der Gesellschaft. Dabei stieß sie mehr außerhalb als innerhalb der Kirche auf Resonanz, was Papst Franziskus’ Reputation als Global Player ungemein vermehrte. Trotz aller heuchlerischen Ehrenbezeugungen war diese ökosoziale Linie des Papstes höchst umstritten und hat zu den Grabenkämpfen in der katholischen Kirche beigetragen. Beispielsweise haben die christdemokratischen Parteien Europas und der Welt – sofern es diese noch gibt – heutzutage einen antipäpstlichen Kurs eingeschlagen: Sie verstärken durch politische Maßnahmen die soziale Ungleichheit und die Umweltzerstörung.
Drei Artikel befinden sich im Buch. Zwei davon wurden vor einigen Jahren verfasst, der dritte und längste im April 2025. Sie wurden aus der Perspektive eines Umwelt‐ und Sozialwissenschaftlers geschrieben, nicht aus der eines Theologen – abgesehen davon, dass der Autor ein Theologiediplom vorweisen kann. Zum einen äußerte Papst Franziskus sich häufig zur Entwicklung der Armen Welt und stellte dabei den europäischen Fortschrittsglauben kritisch bloß, wobei er über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen weit hinausging. Der Artikel »Papst vs UNO. Über den Aufstieg und Niedergang des Entwicklungszeitalter« geht darauf ein. Daneben wagte sich Franziskus auf das glitschige Feld der Weltpolitik vor. Mit seiner Enzyklika Fratelli tutti. Über die Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft umriss er die Ethik eines Miteinanders in der Einen Welt. Dabei kamen – überraschenderweise – die Krise der Bewohnbarkeit der Erde und die Kluft zwischen Reich und Arm zu kurz. Der Artikel »Fratelli tutti im Schatten des Anthropozän« versucht, dies zu ergänzen. Schließlich nimmt sich der Artikel »Revolutionär oder doch Reaktionär? Zum Vermächtnis von Papst Franziskus« vor, zusammenfassend das sozialpolitische Profil des verstorbenen Papstes zu zeichnen. Dabei spielt es weniger eine Rolle, ob er progressiv oder konservativ ist – Franziskus war beides zugleich –, sondern wie er beides zusammenhält. Ein sozialökologischer Konservativer ist derzeit eine Seltenheit. Was damit zu tun hat, dass Franziskus keine eurozentrische Weltsicht hatte. Er hatte eine im Wortsinn katholische, also wahrhaft weltumspannende Weltsicht.
Nicht wenige moralisch aufgeklärte Zeitgenossen warten darauf, dass Leo XIV. sein Blatt mit Schriftzeilen füllen wird. Wird er der Kirchenreformer sein, der zu sein sich Franziskus nicht traute? Wird er eine Perspektive für die säkulare Moderne finden und gleichzeitig für die arme Welt, in der die Sekten Auftrieb haben? Wird er ein Ökumeniker sein, der die Christenheit wieder zusammenführt? Viele Fragen, wenige Gewissheiten. Handgreiflicher ist es, ihn nach seiner Kontinuität zu fragen: Wie verhält sich Leo XIV. zum sozialökologischen Erbe von Franziskus? Das könnte der Prüfstein sein.
Papst vs UNO Über den Aufstieg und Niedergang des Entwicklungszeitalters1
Diplomaten, Würdenträger und Elitesoldaten versammelten sich an der Gangway des eben gelandeten Airbus von Alitalia in Washington. Vertraut war die Szenerie von unzähligen Fernsehbildern, nicht so ganz gewöhnlich war der Gast: Papst Franziskus wurde von Präsident Obama und seiner Frau Michelle am 22. September 2015 zu seinem ersten USA‐Aufenthalt begrüßt. Verblüffend war jedoch sein Auto – ein Fiat 500L! Die Reporter vor Ort waren bass erstaunt, und erst recht für die Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen war das eine Sause: Unter den schweren und gepanzerten Limousinen und SUVs, die an das Flugfeld gekommen waren, saß der Papst im winzigsten Wagen! Selten ist die Parade der Limousinen so sehr ins Lächerliche gezogen worden wie durch den Aktionskünstler aus Rom. Provokation pur, aber ein Zeichen war gesetzt. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit hat Franziskus deutlich gemacht, was seine Strategie ist: die Offensive der Bescheidenheit.
Der Papst kam auch nach New York, um vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen. Das war keine Routinesitzung im schlanken Büroturm am East River, sondern die Staatschefs aus aller Herren Länder kamen zusammen, um die Agenda 2030 für die Vereinten Nationen zu verabschieden. Als deren Kernstück wurden die Sustainable Development Goalsunter Hochstimmung und einer Prise Selbstgefälligkeit beschlossen. Die Rede des Papstes wurde mit Spannung erwartet, immerhin hatte er drei Monaten zuvor mit der Enzyklika Laudato si’ einen Coup bei der Weltöffentlichkeit gelandet. Beide Dokumente adressieren globale Entwicklungsprobleme, indem sie Armut, Wohlstand und die Biosphäre in den Mittelpunkt stellen. Worin bestehen die Gemeinsamkeiten, worin die Unterschiede dieser Dokumente? Vor allem: Sind die Vereinten Nationen und der Vatikan noch immer dem Leitbild Entwicklung verpflichtet? Oder gehen sie darüber hinaus und zählen sich zu den Vertretern des Post‐Development?
Das Paradigma der Entwicklung
Man erinnere sich: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts thronte ganz selbstverständlich das Leitbild der Entwicklung wie ein mächtiger Herrscher über den Nationen der südlichen Hemisphäre. Vom Kolonialismus befreit, waren die Gesellschaften Afrikas, Asiens und auch Lateinamerikas bereit, die Verheißungen der Entwicklung zu glauben. Es war das weltpolitische Programm der postkolonialen Ära. Unschuldig kam der Begriff daher, aber er hat es in sich: Als eine Art mentaler Infrastruktur hat er den Weg für die imperiale Macht des Westens über die Welt geebnet. Wie im Westen, so auch auf Erden, so lautete, kurz gefasst, die Botschaft der Entwicklung.2
Wann hat das Entwicklungszeitalter angefangen? Der amerikanische Präsident Harry S. Truman mag als Bösewicht herhalten. In der Tat, am 20. Januar 1949 bezeichnete er in seiner Antrittsrede vor dem Kongress die Heimat von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung als »unterentwickelte Gebiete«. Mit dieser Rede war das Entwicklungszeitalter eröffnet – jene Periode der Weltgeschichte, die auf das unselige Kolonialzeitalter der europäischen Mächte folgte. Das Entwicklungszeitalter dauerte etwa 40 Jahre und wurde von der Epoche der Globalisierung abgelöst. Und derzeit gibt es wieder eine Zäsur: den Aufschwung des Nationalpopulismus.
Worin bestand die Idee der Entwicklung?3





























