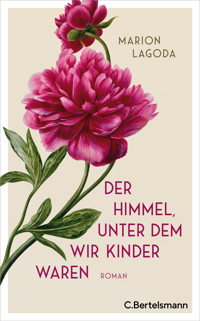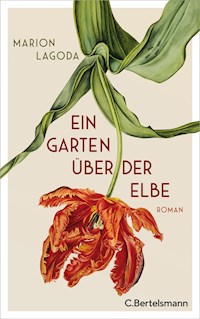
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Atmosphärisch und eindrücklich – eine Frau verwirklicht ihren Traum eines Gartens hoch über der Elbe, der später weltberühmt wird
Hamburg, 1913: Als Hedda ihre Stelle als Obergärtnerin bei der jüdischen Bankiersfamilie Clarenburg antritt, hat sie es nicht leicht. Auf dem parkähnlichen Anwesen oberhalb der Elbe ist sie die erste Frau auf diesem Posten und wird von den ausschließlich männlichen Kollegen entsprechend kritisch beäugt. Auch körperlich wird ihr viel abverlangt, denn das Anwesen über der Elbe ist riesig, und der Erste Weltkrieg fordert ihr gärtnerisches Können noch einmal besonders heraus. Trotzdem gelingt es Hedda, hier ihren gärtnerischen Traum zu verwirklichen – bis hin zum Amphitheater im römischen Stil, das zum Mittelpunkt prachtvoller Feste und Theateraufführungen wird. Doch als sich in den 1930er Jahren die Zeiten verdüstern, geraten sowohl Hedda, die jüdische Vorfahren hat, als auch die Familie Clarenburg immer mehr in Bedrängnis.
Lebendig und mit faszinierenden Pflanzenbeschreibungen erzählt Marion Lagoda das Leben der Frau nach, deren wahrer Name Else Hoffa lautete und die als Obergärtnerin der Familie Warburg den berühmten Römischen Garten in Hamburg-Blankenese anlegte.
Inspirierend und kenntnisreich – das ideale Geschenk für Gartenliebhaber*innen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Hamburg, 1913: Als Hedda ihre Stelle als Obergärtnerin bei der jüdischen Bankiersfamilie Clarenburg antritt, hat sie es nicht leicht. Auf dem parkähnlichen Anwesen oberhalb der Elbe ist sie die erste Frau auf diesem Posten und wird von den ausschließlich männlichen Kollegen entsprechend kritisch beäugt. Auch körperlich wird ihr viel abverlangt, denn das Anwesen über der Elbe ist riesig, und der Erste Weltkrieg fordert ihr gärtnerisches Können noch einmal besonders heraus. Trotzdem gelingt es Hedda, hier ihren gärtnerischen Traum zu verwirklichen – bis hin zum Amphitheater im römischen Stil, das zum Mittelpunkt prachtvoller Feste und Theateraufführungen wird. Doch als sich in den 1930er Jahren die Zeiten verdüstern, geraten sowohl Hedda, die jüdische Vorfahren hat, als auch die Familie Clarenburg immer mehr in Bedrängnis.
Kenntnisreich, lebendig und mit faszinierenden Pflanzenbeschreibungen erzählt Marion Lagoda das Leben der Frau nach, deren wahrer Name Else Hoffa lautete und die als Obergärtnerin der Familie Warburg den berühmten Römischen Garten in Hamburg-Blankenese anlegte.
Autorin
Marion Lagoda ist im Bergischen Land aufgewachsen und studierte Kunstgeschichte, bevor sie ein Volontariat bei der Rheinischen Post begann. Sie arbeitete als Journalistin u.a. für die Frankfurter Rundschau und spezialisierte sich später auf die Themen Natur und Garten. Sie ist Autorin zahlreicher Gartenbücher und schreibt Gartenreportagen für verschiedene Magazine. Marion Lagoda hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Marion Lagoda
Ein Garten über der Elbe
Roman
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 C. Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © Natural History Museum,
London/Bridgeman Images;
Lucky Team Studio/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25585-5V004
www.cbertelsmann.de
»… das ganze Land ist reizend«, erwiderte er, »und es ist gut da wohnen, wenn man von den Menschen kommt, wo sie ein wenig zu dicht aneinander sind, und wenn man für die Kräfte seines Wesens Tätigkeit mitbringt. Zuweilen muss man auch einen Blick in sich selbst tun. Doch soll man nicht stetig mit sich allein auch in dem schönsten Lande sein; man muss zuzeiten wieder zu seiner Gesellschaft zurückkehren …«
Adalbert Stifter, Der Nachsommer
Prolog
Als sie später an die Jahre bei den Clarenburgs zurückdachte, erschien ihr diese Zeit wie ein langer, ferner Traum. Dann und wann, wenn sie den Duft einer Alba Maxima oder einer Maiden’s Blush wahrnahm, kam eine flüchtige Erinnerung an Adeles Rosengarten. Und sah sie im Old Vic Shakespeares Sommernachtstraum, dachte sie unwillkürlich an die Aufführungen von Tommy, Lilly und Ida und ihren Freunden in dem kleinen Amphitheater hoch über dem Fluss; an Adele, wie sie hoheitsvoll die Gäste begrüßte; an Ludwig, der die Besucher in seiner gewohnt launigen Art zu der runden Naturbühne führte; an diese verzauberten Abendstunden, wenn die bleiche Schleiereule ihre Kreise über Titanias Feenreich zog und die Mondviolen im Dunklen leuchteten.
Einmal noch hatte sie den Garten tatsächlich besucht. Das war lange nach dem Krieg gewesen. Und obwohl sie sich geschworen hatte, nie wieder einen Fuß in dieses Land, in diese Stadt zu setzen, die einst sie selbst und die Clarenburgs ins Exil und Ben und Hannah in den Tod getrieben hatten, war sie doch neugierig gewesen. Sie wollte sich ihr Werk noch einmal anschauen.
Im Nachhinein wünschte sie, sie hätte es gelassen. Der Ort war verwüstet, der Rosengarten gerodet. Die feinen Abstufungen des Amphitheaters waren unter dem viel zu hohen Gras kaum mehr auszumachen, die Terrassenbeete nur ansatzweise erkennbar. Allein die Girlandenhecke erhob sich wie eh und je majestätisch über der Elbe, penibel geschnitten und den Verwerfungen ringsum gegenüber gleichgültig scheinend.
Sie hatte den Gastgebern gegenüber ein paar freundliche Worte gefunden. Sie hatten es gut gemeint und gedacht, sie täten ihr einen Gefallen mit der Einladung. Dann war sie voller Trauer zurückgekehrt nach England, ihrem neuen Zuhause, in dem sie sich auch nach zwanzig Jahren nicht heimisch fühlte.
Sie hatte hier andere Gärten angelegt und gehegt. Doch nie wieder hatte sie sich so eins gefühlt mit einem Ort wie damals auf dem weitläufigen Anwesen der Clarenburgs. Sie dachte jetzt häufiger an diese Zeit. Eine Sache des Alters vermutlich. Dinge, die lange zurücklagen, traten jetzt wieder deutlicher zutage. Sie erinnerte sich an im Grunde unwichtige Details, die sich dennoch in ihr Gedächtnis gebrannt hatten, scheinbare Belanglosigkeiten, die ihr in den vorangegangenen Jahrzehnten entfallen waren: an Adeles blütenweiße Garderobe, die sie ausschließlich zu ihren Gartensoireen trug; an das Grübchen in Renatas Kinn; an das magische Licht während der gestohlenen Stunden mit Lorenz; an Siggi Wermuths leichtes Stottern, wenn er aufgeregt war; an Bens Zigarettenetui mit dem elegant verschnörkelten Monogramm; an Sonnenuntergänge, die sich kupferrot, silbergrau, orange glühend auf dem Fluss spiegelten, und Vollmondnächte, die die Wellen wie Diamanten funkeln ließen; an das immer etwas glucksende Lachen von Hannah; Hannah, ihre goldlockige Hannah …
Die Erinnerungen waren geblieben. Und dann und wann geschah es sogar, dass sie ohne Wehmut, ohne Groll zurückdenken konnte. Dann war sie dankbar, dass sie diese Zeit erleben durfte, diese fünfundzwanzig Jahre, die schönsten ihres Lebens.
1
Es war ein ungewöhnlich warmer und freundlicher Tag Ende April des Jahres 1913, als sie ihren Dienst bei den Clarenburgs antrat. Die Obstbäume blühten, als gäbe es kein Morgen, und streuten ihre weißen und rosafarbenen Blütenblätter wie Konfetti auf die Straßen. Die Tulpen in den Vorgärten prangten in all ihren Ostereierfarben. Überall nahm sie eine schier überschäumende, knospende Vegetation wahr.
Sie schaute aus dem Fenster der Kutsche und registrierte, je länger sie fuhren, vor allem haushohe Eibenhecken und immer wieder mächtige Rhododendronpflanzungen, die die Grundstücke rechts und links der stillen Villenstraße begrenzten. Die Knospen mancher der ausladenden Gehölze waren bereits kurz davor aufzubrechen. In ein, zwei Wochen würde das fantastisch aussehen, und für eine kurze Zeit würde man sich fühlen wie in einem Hain aus Edelsteinen. Danach würden diese blickdichten grünen Wände wieder wie ein Schutzwall wirken. Abweisend und undurchdringlich würden sie ihre Aufgabe für alle klar erkenntlich und bestens erfüllen, nämlich die Gärten und die herrschaftlichen Häuser dahinter vor den zudringlichen Blicken des gemeinen Volkes zu verbergen.
Sie verwarf diesen Gedanken. Sie war noch nicht einmal an ihrem Bestimmungsort angekommen, und schon hegte sie böse Vermutungen. Lass dir Zeit, ermahnte sie sich. Schau dir alles in Ruhe an und hab Geduld mit den Menschen. Vor allem das: Geduld mit den Menschen und dann und wann ein wenig Nachsicht.
Sie war am frühen Morgen in Berlin aufgebrochen. In Hamburg angekommen, war sie mit der Vorortbahn Richtung Westen in das am Elbhang liegende Fischerdorf Blankenese gefahren und dort von der hauseigenen Kutsche abgeholt worden. Zwei Koffer, ein Korb mit Reiseproviant, mehr hatte sie nicht dabei. Ihre Notizblöcke, Schreibstifte, Zeichen- und Malutensilien, die Bücher sowie ihre botanischen Nachschlagewerke hatte sie vor einigen Tagen an die neue Adresse geschickt. Ihr künftiger Arbeitgeber bezahlte alles.
Langsam gingen die Rhododendren in eine waldige Parklandschaft über. Die Kutsche bog nach links in einen breiten Seitenweg ab und nach etwa einem Kilometer wieder nach links, wo der Weg in einen runden Vorplatz mündete. Sie hielten vor dem Portal eines weitläufig aussehenden Hauses aus rotem Backstein. Links davon nahm sie eine Remise und Pferdeställe wahr, rechts war ein kleineres, zweistöckiges Gebäude zu sehen, vermutlich das Wohnhaus für das Personal.
Der Kutscher hielt ihr die Tür auf und bot ihr die Hand zum Aussteigen. Er war ein untersetzter Mann mit grauem Haar und freundlichen Augen. »Gehen Sie ruhig ins Haus, Fräulein. Herr Clarenburg erwartet Sie. Ihr Gepäck bringe ich schon mal ins Gärtnerhaus«, sagte er.
Sie fühlte sich verschwitzt und schmutzig von der Reise und hätte sich gern die Hände gewaschen, bevor sie dem Hausherrn gegenübertrat. Aber das war wohl auf die Schnelle nicht möglich.
Als sie auf das klassizistisch anmutende Portal zutrat, kam ihr ein Mann raschen Schrittes aus dem Haus entgegen.
»Sie sind Fräulein Herzog, nicht wahr, Flora Hedwiga Herzog«, sagte er und hielt ihr schon beide Hände entgegen. »Ich bin Ludwig Clarenburg. Herzlich willkommen in Blankenese. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise.« Sein breites Lächeln zog sich über das ganze Gesicht, ein sympathisches Gesicht, wie sie fand. Hochgewachsen, kräftig, mit sich bereits lichtendem schwarzen Haar, dem breiten Schnurrbart und der lebhaften Attitüde wirkte er nicht gerade so, wie sie sich einen hanseatischen Bankier vorgestellt hatte. Aber was wusste sie schon? Solche Leute kannte sie nicht, hatte sie nie gekannt.
Ohne Umschweife fasste er sie galant am Ellbogen und führte sie ins Haus. »Kommen Sie, kommen Sie. Wir gehen in mein Arbeitszimmer. Da können wir uns unterhalten.«
Sie fühlte sich leicht überwältigt vom Überschwang des Hausherrn, der sie im Eiltempo durch die repräsentative Eingangshalle in sein Arbeitszimmer führte, einen behaglichen Raum mit eichengetäfelten Wänden und Bücherregalen bis unter die Decke sowie einem ausladenden Schreibtisch.
»Nehmen Sie doch Platz«, sagte er, während er ihr einen bequemen Stuhl vor dem Schreibtisch zurechtrückte und sich selbst dahintersetzte.
Er überflog ganz kurz die vor ihm liegenden Papiere und schaute sie dann freundlich an.
Sie schaute abwartend zurück.
Wie nahm er sie wahr, was sah er? Eine schmale, groß gewachsene Frau Ende zwanzig mit dichtem kastanienrotem Haar, unter einem breitrandigen Hut aufgesteckt, und einer sehr hellen, fast durchsichtig wirkenden Haut. Große graugrüne Augen, die ihn wachsam musterten. Ihre Haltung war sehr gerade, die Kleidung durchaus elegant, aber sichtlich abgetragen.
Er betrachtete sie lange. Sie schaute schweigend zurück. Ein ironischer Zug erschien um ihre Mundwinkel und ein kurzes Aufblitzen in ihren Augen.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte sie schließlich. »Ich bin ziemlich belastbar.« Sie lächelte zum ersten Mal, seit sie sich kennengelernt hatten. Und zum ersten Mal hörte er auch ihre Stimme, eine ungewöhnlich dunkle Stimme, leicht rauchig.
Er lachte. »Na ja, nichts für ungut. Meine Frau stammt wie Sie aus Würzburg und kannte noch die Gärtnerei Ihres Vaters«, erklärte er. »Sie war immer sehr angetan von seiner Arbeit und hat von Verwandten gehört, dass Sie in seine Fußstapfen getreten sind. Und dann Ihre Ausbildung in Berlin … Ich habe mich natürlich erkundigt. Ihre Referenzen sind tadellos.« Clarenburg schaute noch einmal auf das Empfehlungsschreiben der Königlichen Gärtnerlehranstalt.
»Ich habe da nur wenige Monate hospitiert«, erklärte sie.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Clarenburg. »Aber Ihren Lehrern scheinen Sie dennoch aufgefallen zu sein.«
»Ich war eine von zwei Frauen dort«, bemerkte sie trocken.
Clarenburg blickte auf und sah sie aufmerksam an. »Verstehe«, sagte er. Er lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. »Sehen Sie, ich halte es für eine große Verschwendung, das Potenzial und die Kreativität von Frauen so außer Acht zu lassen, wie das im Moment noch geschieht«, fuhr er fort. »Doch seien Sie versichert: Die Zeiten ändern sich. Meine vier Töchter werden alle aufs Lyzeum gehen und studieren, wenn sie das denn wollen. Auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, dass sie einen Beruf ergreifen, um zumindest finanziell unabhängig von einem männlichen Wesen zu sein. In der Zwischenzeit schauen wir erst mal, was wir hier für Sie tun können.«
Dann stand er auf. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr neues Domizil. Henry hat Ihr Gepäck sicher schon ins Gärtnerhaus gebracht.«
»Vielen Dank. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich auch gern gleich den Garten sehen.«
»Sicher, ich habe noch eine Stunde Zeit. Ich zeige Ihnen erst einmal die Südterrasse, den Bereich, für den ich Sie hauptsächlich habe kommen lassen. Den Rest können wir vielleicht in den nächsten Tagen anschauen. Ein Gang über das gesamte Grundstück braucht schon eine Zeit lang.«
»Das ist sehr freundlich, aber ich kann das auch alleine machen. Sie haben sicher genug zu tun, und ich schaue mir gern alles in Ruhe an.«
Er überging die deutlich zum Ausdruck gebrachte Abfuhr mit Nonchalance. »Gut. Dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr Haus, und dann gehen wir zur Südterrasse.«
»Könnte ich mich vorher kurz frisch machen und mir andere Schuhe anziehen?«, fragte sie.
»Ja natürlich, und das mit den Schuhen ist sicher sinnvoll. Kommen Sie«, forderte er sie auf.
Das Gärtnerhaus, unterhalb des auf einer Anhöhe errichteten Haupthauses gelegen, sollte ihr alleiniges Refugium sein. Das hatte man ihr schon geschrieben. Clarenburg ging mit ihr durch die Vorhalle mit einer in den ersten Stock führenden, geschwungenen Treppe und vorbei an einem lichten Salon. Bei einem kurzen Blick durch die halb geöffneten Schiebetüren sah sie einen offenen Kamin mit davorstehenden, zwanglos gruppierten Sesseln, helle Wände, Stuckdecken von zierlicher Eleganz und weiß gestrichene Möbel, dazu leichte Vorhänge. Es gab einen Flügel und zwei bequem aussehende Polstersofas zwischen den Fensterfronten. Alles atmete großbürgerliche Gediegenheit, aber auch etwas herrschaftlich Festliches wehte durch die Räume.
Unmittelbar neben dem Salon führte eine gläserne Tür nach draußen, sodass man schon von der Diele aus auf die dahinterliegende Szenerie schauen konnte. Eine lang gezogene, überdachte Terrasse bildete eine Art Laubengang, der sich in den anschließenden Wiesenhang schob. Jeweils sechs bis zum Boden gezogene Rundbögen auf beiden Seiten gaben den Blick nach Osten und Westen frei. Rosen- und Glyzinienranken kletterten an den Pfeilern empor, und von der Decke hingen mit Farnen bepflanzte Körbe, gerade so hoch, dass eine groß gewachsene Person wie Clarenburg problemlos darunter hinwegschreiten konnte. Ein paar Deckchairs waren auf dem hellen Sandsteinboden verteilt.
Sie bemühte sich, ihr Entzücken über das Ambiente im Zaum zu halten. Sie brach auch nicht in Begeisterungsstürme aus, als sie die Treppe am Ende der Terrasse erreichten, wo man über die Kronen der weiter hangabwärts stehenden Bäume hinweg den Lauf der Elbe mehrere Kilometer weit überblicken konnte. Vage nahm sie den Salzgeruch des nahen Meeres wahr.
Clarenburg geleitete sie über den Rasenhang nach links hin zu einem Rhododendronwäldchen, durch das ein abwärts führender, verschlungener Weg zu einem unauffälligen Fachwerkbau führte. Eine große Eberesche und einige Hortensienbüsche flankierten das Haus nach Südosten hin. In einem kleinen Anbau lagerten Holzvorräte. Neben der Eingangstür kletterte ein Jelängerjelieber fast bis unters Dach, und unmittelbar an der Vorderfront machte sie die ersten Triebe von Stockrosen und breite Bänder von bereits blühenden Vergissmeinnicht aus. Nach Norden hin stieg der Hang schon wieder leicht an.
Hinter dem Haus zog sich ein planiertes Areal weithin Richtung Osten. Es bot Platz für zwei große Gewächshäuser samt Frühbeetkästen, einen Geräteschuppen sowie einen daran anschließenden ausgedehnten Gemüsegarten. Er bestand aus einem Dutzend quadratisch angeordneter Beete, die durch gepflasterte Wege säuberlich voneinander getrennt waren, und wurde gen Osten von einer mit Spalieren versehenen Ziegelmauer begrenzt. In den vorderen Kompartimenten machte sie noch die letzten vor sich hin trocknenden Rosenkohlstrünke aus. Sie sah ein Spargelbeet, in dem sich die grünen Spitzen ans Licht schoben, und in einigen der hinteren Partien schnurgerade Reihen mit bereits ausgesäten Bohnen, Zwiebeln und Möhren. »Von da beziehen wir einen großen Teil unserer Früchte und des Gemüses«, erklärte Clarenburg. »Auf dem nördlichen Teil des Grundstücks gibt’s noch eine Obstwiese. Das werden Sie ja dann alles noch sehen.«
Dann wandten sie sich um zur Schwelle des Gärtnerhauses. Die Tür war unverschlossen. Sie traten ein, ihr Gepäck stand in der kleinen Diele. Clarenburg zog einen Schlüssel aus seiner Westentasche und reichte ihn ihr. »Das ist nun Ihr neues Zuhause. Ich hoffe, es gefällt Ihnen und Sie fühlen sich wohl.«
»Gewiss«, sagte sie unbestimmt und schaute sich verstohlen um.
»Das Bad ist im ersten Stock, direkt unter dem Dach. Da ist auch Ihr Schlafzimmer«, erklärte Clarenburg. »Hier links ist die Wohnstube und rechts die Küche.«
Sie schaute kurz in die Stube und sah einen Eichenholzfußboden und weiße Wände, einen offenen Kamin und noch leere Bücherregale, die bis zu den Deckenbalken reichten. Ein großer Holztisch stand in der Mitte, darauf eine Vase mit wilden Hyazinthen, die ihren süßherben Duft verströmten. Mehrere Stühle und Sessel waren im Raum verteilt. Ein Sofa stand links der Tür, ein kleiner Beistelltisch vor den Sprossenfenstern, die die Aussicht auf den Fluss freigaben. Ein Blick in die Küche offenbarte einen Kohleherd, einen blank gescheuerten Holztisch, vier Stühle sowie eine ganze Wand mit Einbauschränken und -regalen.
»Geschirr, Besteck, Töpfe, Küchenutensilien. Alles da«, sagte Clarenburg.
»Vielen Dank«, sagte sie. »Verzeihung. Ich bin gleich wieder da.«
Und schon war sie an der Treppe und verschwand kurz darauf samt einem der beiden Koffer in den oberen Gemächern.
Links der Treppe lag ein geräumiges Zimmer mit Gaubenfenster. Auch hier gab es einen Kamin. Auf dem großen Doppelbett war ein kunstvoll gearbeiteter Quilt ausgebreitet, am Fenster stand eine Frisierkommode. Dazu gab es einen schlichten Kleiderschrank und zwei Sessel. Auf dem Holzboden lag ein bunter Kelim. Sie lächelte. Gut möglich, dass sie sich hier wohlfühlen würde.
Sie ging in das Badezimmer rechts der Treppe und wusch sich Hände und Gesicht. Das Bad war nicht groß, bot aber Platz für ein Wasserklosett und eine Badewanne mit Löwenfüßen. Ein Holzofen würde heißes Wasser spenden.
Im Schlafzimmer streifte sie sich die geknöpften Stiefeletten von den Füßen, holte ihre knöchelhohen Arbeitsschuhe aus dem Koffer und zog sie an. Sie schloss für einen Moment die Augen und atmete einmal tief durch. Es war ein langer Tag gewesen, und er war noch nicht zu Ende. Sie war erschöpft, doch sie freute sich auch auf den bevorstehenden Gang zu ihrer künftigen Arbeitsstelle. Dann raffte sie sich auf.
Falls Clarenburg zwischenzeitlich Zweifel an der Entscheidung gekommen waren, diese stille, junge Frau als Obergärtnerin für sein Anwesen zu verpflichten, so ließ er es sich nicht anmerken. Als sie mit Sonnenhut und kräftigen Schnürschuhen ausgerüstet fünf Minuten später wieder die Treppe herunterkam, sah er ihr freundlich entgegen.
»Na, alles zu Ihrer Zufriedenheit?«, fragte er.
»Ja. Können wir gehen?«
»Los geht’s«, sagte er vergnügt.
Sie folgte ihm bergab auf einem sich schlängelnden Pfad. Sie fühlte sich jetzt deutlich wohler als im Haus. Beim Laufen, draußen unter freiem Himmel, war sie in ihrem Element.
Zunächst versuchte sie nur, sich den Weg einzuprägen und zu erfassen, wie lange sie von ihrem Haus bis zur Südterrasse brauchen würde. Sie überlegte, ob Clarenburg wohl einen Kommentar von ihr erwartete; zu seinem Haus, seinem Anwesen, dem Gärtnerhaus … Doch sie fühlte sich zu befangen. Ihr Selbstbewusstsein hatte sie an anderen Männern geschult; rauen Gärtnerburschen, von denen sie sich längst nichts mehr bieten ließ, und blasierten Lehrern der Landschaftsarchitektur, die meinten, Frauen seien für dieses Metier ungeeignet. Entspannte und unprätentiöse Herzlichkeit war ihr neu und verunsicherte sie zusehends.
So war sie noch ganz in Gedanken, als sie von dem unebenen Pfad hochschaute und die angestrebte Südterrasse erblickte – und stieß schließlich doch noch einen Laut der Überraschung aus.
»Diese Hecke …«, rief sie nur und lief schon voraus auf das recht großflächige Rasenplateau.
»Großartig, was?«, rief Clarenburg aufgekratzt und schaute ihr hinterher.
Doch sie war schon angekommen bei der Begrenzung dieses hin zum Fluss abfallenden Terrains, einer aufwendig in Girlandenform geschnittenen Thujahecke, gut hundert Meter lang, wie sie schätzte. Zwischen den mehr als ein Dutzend drei Meter hohen Heckensäulen verliefen bogenförmige Auslassungen, die den Blick auf den Fluss freigaben. Hingerissen betrachtete sie die kunstvollen Bögen, das faszinierende Licht- und Schattenspiel.
»Wie kommt die hierhin?«, fragte sie verzückt und ein bisschen töricht, wie sie sogleich erkannte. Aber sie war völlig in Bann gezogen von der Akkuratesse dieser grünen Architektur, die sie in diesem Teil des Landes nie erwartet hätte.
»Die hat noch unser Vorgänger hier angelegt«, erklärte Clarenburg. »Der liebte Italien und die italienischen Gärten. Ich schätze mal, er wollte ein bisschen was von der südlichen Atmosphäre hier in den Norden tragen. Und unsere Familie stammt ja auch ursprünglich aus Italien. Ist zwar schon vierhundert Jahre her, seit wir von dort nach Deutschland umgesiedelt sind, aber diese Sehnsucht nach dem Süden wird uns wohl nie so ganz verlassen.« Er hielt kurz inne. »Na ja, scheint andererseits auch typisch deutsch zu sein. Wie auch immer: Der überwiegende Teil des Anwesens orientiert sich ja eher am englischen Landschaftsgarten, aber dieser Bereich ist ganz und gar italienische Renaissance. Die Bäume, die hier am Rand wachsen, sind Kalifornische Flusszedern, sehen aber aus wie Zypressen. Ist doch alles wie in Italien. Wir nennen dies daher auch manchmal unsere römische Terrasse. Und der Blick auf die Elbe ist fast wie der aufs Mittelmeer, finden Sie nicht?« Er sah sie abwartend an.
»Ja«, sagte sie und verkniff sich ein Grinsen. »Fast.«
Er lachte. »Wir müssen uns halt mit dem zufriedengeben, was wir haben. Und diese Hecke ist doch wirklich etwas Besonderes. Sie muss mal wieder geschnitten werden. Aber darum werden Sie sich dann ja kümmern.«
Sie schaute sich weiter auf dem Gelände um. Sie sah zwei alte baufällige Weinhäuser und einen Schuppen auf dem Ostteil und auf der gegenüberliegenden Seite ein Wäldchen, das sich weithin erstreckte und in die Parklandschaft überging. Nach Norden hin lag der bewaldete Hang mit einem breiten Streifen vernachlässigter Obstgehölze in seinem unteren Bereich.
»Sehen Sie, dieser Berg hier muss gestaltet werden«, erklärte Clarenburg ihrem Blick folgend. »Das ganze Strauchwerk muss weg. Ich möchte hier Blumen haben, jede Menge Blumen. Ich setze da große Hoffnungen in Sie. Aber bei Ihrem Namen dürfte ich kaum enttäuscht werden«, fügte er lächelnd hinzu.
Sie schaute ihn irritiert an, dann verstand sie. »Oh, Sie meinen Flora. Ich werde Hedda genannt.«
»Warum? Flora passt doch vorzüglich zu einer Gärtnerin«, rief er aus.
»Etwas vermessen, oder?«, gab sie knapp zurück. »Nennen Sie mich Hedda.«
Er schaute sie verwundert an und wirkte leicht indigniert.
»Gut, wenn Sie mögen«, sagte er.
Sie wusste, dass ihr Talent, sich ins eigene Fleisch zu schneiden, bemerkenswert war. Doch ihrer Erfahrung nach war es für alle Seiten unkomplizierter, wenn von Anfang an klar war, dass sie sich nicht alles gefallen ließ. So würde sie auch später ihre eigenen Vorstellungen problemloser umsetzen können. Und falls ihm das nicht gefiele, wäre Zeit genug, sich hier baldigst zu verabschieden und woanders eine neue Stelle anzutreten. Sie hatte noch zwei weitere Angebote bekommen.
Es würde ihnen beiden Zeit und Nerven sparen, wenn sie wussten, auf was und wen sie sich einließen. Sie hieß Hedda, auch wenn in ihrer Geburtsurkunde ein anderer Name stand.
Sie überließ Clarenburg seinen womöglich nicht gerade freundlichen Gedanken und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem Gelände. Die Häuser und den Schuppen würde man abtragen müssen. Den Hang könnte man terrassieren. Auf Anhieb stellte sie sich eine üppig bepflanzte Trockenmauer vor, dahinter eine Eiben- oder Thujahecke, diesmal geradlinig geschnitten, vor der sich die Farben der Blütengewächse effektvoll abhoben.
»Ich verstehe, was Sie meinen«, sagte sie schließlich. »Ich mache einen Plan.«
»Bestens«, erwiderte er nun wieder gut gelaunt. »Und hier«, fuhr er fort und schritt auf das Wäldchen an der Westseite zu. »Was halten Sie von einem Rosengarten? Meine Frau wünscht sich so sehr einen Rosengarten. Dafür müsste dieses Waldstück gerodet werden. Das ist klar. Aber Wald haben wir ja hier genug. Und hier auf dem Rasen, da hätten wir gern ein Seerosenbecken. So eines im italienischen Stil, damit es zur Hecke passt. Ginge das?« Er schaute sie an, fragend und ein kleines bisschen unsicher zwar, doch gleichzeitig auch berauscht von seinen eigenen Gedankenflügen.
Sein Enthusiasmus rührte sie, und sie musste nun doch lächeln über seinen Eifer. »Sicher«, sagte sie. »Warum nicht?«
Die kommenden Tage verbrachte sie mit Wanderungen über das weitläufige Gelände. Die Umgebung erkunden, sichten, beobachten. Licht und Schatten wahrnehmen, dem Wind lauschen und dem Lauf der Täler folgen, ein Gespür bekommen für den Geist, die Seele eines Ortes: Dies alles galt es zu ergründen. Um dann zu entscheiden, wie man diesen Ort gestaltete. So hatte sie es gelernt. Und sie brannte darauf, das Gelernte umzusetzen. Dies würde ihr erster Garten sein, der erste, den sie mit- und zum Teil sogar umgestalten durfte. Als Obergärtnerin, als erste Obergärtnerin Deutschlands, soviel sie wusste. Keine der wenigen Frauen, die sie in diesem Metier angetroffen hatte – und es waren in der Tat sehr, sehr wenige –, hatte jemals zuvor solch eine Verantwortung getragen.
Aber zunächst musste sie sich einen Überblick verschaffen. Gleich am Tag nach ihrer Ankunft begann sie damit. Sie zog ihre Schnürschuhe an, setzte den Sonnenhut auf, packte eine Flasche mit Wasser, zwei Äpfel, Notizbuch und Stift in ihren Wanderrucksack und zog los.
Man hatte ihr Brot, Käse, Schinken, Eier, Obst, Kaffee und Tee ins Gärtnerhaus liefern lassen. Was sie sonst noch benötigte, konnte sie auflisten. Henry, der Kutscher und Diener Ludwig Clarenburgs, würde das Gewünschte bei seinen regelmäßigen Besorgungsfahrten mitbringen. Wenn sie wollte, konnte sie ihn auch begleiten. Und natürlich konnte sie für besondere Wünsche, etwa wenn sie Kleidung oder sonst etwas Persönliches benötigte, mit der Vorortbahn in die Stadt fahren.
Im Großen und Ganzen hieß das, dass sie einigermaßen autark leben würde. Das Mittagessen konnte sie gemeinsam mit den übrigen Bediensteten im Gesindehaus neben dem Haupthaus einnehmen – wenn sie das denn wollte, was vermutlich eher selten der Fall wäre. Ihre Kleidung würde im Haupthaus gewaschen werden, und eine der diversen Haushaltshilfen der Clarenburgs kam einmal in der Woche zum Saubermachen. Sie konnte sich also voll und ganz auf ihre gärtnerischen Verpflichtungen konzentrieren.
Clarenburg hatte sie am Tag ihrer Ankunft noch kurz seiner Frau Adele und seiner ihr unübersichtlich scheinenden, quirligen Kinderschar sowie den Hausangestellten vorgestellt. Dann hatte er sie sich selbst überlassen, was sie für ein gutes Zeichen hielt. Sie arbeitete gern selbstständig und ließ sich ungern reinreden.
Es war immer noch sehr warm für Ende April, und die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Sie folgte dem Pfad hangaufwärts Richtung Haupthaus, um dann abzubiegen und durch eine weitere herausgewachsene Rhododendronpflanzung den Hang hochzusteigen. Sie hatte ihre Kindheit in Mainfranken verbracht, in Würzburg, der alten Residenzstadt mit ihren Weinbergen und der sie umgebenden Mittelgebirgslandschaft. Größere Höhenunterschiede im Gelände war sie gewohnt. Aber hier, mitten in der Norddeutschen Tiefebene, ging dieser Hang schon als veritabler Berg durch und wurde von den Anwohnern auch so genannt.
Sie hatte die Chroniken der Liegenschaft studiert. Die Gletscher und Schmelzwässer der Eiszeiten hatten das Relief dieses Ortes geprägt. Drei Eisvorstöße hatten das Ufer des Stroms modelliert, an dessen Nordufer sich der Geestrücken fast achtzig Meter in die Höhe schob. Einst ein kahler, sandiger und nur mit Heidekraut bewachsener Hügelrücken, war er von diversen Besitzern im 19. Jahrhundert gemäß der damaligen Gartenmode nach und nach in einen weitläufigen Landschaftspark mit zum Teil exotischen Gehölzen verwandelt worden.
Sie sah einen Ginkgo etwas abseits auf einer kleinen Lichtung, ein ausgewachsener, breit ausladender Baum, fast zwanzig Meter groß, mit grauschrundiger Borke. Ein Ehrfurcht gebietendes Gewächs, das allen evolutionären Entwicklungen die Stirn geboten hatte und noch genauso aussah wie vor 250 Millionen Jahren. An einer anderen Stelle nahm sie eine Himalajabirke wahr, mit einem Stamm so weiß und glatt wie frisch poliertes Porzellan. Eine Bergkirsche prunkte bereits mit Blüten in einem pudrigen Rosé. Aber ihr gefiel vor allem der Stamm, so glänzend mahagonifarben, dass er selbst an trüben Wintertagen schimmerte wie eine frisch aus der Schale gefallene Rosskastanie.
In einigen Baumkronen hatten sich Misteln angesiedelt. Jetzt, wo die Bäume noch kahl waren, wirkten die immergrünen Gewächse mit den kugeligen weißen Früchten recht dekorativ. Auf Dauer würden die Schmarotzer dem Wirtsbaum den Garaus machen. Sie schrieb eine Notiz. Zur Weihnachtszeit würde sie einen Gutteil von ihnen entfernen lassen. Sie würden dann den Salon der Clarenburgs schmücken und die Familienmitglieder und deren Gäste zum Küssen verführen. So war es Brauch in England, wie sie von ihrer Freundin Elisabeth erfahren hatte. Man würde sehen, ob die Clarenburgs ihn kannten.
Bei ihrer Wanderung sah sie hin und wieder von fern Männer, die in dem waldigen Gelände mit Baumpflegearbeiten beschäftigt waren. Wenn sie sie bemerkten, hielten sie kurz inne, nickten ihr zu und arbeiteten dann weiter. Man schien auf ihre Ankunft vorbereitet zu sein.
Als sie fast schon am höchsten Punkt des Berges angelangt war, stieß sie auf ein langes, strohgedecktes, weiß getünchtes Holzhaus, das unter sechs hohen Linden auf einem ausgedehnten Plateau lag. Das Sommerhaus der Familie, Arche genannt. Das hatte sie dem Kartenmaterial entnommen, das Clarenburg ihr zur Verfügung gestellt hatte.
Durch ein sirrendes Geräusch irritiert, ging sie an den Bäumen vorbei hinter das Haus. Dort stand ein groß gewachsener, schlanker Mann und mähte mit einer Sense das Gras auf einer weitläufigen, zum Teil schon sauber getrimmten Rasenfläche. Er stand mit dem Rücken zu ihr, nur mit einer Arbeitshose bekleidet, und hatte sie noch nicht bemerkt.
Er stand dort sehr gerade, mit leicht geöffneten Beinen und nach vorn versetztem rechten Fuß. Mit der linken Hand hielt er den hinteren, mit der rechten den vorderen Griff der Sense und bewegte sie in Schnittrichtung von rechts nach links, von rechts nach links, von rechts nach links. Er schien ganz auf die gleichmäßige und kontrollierte Bewegung des Blattes konzentriert, vollends vertieft in sein Tun, was der ganzen Verrichtung die Anmutung eines meditativen Aktes verlieh.
Fasziniert sah sie ihm zu, musterte das Muskelspiel auf seinem Rücken, das beständige Hin und Her der Sense, und verfiel beinahe selbst in eine Art Trancezustand, als er unvermittelt mit der Arbeit innehielt, sich umdrehte und sie überrascht ansah.
»Oh, Besuch«, sagte er aufgeräumt, legte die Sense beiseite, ging langsam zu seinem Hemd, das auf einem schon abgemähten Teil der Rasenfläche lag, und zog es sich über.
Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Es war ihr peinlich, als Voyeurin ertappt zu werden.
»Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Sie nicht stören. Das sah so perfekt aus, wie Sie die Wiese gemäht haben. Diese Schnitttechnik … Wirklich ganz außerordentlich, sehr gekonnt, meine ich. Ich hab das nie richtig gelernt«, stammelte sie.
Sein Hemd zuknöpfend, kam er langsam auf sie zu. Er schien etwa in ihrem Alter zu sein, schätzte sie. Schließlich stand er vor ihr und musterte sie; musterte sie offen und unbefangen mit Augen von solch einem klaren und durchdringenden Hyazinthenblau, dass sie sofort wieder die Fassung zu verlieren fürchtete.
»Sie sind die neue Gärtnerin«, stellte er eher fest, als dass er fragte, und bedachte sie ausgiebig mit seinem blauen Blick.
»Ja«, sagte sie knapp und atmete einmal tief durch. »Ich bin Hedda Herzog. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Ich war ein bisschen außer Atem. Bin schon eine Weile unterwegs. Ist das hier ein Platz für … ja, für was eigentlich? Fußball? Rugby?«
»Krocket«, sagte er. »Die Familie spielt gern Krocket und hinten auf dem Platz Tennis.« Er zeigte auf einen von einem Netz geteilten Sandplatz hinter dem Rasenfeld.
»Ah ja«, sagte sie. »Und Sie sind …?«
»Oh, Verzeihung, wie unhöflich. Mein Name ist Lorenz Vidal. Ich bin einer der Gärtner.« Er machte die Andeutung einer Verbeugung und schaute sie belustigt an. Ihre Verlegenheit schien ihn zu amüsieren.
»Prima«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich werde dann mal weitergehen und Sie Ihrer Arbeit überlassen. Wir werden uns dann ja wohl häufiger sehen.«
»Na, das hoffe ich doch«, sagte er vergnügt. »Bis dahin und einen schönen Tag.« Daraufhin drehte er sich um, nahm seine Sense und widmete sich wieder seiner Aufgabe.
Ein paar Minuten lang haderte sie mit ihrer Konfusion, die sie so gar nicht an sich kannte. Doch bald schon hatte sie den Verdruss vergessen und gab sich wieder ganz diesem bezaubernden Frühlingstag hin, der warmen Sonne auf ihrem Gesicht, der malerischen Umgebung. Sie wanderte Richtung Westen, wo der Rasen sanft überging in eine lang gestreckte Obstwiese, auf die blühende Schachbrettblumen einen mauvefarbenen Schleier gelegt hatten. Der Boden schien hier also feuchter zu sein als weiter unten auf dem Anwesen. Sie betrachtete die fachkundig geschnittenen Bäume, Birne und Apfel, Kirsche und Pflaume. An den Rändern wuchsen zahlreiche Beerensträucher.
Ein aufgeschreckter Hase lugte alarmiert aus dem hohen Gras und lief dann im Zickzackkurs in Richtung der schützenden Gehölze weit hinter der Wiese. Über ihr zog ein Mäusebussard seine Kreise.
An die Wiese schloss sich eine ausladende Weißdornhecke an, die die Grenze des Grundstücks markierte. Sie würde in zwei Wochen blühen. Ein Zaunkönig war bereits emsig dabei, in dem undurchdringlichen Geäst sein Nest zu bauen. Sie schaute ihm einen Moment bei seinem Treiben zu und ging dann schon wieder leicht abwärts, stieß auf knospende Magnolien, blühende Felsenbirnen, einen Haselnusshain und zu ihrer Überraschung auch auf einen Japanischen Schnurbaum, gut zwanzig Meter hoch und perfekt auf einer der kleinen Aussichtsplattformen gepflanzt, wo er später im Jahr mit seinen duftenden cremeweißen Rispenblüten einen ziemlich spektakulären Anblick bieten würde. Sie hoffte es zumindest, denn der Baum blühte erst nach gut zwanzig Jahren und brauchte dafür lange, heiße Sommer, die in diesen Breiten eher nicht zu erwarten waren.
Der Baumbestand war in einigen Bereichen in der Tat recht ungewöhnlich. Doch geprägt wurde das Gelände von Eichen, Buchen und Kiefern. Irgendwann, so vermutete sie, musste dann jemand ernsthaft seinen Pückler studiert haben, das Standardwerk über Landschaftsgärtnerei des begnadeten Fürsten zu Pückler-Muskau. Denn vor etwa zwanzig Jahren, so hatte sie gelesen, war das Gelände noch einmal umgestaltet worden, behutsam zwar, aber sehr sichtbar.
So war das Terrain an diversen Stellen terrassiert worden. Rasenplätze und verschlungene Wege waren angelegt, Aussichtspunkte geschaffen worden, die Blicke auf den Strom ermöglichten, der sich hier schon weit zum Meer hin öffnete. Im Moment war er noch nahezu von allen Stellen aus zu sehen. Sie musste das Ganze noch einmal in Augenschein nehmen, wenn die Bäume belaubt waren und die Perspektiven deutlicher zutage treten würden.
Sie stieß auf die Losung von Mardern und Igeln, von Füchsen, Hasen und Eulen. Sie fand mehrere leere Gehäuse von Schnirkelschnecken und sogar ein unbewohntes Weinbergschneckenhaus. Vorsichtig steckte sie es in eine der Außentaschen ihres Rucksacks. Unter einem Totholzhaufen, wo sie das abgenagte Kerngehäuse ihres Apfels verstecken wollte, entdeckte sie zwei Erdkröten.
Sie hörte einen Specht klopfen und von weither einen Kuckuck rufen. »Die Vögel sind in diesem Garten unser Mittel gegen Raupen und schädliches Ungeziefer«, hatte Freiherr von Risach in Stifters Nachsommer erklärt, dem Buch, bei dessen Lektüre sie mehr über die Natur und Wetterphänomene, über Pflanzen und Gartenbau gelernt zu haben meinte als bei all ihren Ausbildern zusammen. Und schon der Freiherr wusste, dass man diesen bevorzugten Helfern des Gärtners die »Bedingungen ihres Gedeihens« geben müsse, so sie sich denn dauerhaft und in großer Zahl ansiedeln sollten. Sie würde Nistkästen besorgen.
Sie war nun schon eine Stunde lang unterwegs. Am Fuß einiger Buchen wuchsen große Kolonien von Buschwindröschen und Hasenglöckchen und bildeten weiße und himmelblaue Teppiche. Sie machte sich eine Notiz.
Langsam ging sie weiter abwärts, die Elbe immer im Blick. Denn der Fluss, das war ihr längst klar geworden, war der Protagonist dieses landschaftlichen Schauspiels. Immer wieder blitzte zwischen den Bäumen das breite, quecksilbrig anmutende Band des mal ins Land hineinströmenden, mal auslaufenden Wassers hindurch. Ein gleichförmiges Mantra der immerwährenden Gezeiten. Ein Trugbild vielleicht, dachte sie, als sie schließlich auf der Südterrasse stand und in die Ferne Richtung Westen schaute. Jeder Anwohner hier wusste, dass der Fluss bei Sturmfluten die am Fuß des Berges gelegenen dörflichen Vororte Hamburgs wild und unbarmherzig unter Wasser setzte. Menschen waren dabei gestorben und würden weiter sterben. Die Natur war immer stärker.
Ein Gedanke, der sie zu ihrem eigentlichen Anliegen zurückbrachte. Diese breite, verwilderte Rasenterrasse würde über die nächsten Jahre hinaus ihr hauptsächlicher Arbeitsplatz sein. Ihre Aufgabe würde es sein, die Wünsche des Besitzers mit den naturgegebenen Bedingungen in Einklang zu bringen – und, gestand sie sich, nicht zuletzt auch mit ihren eigenen Vorstellungen von einem gelungenen Garten.
Sie hatte sich die Ideen Ludwig Clarenburgs in Ruhe angehört und würde sie umsetzen. Sie freute sich auf die Arbeit. Gleichwohl konnte sie nicht leugnen, dass sich auch eine gewisse Unruhe in ihr Gemüt schlich. Die Gestaltung dieses Gartens war ein gewaltiges Vorhaben. Sie war in allen gärtnerischen Belangen gut ausgebildet worden, ihr Wissen über Pflanzen und Gärten war für ihr immer noch junges Alter beachtlich. Aber hier ging es nicht allein um Pflanzenverwendung und gefällig aussehende Beete und Boskette. Sie würde jeden einzelnen Schritt genau planen, die gesamte Logistik des Unternehmens im Blick haben müssen. Darüber hinaus musste sie die Arbeitskräfte leiten und sie bei Laune halten.
Doch Menschenführung war nicht ihre Stärke. Und falls die übrigen Gärtner ein ebensolches Selbstbewusstsein an den Tag legen sollten wie der Mäher an der Arche, kämen möglicherweise nervenzermürbende Monate mit langen und anstrengenden Diskussionen auf sie zu.
Sie ließ ihren Blick über das Terrain schweifen, über die Hecke, den Hang, den vernachlässigten Rasen. Dieses großzügige, aber doch überschaubare Areal war gleichfalls erst vor zwanzig Jahren entstanden, eine Art Aussichtsbalkon zum darunter steil abfallenden Hang. Sie betrachtete die Thujahecke und fühlte sich bei ihrem Anblick in weit südlichere Regionen versetzt. Sie dachte an italienische Renaissancegärten und an den Giardino del Belvedere in Castel Gandolfo, dem Sommersitz der Päpste am Albaner See. Sie hatte Fotografien davon gesehen. Sie spazierte an der Hecke entlang und war fasziniert von diesem reizvollen Spiel von Licht und Schatten, dem gleichmäßigen Wechsel von Schauen und Verbergen.
Wie Clarenburg schon gesagt hatte, musste die Hecke dringend geschnitten werden, sonst wäre die Form dahin. Darüber hinaus schien sie ihr für den spitz zulaufenden Raum zu gewaltig. Wenn der gewünschte Rosengarten hier entstände, würde man die Terrasse Richtung Westen erweitern müssen. Dann würden die Proportionen stimmen.
Nachdenklich betrachtete sie das Waldstück, das sich an die Terrasse anschloss. »Erweiterung der Terrasse Richtung Westen« notierte sie. Und wenn die Weinhäuser und der Schuppen weg wären und Clarenburg die Trockenmauer billigen würde, müsste der Rasen komplett neu angelegt werden.
Sie bückte sich und pulte eine Handvoll Erde aus dem Boden am Waldrand. Sie zerbröselte zwischen ihren Fingern. Sie sah Hungerblümchen und Hasenklee in der Nähe wachsen, was auf sandigen, nicht besonders nährstoffreichen Boden hinwies. Sie erinnerte sich, dass dies früher eine Heidelandschaft gewesen war. Für den Rosengarten müsste die Erde ausgetauscht werden, für eine Trockenmauer wäre sie ideal. Noch eine Notiz.
»Was machen Sie da?«
Sie drehte sich um. Vor ihr stand ein blondschopfiger Junge, vielleicht elf, zwölf Jahre alt, nahm sie an. Sie kannte sich mit Kindern nicht aus.
»Das siehst du doch. Ich schreibe etwas in mein Notizbuch«, antwortete sie knapp, in der Hoffnung, der Kleine würde den Hinweis verstehen und verschwinden.
»Und warum?«
Hoffnung geplatzt. »Zur Erinnerung«, sagte sie. »Damit ich es nicht vergesse«, fügte sie streng hinzu, damit es der Knabe auch wirklich begriff. Dann klappte sie ihr Notizbuch zu, packte es wieder in den Rucksack und inspizierte einmal mehr den verwilderten Nordhang. Merkwürdig, dachte sie. Was hatten sich die Vorbesitzer nur dabei gedacht? Auf der einen Seite diese wunderschöne Hecke und dieser breit angelegte Rasenplatz, auf der anderen diese offensichtliche Verwahrlosung.
»Sie sind die neue Gärtnerin.«
Der Kleine war immer noch da.
»Genau«, sagte sie, weiter den Hang betrachtend.
»Ich hab Sie gestern schon gesehen. Ich bin Thomas. Sie können mich Tommy nennen.«
»In Ordnung. Ich bin Hedda«, sagte sie widerwillig, ohne ihn anzusehen. Sie erinnerte sich. Das war der Älteste der fünf Clarenburg-Kinder. Clarenburg hatte ihr die Namen samt Alter seines Nachwuchses am Vortag präzise und voller Stolz aufgezählt. Doch sie hatte das alles sofort wieder vergessen. Unnützes Wissen.
»Ich muss eine Weile hierbleiben«, sagte er.
»Ach ja? Und warum?«
»Hier sucht mich keiner.«
»Wer sollte dich suchen?«, fragte sie und schritt die Fläche ab. Sie würde das gesamte Gelände noch einmal genau ausmessen, aber fürs Erste genügten ihr die groben Maße. Sie schätzte das gesamte Areal auf gut 2500 Quadratmeter, vielleicht etwas mehr.
»Liebernicht«, sagte der Junge und schaute nervös den Weg hoch, auf dem er gekommen war.
Sie sah ihn irritiert an und musste plötzlich lachen. »Du meinst Frau von Nieberlicht, eure Gouvernante. Was hast du denn angestellt?«
»Habe ihre Flasche Rum entdeckt und Lebertran reingefüllt. Das kann sie natürlich nicht meiner Mutter erzählen. Wär ja dann klar, dass sie heimlich trinkt. Blöderweise ahnt sie, dass ich das war, und dann hat sie gemerkt, dass Dora meinen Hausaufgaben-Aufsatz geschrieben hat. Und das wird sie meiner Mutter jetzt petzen. Aus Rache sozusagen. Und Mutter wird ziemlich wütend sein. Na ja, zumindest eine Weile.«
»So was aber auch. Wie lange willst du dich denn hier verstecken?«
»Na ja, ich denke so in ein, zwei Stunden wird sie sich wieder abgeregt haben. So lange müsste ich noch hierbleiben. Vielleicht kann ich helfen.«
»Kaum«, sagte Hedda, holte noch einmal ihr Notizbuch hervor und war in Gedanken schon wieder ganz woanders. Sie hoffte, dass ihre Bücherkisten bald ankommen würden. Sie hatte sie erst spät losgeschickt, weil sie ihre Nachschlagewerke bis zuletzt gebraucht hatte. Für ein farblich harmonisch aufeinander abgestimmtes Pflanzenkonzept benötigte sie ihren Foerster.
Die Veröffentlichungen des jungen Gartengestalters Karl Foerster hatte sie in Berlin verschlungen. Fasziniert von seinen Werken war sie ziemlich spontan in seine Gärtnerei nach Bornim gepilgert und hatte ihn dort sogar kennengelernt. Er war in seinen Beeten zugange gewesen, und sie hatte ihn kurzerhand angesprochen. Nachdem sie eine Weile intensiv mit ihm gefachsimpelt hatte, war ihm wohl klar geworden, dass er es mit einer Kollegin zu tun hatte und nicht mit einer seiner vielen weiblichen Verehrerinnen.
»Wissen Sie, die Hauptsache ist die Verheiratung und Verschmelzung der Pflanzen untereinander«, hatte er ihr in seinem unnachahmlichen Duktus erklärt. Er empfahl, Pflanzen in Klängen zu sehen. »Ich zum Beispiel habe eine Vorliebe für Dreiklänge, wobei zwei einander fremde Farben durch eine dritte in ein leidenschaftliches Gespräch gesetzt werden.« Dabei hatte er sie mit glühendem Blick angesehen, und sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass es für ein leidenschaftliches Gespräch zwischen ihnen beiden keines Dritten bedurfte.
In seiner bisweilen etwas pathetischen Art war dann noch von »seelischen Vitaminträgern« und »Duftschätzen« in den Beeten, von »Zeitriesen und Raumzwergen«, »Ordnungshelden« und von der Farbe Blau als »König der Gärten« die Rede gewesen. Schließlich hatte er ihr eine Ausgabe seines ersten Buches geschenkt, Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit, und sogar eine Widmung hineingeschrieben: »Der Garten ist ein Ausdrucksmittel für die innerste Eigenart und Naturanschauung eines Menschen, durch das wir ganz neue Zugänge zu seinem Wesen finden können. Mensch sein heißt, nach Ausdruck ringen! In Verehrung Karl August Foerster«.
Jetzt brannte sie darauf, die Ideen aus seinen Schriften in die Praxis umsetzen zu können. Auch das war ein Grund gewesen, die Stelle bei den Clarenburgs anzunehmen. Die Trockenmauer wollte sie gemäß der Foerster’schen Maxime »Es wird durchgeblüht!« so anlegen, dass sie zu jeder Jahreszeit interessant aussah. Mit exotischen Mimöschen war das nicht zu schaffen, sondern nur mit Stauden, die dem regionalen Klima und dem Boden gewachsen wären.
»Das da ist zum Beispiel Knirrkohl. Wussten Sie das?« Der Junge holte sie aus ihren Gedanken zurück ins Hier und Jetzt. Er zeigte auf ein unscheinbares Gewächs, das sich knospig aus dem Boden schob.
Sie hatte ihn fast vergessen. Doch jetzt sah sie ihn etwas interessierter an. »Nicht ganz«, sagte sie unfreiwillig beeindruckt. »Das ist das Nickende Leimkraut, botanisch Silene nutans. Hübsche Pflanze. Duftet stark. Was du meinst, ist das Taubenkropf-Leimkraut, das wird auch Knirrkohl genannt. Ist verwandt und sieht ähnlich aus. Heißt botanisch Silene vulgaris. Interessierst du dich für Pflanzen?«
»Geht so.« Der Junge hob einen Ast vom Boden auf. »Pflanzen sind eben nur Pflanzen.« Er wischte mit dem Ast gelangweilt über den Boden.
»Unsinn«, sagte sie. »Pflanzen sind eben nicht nur Pflanzen. Damit wird man ihrer Vielfalt nicht gerecht. Die biologischen Unterschiede zwischen einem Gänseblümchen und einem Mammutbaum sind gewaltig, ähnlich wie die zwischen einer Schnecke und einem Menschen. Niemand käme auf die Idee, vom Verhalten einer Schnecke auf das eines Menschen zu schließen, obwohl beide dem Tierreich angehören. Aber bei Pflanzen tun wir genau das.«
Er schaute sie nachdenklich an. »Mhm, schon möglich«, sagte er und schlenderte zu dem Wäldchen hinüber. »Hier, schauen Sie mal, das da sind Waldameisen. Haben Sie die schon mal gesehen?« Er wies auf einen kleinen Hügel am Gehölzrand und fuchtelte mit dem Ast in der Luft herum. »Wenn man darin rumstochert, gibt es ein ziemliches Gewusel. Gucken Sie mal.«
Sie trat eilig auf ihn zu und nahm ihm den Ast aus der Hand. »Lass das!«, sagte sie streng.
»Warum? Sind doch nur blöde Ameisen«, gab er zurück.
»›Blöde Ameisen‹? Wir wollen lieber nicht darüber diskutieren, wer hier blöd ist. Ameisen gab es schon vor über 100 Millionen Jahren. Die sind also ein kleines bisschen länger auf der Welt als wir Menschen. Sie sind in hochkomplexen Staaten organisiert. In diesem Haufen hier leben etwa 600 000 Tiere. Es gibt unter ihnen Jäger, Sammler und sogar Viehzüchter. Sie tragen zur Verbesserung des Bodens bei, verbreiten Pflanzensamen und verhindern die Vermehrung anderer Insekten, die ich nicht im Garten haben will. Und darum, mein Lieber, gehören Ameisen zu meinen allerbesten Freunden, und du wirst dich unterstehen, ihren Hügel zu zerstören.«
Der Junge starrte sie verblüfft an. »Schon gut«, sagte er. »Ich mach ja gar nichts.«
»Du solltest etwas mehr Respekt vor den Geschöpfen in deiner Umgebung haben. Auch wenn sie klein sind, auch wenn sie anders sind und du sie nicht verstehst. Kapiert?«
»Ja«, sagte der Junge nur und schaute sie weiter staunend an, als sei auch sie eines dieser Wesen, die sie gerade beschrieben hatte. Nicht klein zwar, aber doch anders und ziemlich rätselhaft.
Sie wandte sich um und ging zu ihrem Rucksack, den sie an der Hecke gelassen hatte. Sie nahm den zweiten Apfel heraus und teilte ihn mit ihrem Schweizer Messer in zwei Hälften.
»Magst du?«, fragte sie den Jungen und hielt ihm eine Hälfte hin.
»Klar, danke«, sagte er und biss in seine Hälfte. Er betrachtete sie interessiert, schien jedoch nicht weiter eingeschüchtert von ihrer kleinen Tirade. Dann spähte er nochmals den Weg zum Haupthaus hoch.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«, fragte er, nun doch ein wenig beklommen, als sie Anstalten zum Aufbruch machte, um das Wäldchen auf der Westseite zu erkunden.
»Du darfst eine zweite stellen«, sagte sie.
»Was? Äh … ja, ach so. Kann ich ein bisschen mit Ihnen rumlaufen?«
Sie seufzte. »Meinetwegen. Aber halt die Klappe und geh dicht hinter mir. Wehe, du strolchst einfach so durchs Gelände. Ich will sehen, was hier wächst und was hier sonst noch so lebt. Und ich will nicht, dass du alles zertrampelst.«
Niemals hätte sie sich seinerzeit vorstellen können, dass dies der Beginn einer lebenslangen Freundschaft sein würde. Und wenn sie viele Jahre später befragt wurden, unter welchen Umständen sie beide sich kennengelernt hatten, sahen sich Hedda Herzog und Tommy Clarenburg immer nur kurz an, grinsten und sagten meistens wie aus einem Mund: »Liebernicht.«
2
Für den darauffolgenden Vormittag hatte Ludwig Clarenburg sie ins Haupthaus bestellt. Er wollte ihr die Gärtner vorstellen.
Sie war früh aufgestanden, lehnte mit einer Tasse Tee an der Tür des Gärtnerhauses und schaute auf den Fluss, der in der Morgensonne glitzerte. Sie hatte schlecht geschlafen. Langsam dämmerte ihr, auf was sie sich hier eingelassen hatte, und eine leichte Unruhe befiel sie. An Frühstück war nicht zu denken. Sie war viel zu nervös. Selbst ein leichtes Essen würde Übelkeit hervorrufen. Das kannte sie von sich. Also lieber noch eine Tasse Tee mit viel Zucker. Das musste fürs Erste reichen.
Kurze Zeit später machte sie sich auf den Weg zum Haupthaus.
Clarenburg wartete schon. »Ah, Fräulein Hedda, wunderbar. Kommen Sie, die Jungs sind schon auf der Terrasse und trinken Kaffee.«
Sie war überrascht, sagte aber nichts. Offensichtlich pflegte Ludwig Clarenburg auch gegenüber seinen übrigen Angestellten einen ungezwungenen Umgangsstil.
Auf der Terrasse standen sechs Männer unterschiedlichen Alters mit Kaffeetassen in der Hand und schauten ihr erwartungsvoll entgegen.
»Das«, eröffnete Clarenburg die Vorstellung launig, »ist Hedda Herzog, die neue Obergärtnerin. Ab sofort hört alles auf ihr Kommando.«
Die Männer musterten sie skeptisch. Sie nickte und bemühte sich um ein freundliches Gesicht.
Ihr war von vornherein klar gewesen, dass dies nicht leicht werden würde. Eine Frau als Obergärtnerin: Das kam im Denken dieser Männer und vermutlich im Denken aller Männer mit Ausnahme Ludwig Clarenburgs nicht vor.
»Dies hier ist Jost Vidal. Er ist am längsten bei uns und kennt den Berg und seine Pflanzen aus dem Effeff.« Clarenburg stellte sie einem großen, kräftigen Mann mit eisgrauem Haar um die sechzig vor. Er nickte ihr mit unbewegter Miene zu.
»Und das ist sein Sohn Lorenz. Er wird die Arbeit seines Vaters als zweiter Gärtner übernehmen, wenn Jost sich irgendwann zur Ruhe setzt«, fuhr Clarenburg fort und führte sie zu dem etwa dreißig Jahre jüngeren Pendant seines Vaters, dem Mäher vom Vortag. »Tag, Chefin«, sagte er, ein klein wenig zu ironisch, wie sie fand. Ihre Blicke trafen sich und blieben einen Moment länger als gebührend aneinander hängen.
»Guten Morgen«, sagte sie fest, drückte den Rücken durch und straffte die Schultern. Sie beschloss, von vornherein klarzustellen, wer hier das Sagen hatte. Anders würde es nicht funktionieren. »Wenn es Ihnen allen recht ist, werde ich Sie bei Ihrem Vornamen nennen und siezen, so wie es hier ja offenbar üblich ist«, fuhr sie fort. »Dies hat auch den Vorteil, dass es bei zwei Vidals in der Belegschaft nicht zu Missverständnissen kommt.«
»Ist gut«, »In Ordnung«, »Von mir aus«, schallte es ihr mehr oder weniger zustimmend entgegen.
»Ja prima«, bemerkte Ludwig Clarenburg. »Das sind dann hier noch Peer Schuldt, Gisbert Dreyer und unsere beiden Jungspunde Siegfried Wermuth und Hans Rosenzweig. Und das wär’s auch schon, meine Herren. An die Arbeit.«
Sie nickte den vier jungen Männern zu, die sie um die zwanzig schätzte, Siegfried und Hans vielleicht ein paar Jahre jünger.
»Wir treffen uns gleich in dem Schuppen neben den Gewächshäusern«, verkündete sie. Die Männer tranken ihren Kaffee aus, verabschiedeten sich von Clarenburg und gingen Richtung Schuppen davon.
Hedda brannte darauf, Ludwig Clarenburg ihre Pläne für die Südterrasse zu erläutern. Wenn er ihre Vorschläge billigte, käme viel Arbeit auf die sechs Männer zu. Clarenburg lud sie in sein Arbeitszimmer, wo sie ihm ihre Absichten auseinandersetzte: Terrassierung, Trockenmauer, Rasenplateau mit Seerosenbecken als Mittelachse, Rosengarten auf dem erweiterten Plateau Richtung Westen. »Ich muss noch alles genau abmessen und ausrechnen. Dann zeichne ich einen Plan und stelle die Pflanzenliste zusammen. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Ich bräuchte noch einen Kostenrahmen, eine ungefähre Geldsumme, mit der ich rechnen kann.«
Clarenburg nickte. »Kriegen Sie«, sagte er. »Und das alles hört sich wirklich gut an. Ich vertraue Ihnen da ganz. Ich selbst habe überhaupt keine Ahnung von Gärten und Pflanzen. Das fällt mehr in die Domäne meiner Frau. Sie wird sich auch noch mit Ihnen in Verbindung setzen. Im Moment ist sie vor allem mit den Kindern beschäftigt. Wie dem auch sei: Ich für meinen Teil will es einfach nur schön haben.«
»Das dürfte kein Problem sein«, versicherte sie und verabschiedete sich.
Erleichtert, dass Clarenburg ihre Pläne billigte, ging sie zum Schuppen, wo die Gärtner auf sie warteten. Als sie sich dem Eingang näherte, vernahm sie lebhaftes Geplauder, das abrupt verstummte, sobald sie das geräumige Holzhaus betrat. Hier war in Regalen und an Wandhaken hängend alles aufbewahrt, was man für den Gärtnerberuf benötigte. Sie sah Spaten, Hacken und Hippen, Sicheln, Sensen und Rechen, Schubkarren, Gießkannen sowie Scheren und Tontöpfe jedweder Größe. Es waren altvertraute Gerätschaften, deren Anblick sie unversehens ruhig werden ließ und zuversichtlicher stimmte.
In der Mitte stand ein großer Tisch, um den die Männer sich gruppiert hatten und ihr mit erkennbarer Reserviertheit entgegenblickten.
»Guten Morgen noch einmal«, sagte sie mit einem entschlossenen Zug um den Mund und bemühte sich angestrengt um Souveränität, die sie in diesem Augenblick mehr denn je zu benötigen meinte. »Ich möchte mit Ihnen meine Pläne für die Südterrasse besprechen.« Sie trat an den Tisch, und dann legte sie ihnen ihre Vorstellungen ebenso klar und zügig dar, wie sie es zuvor bei Ludwig Clarenburg getan hatte.
Die Gärtner hörten ihr wortlos zu. Die beiden Jüngsten, Siegfried und Hans, schauten hin und wieder unsicher zu Jost Vidal und dann wieder leicht betreten zu Boden. Die vier anderen, Jost, Lorenz, Peer und Gisbert, ließen nicht erkennen, was sie dachten.
»Sie wissen also, was auf Sie, Verzeihung, was auf uns zukommt. Zuallererst muss die Girlandenhecke geschnitten werden. Und dann müssen die alten Schuppen abgebaut und weggeräumt werden. Da sollten Sie alle mitarbeiten, damit wir uns möglichst schnell die Terrassierung vornehmen können. Die weiteren Arbeiten auf dem Berg werde ich dann unter Ihnen aufteilen. Ich hoffe, Sie sind einverstanden.«
Ein Moment der Stille.
Im Grunde genommen war es ihr vollkommen egal, ob die Männer mit ihren Anweisungen einverstanden waren. Sie war hier der Chef, und Ludwig Clarenburg hätte es ihrer Ansicht nach nicht treffender formulieren können: Ab sofort müssten alle auf ihr Kommando hören.
Dennoch hatte sie sich um einen verbindlichen Ton bemüht. Denn es war ihr klar, dass sie bei allem, was sie plante, auf die Gärtner angewiesen war. Auch wenn sie den Ton angab, konnten die Männer ihr jede Menge Scherereien bereiten. Sie konnte es sich nicht leisten, sie gleich am Anfang gegen sich aufzubringen.
»Ja, dann werden wir uns mal an die Hecke machen, wenn’s recht ist«, sagte Jost Vidal schließlich und nickte ihr kurz zu. »Jungs, ihr wisst, wo die Scheren sind.«
Jeder griff sich eine der Heckenscheren, die an der Wand hingen. Dann zogen sie wortlos ihrer Wege Richtung Südterrasse.
Als sie allein war, ließ sie sich in einen der beiden alten Korbstühle fallen, die am Tisch standen. Sie schloss für einen Moment die Augen. Geschafft!, dachte sie. Dann stand sie auf und machte sich an die Arbeit.
Auch in den kommenden Wochen spazierte sie immer wieder für ein, zwei Stunden zu unterschiedlichen Tageszeiten durchs Gelände und machte sich Notizen über den Sonnenstand. Sie beobachtete, wie sich die Vegetation mit dem voranschreitenden Frühling veränderte, und registrierte die Wandlungen beim Übergang zum Sommer. Die übrige Zeit entwickelte sie Konzepte für das Rasenplateau, die Trockenmauer und den Rosengarten, zeichnete Pläne und stellte erste Pflanzenlisten zusammen.
Die Gärtner waren bereits damit beschäftigt, die Weinhäuser und den Schuppen auf der Südterrasse abzutragen. Unter ihrer Aufsicht war die Hecke geschnitten worden, und sie konnte erstmals die Meisterschaft der Männer bewundern. Freihändig und ohne Schnittschablonen hatten sie auf einer Leiter stehend die Thujen akkurat nur mit einer Heckenschere ausgestattet zurechtgestutzt.
Bald schon könnte die Terrassierung des Nordhangs beginnen.
Mit den Gärtnern kam sie leidlich aus. Sie wusste, dass sie unter Beobachtung stand. Sie würde hier nur dann ein Bein auf den Boden bekommen, wenn ihre Kompetenz in gärtnerischen Belangen die Belegschaft überzeugte. Doch das brauchte seine Zeit, das war ihr bewusst. Noch sahen sie sie lediglich als Planerin, als einen unkalkulierbaren Eindringling in ihr bislang wohlgeordnetes grünes Reich. Dass sie sehr wohl in der Lage war mit anzupacken und keine Scheu hatte, sich die Hände schmutzig zu machen, konnten sie schließlich nicht wissen.
Misstrauisch beäugten die Männer sie, wenn sie die Südterrasse durchmaß und sich fortwährend Notizen machte. Gab sie ihre Anweisungen, schauten die jüngeren Gärtner nach alter Gewohnheit nach wie vor erst einmal Jost Vidal an. Doch der gab nie zu erkennen, ob er mit ihren Entscheidungen einverstanden war oder nicht, sondern führte sie wortlos, stoisch und zuverlässig aus.
Im Grunde hatte sie mit heftigeren Widerständen gerechnet. Schließlich war Jost bislang der Herr über die Clarenburg’schen Gärten gewesen. Sie hatte keine Ahnung, wie Ludwig Clarenburg ihm die Verpflichtung eines weiblichen Obergärtners dargelegt hatte, und mochte sich die ungläubigen und vermutlich auch empörten Gesichter der männlichen Belegschaft gar nicht vorstellen. Sie war instinktiv auf Intrigen eingestellt, auf mehr oder weniger bösartige Streiche oder Sabotageakte, aber sie fand keine Anzeichen dafür. Oft, wenn sie morgens zu den regelmäßigen Besprechungen im Gärtnerschuppen eintraf, verstummten die Männer schlagartig, sodass sie argwöhnte, sie hätten über sie gesprochen, und höchstwahrscheinlich nicht gerade Schmeichelhaftes. Und dann und wann, wenn ihre Unterredungen beendet waren und sie ihrer Wege ging, hörte sie die Gärtner im Hintergrund verhalten lachen.
Doch sie bemühte sich, alles Zwischenmenschliche auszublenden und sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren, ein Feld, auf dem sie sich sicher fühlte. Mit Pflanzen und Gärten kannte sie sich aus, mit Menschen weniger.
Die größten Vorbehalte schien ihr Lorenz Vidal entgegenzubringen. Er redete noch weniger als sein Vater; zumindest in ihrer Gegenwart war er schweigsam und zurückhaltend. Wenn sie ihre Anweisungen gab, nahm er sie mit unbewegtem Gesicht entgegen. Nur hin und wieder fühlte sie sich von ihm beobachtet, und wenn sie ihn ansah, verzog er das Gesicht kaum merklich zu einem leicht spöttischen Lächeln, das sie nicht interpretieren konnte. Sie versuchte, ihn zu ignorieren. Denn auch er tat, was sie ihm auftrug. Und das war die Hauptsache. Schließlich wollte sie hier keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen.
In Briefen an ihre Freundin Elisabeth, die in Guildford im englischen Surrey lebte, schilderte sie ihre ersten Eindrücke.
»Liebste Lizzie,
ich weiß, dass Du begierig bist zu erfahren, wie es mir hier in der neuen Stadt, meinem neuen Domizil, meiner neuen Arbeitsstelle ergeht. Aber ich kann noch gar nicht so viel sagen. Das heißt, ich könnte viel berichten, aber all das Erlebte wirbelt noch sehr ungeordnet durch meinen Kopf, und ich muss das alles erst einmal sortieren, bevor ich es in Worte fassen kann.
Ludwig Clarenburg scheint ein respektabler, zuvorkommender Mann zu sein. Er hat mich sehr freundlich empfangen und meine Pläne für den Garten gebilligt. Mit dem Rest der Familie und den übrigen Bediensteten hatte ich bislang nicht viel zu tun. Mit den insgesamt sechs Gärtnern arbeite ich gut zusammen. Ich vermute, Clarenburg hat sie vorher instruiert und sie angewiesen, mir keine Steine in den Weg zu legen. Die Skepsis steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Und ich kann es sogar verstehen. Eine Frau als Obergärtnerin ist eben nicht üblich. So etwas kennt man hier nicht. Sie werden sich daran gewöhnen müssen.
Ansonsten habe ich ein Haus ganz für mich allein. Es liegt abseits des Haupthauses direkt an den Gemüsegärten und den Gewächshäusern. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es komplett einzurichten. Im Moment ist zu viel zu tun. Aber wenn ich meine Bücherkisten erst einmal ausgepackt habe, wird es sicher hübsch aussehen.
Insgesamt geht es mir gut. Für ein abschließendes Urteil ist es aber noch zu früh. Warten wir es ab.
Noch eine große Bitte: Kannst Du mir Breeches samt dazu passender Jacke mit möglichst vielen Taschen besorgen? Ich weiß, dass die Swanley-Absolventinnen in Kew Gardens solche Arbeitskleidung tragen. Hier gibt es so etwas natürlich nicht. Wie gesagt: Frauen als Gärtnerinnen sind hierzulande nicht vorgesehen. Im Garten dienen Frauen vor allem als Dekoration. Sie sollen hübsch aussehen und stilvoll um die Beete flanieren. Noch nicht mal zum Blumenpflücken gehen die Damen des Hauses hier in den Garten. Das besorgt das Personal.
Wie auch immer: Ich kann auf Dauer unmöglich in langen Röcken meiner Arbeit nachgehen. Ich zeichne ja nicht allein famose kleine Pflanzpläne, sondern bin im Moment vor allem im Gelände unterwegs, um die Arbeiten auf der Südterrasse zu beaufsichtigen. Sie wird auch römische Terrasse genannt, und in der Tat hat sie einen Anflug italienischer Eleganz. Zurzeit jedoch ist sie noch ein einziges schlammiges Durcheinander. Ich brauche Hosen!!!