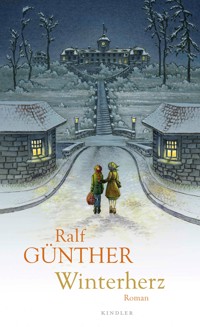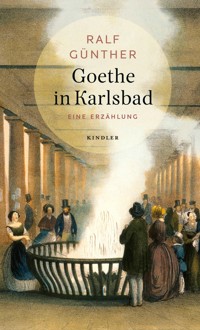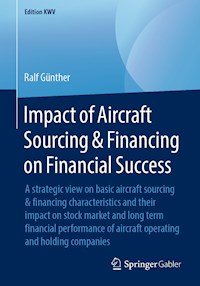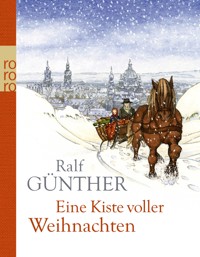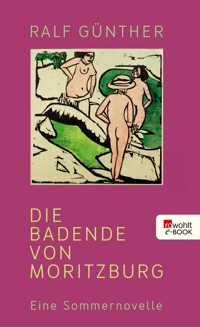19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großartig recherchierter Roman über ein kaum bekanntes Stück deutscher Geschichte – die DDR-Kreuzfahrt Sommer 1988: Der zwanzigjährige Ronni und die Mittzwanzigerin Sabine lernen sich an Bord der MS Arkona kennen, einem Kreuzfahrtschiff der DDR. Sie ist Jurastudentin und reist in der gehobenen Klasse, er ist ein einfacher Steward. Sie lebt in Frankfurt am Main, er stammt aus Dresden. Ihre Reise führt sie nach Skandinavien, die großen Hafenstädte der Ostsee entlang – mit ausnahmslos westdeutschen Gästen und ostdeutscher Besatzung, mit Bibeln in den Nachtschränken und der Stasi an Bord. Ronni und Sabine fühlen sich schon bald zueinander hingezogen, obwohl ihre Lebenswelten so unterschiedlich sind. Treffen können sich die beiden nur heimlich. In der Schiffswäscherei tauschen sie sich über ihre Lieblingsfilme aus, über ihre Sorgen, ihre heimlichen Träume. Doch dann wird ihre Beziehung entdeckt, und die Staatssicherheit setzt Ronni unter Druck. Er muss sich entscheiden – für sein Land oder für die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ralf Günther
Ein grenzenloser Sommer
Roman
Über dieses Buch
Ein Sommer auf hoher See. Eine Liebe, die nicht sein darf.
Sommer 1988: Ronni und Sabine lernen sich an Bord der MS Arkona kennen, eines Kreuzfahrtschiffs der DDR. Sie ist Jurastudentin und reist in der gehobenen Klasse, er ist ein einfacher Steward. Sie lebt in Frankfurt am Main, er stammt aus Dresden. Ihre Reise führt sie nach Skandinavien, die großen Hafenstädte der Ostsee entlang, mit ausnahmslos westdeutschen Gästen, ostdeutscher Besatzung – und der Stasi an Bord.
Ronni und Sabine fühlen sich bald zueinander hingezogen, obwohl ihre Lebenswelten so unterschiedlich sind. Treffen können sich die beiden nur heimlich. Im Bordkino oder in der Wäscherei tauschen sie sich über ihre Lieblingsfilme aus, über ihre Sorgen, ihre heimlichen Träume. Doch dann wird ihre Beziehung entdeckt, und die Staatssicherheit setzt Ronni unter Druck. Er muss sich entscheiden – für sein Land oder für die Liebe.
Vita
Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem «Das Weihnachtsmarktwunder» sowie «Als Bach nach Dresden kam». Ralf Günther lebt in der Nähe von Dresden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Kike Arnaiz/Westend61
ISBN 978-3-644-02184-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Erste AusfahrtDie großen Hafenstädte der Ostsee
Kurs: Kiel
Der Bug zerschnitt die Ostsee und teilte das Wasser in zwei Hälften. Die eine strömte backbords, die andere steuerbords an den stählernen Wänden des Schiffskörpers entlang, um sich in der Heckwelle strudelnd wieder zu vereinigen. Die MS Arkona warf kaum Gischt auf, so scharf war der Schnitt. Vereinzelt züngelte Wasser die Bordwand hinauf, nur um sich gleich wieder zurückzuziehen. Der Ozean war weit.
Ronni stand an der Reling und schaute in den Wind. Der fegte ihm die Locken aus der Stirn. Es ging in den Westen, niemand hinderte ihn. Er hatte keinen Besucherantrag stellen müssen oder gar einen Ausreiseantrag. Keine Sperren überqueren, keine Fragen beantworten, keine Selbstschussanlagen hinter sich lassen. Nicht unter Stacheldraht kriechen oder an Wachtürmen vorüber. Er war dreiundzwanzig und durfte ganz legal in den Westen reisen. Dorthin hatte es ihn zwar niemals gezogen, aber ans Meer, das war sein Traum! Er war überwältigt von der Erkenntnis, dass Träume Wirklichkeit werden konnten.
Gelernt hatte er in der Betriebsschule Flotte in Reutershagen und auf dem Ausbildungsschiff MS Georg Büchner. Da war er einer der Jüngsten. Und dann, um den Umgang mit Westlern zu lernen, im Hotel Neptun in Warnemünde. Niemals hat er irgendeinen Zweifel an seiner Loyalität gegenüber der herrschenden Partei gelassen. Warum sollte er sie auch infrage stellen? Sie hatte ihm eine unbeschwerte Kindheit und Jugend beschert – und nun diesen Beruf: Restaurantsteward. Und schließlich war sein Onkel ein hohes Tier in dieser Partei. Man konnte Ronni privilegiert nennen.
Lässig lehnte sein linker Arm über der Reling, der Wind ließ die hellen Härchen zittern. Es war sein erstes Jahr auf diesem Schiff und die dritte Ausfahrt. Er hatte gelernt, mit der Arbeit auf schwankendem Boden umzugehen, hatte gelernt, dass es wirksame Mittel gegen die Seekrankheit gab und dass man an Deck niemals gegen den Wind spucken sollte. Die Ostsee hatte auch ihre Tücken. Nach zwei Ausfahrten fühlte er sich bereits als alter Hase – doch nun hatte der Kapitän Westkurs gesetzt. Das war neu.
Die Sonne war bereits untergegangen, blaue Stunde. Noch in der Dämmerung schien der massige Schiffskörper einen Schatten zu werfen. Ronni nahm einen Zug von seiner Karo-Zigarette und schnipste sie dann dem schwarzen Wasser entgegen. Eine Möwe segelte am Wind. Sie entdeckte die Glut, legte die Flügel an und stürzte dem Stummel hinterher. Doch bevor sie ihn schnappen konnte, erkannte sie, was es war, und ließ davon ab. Schlaues Tier, dachte Ronni. Die Glut trudelte ins Halbdunkel und erlosch weit unten mit einem Zischen.
Eben wollte sich Ronni umwenden und in die Kajüte zurückkehren, die er sich mit dem Vorspeisenkoch teilte. Da stand plötzlich Harry im Weg. Er trug eine schwarz gerahmte Hornbrille, wie Ronni das von den Funktionären kannte. Doch Harry war kein Funktionär, nur Brigadeleiter. Wären sie Landratten, hieße er Oberkellner. Zur See war das Steward oder eben Chefsteward. Genosse Chefsteward, um korrekt zu sein. Alle Servicekräfte an Bord waren Stewards: Kabinenstewards, Poolstewards und eben Restaurantstewards. Um die gebotene Internationalität herzustellen, war an Bord die Pflicht aufgehoben, Begriffe des Klassenfeindes zu meiden, hatte man Ronni und seinen Kollegen erklärt. Selbst die Fürst-Pückler-Eistorte hieß wieder so. Und die Etiketten der Jeans in der Bordboutique lauteten auf Bluejeans und nicht Nietenhosen.
Harry stand neben Ronni, Seite an Seite starrten sie aufs Wasser. «Das ist jetzt Westwasser», sagte Harry. Ronni sah ihn an. Was sollte denn das sein: Westwasser? Harry war etwas kleiner als Ronni, von untersetzter Statur. Sie hatten sich nie übers Alter unterhalten, doch Ronni wusste, dass er Familie hatte, daheim in Rostock. Harry sah seine Familie viermal im Jahr. Was dies bedeutete, konnte Ronni noch nicht ermessen. Er hatte noch keine Kinder, nicht einmal das, was man eine «feste Freundin» nannte. Sein Beziehungsleben war wie das Schiff: Es tingelte von Hafen zu Hafen, ohne dauerhaft festzumachen.
«Was soll das denn sein: Westwasser?» Ronni stieß Luft durch die Nase.
«Wir haben die internationalen Gewässer verlassen und befinden uns im Hoheitsbereich der BRD.»
«BRD», wiederholte Ronni, «wie das klingt … Was soll man sich darunter vorstellen?»
«Das kapitalistische Deutschland. Nato-Gebiet», setzte Harry den Gedanken ungefragt fort. Umständlich hakelte er die Brille von der Nase und begann, die Gläser mit seinem Serviertuch zu polieren. Das war ihr Erkennungszeichen als Kellner: Wenn Harrys Tuch nicht über seinem Unterarm hing, steckte es in der Gesäßtasche.
Ronni deutete mit einer unbestimmten Handbewegung über die Reling. «So nah wie das Schiff dem Wasser da unten kommen wir dem Westen sowieso nicht, schließlich darf niemand von uns in Kiel an Land gehen.» Er war beinahe erleichtert.
«Dem Westen vielleicht nicht.» Harry nickte Richtung Küstenlinie. «Aber den Westlern.»
«Warum fahren wir überhaupt für die?»
«Frag doch deinen Onkel in Berlin!» Harry sah Ronni verschmitzt an.
«Was hat der damit zu tun?»
«Das weißt du nicht?» Harrys Augen hinter den Brillengläsern leuchteten.
Natürlich wusste Ronni, dass er seine Ausbildung und diese Anstellung den Privilegien seines Onkels zu verdanken hatte: Haus in Wandlitz, sonntags bei den Honeckers zum Kaffee, einflussreich, unerreichbar.
«Frag ihn! Ich sag’s dir nicht», neckte Harry.
«Das werde ich tun», sagte Ronni entschlossen. «Wenn ich ihn das nächste Mal treffe.»
Ronni beobachtete die Möwe, die auf gleicher Höhe, aber jenseits der Reling nach wie vor neben ihnen hersegelte, wohl in der Erwartung, dass Ronni noch etwas Interessanteres über Bord warf als einen Zigarettenstummel.
«Es ist», fuhr Harry fort, «allein das Verdienst deines Onkels, dass dieses Schiff für uns fährt: das West-Traumschiff unter Ost-Flagge.»
«Das Schiff war wohl der Star der Serie», vermutete Ronni.
«Allerdings. Neben Sascha Hehn. Und natürlich Heide Keller. Aber gegen den Sonnenstudio-Casanova war Heide Kellers Ausstrahlung eher von der Art einer Distel.»
«Du hast Westfernsehen geschaut?», fragte Ronni ohne Vorwurf in der Stimme.
Harry nickte grinsend. «Du etwa nicht?»
Ronni verneinte.
«Wie konnte ich das nur vergessen?» Theatralisch schlug sich Harry mit der Hand vor die Stirn. «Du kommst ja aus dem Tal der Ahnungslosen.»
«Dafür kenne ich jede Folge von Zur See», konterte Ronni. Zur See war auch der Grund, warum Ronni überhaupt auf einem Schiff angeheuert hatte. Die Erlebnisse der Mannschaft des Frachtschiffs J.G. Fichte hatten seine Abenteuerlust befeuert und seine Berufswünsche beflügelt. Zur See versprach etwas, das selten in der DDR war: Weltläufigkeit, Abenteuer, Freiheit. Immer hatte er davon geträumt. Und nun stand er hier an einer Reling, Kurs auf Kiel, den Westwind in der Nase – ein schöner Traum.
Die Klinik lag auf einer Anhöhe in den Ausläufern der Rhön. Bad Vilbel war nah, aber nicht spürbar. Die Bürotürme Frankfurts wuchsen bei guter Sicht aus einer Dunstglocke am Horizont. Der Parkplatz lag unterhalb, talseitig. Das war gut so, denn die Schönheit der Gründerzeitgebäude sollte nicht vom Glitzerlack der Blechkarossen überstrahlt werden. So parkte man das Auto – ein Hardtop etwa, wie Hilde Pohl es fuhr – und ging dann gemessenen Schrittes etwa hundert Meter bergan. Doch bevor Hilde Pohl dies tat, löste sie die Haken des Kunststoffdachs, nahm es dann wie den Deckel einer Dose vom Fahrzeug und verstaute es im Kofferraum. Solcherart Cabriolets waren jetzt in Mode, denn sie entbehrten der teuren Mechanik eines Sportwagens mit Einklappautomatik. Klein und schnittig machten sie etwas her – das richtige Auto für Hilde Pohl.
Der Ausstieg war etwas unbequem für ihren Körperbau, doch mit der Energie einer Mittsechzigerin, die auf ein erfolgreiches Leben zurückschauen konnte, stemmte sie sich hoch. Als Flüchtlingskind in Westdeutschland angekommen, hatte sie es bis zur Mitarbeiterin eines Staatsministeriums gebracht. Zeitweise war sie zur persönlichen Referentin eines Ministerpräsidenten aufgestiegen.
An der Rezeption nannte sie ihren Vor- und Nachnamen, dann den Vornamen der Nichte. «Ihre Tochter sitzt da drüben. Seit einer Stunde schon.»
«Sie ist nicht …», wollte Hilde monieren, da hatte ihr die Patientenmanagerin bereits das Besucherbuch zur Unterschrift unter die Hände geschoben. Zwar hatte sie keine eigenen Kinder, doch die Tochter ihrer Schwester, ein Einzelkind und kluges Mädchen, lag ihr am Herzen. Leider war sie in die falschen Kreise geraten …
Hilde verzichtete auf eine Erklärung, die niemand erwartete. Sie trug sich ein und suchte dann in der angewiesenen Richtung. In einer Sitzgruppe am Rande des Wintergartens mit Ausblick auf die sanft auslaufenden Hügel der Rhön entdeckte Hilde die Nichte. Sie hatte den Kopf gesenkt, ihre Kleidung war – von der Schulter bis zur Sohle – schwarz.
«Gehen Sie ruhig zu ihr, es ist alles erledigt.»
Mit kleinen Schritten bewegte sich Hilde auf die Nichte zu. Sabine sah blasser aus als zuletzt. Sicherlich lag das auch an der Kleidung: schwarze Jeans, schwarzer Kapuzensweater, die Ärmel hochgeschoben.
Auch die Nichte ließ Blicke wandern. Da entdeckte sie Hilde. Zum Gruß hob Sabine kurz die Hand und ließ sie kraftlos wieder sinken. Sie blieb sitzen und machte keinerlei Anstalten, Hilde entgegenzukommen. Sabine saß einfach nur da, mit kreuzgeradem Rücken, die Hände auf den Oberschenkeln, wie ein zufälliges Abbild ihrer selbst. Also setzte sich die Tante wieder in Bewegung, durchmaß den Raum zwischen Empfangsbereich und Wintergarten mit kurz gesetzten Schritten.
Als sie vor Sabine stand, blickte die Nichte, schon immer große, braune Augen, die ganz wunderbar – fand Hilde – zu Sabines Haar passten, skeptisch zur Tante auf. Der Pagenschnitt fiel ihr jetzt bis auf die Schultern, er war also etwas zu lang. Das sah nicht schick aus, dem musste man Abhilfe schaffen, dachte Hilde, bald schon. Sie würde das anpacken, nicht selbst schneiden, nein, so weit ging Hilde nicht, aber einen Termin beim Bordfrisör vereinbaren.
Etwas flößte Hilde Ehrfurcht ein. Das stille Lächeln, die unbewegte Position, das Glänzen ihrer Augen – Sabine strahlte Würde aus.
Hilde musterte sie, um dem Eindruck auf den Grund zu gehen. So etwas kannte sie bisher nicht von Sabine. Dann hatte sie eine Ahnung, was es sein könnte: die Würde einer Überlebenden. Nach einer gefährlichen Überdosis hatten die Eltern sie direkt in den Entzug geschickt. Nicht einen einzigen Tag noch daheim, kein Abschiednehmen, kein Zögern und Zaudern, da kannten die Eltern nichts. Aber natürlich musste es die beste Entziehungskur sein, die zu haben war.
Als die Eltern gezwungen waren, sich Sabine zuzuwenden, ausnahmsweise einmal nicht weg-, sondern genau hinzusehen, zeigten sie Härte. Und auch jetzt waren sie nicht bereit, ihre Tochter, die Verführbare, die Schwache, in die Arme zu nehmen. Sahen sich nicht in der Lage, ihre Härte als die Ursache von Sabines Schwäche zu akzeptieren. Deshalb hatten sie Hilde das Feld überlassen.
Hilde ergriff ihre Hand und tätschelte sie. «Wie geht es dir?» Sie konnte es kaum erwarten, der Nichte die Neuigkeit zu verkünden.
Sabine lächelte verhalten. Dabei hob sie die Schultern an. Wie dünn und zerbrechlich sie wirkte, dachte Hilde. Wo war das fröhliche Mädchen? Wo hatte es sich versteckt?
«Besser», sagte Sabine. «Es muss mir doch besser gehen. Sonst würden sie mich nicht entlassen, nicht wahr?»
Sie lachten beide – aus Verlegenheit, nicht aus Freude. Sabine machte einen wankenden Schritt in Richtung der Tante. Hilde dachte schon, die Nichte breche zusammen. Sie öffnete die Arme, um sie aufzufangen, doch anscheinend wollte Sabine sie nur umarmen.
Dann schlenderten sie den Weg zum Parkplatz hinunter. Einer der zahlreichen Hausmeister der Klinik folgte in einigem Abstand mit Sabines Koffer. Hilde war es vollkommen schleierhaft, wie man damit einen Zeitraum von zwölf Wochen überbrücken konnte.
«Ist das alles Gepäck?», fragte sie überrascht.
Und als der Kofferraum des Cabriolets aufsprang und Sabine dort schon vier Koffer verstaut sah, fragte sie: «Wohin fahren wir?»
«Nach Kiel», verkündete die Tante. «Und dann geht es gleich weiter.»
Jetzt runzelte Sabine die Stirn. «Weiter? Wohin?»
«Auf ein Schiff!» Die Vorfreude war Hilde anzusehen.
Sabine machte große Augen. «Ein Schiff? Warum?»
«Wir machen eine Kreuzfahrt. Zehn Tage Ostsee. Damit du auf andere Gedanken kommst, mein Herz.» Tante Hilde stemmte die Hände in die Hüften. «So, jetzt ist es raus. Freust du dich? Ich hatte so gehofft, du würdest dich freuen.»
«Ich freue mich, ja, ich freue mich», stammelte Sabine, ohne dass Freude zu hören war.
«Weißt du, es ist ein ganz besonderes Schiff.»
Sabine entfuhr ein Räuspern. Es hatte ihr die Sprache verschlagen. Wenn sie ehrlich war, wünschte sie sich nichts mehr als Ruhe, einen festen Ort; wo dieser Ort liegen könnte, wusste sie allerdings auch nicht.
Ein Kreuzfahrtschiff schien ihr nicht gerade der Inbegriff von Ruhe zu sein, ganz im Gegenteil: Auf einem Schiff war man ständig in Bewegung, rastlos sogar. Und sicherlich war man immer unter Menschen! Sie würde sich beobachtet fühlen wie in der Klinik. Dabei sehnte sie sich nach Privatsphäre, nach echter Einsamkeit. Einem Ort, wo sie sich in aller Ruhe auf die Suche nach sich selbst begeben könnte, die neue Sabine, die Wiedergeborene.
Aber vielleicht, so hoffte sie, wenn nur genügend Gäste im Alter der Tante an Bord waren, würde man sie in Ruhe lassen.
Als habe Hilde ihre Gedankengänge erraten, beteuerte sie: «Du musst dir keine Sorgen machen, du kannst dich ganz auf deine Genesung konzentrieren …»
«Ich bin gesund», insistierte Sabine verärgert.
«Ja, natürlich, dann konzentrierst du dich eben auf deine … Ruhe.»
«Können wir nicht einfach nach Hause fahren?»
Die Tante ignorierte den Vorschlag. Wenn Sabine sich fragte, wo denn dieses Zuhause lag, wusste sie keine Antwort. Ihre kleine Studentinnenwohnung in Frankfurt war es jedenfalls nicht.
Sabine beobachtete, wie die Tante dem Hausmeister einen Heiermann zusteckte, fünf D-Mark, so nannte sie, wie so viele, das große silberne Geldstück.
Dann ging sie hinüber auf die Fahrerseite und setzte sich ans Steuer. Bevor sie das Lenkrad ergriff, streifte sie sich sportliche Handschuhe aus hellem, durchbrochenem Leder über. Die trug die Tante immer, wenn sie oben ohne fuhr – ihr Ausdruck, natürlich, Augenzwinkern inbegriffen. Sabine fand sowohl den Ausdruck als auch die Handschuhe selbst furchtbar albern.
Unschlüssig blieb sie neben der Wagentür stehen. Tatsächlich war sie sich nicht sicher, was sie vom Angebot der Tante hielt und ob sie sich darauf einlassen sollte. Ob sie überhaupt in der Lage wäre, solch einen schrillen Urlaubsalltag durchzustehen? Aber nach Hause zu den Eltern? Das war eindeutig die schlechtere Alternative, Streit und Vorwürfe inbegriffen.
Einen etwas ruhigeren Ort als einen Vergnügungsdampfer hätte sie sich freilich vorstellen können, aber eine kurze Frist vor der Rückkehr in die Elternmühle wäre vielleicht das Richtige. Und wenn sich die Tante Hilde doch so sehr darauf freute?
«Seien Sie für sich selbst da! Nicht für die anderen», hörte sie die Stimme ihrer Therapeutin in ihrem inneren Ohr. Nun denn, sie würde an dieser komischen Kreuzfahrt teilnehmen, weil sie für sich selbst da sein wollte. Ganz in Ruhe, nur für sich! Sicherlich gäbe es eine Bibliothek, einen Rückzugsort für sie. Mehr als daheim.
«Du wirst schon ein ruhiges Eckchen finden», beschwor die Tante sie, und Sabine wurde dieses Gedankenlesen allmählich unheimlich.
Ja, das würde sie, dachte sie dann. Und es wäre vermutlich nicht das von Tante Hilde bevorzugte Eckchen.
Die Unterweisungen des Politoffiziers Henckel im großen Speisesaal ließ Ronni stoisch über sich ergehen. Es waren die üblichen Warnungen vor den Verlockungen des Westens: Lindt-Schokolade, Jacobs-Kaffee, Lübecker Marzipan. Außerdem sollten alle Trinkgelder in Devisen umgehend dem Chefsteward ausgehändigt werden. Ein Raunen ging durch die Menge. Das war neu. Für Ronni ohnehin, schließlich war dies seine erste Westreise. Alle bisherigen Reisen hatten ihn in die Hoheitsgewässer der sozialistischen Bruderstaaten geführt.
Die nun folgenden Salven gegen den Kapitalismus überhörte Ronni, er kannte sie in- und auswendig – der Kapitalismus verführe die Menschen mit Geld und Schokolade, um sie zu Soldaten zu machen, die dann waffenklirrend an der Grenze der Bruderstaaten auf ein Zeichen von Schwäche warteten, um über den einzig vernünftigen Teil der Welt herzufallen. Er sei wie der Rattenfänger von Hameln, führte der Politoffizier aus, «wenn ihr diese Geschichte kennt, Genossinnen und Genossen». Henckel verschliff die Endung «-innen» genau wie Erich Honecker. Beinahe klang es wie «liebe Genossen und Genossen».
«Kollege Krapp, was lässt Sie da grinsen?», fuhr Henckel ihn an.
Der Politoffizier hatte den harten Zungenschlag des Norddeutschen. Ronnis sächsischer Klang hingegen war weich. Er hatte versucht, ihn sich abzutrainieren, um nicht aufzufallen an Bord, denn seine Herkunft rief Misstrauen hervor. Selbst Kabinenkollege Jochen nannte ihn aufgrund seiner besonderen Beziehung zu den Herrschenden nur «den Günstling».
«Glaub mir, Kollege Krapp, es ist todernst», nahm der Politoffizier Ronni in die Pflicht. «Wir befinden uns im Krieg. Wir sind ein kleines Land. Was glauben Sie, wie schnell die uns einkassieren ohne die schützende Hand unseres großen, starken Bruders? Hätten die längst getan. Also: ‹Holzauge, sei wachsam!›»
Über diesen Spruch stolperte Ronni jedes Mal, wenn Henckel ihn brachte. Wie konnte ein Holzauge wachsam sein? Er nickte dennoch, um nicht noch mal einen Rüffel zu bekommen. Mit dem Genossen Henckel war nicht zu spaßen – bei aller Jovialität, die er an den Tag zu legen versuchte. Dass der Politoffizier über Ronnis heißen Draht zum Politbüro bestens informiert war, stand außer Frage. Doch es schien ihn nicht zu interessieren.
«Wir sind Botschafter unseres Landes», fuhr er fort, «ein jeder von uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meldet Verdächtiges, umgehend! Wir kämpfen hier an vorderster Front.»
«Was dürfen wir denn als verdächtig ansehen, Genosse Politoffizier?», fragte der ölverschmierte Leiter der Maschinenbrigade. Anders als die Stewards kamen die Maschinisten niemals in Kontakt mit den Gästen. Ihr Arbeitsbereich lag tief im Bauch des Schiffes. Dorthin wagte sich kaum jemand. Es war heiß und schmierig, roch nach Diesel und Schwefel, Ronnis Brigadekollegen nannten es «die Vorhölle».
«Na, wenn der Motor stottert», übernahm Ronnis Kajütenkumpel Jochen die Antwort, «dann hat vermutlich Helmut Kohl seine Hand im Spiel.» Alle lachten, auch Ronni. Jochens Humor war wagemutig. Er war einer der wenigen, die den Namen des amtierenden westdeutschen Kanzlers offen aussprachen.
Nur der Politoffizier lachte nicht. «Ihr wisst ja wohl, was ich meine», würgte Henckel die Diskussion ab.
«Nein. Weiß ich nicht.» Ratsuchend wandte sich Ronni an Jochen.
«Vorletztes Jahr zum Beispiel», flüsterte Jochen, «auf der Abschiedsfahrt unseres alten Käptens, gab es eine sehr rüstige Gruppe Sportler. Die hatten ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm: Ausstaffiert in Sporthosen und Sportjacken mit Abzeichen unserer Olympiamannschaft, rannten sie jeden Morgen gegen die Reling an und streckten dabei die Arme aus, so als wollten sie sich im nächsten Moment drüberwerfen. Das war so kurios und offen zur Schau gestellt, dass niemand etwas Böses vermutete. Aber was wie eine alberne Übung aussah, stellte sich am Ende als ein Trainingsprogramm der besonderen Art heraus. Die haben nämlich den Anlauf und Schwung geübt, den sie benötigen würden, um mit einem Sprung über die Reling weit genug vom Schiffskörper wegzukommen. Eines frühen Morgens, als das Schiff vor Kuba vor Anker lag, sprangen sie dann tatsächlich.»
«Sie überlebten?», fragte Ronni flüsternd, während Henckel weiter über den Umgang mit dem Klassenfeind dozierte.
Jochen grinste. «Sie erreichten sogar den Strand.»
«Und dann?», fragte Ronni.
Jochen zog eine Augenbraue hoch. «Auf Kuba haben die Behörden die Sportler sofort festgenommen. Also nimm dir bloß kein Beispiel an denen.»
«Hätten die mal besser bis Fehmarn gewartet», rief einer der Poolstewards, der ihre Unterhaltung belauscht hatte. «Da wären sie ihnen mit einem Koffer Westgeld entgegengeschwommen.»
Streng sah Henckel zu ihnen hinüber. «Eines möchte ich zum Abschluss noch einmal sehr deutlich in Erinnerung rufen.» Henckel zog die Bemerkung in die Länge, bis er sich der Aufmerksamkeit aller sicher war. Auch Ronni spitzte die Ohren. «Der Umgang mit dem Klassenfeind bleibt höflich und distanziert. Ihr wisst, die Westler sind mit allen Wassern gewaschen.»
«Wir melken die Kuh, aber wir streicheln sie nicht», übersetzte der Leiter der Maschinenbrigade. Niemand lachte. Ronni wurde rot. Er empfand die Bemerkung als unanständig.
«Das war’s für heute. An die Arbeit, Kolleginnen und Kollegen!», schloss der Politoffizier in staatstragender Manier. Und Ronni wandte sich erleichtert ab.
Am Nachmittag, kurz bevor die Arkona Kurs auf Kiel nahm, beorderte der Chefsteward Ronni in den großen Speisesaal. Auf einen Laufwagen der Bordbibliothek hatte er Körbe voller Bücher mit identischem marineblauem Einband gestapelt. Tatsächlich schienen es mehr als hundert Exemplare ein und desselben Buches zu sein. Wertvoll mussten sie sein, denn der Einband war aus Leinen und der etwas abgegriffene Schnitt goldglänzend beschichtet. «Neues Testament», las Ronni ab und blätterte durch die Seiten: Dünndruck, kleine Buchstaben. Obwohl es beinahe durchscheinend war, fühlte es sich fest an, nicht so faserig wie Ostpapier.
«Die Bibel auf dem Nachttisch, das wünschen sich die Westler», kommentierte Harry.
«Wozu das denn?»
«Vielleicht als spirituellen Rettungsring?», spekulierte sein Brigadeleiter.
«Warst du schon mal im Westen?», fragte Ronni unvermittelt. «So richtig?»
«Iwo.» Harry machte eine angewiderte Geste. Die Brille rutschte ihm ein wenig herunter, er schob sie wieder hoch. «Dahin zieht’s mich nicht. Und im Dienst ist es ohnehin verboten: Solange wir uns im kapitalistischen Ausland bewegen, wird jede Entfernung von Bord als Republikflucht gewertet.»
Ronni schwieg nachdenklich. Republikflucht. Niemals hatte er nur einen Gedanken darauf verschwendet. Es ging ihm gut, die Arbeit an Bord machte ihm Spaß, im Intershop gab es sogar Lindt-Schokolade zu kaufen. Warum sollte er die DDR verlassen? Natürlich hatte er von Fällen gehört. Auch auf den Bänken seiner Oberschule fehlten manchmal von heute auf morgen Mitschüler. Aber ihm hatte dieses Land bisher alles gegeben, was er brauchte: ein Bett, eine Arbeit, gutes Essen, Schallplatten von Silly und den Puhdys, sogar Jeanshosen! Und als Thälmannpionier hatte er sogar ein paarmal ohne die Eltern an die geliebte Ostsee reisen dürfen. Ferienlager mit hundert anderen Jugendlichen, Jungen wie Mädchen! Seitdem war er süchtig nach dem Geruch der Brandung.
Ronni spürte, wie Harry ihn von der Seite musterte. Harry war der Brigadeleiter, und Ronni konnte sich mit allen Sorgen an ihn wenden. Der Umgang war nicht so eng wie mit dem Kabinengenossen Jochen; den hörte er manchmal schnarchen, als lägen sie im selben Bett. Das war ein guter Kumpel. Doch Harry vertraute Ronni vollkommen.
Die See war rau, der auflandige Wind stand steif auf die Einfahrt zur Kieler Bucht. Im Gang der ersten Klasse wurden sie von Wand zu Wand geworfen. Sie öffneten eine der Kabinentüren. Harry nahm zwei Bibeln aus dem obersten Korb und drückte sie Ronni in die Hand. «Die kommt in jeden Nachttisch: Schublade auf, Bibel rein, Schublade zu. Du hast eine Minute pro Kabine.»
Vorsichtig trat Ronni auf die langflorige Auslegware. Selbst durch die Schuhsohlen hindurch fühlte sie sich unglaublich weich an. Jedes Geräusch wurde geschluckt. Gischt peitschte gegen die Glasscheiben, doch hier drinnen hauste man wie ein König. Die Eleganz der Kabine beeindruckte Ronni. Die Einrichtung stammte aus dem Westen, das sah man. Derartige Möbel, Vorhänge, Teppiche gab es nicht zu kaufen in der DDR. Und hier, in der ersten Klasse, besaßen die Bullaugen die Form richtiger Fenster. Der Zuschnitt war insgesamt großzügiger, Harry sprach gern von Suiten. Wieder so ein Westwort. Weiter unten, knapp über der Wasserlinie, wo sich die einfacheren Kabinen befanden, waren die Fenster rund: Bullaugen, wie es sich für Schiffe gehörte. An seinen freien Tagen liebte Ronni es, hinauszuschauen. Doch freie Tage waren selten.
«Nicht trödeln», hörte Ronni Harry rufen und beeilte sich bei den nächsten Kabinen, um die Vorgabe einzuhalten: Eine Bibel in jeder Hand, betrat er die Suite, zog die erste Nachttischschublade auf, legte ein Exemplar hinein, schob sie wieder zu. Dann trat er mit federndem Schritt um das Doppelbett: Schublade auf, Bibel rein, Schublade zu. Als Ronni wieder auf den Gang trat, sagte Harry: «Dreißig Sekunden. Alle Achtung, Ronni, das ist Planerfüllung!»
Mit dem Generalschlüssel verschloss Harry die Kabine wieder. Und weiter zogen sie in Schlangenlinien, das Rollen des Schiffes nur mühsam ausgleichend, den Gang hinunter mit einem Korb voller Bibeln.
«Stimmt es», fragte Ronni, «dass im Falle eines Unglücks die Passagiere zuerst gerettet werden?» Er hatte dies gerüchteweise gehört. Seitdem beschäftigte ihn diese Frage.
«So steht es im Evakuierungsplan, ja. Aber hast du schon mal einen Notfall erlebt? Bei der Armee? In der Schule?»
Ronni nickte.
«Und», Harry schob seine Hornbrille nach oben, «hält sich da irgendjemand an Evakuierungspläne?»
Ronni schwieg nachdenklich. Eine richtige Antwort auf seine Frage war das nicht.
«Auf jeden Fall», fuhr Harry fort, «wollen die Damen und Herren höflich behandelt werden. Am besten, man küsst ihnen die Schuhe.»
«Auf der Gastronomieschule haben wir exakt das Gegenteil gelernt: Der Kellner hat das Sagen, der Gast hat zu folgen. Er muss warten, bis er platziert wird, der Kellner bestimmt, was es gibt und was nicht. Mit leisem Nachdruck oder mit barschem Befehlston steuert er die Bestellung. So ist es überall in der Republik. Nur eben hier nicht und auch nicht im Neptun.»
«Du warst in Warnemünde?»
«Zur Ausbildung, nach der Gastronomieschule. Mein Onkel meinte, dort bekäme man den letzten Schliff fürs Schiff. Er redet gern in Reimen.»
«Meinst du, du bekommst das hin?», fragte Harry skeptisch.
«Was?»
«Die Westpassagiere zuvorkommend zu behandeln? Sie auf Händen zu tragen …?»
«Sicher», sagte Ronni. «Das schaffe ich.»
«Wir werden sehen», erwiderte Harry und runzelte die Stirn.
Unter Kronleuchtern deckten Ronni und seine Kollegen die Tische fürs erste Abendessen an Bord ein. Alle Restaurantstewards waren im Einsatz. Einige der Kabinenstewardessen halfen unter der Anleitung von Brigadeleiterin Moni. «Viele Hände, schnelles Ende», sagte Moni gern. Den Spruch kannte Ronni schon aus Kindergartentagen. Er brachte ihn eher mit Kinderscheren und Bastelleim in Verbindung als mit Besteck und Servietten.
Ronni stellte die Karten für den ersten Abend dekorativ in der Tischmitte auf. Es gab typische Gerichte aus der Heimat: Thüringer Klöße und Szegediner Gulasch, Soljanka und Plinsen zum Nachtisch. Nur die Namen der Weine klangen plötzlich exotisch: Statt Schwarzer Mädchentraube und Stierblut im geflochtenen Körbchen wurden Cabernet Sauvignon und Pinot Grigio serviert.
«Warum tauschen wir die Weine?», fragte Ronni, mit einem Stoß Karten in der Hand von einem Tisch zum anderen schlendernd.
Harry polierte gerade noch einmal höchstpersönlich und eigenhändig das Besteck. Auf den Messern, Gabeln und Löffeln der Arkona prangte immer noch der Schriftzug Astor – so hatte das Schiff geheißen, als es noch unter Westflagge gefahren war. Heute, am ersten Abend, sollte das Besteck für die Devisengäste glitzern. Ein hundertfaches Funkeln auf den Tischen, Ronni liebte diesen Anblick. Und das war noch nicht das Galadinner!
«Weil die Westdeutschen andere Geschmacksnerven haben», gab Harry schließlich Auskunft.
«Andere Geschmacksnerven?» Ronni sah Harry ungläubig an.
«Na, süße Weine mögen sie nicht. Sie trinken lieber saure.» Harrys Stirn glänzte. Er wandte sich den übrigen Restaurantstewards im Saal zu. «Zum Galadinner singt Roberto Blanco», verkündete er. Großes Hallo des Kollektivs. Ronni hörte den Namen zum ersten Mal. Offenbar war der Mann populär unter den Werktätigen. Nur wenige riefen nach Frank Schöbel, sie wurden niedergezischt: «Von Roberto Blanco hol ich mir ein Autogramm. Den Schöbel hab ich schon», hörte er Moni sagen.
Kurze Zeit später passierten sie den Fehmarnbelt, und mit einem Mal waren sie auf vier Seiten von Land umgeben. Nur bei genauem Hinsehen konnte man noch Lücken in der grünen Küstenlinie ausmachen. Kaum wahrnehmbar rückte das Ufer näher. Aufgekratzt und nur mit einem Blouson bekleidet, stand Ronni an Deck und beobachtete, wie sich der schnittige, spitz zulaufende Bug neigte. Die beiden schwenkbaren Propellerschrauben am Heck machten das Schiff trotz seiner Größe erstaunlich wendig. Sie passierten den Strand von Hohwacht, dann setzte der Erste Offizier neuen Kurs: Die Arkona steuerte direkt in die Kieler Förde hinein.
Nachdem sie den Leuchtturm Friedrichsort passiert hatten, wurde die Stadt spürbar. Straßen, Häuser, Fabriken. Mit einem Mal sah Ronni kaum noch Grün an Land. Gebäude lehnte sich an Gebäude, durchschnitten von Asphaltbändern. Darauf schlängelte sich Blech an Blech. So viele Fahrzeuge beieinander hatte er im Osten noch nie zu Gesicht bekommen. Lackiert in allen Farben des Regenbogens. Undenkbar in der Deutschen Demokratischen Republik, wo man zehn Jahre oder länger auf ein Fahrzeug der Marke Trabant wartete und derzeit zwischen den Farben Delfingrau und Papyrusweiß wählen konnte. Persisch Orange, die Farbe des Trabbis seiner Eltern, war bereits 1977 wieder ausgemustert worden. Ronni liebte diese Farbe – und das Auto.
So hatte sich Ronni den Westen vorgestellt: bunt, eng, aufdringlich. Zu Hause in Dresden blieb man von alledem unbehelligt. Die TV-Wellen strichen einfach über den Einschnitt des Elbtals zwischen Gorbitz und Bühlau hinweg. Nur die Sicherheitsbehörden hatten so hohe Antennen, dass sie Westen schauen konnten. Selbstverständlich ausschließlich zu dem Zweck, ihren Pflichten nachzukommen.
Seit seiner Ausbildung, zuerst in Leipzig, dann in Rostock und auf See, hatte Ronni eine leise Vorahnung bekommen. Selbst auf dem Lehrschiff empfing man Westfernsehen und Weltradio. Und ja, Ronni konnte es nicht leugnen, obwohl er eine glückliche Kindheit und Jugend mit Rockmusik und Schlaghosen in seinem Land verbracht hatte, war in ihm eine gewisse Neugier auf diese ganz andere Welt erwacht.
Ronni harrte auf dem Deck aus. Er versuchte, eine Promenade zu entdecken, eine Flaniermeile am Fluss entlang, wie er es aus Warnemünde kannte. Doch die Kieler Förde ähnelte einem Schlauch, der sich wie ein Schleppnetz zum Ende hin zusammenzog und sein Ziel nicht preisgab.
Das Ufer wurde städtischer. Und je schmaler die Förde wurde, desto dichter drängte die Stadt heran: Hochhäuser, die das Schiff überragten, bei Tage flimmernde Leuchtreklamen. Schreiende Farben traten gegeneinander an, versuchten, sich zu übertönen. In Leipzig grüßte einzig die Reklame der Leipziger Messen, das drehbare Neon-Doppel-M, die Gäste aus dem In- und Ausland. Dort, in Auerbachs Keller, war Ronni im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum ersten Mal echten Westlern begegnet. Die beiden jungen Männer waren laut gewesen und hatten mit Geld nur so um sich geworfen. Das hatte Eindruck auf ihn gemacht.
Beim Leuchtturm Holtenau kam ein Lotse mit seinem Boot längsseits und stieg über die Leiter an Bord, um den Ersten Offizier beim Navigieren zu unterstützen. Und als sie in der Hörn anlangten, dem letzten und schmalsten Stück des Förde-Schlauchs, und vollkommen freien Blick auf die Straßenzüge und Gebäude hatten – da entdeckte Ronni nichts Schönes. Hinter den schreienden Werbetafeln und Plakatwänden verbarg sich das Stadtgrau wie daheim in Dresden. Doch ein so spektakuläres Stadtpanorama wie dort suchte man hier vergebens, fand er.
In einem gewagten Manöver, unterstützt von zwei Schleppern, wendete die Arkona auf einer Wasserfläche, die nur wenig breiter als das Schiff lang war. Dann machte sie am Kreuzfahrtpier fest. Von dort aus würden sie die erste Kreuzfahrt für Westler in dieser Saison antreten. Die großen Hafenstädte der Ostsee: Danzig, Riga, St. Petersburg (so stand es im Prospekt und nicht Leningrad, Ronni musste lange überlegen, welche Stadt damit gemeint war), Helsinki, Stockholm – dann wieder zurück nach Kiel. Zwei Seetage waren angesetzt, sechs Landgänge, acht Tage insgesamt. Im September war die Ostsee noch schön, erst später hielten hier die Herbststürme Einzug.
Nun wurden die Gangways an die Bordwandpforten gelegt. Vom landseitigen Deck aus beobachtete Ronni die Ankunft der Gäste. Nachdem die Absperrseile gefallen waren, schlenderten sie zum Schiff hinauf. Die Koffer blieben vorerst an Land und warteten darauf, mithilfe eines Krans und hölzerner Paletten auf das Achterdeck gehoben zu werden. Manche der Passagiere, die nun zu Dutzenden mit Reisebussen am Pier abgeladen wurden, harrten nicht etwa am Fuße der Gangway aus, sondern drängelten, um so schnell wie möglich an Bord zu gelangen. Während das Feld zu Beginn noch dicht beisammen lag, zog es sich auf der ansteigenden Gangway rasch auseinander.
Zwei Frauen fielen Ronni neben all den Pärchen und Familien ins Auge, vielleicht wegen ihres offenbar großen Altersunterschieds. Waren sie Mutter und Tochter? Oder zumindest miteinander verwandt? Die ältere Frau war etwas untersetzt und klein und in ein Gebinde bunter, durchscheinender Tücher gehüllt, die im Wind flatterten wie die Wimpel einer Yacht. Die jüngere Frau war groß, schlank und ganz in Schwarz gekleidet. Sie folgte der Vorausstürmenden zögernd und mit etwas Abstand. Ob sie bloß keine Eile hatte oder von Zweifeln geplagt war, konnte Ronni aus der Ferne nicht sagen. Sie trug ein schwarzes Oberteil, dazu eine ebenso schwarze Jeans und zu guter Letzt eine dunkle Brille. Sicherlich war sie in Trauer, anders konnte sich Ronni die Kluft nicht erklären. Eine schwarze Jeans, dachte Ronni. Wie heilfroh man sein konnte, wenn man in den HO-Läden eine blaue ergatterte, aber schwarz!
Immer wieder wandte sich die Vorauseilende zu der Jüngeren um, Ronni schnappte einzelne Rufe auf, offenbar ermunterte sie sie. Doch die junge Frau in Schwarz harrte auf halber Höhe der Gangway aus, um den Blick über den Hafen schweifen zu lassen. Der Wind fuhr ihr in das weit sitzende, kurzärmlige Shirt. Er beulte den Stoff und ließ ihn flattern wie ihr braunes, langes Haar.
Ronni dachte, sie müsse eine Schauspielerin sein, so lässig lehnte sie sich in Jeans und Sonnenbrille gegen das Reep. Wieder rief die ältere Frau etwas. Und die jüngere verharrte an Ort und Stelle und tat nichts weiter, als das Gesicht in die letzten Strahlen der Abendsonne zu halten, während die anderen Passagiere an ihr vorbeiströmten. Sie war ihm sympathisch, dachte Ronni. Nicht mehr lange, und die Westgäste würden an den vorbereiteten Tischen Platz nehmen, um das erste Dinner an Bord zu genießen. Dann würde er ihren Namen erfahren …
Als er lautes Fluchen hörte, drehte sich Ronni, schon halb abgewandt, noch einmal um. Die ältere Frau war offenbar mit einem ihrer Absätze zwischen den Planken stecken geblieben. Schimpfend und um Gleichgewicht ringend, zog sie den Schuh vom Fuß und entwand ihn den hölzernen Planken, ohne dass der Absatz brach. Doch anstatt den Schuh wieder über den Fuß zu streifen, zog sie auch den zweiten aus und ging barfuß, nur mit der Strumpfhose bekleidet, an Deck. Ronni grinste angesichts dieser sympathischen Spontaneität. Dann sah er sich um, aber von der jüngeren Frau war nichts mehr zu sehen. Er schnippte seine halb gerauchte Zigarette über die Reling und wandte sich der Treppe zu. Die Stewards der Restaurantbrigade waren angehalten, den Passagieren beim Einschiffen und Verstauen der Koffer zur Hand zu gehen.
Sabine und Hilde hatten die Kabine, ihren Rückzugsort für die nächsten acht Tage, eben in Besitz genommen. Die Tante schritt zwischen Betten und Sesseln hin und her, als wolle sie die Entfernungen abmessen. «Verrückt», sagte sie immer wieder, «das sieht wirklich exakt so aus wie im Fernsehen.» Sabine hatte es sich auf der frisch bezogenen Matratze bequem gemacht und wusste noch nicht, wie sie die ersten Tage in dieser Enge überstehen sollte. Beinahe wünschte sie sich zurück in die Klinik.
Da klopfte es an der Kabinentür. Die Tante warf Sabine einen Blick zu. Widerwillig schob sie die Füße von der Matratze und setzte sich auf die Bettkante. «Das werden die Koffer sein», bemerkte Hilde. Sabine verschränkte die Hände, um ihr Knie damit zu umfassen, und rief, um Weltläufigkeit bemüht: «Herein!»
Der Steward, ein athletischer junger Mann in schmucker weißer Uniform mit wirren Locken, trat ein und stellte die Koffer vor den Betten ab. Abwartend verharrte er in seiner Position. Eine peinliche Stille griff Raum, niemand rührte sich. Obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte, kam es Sabine vor, als erkenne er sie wieder. Der Steward starrte auf die Handschuhe der Tante, die sie, obwohl es noch warm war im Spätsommer, trug. Hautfarbene Seidenhandschuhe, die bis zum Ellenbogen reichten. Bestimmt hatte er noch nie solche Handschuhe gesehen. Sabine fragte sich, ob sie ihn auffordern sollte, die Kabine wieder zu verlassen, da zog Hilde die Handschuhe aus, nahm ihr Portemonnaie aus der Handtasche und drückte dem Steward einen blauen Zehn-D-Mark-Schein in die Hand. Der starrte auf den Schein, als wisse er nichts damit anzufangen. Als Hilde die Hand des jungen Mannes ergriff und seine Finger einen nach dem anderen mit leichtem Druck schloss, ließ er es geschehen. Seine Faust mit dem Schein verschwand in der Hosentasche, und er verabschiedete sich, indem er zwei Finger der freien Hand wie an den unsichtbaren Schirm einer nicht vorhandenen Matrosenmütze legte.
«Hat er vor uns salutiert? Und hast du gesehen, wie er dich angestarrt hat?», fragte Sabine, nachdem der Steward die Kabine verlassen hatte.
«Er ist jung. Vielleicht hat er noch nie im Leben einen Zehner West gesehen. Geschweige denn in den Händen gehalten.»
«Das Starren war aufdringlich.»
«Ich fand ihn süß», versuchte die Tante, ihre Nichte durch das eigene Urteil offenbar zu einer Stellungnahme zu bewegen. «Mit diesen Wuschellocken in der Stirn, als sei er gerade eben aus dem Bett geschlüpft … Vielleicht sind wir ihm vorher auf dem Schiff schon aufgefallen.»
«Er wirkte nicht wie ein Ausländer», bemerkte Sabine schüchtern.
«Ausländer wäre auch das falsche Wort. Die Mannschaft auf diesem Schiff stammt aus der DDR.»
«Wirklich?»
Hilde bestätigte nickend. «Dieses Schiff befindet sich im Besitz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.»
«Tatsächlich? Warum dürfen wir dann mitfahren?»
«Einen Teil der Reisen verchartern sie an einen westdeutschen Reiseveranstalter. Das ist ein gutes Geschäft – für beide Seiten. Die DDR braucht Devisen, weil sie ihre Leute gut leben lassen will: für Orangen und Bananen zum Weihnachtsfest und für warme Winter. Und weil die Arkona vor gar nicht langer Zeit noch als Astor durch die Fernsehkanäle des Westens schipperte, ist dieses Schiff prominenter als mancher Prominente.»
«Seit wann kennst du dich so gut aus in der Seefahrt, Tantchen?»
Hilde lächelte unbestimmt. «Du weißt doch: Ich liebe diese Serie, Bine.»
Sabine versteinerte. Diesen in der Familie einstmals geläufigen Kosenamen hatte sie lange nicht gehört. Sie wusste nicht, ob sie dafür bereit war.
«Das war schon immer mein Traum: einmal mit dir auf dem Traumschiff über die Meere fahren», fügte die Tante sanft hinzu.
Sabine ließ dieses so offen geäußerte Liebesbekenntnis unbeantwortet. Stattdessen versank sie in ihre Gedanken. Erinnerte sich an ein Vorher, an eine Zeit der Unschuld, der Kindlichkeit, die die vierzehnjährige Bine mit der ersten Zigarette verloren hatte. Mit Macht war die Welt der Verführung in ihre Jugend gekracht. Und beinahe wäre Sabine an dieser Karambolage zugrunde gegangen …
Mit dem Waschzeug in der Hand war Hilde derweil durch eine schmale Tür ins Bad verschwunden.
«Rechts oder links», rief Tante Hilde herüber.
«Wie bitte?» Geistesabwesend tauchte Sabine aus ihren Erinnerungen auf.
«Bevorzugst du das rechte oder das linke Zahnputzglas?»
Sabine verdrehte die Augen. Was die Tante für Probleme hatte! «Das kannst du dir aussuchen!» Sie ließ sich in das Kopfkissen fallen, warf die Arme nach hinten und schloss die Augen. Ein unbekannter, stechender Duft fuhr in die Nase. «Die Wäsche riecht merkwürdig.» Sabine rümpfte die Nase.
Ohne ihre Waschutensilien trat Hilde wieder in den schmalen Gang, der die Kabine mit dem Deckkorridor verband. Sie schnupperte, als falle es ihr erst jetzt auf. «Es riecht nach DDR», sagte die Tante. Sie nahm das Kissen von ihrem Bett und sog den Geruch ein. Darüber schloss sie die Augen und versank in ein Schweigen, das kein Nachfragen zuließ.
Sabine legte sich aufs Bett und schob ihren Kopf über den Rand, um darunter zu schauen.
«Was tust du da?», fragte die Tante.
Sabine kicherte. Sie hatte eine Entdeckung gemacht. «Die Beine sind am Kabinenboden festgeschraubt.»
«Wessen Beine?», fragte Tante Hilde geistesabwesend. Sie hatte begonnen, ihre Wäsche in den Schrank an der Türseite der Kabine zu stapeln.
«Die des Bettes.»
«Bei Sturm werden die Möbel schon mal hin und her geworfen», sagte Hilde lakonisch, während sie die sehr bunten Stapel an der Regalkante ausrichtete.
Sabine richtete sich wieder auf, ihr Gesicht war gerötet. «Nicht, dass ich seekrank werde! Das hätte mir gerade noch gefehlt.»
Als sie ihren Koffer beinahe geleert hatte und das Schwarz fast vollständig vom Koffer in den Wandschrank gewandert war, fiel aus dem letzten Wäschestoß – einem Bündel schwarzer Strumpfhosen – ein silberner Gegenstand. Es klirrte, als er in der Kofferschale aufkam.
«Sabine!»
«Was?», fragte die Nichte und nahm den Löffel in die Hand.
Die Tante zögerte. «Ist das ein Drogenbesteck?»
Sabine hielt den Gegenstand ins Licht. Er sah aus wie ein mittelgroßer Löffel, besaß aber Zähne an seinen Rändern. Sabine schmunzelte. «Das», sagte sie feierlich, «ist ein Grapefruitlöffel.»
Die Tante blieb skeptisch. «Du nimmst einen einzelnen Löffel mit, um Grapefruit zu essen?»
Sabine nickte. «Wozu sonst? Um Dope aufzukochen, reicht jeder beliebige Löffel», erläuterte Sabine.
«Ich will solch ein Wort nicht in meiner Gegenwart hören!»
«Löffel?» Sabine grinste.
«Du weißt genau, was ich meine. Seit wann bist du bitte schön ein Grapefruitfan?»
Sabine zögerte. Sie hatte wenig Lust, ihrer Tante von den letzten Wochen zu erzählen. Schon in Kiel hatte diese sie mit Fragen gelöchert, aber Sabine hatte nur knapp geantwortet. «In der Klinik haben wir Grapefruit gegen den Durst gegessen. Auf Entzug bekommt man eine unstillbare Sehnsucht nach frischem Wasser. Dein Mund ist eine Wüste. Wenn ich eine Grapefruit sehe, will ich nur noch hineinbeißen. Der Löffel dient auch dazu, den Prozess zu verlängern und die Geduld zu trainieren.»
Sabine schwieg und genoss diesen seltenen Moment totaler Sprachlosigkeit der Tante.
«Ich bevorzuge Orangen», bemerkte Hilde schließlich schmallippig.
Sabine grinste still in sich hinein. Und freute sich insgeheim darauf, die Tante in Zukunft doch hin und wieder schockieren zu müssen.
Zum ersten Dinner – die Mahlzeiten wurden an Bord durchweg englisch ausgesprochen – empfingen die versammelten Restaurantstewards die Gäste am Durchgang zum großen Speisesaal auf dem C-Deck. Ronni beobachtete das Defilee. Von Jogginghose bis Smoking war alles vertreten. Die Passagiere harrten zunächst vor den Tischlisten aus, identifizierten ihre Namen und wurden dann von den zuständigen Stewards zu ihren Plätzen geführt. Künftig musste jeder wissen, wo er oder sie zu sitzen kam. Und keiner wollte sich eine Blöße geben. Die Zusammensetzung der Tische blieb für den Rest der Reise dieselbe.
Die beiden Frauen von der Gangway und aus der Kabine erkannte Ronni sofort. Und auch die ältere der beiden erkannte ihn und wandte sich an das vertraute Gesicht. Gemeinsam suchten sie anhand der Liste den Sitzplatz, und so erfuhr Ronni ihre Namen: Hilde Pohl und Sabine Markwald. Frau Pohl trug erneut sehr leichte, bunte Stoffe, die ihren Körper umflatterten; Sabine trug immer noch die schwarze Jeans, jetzt aber mit einem langärmligen Oberteil, natürlich ebenfalls schwarz. Die Kleidung verstärkte den Eindruck ihrer Blässe. Sie wirkte kränklich, mindestens angeschlagen. Oder hatte sie bis eben noch in der Kajüte geschlafen? Am Nachmittag?
Ronni spürte, dass Sabines Garderobe mehr Aufmerksamkeit erregte als die zahlreichen Abendkleider, die mit Stolz und Eleganz, einige sogar mit Hochmut getragen wurden. Sie fiel auf durch ihre Bescheidenheit und Unangepasstheit, das imponierte ihm. An den Füßen trug sie Sandalen mit einer extradicken Korksohle. Das war zwar nicht elegant, aber lässig und sicherlich urst bequem.