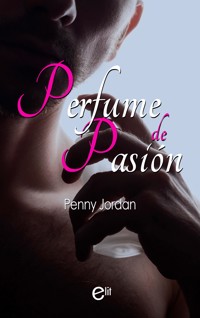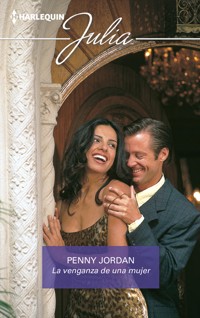8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
London in den Fünfzigerjahren. Die vier jungen Erbinnen einer berühmten Seidendynastie müssen sich der Realität stellen: Die verwöhnte Emerald, die attraktive Rose, die rebellische Jenny und die ambitionierte Ella leben und vergnügen sich in der Glamourwelt der Mode und glauben, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Doch auch in einem Luxusleben ist nicht alles so leicht, wie es scheint, und Intrigen aus der Vergangenheit können fatale Auswirkungen haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Ähnliche
Buch
London in den späten fünfziger Jahren. Die vier jungen Erbinnen einer berühmten Seidendynastie müssen sich der Realität stellen und ihren Platz im Leben finden: die verwöhnte, von Eitelkeit und Standesdünkel getriebene Emerald, die exotische Schönheit Rose, die es als Waise eines englischen Adligen und einer chinesischen Prostituierten nicht leicht hat, die rebellische Janey, die von einer Karriere als Modeschöpferin träumt, und die ambitionierte Moderedakteurin Ella, deren Berufung eigentlich ganz woanders liegt.
Sie alle arbeiten, leben und vergnügen sich in der Glamourwelt der Mode und glauben, dass ihnen die Welt offensteht. Doch auch in einem Luxusleben ist nicht alles planbar, und Geheimnisse aus der Vergangenheit können fatale Auswirkungen auf die Zukunft haben.
Über zwei Jahrzehnte, zwischen Aufbruch und Nostalgie, zwischen Intrigen, Verrat und großen Gefühlen teilen vier höchst unterschiedliche Frauen eine gemeinsame Sehnsucht: nach Momenten des Glücks und der großen Liebe.
Autorin
Penny Jordan ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Autorinnen von Frauenromanen in Großbritannien und hat weltweit bisher über 80 Millionen Bücher verkauft. »Ein Hauch von Seide« ist nach »Der Glanz der Seide« der zweite Teil einer Serie um eine große Seidendynastie aus Cheshire, wo die Autorin selbst lebt.
Von Penny Jordan außerdem bei Goldmann lieferbar:
Penny Jordan
Ein Hauch
von Seide
Roman
Aus dem Englischen
von Elvira Willems
Die Originalausgabe erschien 2009
unter dem Titel »Sins« bei Avon,
a division of HarperCollins Publishers, London.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung September 2011
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Penny Jordan
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Folgenden Menschen möchte ich für ihre unschätzbare Hilfe danken:
Meiner Agentin Teresa Chris.
Maxine Hitchcock und ihren Mitarbeitern bei Avon für ihre Geduld und ihr Verständnis.
Yvonne Holland, die das Manuskript wie immer einem wunderbaren Lektorat unterzogen und mich vor inhaltlichen Fehlern bewahrt hat.
Ich möchte dieses Buch meinen Leserinnen und Lesern widmen, besonders den netten Menschen, die mir geschrieben haben, um mir zu sagen, wie sehr ihnen Der Glanz der Seide
Erster Teil
1
London, Januar 1957
Rose Pickford öffnete die Tür, betrat den Laden ihrer Tante Amber in der Walton Street, mit seiner Wärme und seinem vertrauten Duft nach Vanille und Rosen – ein Duft, der eigens für ihre Tante kreiert worden war –, und stieß erleichtert einen kleinen Seufzer aus.
Eines Tages – so Ambers Worte – würde Rose nicht nur diesen exklusiven Laden in Chelsea leiten, wo die Möbelstoffe aus der Seidenfabrik ihrer Tante in Macclesfield verkauft wurden, sie würde auch Kunden bei der modernen und eleganten Neuausstattung ihrer Wohnungen beraten.
Eines Tages.
Doch im Augenblick war sie nur eine unerfahrene Kunststudentin frisch vom College, die bei Ivor Hammond, einem von Londons renommiertesten Innenausstattern, als Mädchen für alles angestellt war.
»Hallo, Rose, wir wollen gerade eine Tasse Tee trinken. Möchtest du auch eine?«
Rose lächelte dankbar. »Ja, bitte, Anna.«
Anna Polaski, die den Laden im Augenblick führte, war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mit ihrem Ehemann Paul, der Musiker war, als Flüchtling aus Polen nach England gekommen. Anna war immer sehr freundlich, und Rose vermutete, dass sie ihr leidtat – weil Anna erkannte, dass auch Rose in gewisser Weise eine Außenseiterin war.
»Ich hasse den Januar. Ein schrecklicher Monat, so kalt und so trist«, sagte Rose zu Anna, während sie die wunderschönen weichen italienischen Lederhandschuhe auszog, die ihre Tante ihr zu Weihnachten geschenkt hatte.
»Ha! Das nennst du kalt? Du müsstest mal einen Winter in Polen erleben, mit meterhohem Schnee«, entgegnete Anna. »Wir essen bald zu Mittag«, fügte sie hinzu. »Ich habe selbstgemachte Gemüsesuppe mitgebracht, und du kannst mitessen, wenn du willst.«
»Würde ich sehr gern«, antwortete Rose, »aber ich kann nicht. Ich muss um halb zwei zurück sein, damit Piers wegkann, um für einen neuen Auftrag auszumessen.«
Piers Jeffries war Ivors Assistent, ein gut aussehender junger Mann, der vorgab, Rose zu mögen und ihr helfen zu wollen, der es aber gleichzeitig raushatte, die Dinge so zu drehen, dass man, sobald etwas schiefging, Rose die Schuld dafür gab. Nach außen mochte Piers Mitgefühl mit ihr zeigen und sich zuweilen sogar gegen ihren ungeduldigen und hitzigen Chef auf ihre Seite stellen, doch Rose hegte den Verdacht, dass er es insgeheim genoss, wenn sie in Ungnade fiel.
»Ich muss den Ursprung eines Entwurfes meines Großonkels überprüfen«, erklärte Rose. »Ivor hat einen Kunden, der ihn benutzen möchte, und er hat sich danach erkundigt, wo er herkommt. Das Problem ist, dass er nicht weiß, wie der Entwurf heißt, er kann ihn nur beschreiben.«
Anna schnaubte spöttisch. »Und er glaubt, du könntest es in einer halben Stunde herausfinden! Hast du ihn nicht daran erinnert, dass wir hier über zweihundert verschiedene Entwürfe haben, die auf die Zeichnungen deines Großonkels zurückgehen?«
»Die sind alle in hellem Aufruhr. Der Kunde ist ungeduldig, und Ivor hat ihm die Information für heute Nachmittag versprochen. Er erweckt immer gern den Eindruck, die Dinge liefen wie am Schnürchen. Ich glaube, es ist einer der Entwürfe mit einem griechischen Fries, also fange ich mit dem Buch an.«
»Dann geh schon mal hoch. Ich schicke Belinda mit einer Tasse Tee für dich rauf.«
Das Erdgeschoss des Hauses in der Walton Street wurde als Ausstellungsraum genutzt, oben im Atelier, das auch als Büro diente, wurden die Musterbücher aufbewahrt.
Da ihre Tante akribische Aufzeichnungen und Musterbücher führte, brauchte Rose nicht lange, um den gesuchten Entwurf zu finden. Den Stoff gab es in vier verschiedenen Farben: in einem warmen Rot, in Königsblau, in Dunkelgrün und in einem satten Goldgelb. Das Muster am Rand stammte von einem antiken Fries, den ihr Onkel abgezeichnet hatte. Das Stück Fries, das sich jetzt in einem Londoner Museum befand, hatte der Earl of Carsworth, wie es in den Notizen ihres Onkels hieß, in den 1780er Jahren von einer Bildungsreise auf den Kontinent mitgebracht.
Rose notierte diese Informationen, trank ihren Tee, der inzwischen kalt geworden war, und eilte wieder die Treppe hinunter.
Draußen blies der Ostwind ihr schneidend entgegen, und es kam ihr noch kälter vor als vorher, trotz der Wärme ihres dicken marineblauen Kaschmirmantels – ein Geschenk von ihrer Tante, als sie angefangen hatte zu arbeiten –, ein Mantel, in dem sie »den richtigen Eindruck erweckte«, hatte Amber gesagt.
Den richtigen Eindruck. Traurigkeit überschattete Roses Gedanken, als sie ein Taxi herbeiwinkte. Die Fahrt musste sie natürlich selbst bezahlen, aber das war besser, als womöglich noch zu spät zurück zu sein. Was ihre Tante nicht gesagt hatte, was sie aber beide wussten, war, dass es aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit ihrer leiblichen Mutter für die Leute nur allzu leicht wäre, sie nicht als die Nichte einer der reichsten Frauen von Cheshire zu betrachten – deren erster Gatte der Herzog von Lenchester gewesen war und deren zweiter Gatte der örtlichen Gentry angehörte –, sondern als die Tochter einer armen chinesischen Einwanderin.
Dabei war ihre Mutter nicht einmal annähernd etwas so Respektables gewesen.
»Deine Mutter war eine Hure, eine Prostituierte, die ihren Körper an Männer verkauft hat«, hatte ihre Cousine Emerald Rose einmal verhöhnt.
Rose wusste, dass Emerald gehofft hatte, sie zu schockieren und zu verletzen, doch wie konnte sie, wo Rose oft genug gehört hatte, wie ihr Vater unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen genau so über ihre Mutter hergezogen war?
Ihr Vater hatte ihr allzu oft erklärt, dass er sich allein ihretwegen dem Alkohol zugewandt hatte, um die Verzweiflung und das Elend des Lebens zu ertränken, zu dem ihre Existenz ihn zwang. Sie, die Tochter, die er verabscheute und hasste und die genauso aussah wie die chinesische Hure, die ihre leibliche Mutter gewesen war.
Nach seinem Tod hatte Rose schreckliche Angst gehabt, man würde sie wegschicken – zurück nach China. Ihre Urgroßmutter hätte das, wie Emerald ihr erklärt hatte, getan, ohne mit der Wimper zu zucken, doch ihre Tante Amber hatte dafür gesorgt, dass Rose ein Zuhause bekam, das weit über ihre kühnsten Träume hinausging.
Ihre Tante Amber und deren Mann Jay waren wunderbar freundlich und großzügig zu Rose gewesen, und so war sie in Denham Place aufgewachsen, zusammen mit ihrer Cousine Emerald, Ambers Tochter aus erster Ehe, mit Ella und Janey, Jays beiden Töchtern aus seiner ersten Ehe, und mit Ambers und Jays Zwillingen, den beiden Mädchen Cathy und Polly. Sie war auf dasselbe exklusive Internat geschickt worden wie Ella und Janey und hatte wie sie St. Martins besucht, das berühmte College für Kunst und Design in London. Man hatte ihr das Gefühl gegeben, Teil der Familie zu sein – was nach ihrer unglücklichen frühen Kindheit, als jeder falsche Schritt einen Zornausbruch ihres Vaters provozierte, paradiesisch gewesen war. Alle hatten ihr dieses Gefühl gegeben, bis auf Emerald. Aus irgendeinem Grund verabscheute sie Rose, und selbst jetzt noch machte sie oft spitze Bemerkungen, die so giftig waren wie je.
Rose lebte zusammen mit Ella und Janey in einem vierstöckigen Haus in Chelsea, wo auch Amber wohnte, wenn sie alle zwei Monate nach London kam, um sich um ihre Firma für Innenausstattung zu kümmern.
Rose hielt große Stücke auf ihre Tante, es gab nichts, was sie nicht für sie tun würde. Amber hatte sie beschützt und unterstützt und darüber hinaus auch geliebt. Als Rose also gemerkt hatte, wie sehr es ihre Tante freute, wenn sie über Innenausstattung sprach, hatte sie beschlossen, so viel wie möglich über dieses Metier zu lernen. Das hatte wiederum dazu geführt, dass ihre Tante sie ermutigte, eine Ausbildung als Innenausstatterin zu machen, damit sie eines Tages die Leitung von Ambers Firma übernehmen konnte. Der Gedanke daran, dass ihre Tante großes Vertrauen in sie setzte und an sie glaubte, erfüllte Rose mit frischer Entschlossenheit, niemandem zu zeigen, wie schrecklich sie es fand, für Ivor Hammond zu arbeiten.
Ihre Tante war hocherfreut gewesen, als ihr alter Freund Cecil Beaton verkündet hatte, er habe Ivor Hammond empfohlen, Rose als Lehrmädchen zu sich zu nehmen.
»Bei ihm wirst du viel mehr lernen, als ich dir je beibringen könnte, Schatz. Und eines Tages wirst du die gefragteste Innenausstatterin in ganz London sein.«
Das Taxi hielt vor dem Laden ihres Chefs in der Bond Street. Das Schaufenster war mit zwei beeindruckenden Regency-Stühlen und einem Schreibpult aus Mahagoni dekoriert, auf dem ein schwerer georgianischer silberner Kerzenleuchter stand.
Ivor war auf die typischen Möbel und das elegante Dekor der Oberschicht spezialisiert, für die sich inzwischen auch immer mehr soziale Aufsteiger interessierten. Roses eigener Geschmack neigte eher zu einem moderneren, nicht so überladenen Look, doch das würde sie niemals sagen. Wenn ihre Tante glaubte, Ivor sei der Richtige, um ihr alles über Innenausstattung beizubringen, dann würde sie ihre rebellischen Ideen, die sie sich nach etwas Aufregenderem und Innovativerem sehnen ließen, fallen lassen.
»Oh, da bist du, Chinky.«
Obwohl sie bei Piers’ Worten innerlich zusammenzuckte, wehrte sie sich nicht, sie war schließlich schon Schlimmeres genannt worden. Ihre Urgroßmutter hatte keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr sie es verabscheute, »ein hässliches gelbes Gör« zur Urenkelin zu haben.
»Hast du die Informationen, die der Chef wollte? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du sie nicht hast, denn er hat eine Stinklaune. Die Jackpot-Gewinnerin war da, während du weg warst, und hat ihren Auftrag storniert.«
»Ich dachte, er wollte sie sowieso nicht als Kundin«, erwiderte Rose.
Ihr Chef hatte sich, wie Rose fand, unnötig abschätzig über die Wasserstoffblondine geäußert, die in einem Leopardenfellmantel und einer dicken Parfümwolke in den Laden gestöckelt war, um zu verkünden, sie und ihr Männe hätten beim Toto gewonnen und würden sich eine »schicke Wohnung« kaufen, die sie neu ausgestattet haben wollten.
»Sie wollte er vielleicht nicht, ihr Geld schon.« Piers schniefte abschätzig. »Ich sollte wirklich allmählich über die anderen Angebote nachdenken, die ich hatte. Wie der liebe Oliver Messel neulich zu mir sagte, ich muss wirklich meinen Ruf und meine Zukunft im Auge behalten, wenn ich mit der Art von neureichen Kunden in Verbindung gebracht werde, die Ivor heutzutage anzieht. So was spricht sich schließlich rum. Und die Tatsache, dass er dich genommen hat, hilft auch nicht gerade. Na, wie denn auch? Ich bin überrascht, dass wir nicht mit Anfragen für Kostenvoranschläge für die Neugestaltung der chinesischen Restaurants in Soho überschwemmt werden.«
Roses Gesicht brannte, während er über seinen eigenen Witz kicherte. Sie wünschte sich das Ende des Tages herbei, wenn sie der giftigen Atmosphäre des Ladens entfliehen konnte.
Vollkommen wohl und sicher und akzeptiert fühlte sie sich nur, wenn sie mit ihrer Tante Amber zusammen war, und hätte sie ihrer Tante nicht einen Gefallen tun wollen, hätte Rose sie angefleht, ihr zu helfen, eine andere Arbeitsstelle zu finden.
Mit Jays Töchtern kam sie gut zurecht, sie hatten viel Spaß zusammen. Trotzdem war Rose sich deutlich bewusst, dass sie anders war, eine Außenseiterin, deren Aussehen Menschen – besonders Männer – dazu verleitete, sich ihr gegenüber verletzend und grob zu verhalten. Sie sahen Rose an, als wüssten sie alles über ihre Mutter, als wollten sie, sie wäre wie ihre Mutter. Doch so würde sie niemals sein, niemals …
»Um Himmels willen, Ella, sei vorsichtig. Du bist wirklich schrecklich ungeschickt.«
Ungeschickt und reizlos, dachte Ella Fulshawe elend, als sie sich bückte, um die Wäscheklammern aufzuheben, die vom Tisch gefallen waren, wo eine Nachwuchskraft aus der Moderedaktion sie hingelegt hatte. Mit ihnen wurden die Kleider hinten zusammengehalten, sodass es, wenn die überschlanken Mannequins von vorn fotografiert wurden, so aussah, als würden die Kleider passen.
Ella war nicht begeistert, für Vogue zu arbeiten, sie wäre lieber eine richtige Reporterin bei einer richtigen Zeitung gewesen. Ihre Schwester Janey mochte sie beneiden, doch Janey lebte und atmete Mode, während Ella sich überhaupt nicht dafür interessierte. Sie wollte über wichtige Dinge schreiben, nicht über dämliche Kleider. Doch als man ihr die Stelle angeboten hatte, war ihr Vater so erfreut und stolz auf sie gewesen, dass sie sie einfach nicht ausschlagen konnte.
»Dein Vater hofft sicher, dass du dich von einem hässlichen Entlein in einen Schwan verwandelst, wenn du für Vogue arbeitest«, hatte Emerald nur spöttisch kommentiert.
Hatte ihr Vater wirklich gedacht, wenn sie für Vogue arbeitete, würde sie sich in etwas Hübsches und Selbstbewusstes verwandeln? Wenn ja, waren seine Hoffnungen bitter enttäuscht worden. Im Gegenteil, neben den hübschen, glamourösen Mannequins, mit denen sie nun jeden Tag zu tun hatte, fühlte sie sich umso reizloser. Neben diesen Frauen mit ihren kleinen Brüsten und schlanken Beinen kam sie sich unförmig und dick vor. Ihre üppigen Brüste und ihren kurvenreichen Körper mochte sie dann überhaupt nicht mehr.
»Wirklich schade, dass du zwar die Gesichtszüge deiner armen Mutter geerbt hast, aber nicht ihre Figur. Ehrlich, Ella, so viel fleischiges Übermaß hat etwas entschieden Bukolisches und nahezu Gewöhnliches. Deine arme Mutter wäre entsetzt, wenn sie dich sehen könnte. Wo sie selbst doch so schlank war.«
Die unfreundliche Kritik, mit der ihre Tante Cassandra Ella bedacht hatte, als sie in die Pubertät gekommen war, hatte ihre Spuren hinterlassen und sie viel mehr verletzt, als es die gehässigen Bemerkungen ihrer Stiefschwester Emerald je vermochten. Sie waren tief in Ellas Herz gebrannt.
Die Mannequins waren so schlank und so hübsch, und Ella sah die Bewunderung in den Augen der Fotografen, die mit ihnen arbeiteten und die sie, Ella, nur mit einem kurzen Blick abtaten. Zumindest die meisten. Einer hatte es für nötig befunden, seine Verachtung für sie sehr deutlich zu machen. Oliver Charters.
Charters war ein aufstrebender junger Fotograf, der sich gerade seine ersten Sporen verdiente. Der Moderedaktion von Vogue zufolge war er außerordentlich talentiert und würde es weit bringen. Ein einziger Blick aus seinen strahlend grünen Augen genügte, und Mannequins und Redakteurinnen schmolzen gleichermaßen dahin.
Doch als dieser grünäugige Blick in Ellas Richtung gefallen war, war das unbekümmerte Interesse, mit dem er die anderen jungen Frauen bedachte, verschwunden und von schierem Unglauben abgelöst worden. Als wäre das nicht schlimm genug, hatte er diesen Blick auch noch mit einem entsetzten Ausruf begleitet, was die Assistentin des Artdirectors zu einem boshaften Kichern inspirierte und dazu, den Vorfall später vor dem ganzen Redaktionsteam zum Besten zu geben.
Oliver Charters war jetzt hier in dem kleinen, beengten Büro, wo Ellas Chefin, die Feature-Redakteurin, und die leitende Moderedakteurin das hübsche Mannequin musterten, das ein viel zu großes cremefarbenes Kleid trug.
Ella tat ihr Bestes, um ihre unmoderne Figur zu verbergen; sie hüllte sich in weite, ausgebeulte Pullover über Faltenröcken und weißen Blusen – fast so, als trüge sie noch ihre Schuluniform, wie Janey einmal missbilligend bemerkt hatte.
Zu Hause in Denham war sie die Älteste, und dort war sie selbstbewusst genug, um ihre Verantwortung gegenüber den Jüngeren zu übernehmen, besonders gegenüber Janey, die ständig Dummheiten machte und sich in Schwierigkeiten brachte, manchmal in richtig ernste. Vor allem, wenn es darum ging, sich Versagern sämtlicher Couleur anzunehmen – sowohl tierischen als auch menschlichen. Doch hier bei Vogue, ohne den Schutz durch die Liebe ihres Vaters und ihrer Stiefmutter, fühlte Ella sich linkisch, verletzlich und dumm. Jetzt hatte ihre Unbeholfenheit dazu geführt, dass ihr Gesicht brannte und ihre Kehle sich über den drohenden Tränen schloss.
»Darüber kann ich unmöglich schreiben. Es sieht schrecklich aus«, beklagte Ellas Chefin sich. »Ich soll über aufregende neue junge Mode berichten; das sieht eher aus wie etwas, was eine Bauersfrau oder ein Mädchen wie Ella tragen würde. Wo ist das Kleid von Mary Quant? Geh und such es, wärst du so nett, Ella?«, verlangte sie.
Oliver, der sich in der offenen Tür abstützte, während er sich mit dem Mannequin unterhielt, versperrte ihr den Weg. Die Lederjacke, die er zu Jeans und schwarzem T-Shirt trug, verlieh ihm etwas Liederliches, was zu seinem überlangen dunklen Haar und der Zigarette passte, die ihm aus dem Mundwinkel hing. Janey hätte ihn toll gefunden, Ella fand ihn eher lästig.
»Verzeihung.«
Er war so von dem Mannequin gefesselt, dass er weder ihre Entschuldigung gehört noch mitbekommen hatte, dass sie nicht durch die Tür kam.
Ella räusperte sich und versuchte es noch einmal.
»Verzeihung, bitte.«
Das Mannequin zupfte am Ärmel seiner Lederjacke. »Ella möchte vorbei, Oliver.«
»Dann zwäng dich halt vorbei, Liebchen. Ich hätt nichts dagegen, wenn du dich an meinem Hintern reibst.«
Mit diesen absichtlich vulgären Worten hoffte er wohl, Ella in Verlegenheit zu bringen. Ella schoss einen eisigen Blick auf seinen Rücken ab. Das Mannequin kicherte, als Oliver den Rücken so weit durchbog, dass sie selbst sich vielleicht hätte durchzwängen können. Doch für Ella war es bei weitem zu eng.
»Ella kommt da nicht durch. Ollie, rück mal beiseite«, erklärte das Mannequin ihm.
Jetzt musterte er Ella von oben bis unten und dann wieder bis oben, und seine Inspektion fand erst ein Ende, als sein Blick auf ihrem inzwischen puterroten Gesicht ruhte.
»Gehst du Tee kochen, Liebchen?«, fragte er und schenkte ihr ein gemeines Grinsen. »Für mich zwei Stück Würfelzucker«, fügte er hinzu, bevor er den Blick genüsslich auf ihren Brüsten ruhen ließ.
Beim Hinausgehen hörte Ella noch, wie das Mannequin gehässig sagte: »Die arme Ella. Ich würde ja im Boden versinken, wenn ich so fett wäre wie ein Elefant. Ich bin überrascht, dass sie nicht versucht, wenigstens ein bisschen abzunehmen.«
Oliver Charters lachte und meinte: »Es hätte gar keinen Zweck, wenn sie es versuchte. Sie würde es eh nicht schaffen.«
Mit brennendem Gesicht blieb Ella wie angewurzelt stehen, gezwungen, mit anzuhören, wie sie sich über sie ausließen, bis sie sich schließlich aus ihrer Starre löste und weiterging. Sie hasste die beiden, aber ihn, Oliver Charters, hasste sie am meisten, wie sie bitter feststellen musste. Widerlicher Kerl! Das hämische Lachen der beiden folgte ihr den Flur hinunter.
Oliver Charters dachte also, sie besäße nicht die Willenskraft, um abzunehmen? Na, dem würde sie es zeigen. Sie würde es allen zeigen.
Die Herzogin.
Dougie Smith stierte auf den verblassten Namen am Bug des Schiffes, das am Trockendock festgemacht war.
»Wurd’ stillgelegt, weil sie nich’ mehr gebraucht wird. Von was Neuem von ihrem Platz verdrängt«, erklärte ein alter Matrose ihm, der am Kai stand und sich eine Capstan Full Strength anzündete, und krönte seine Worte mit einem Hustenanfall.
Dougie überlegte, ob das stille, fast ominöse Schiff ihm in seiner erzwungenen Ruhepause wohl eine Botschaft übermitteln sollte. Er nickte zu der Bemerkung des Matrosen und wandte sich ab, ging den hektischen Aktivitäten auf dem Kai mit ihrem Gestank nach abgestandenem Wasser, Fracht und der vertrauten Mischung aus Teer, Öl, Tauen und Myriaden anderer Aromen mit Bedacht aus dem Weg.
Er duckte sich unter Trossen und Tauen weg und schmiegte sich tiefer in die Matrosenjacke, die er sich auf Anraten anderer Matrosen schon in der milden Wärme von Jamaica gekauft hatte, wo er das Schiff gewechselt hatte.
Das Frachtschiff, auf dem er dort angeheuert hatte, um sich seine Passage nach London zu verdienen, ragte aus dem kalten Januarnebel wie ein grauer Geist. Dougie schauderte. Die Matrosen hatten ihn vor dem kalten, nebligen Wetter in London gewarnt. Die meisten waren zähe alte Teerjacken gewesen, die ihn zuerst misstrauisch beäugt hatten – den jungen Australier, der eine billige Passage ins »Heimatland« wollte. Doch sobald er bewiesen hatte, dass er sich ordentlich ins Zeug legen konnte, hatten sie ihn unter ihre Fittiche genommen.
Er hatte Gewissensbisse, weil er ihnen Lügen aufgetischt hatte, doch er bezweifelte, dass sie ihm geglaubt hätten, wenn er mit der Wahrheit herausgerückt wäre. Was hätte er sagen sollen? »Ach, übrigens, Jungs, ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn ich euch sage, dass so ein Anwalt in London glaubt, ich wäre ein Herzog.« Dougie konnte sich lebhaft vorstellen, wie sie darauf reagiert hätten. Schließlich erinnerte er sich noch gut an seine eigene Reaktion, als er die Nachricht bekommen hatte.
Er hob seinen Seesack auf, kehrte dem grauen Rumpf des Schiffes, das in den letzten Monaten sein Zuhause gewesen war, den Rücken und schlug, wie er hoffte, die richtige Richtung zur Seemannsmission ein, wo er, wie man ihm versichert hatte, ein sauberes Bett für die Nacht kriegen würde.
Wenigstens fuhren sie hier auf derselben Straßenseite, nahm er erleichtert zur Kenntnis, als aus dem Nebel ein Lastwagen auf ihn zukam, dessen Fahrer hupte, damit er ihm aus dem Weg ging.
Auf den Kais herrschte reges Treiben, und niemand achtete besonders auf Dougie. Seeleute stellten einander keine Fragen, sie hatten – ganz ähnlich wie die Viehtreiber im Outback – einen Ehrenkodex, der besagte, dass jeder das Recht hatte, seine Vergangenheit für sich zu behalten.
Dafür war Dougie dankbar gewesen auf seiner langen Reise nach England. Er wusste immer noch nicht recht, was er davon halten sollte, dass er womöglich ein Herzog war. Sein Onkel, der die britische Oberschicht aus Gründen, die er nie richtig erklärt hatte, verachtete, hätte ihm in deutlichen Worten zu verstehen gegeben, er solle den Brief des Anwalts ignorieren.
Doch was war mit seinen Eltern – was hätten sie gedacht? Dougie wusste es nicht. Sie waren kurz nach seiner Geburt bei einer Überschwemmung ums Leben gekommen, und wenn sein Onkel nicht gewesen wäre, wäre er in einem Waisenhaus gelandet. Er hatte Dougie nie viel über seine Eltern erzählt. Dougie wusste bloß, dass sein Onkel der Bruder seiner Mutter war und dass es ihm nicht recht gewesen war, dass sie Dougies Vater geheiratet hatte.
»Ein Weichling mit englischem Akzent und seltsamem Gebaren, der ein Schaf nicht mal hätte scheren können, wenn es um sein Leben gegangen wäre.« Viel hatte er nicht für seinen Schwager übriggehabt.
Es war hart gewesen, im australischen Outback aufzuwachsen, auf einer großen Schaffarm, etliche Meilen von der nächsten Stadt entfernt. Aber auch nicht härter als das Leben vieler anderer junger Burschen. Wie sie hatte er seine Hausaufgaben in der Küche der Farm gemacht, unterrichtet von Lehrern, die über den Äther Kontakt zu ihren Schülern hielten. Wie sie hatte er seinen Teil auf der Farm tun müssen.
Nachdem die Schule und die Prüfungen überstanden waren, hatte sein Onkel ihn auf eine benachbarte Schaffarm geschickt – als »Jackaroo«, wie man die jungen Männer der jüngeren Generation nannte, die eines Tages die Farmen ihrer Familien übernehmen würden.
Nach dem Krieg waren die Zeiten hart gewesen, und das war seither so geblieben. Als sein Onkel krank geworden war, hatte der fliegende Arzt ihm gesagt, er habe ein schwaches Herz und solle aufhören zu arbeiten. Doch sein Onkel hatte sich rundheraus geweigert und war, genau wie er es sich gewünscht hatte, eines Abends bei Sonnenuntergang auf der Veranda seines baufälligen Bungalows gestorben, während der Regen auf das Blechdach prasselte wie Gewehrkugeln.
Dougie hatte, als einziger Verwandter, die Farm geerbt, samt der Schulden und der Verantwortung für die Leute, die auf der Farm arbeiteten: Mrs Mac, die Haushälterin, und die Treiber Tom, Hugh, Bert und Ralph samt ihren Frauen und Familien.
Dougie hatte bald herausgefunden, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als das Angebot eines wohlhabenden Nachbarn anzunehmen, der sich zur Hälfte in die Schaffarm einkaufte.
Das war vor fünf Jahren gewesen. Seither war die Farm gediehen, und Dougie hatte sich eine Auszeit genommen, um seine Ausbildung in Sydney abzuschließen. Dort hatte ihn der erste Brief des Anwalts erreicht, und er hatte ihn schlichtweg ignoriert.
Ein halbes Dutzend Briefe später – und mit wachsendem Bewusstsein dafür, wie wenig er eigentlich über seinen Vater und dessen Familie wusste – war er zu dem Schluss gekommen, er sollte vielleicht herausfinden, wer er war und wer nicht.
Der Anwalt hatte ihm angeboten, ihm die Passage vorzuschießen. Nicht dass Dougie einen solchen Vorschuss gebraucht hätte – er besaß jetzt dank des Erfolgs der Farm eigenes Geld –, doch er hatte sich nicht auf eine Situation einlassen wollen, die ihm nicht ganz geheuer war, ohne mehr darüber zu wissen.
Für seine Überfahrt nach England zu arbeiten mochte nicht der schnellste Weg gewesen sein, um hinzukommen, doch es war todsicher der aufschlussreichste, wie Dougie zugeben musste, als er durch das Dock-Tor ging und in die nebelverhangene Straße einbog.
Er war Dougie Smith – Smith war der Nachname seines verstorbenen Onkels gewesen und der Name, den er immer getragen hatte –, doch laut seiner Geburtsurkunde war er Drogo Montpelier. Vielleicht war er auch der Herzog von Lenchester, doch im Augenblick war er ein Matrose, der eine anständige Mahlzeit brauchte, ein Bad und ein Bett, exakt in dieser Reihenfolge. Der Anwalt hatte ihm in seinen Briefen die Familienkonstellation hier in England dargelegt und ihm erklärt, der Tod des letzten Herzogs und seines Sohns und Erben bedeute, dass er, der Enkel des Großonkels des verstorbenen Herzogs – wenn er das denn tatsächlich war –, jetzt der Nächste in der Erbfolge war.
Doch was war mit der Witwe des letzten Herzogs, die inzwischen wieder geheiratet hatte? Was war mit seiner Tochter, Lady Emerald? Dougie konnte sich nicht vorstellen, dass sie ihn willkommen heißen würden, wenn er in ein Territorium drängte, das sie gewiss als das ihre betrachteten.
Er mochte nicht viel über die britische Oberschicht wissen, doch eines war ihm klar: Wie jede andere eng verbundene Gemeinschaft würde sie einen Außenseiter auf den ersten Blick erkennen und die Reihen schließen. Das war der Lauf der Welt, und obendrein war es nur natürlich.
Eine junge Frau mit müden Augen und blässlicher Haut, in schäbigen Kleidern, die Haare strohgelb gefärbt, drückte sich von der Mauer ab, an der sie gelehnt hatte, und rief: »Willkommen zu Hause, Seemann. Wie wär’s, willst du ’nem hübschen Mädchen was zu trinken spendieren und dich von ihr ein bisschen verwöhnen lassen?«
Dougie schüttelte den Kopf und ging an ihr vorbei. Willkommen zu Hause. Würde er willkommen sein? Wollte er hier willkommen sein?
Dougie hievte seinen schweren Seesack höher auf die Schulter und drückte den Rücken durch. Es gab nur einen Weg, es herauszufinden.
2
Janey war glücklich. Eigentlich müsste sie Schuldgefühle haben, weil sie in St. Martins sein und sich eine Vorlesung über die Geschichte des Knopfes anhören sollte. Doch wenigstens befasste sie sich im Augenblick mit Knöpfen. Ganz behutsam knöpfte sie Dans Hemd auf.
Ein aufgeregtes Kichern stieg in ihr auf. Was sie hier machte, war natürlich ganz schlimm. Nicht nur, dass sie die Vorlesung schwänzte, sie war auch noch mit Dan in seine Souterrainwohnung gegangen, und jetzt lagen sie in Dans schmalem Bett mit der klumpigen Matratze und kuschelten sich gegen die eisige Januarfeuchtigkeit aneinander. Dans Hemd war auf dem Boden gelandet. Janey trug zwar noch ihren Pullover, doch der BH darunter war geöffnet und aus dem Weg geschoben worden, sodass Dan ihre Brüste drücken und kneten konnte, was ein köstliches Zittern in ihr auslöste.
Ja, sie war sehr schlimm. Ihre Schwester Ella würde das bestimmt so sehen. Ella hätte nie eine Vorlesung versäumt, geschweige denn einen Jungen an ihren nackten Brüsten fummeln lassen. Doch sie, Janey, war nicht Ella, Gott sei Dank, und Dan, dessen Schwester ebenfalls in St. Martins war, war ein toller Kerl. Janey hatte sich vom ersten Augenblick an in den jungen Schauspieler verliebt. Und Dan war unglaublich glücklich, dass sie hier bei ihm war. Janey fand es toll, wenn sie Menschen glücklich machen konnte. Sie erinnerte sich noch gut, wie sie das erste Mal gemerkt hatte, dass sie nicht länger verängstigt und unglücklich war, wenn sie tat, was andere wollten. Das war, als Tante Cassandra zu Besuch gekommen war, als ihre Mutter in einer ihrer beängstigenden, unberechenbaren Stimmungen gewesen war.
»Ich bin froh, dass du hier bist, Tante Cass«, hatte Janey zu ihrer Tante gesagt, »denn du machst Mummy froh.«
Zu Janeys Erleichterung war die Atmosphäre augenblicklich wie verwandelt gewesen. Ihre Mutter hatte angefangen zu lachen und sie sogar umarmt, während ihre Tante sich so über ihre Bemerkung gefreut hatte, dass sie ihr einen Penny schenkte. Janey war noch klein gewesen, als ihre Mutter gestorben war, aber sie konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie verängstigt und traurig die Wutanfälle ihrer Mutter sie gemacht hatten. Von da an hatte sie sich besondere Mühe gegeben, Dinge zu sagen und zu tun, die andere Menschen glücklich machten …
Die ganze Schulzeit hindurch war sie »zuvorkommend« gewesen, wie ihre Lehrer ihr Verhalten anerkennend beschrieben. Janey hatte ihre Süßigkeiten und ihr Taschengeld immer bereitwillig mit ihren Schulfreundinnen geteilt, besonders wenn sie wusste, dass die anderen dann wegen irgendwas nicht mehr sauer waren. Bevor sie selbst glücklich sein konnte, war es ihr wichtig, dass die Menschen um sie herum glücklich waren. Wenn eine Freundin unglücklich war, überschlug Janey sich, um ihr ein Lächeln zu entlocken. Nichts war ihr mehr verhasst als Streit und wütend erhobene Stimmen. Das erinnerte sie zu sehr an ihre frühe Kindheit.
Sie war unglaublich froh, dass sie nicht so war wie Ella – die arme Ella, die immer alles schrecklich ernst nahm, die schnippisch und unfreundlich sein konnte, besonders gegenüber jungen Männern, und die Spaß zu haben als Sünde betrachtete.
Janey wand sich vor Verzückung. Sie hätte Dan am liebsten noch glücklicher gemacht und wäre gern noch waghalsiger gewesen, aber sie wagte es nicht. Im letzten Semester hatten zwei Mädchen St. Martins verlassen müssen, weil sie in Schwierigkeiten geraten waren. Janey wollte auf keinen Fall schwanger werden und abgehen müssen, ohne ihr Studium zu beenden. Dan hatte Verständnis gezeigt, und das machte das Ganze um so wunderbarer. Manche Männer konnten ganz schön schwierig und unfreundlich werden, wenn ein Mädchen nein sagte.
Janey liebte London und St. Martins, sie fand es toll, zur King’s-Road-Szene dazuzugehören, die am Wochenende die Cafés und Kneipen unsicher machte und laute Partys in dunklen, verrauchten Kellern besuchte, wo Beatmusik gespielt wurde. Sie fand, es gebe keinen besseren Ort auf der Welt als die King’s Road in Chelsea. Es war schrecklich aufregend dazuzugehören, Teil der ausgewählten Clique junger Leute zu sein, die die Gegend zu ihrem persönlichen Spielplatz erkoren hatte und ihr ihren Stempel aufdrückte. Hier musste man sein, um zu sehen und gesehen zu werden. Wer in war, wusste das. Selbst die großen Modezeitschriften nahmen es allmählich zur Kenntnis.
Sobald sie St. Martins abgeschlossen hatte, wollte Janey sich der Reihe junger Designer anschließen, die sich in Läden in der King’s Road niederließen und, dem Beispiel von Mary Quant folgend, ihre Entwürfe in ihren eigenen Boutiquen verkauften. Sie konnte es kaum erwarten.
»Was liest du da, Ella?«
»Nichts«, flunkerte Ella und versuchte den Artikel aus Woman zu verstecken, den sie gerade las. Er handelte davon, dass Ryvita-Kekse ausgezeichnet beim Abnehmen halfen.
Den Beschluss abzunehmen hatte sie mit großer Entschlossenheit gefasst, doch je mehr sie sich anstrengte, nichts zu essen, desto mehr verlangte es sie danach – mit dem Ergebnis, dass sie, als sie sich am Morgen auf der Waage in der Eingangshalle der U-Bahn-Station gewogen hatte, feststellen musste, dass sie sogar drei Pfund zugenommen hatte.
»Schwindlerin«, erwiderte Libby, die Assistentin des Artdirectors, vergnügt. »Zeig mal her.« Libby entriss Ella die Zeitschrift und hob fragend die Augenbrauen. »Willst du abnehmen?«
Ella verließ der Mut. Gleich würde die elegante, schlanke Libby es allen erzählen, und dann würde das ganze Büro über sie lachen.
»Da brauchst du deine Zeit aber nicht mit Ryvita-Keksen zu vergeuden«, erklärte Libby ihr, ohne eine Antwort abzuwarten. »Du brauchst nur zu meinem Arzt zu gehen und dir ein paar von seinen Spezialpillen verschreiben lassen. Davon habe ich in einem Monat sechs Kilo abgenommen. Die sind phantastisch.«
»Diätpillen?«, fragte Ella unsicher. Sie hatte nicht gewusst, dass es so etwas gab. Sie hatte Anzeigen für so etwas Ähnliches wie Toffees gesehen, die man dreimal am Tag einnehmen sollte, aber keine für Diätpillen.
»Ja, das ist richtig. Die nehmen alle, sämtliche Mannequins, auch wenn niemand es zugibt. Also, ich könnte Dr. Williamson gleich anrufen und einen Termin für dich vereinbaren. Aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, dass du es von mir hast.«
»Ich …«
Bevor sie etwas sagen konnte, griff Libby schon zum Telefonhörer und nannte der Telefonistin eine Nummer aus ihrem hübschen ledergebundenen Terminkalender.
»So, alles klar«, verkündete sie einige Minuten später mit einem triumphierenden Lächeln. »Dr. Williamson hat in der Mittagspause Zeit für dich. Er ist gleich um die Ecke in der Harley Street.«
Der Mann beobachtete sie immer noch. Nicht dass Emerald überrascht war. Natürlich beobachtete er sie. Sie war schließlich sehr schön. Das sagten alle. Der Besuch im Louvre, der zu den kulturellen Aktivitäten des französischen Mädchenpensionats gehörte, das sie besuchte, hatte so langweilig zu werden gedroht, dass sie versucht gewesen war, sich mit einer Ausrede davor zu drücken. Doch jetzt, da sie einen Verehrer hatte, den sie hinter dem Rücken der greisen Kunsthistorikerin, die sie durch die Schätze des Museums führte, hänseln und quälen konnte, versprach der Nachmittag alles andere als langweilig zu werden. Sehr gemächlich, fast provokant, strich sie mit der Hand über ihren gut sitzenden rehbraunen Kaschmirpullover. Sie hätte lieber eine etwas auffälligere Farbe getragen, doch ihre Mutter hatte darauf bestanden, der neutrale Farbton sei sehr viel eleganter. In Wirklichkeit hatte sie natürlich »sehr viel schicklicher« gemeint. Er würde die bewundernde männliche Aufmerksamkeit vielleicht nicht auf Emeralds Figur lenken. Wie dumm von meiner Mutter, sich einzubilden, sie könnte so dafür sorgen, dass Männer mich nicht bewundern, dachte Emerald geringschätzig. Das war unmöglich. Nicht dass ihre Mutter das je auch nur im Entferntesten zugeben würde. Es brachte Emerald zur Weißglut, dass ihre Familie – ihre Stief- und Halbschwestern, aber besonders ihre Mutter – sich weigerte, ihrer unbestreitbaren Überlegenheit – der Geburt, der Erziehung sowie des Aussehens – zu huldigen. Ihre Mutter tat, als wäre sie genau wie die anderen: Jays Töchter Ella und Janey, ihre Halbschwestern Cathy und Polly, die noch zur Schule gingen, aber vor allem ihre Cousine, die Halbchinesin Rose. Allein der Gedanke an Rose brachte Emerald in Rage. Eine Halbchinesin, ein Bastard, den ihre Mutter aus irgendwelchen unvorstellbaren Gründen tatsächlich behandelte wie ihr eigenes Kind. Ihre Mutter hatte immer schon viel Aufhebens um Rose gemacht und ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als sie Emerald je hatte zuteilwerden lassen, dabei war die ihre eigene Tochter. Das würde Emerald ihrer Mutter nie verzeihen. Niemals. Ihre Nanny und ihre Urgroßmutter hatten immer gesagt, Rose sei ein Niemand, ein Kind, das man dem Tod hätte überlassen sollen. Emerald war dagegen die Tochter eines Herzogs, der einer der reichsten Männer Englands gewesen war. Eines ehrenwerten, heroischen Mannes, den jeder bewundert hatte. Im Gegensatz zu Roses Vater, der ein Taugenichts und ein Säufer gewesen war. Ihre Urgroßmutter hatte immer gesagt, Onkel Greg würde nur so viel trinken, weil er sich wegen Rose so schämte. Von Rechts wegen hätte Emeralds Mutter dasselbe empfinden müssen, statt Rose zu behandeln, als wäre sie etwas Besonderes – als wäre sie mehr wert als Emerald. Das war natürlich unmöglich. Emerald glaubte, dass ihre Mutter nur so viel Aufhebens um Rose machte, weil sie neidisch war auf Emerald. Neidisch darauf, dass Emerald als Tochter eines Herzogs geboren worden war, der seine Tochter so sehr geliebt hatte, dass er ihr praktisch sein ganzes Geld vermacht hatte. Ein Vermögen …
Wenn sie gekonnt hätte, hätte Emerald als Kind schon verlangt, in einem der Häuser ihres Vaters leben zu dürfen, wie es sich für ihren Stand schickte, und nicht in Denham mit ihrer Mutter, Jay und den anderen.
Sie hatte sich rundheraus geweigert, dieselbe Schule zu besuchen wie die anderen. Ihren Debütantinnenball und ihre Vorstellung bei Hofe hatten die anderen als altmodische Rituale betrachtet, die man der Form halber hinter sich brachte, doch Emerald hatte sich absichtlich so lange damit zurückgehalten, bis sie hinterher ihren eigenen Ball haben konnte, ohne ihre Stief- und Halbschwestern. Und sie bestand darauf, die Saison so zu begehen wie in den Erzählungen ihrer Urgroßmutter, als die noch klein gewesen war. In Blanche Pickfords Adern mochte kein blaues Blut geflossen sein, doch sie hatte gewusst, wie wichtig es war, und dieses Wissen hatte sie an Emerald weitergegeben.
Rose besaß weder einen Adelstitel noch ein eigenes Vermögen, und Rose würde auch nicht Debütantin der Saison sein und einen Mann heiraten, der sie noch bedeutender machen würde. Dann konnte Emeralds Mutter sie nicht mehr übersehen zugunsten eines Görs aus den Gossen von Hongkong. Dann konnte sie auch nicht mehr darauf bestehen, Emerald und Rose wären einander ebenbürtig. Emerald war fest entschlossen, im Wettstreit mit ihrer Geschlechtsgenossin immer die Nase vorn zu haben.
Immer.
Der Mann, der sie beobachtet hatte, stand auf und machte Anstalten, zu ihr herüberzukommen. Emerald maß ihn mit berechnendem Blick. Ihr Bewunderer war nicht sehr groß, sein Haar war ein wenig schütter. Geringschätzig wandte Emerald ihm den Rücken zu. Nur das Beste vom Besten war gut genug für sie: der größte, am besten aussehende, reichste Mann mit dem höchsten Adelstitel. Ihre Stiefschwestern, die unbedingt arbeiten gehen wollten wie gewöhnliche kleine Ladenmädchen, hatten gar keine andere Wahl, als einen langweiligen, gewöhnlichen Mann zu heiraten, während Rose natürlich Glück hätte, wenn sie überhaupt einen anständigen Mann fände, der bereit wäre, sie zu heiraten. Ganz anders Emerald. Sie konnte und musste den begehrtesten Gemahl bekommen, den es gab.
Sie hatte sich ihren Zukünftigen sogar schon ausgesucht. Für sie gab es nur einen: den älteren Sohn von Prinzessin Marina, den Herzog von Kent, der nicht nur ein einfacher Herzog war wie ihr Vater, sondern sogar von königlichem Geblüt. Emerald sah sich schon vor sich, umgeben vom eifersüchtigen Geschnatter der Brautjungfern, die alle grün waren vor Neid, weil sie den begehrtesten Junggesellen der Saison abbekam.
Sie würden sehr gefragt sein und überall eingeladen werden, die Männer würden sie ansehen und ihren Gemahl beneiden, die Frauen würden sie ansehen und vor Neid auf ihre Schönheit schier platzen. Emerald hatte vor, sich ganz von ihrer Familie loszusagen. Sie wollte auf keinen Fall noch irgendetwas mit Rose zu tun haben. Von einem Herzog von königlichem Geblüt konnte man nicht erwarten, dass er gesellschaftlichen Umgang mit jemandem wie Rose pflegte, und da ihre Mutter so große Stücke auf Rose hielt, würde es ihr sicher nichts ausmachen, von Emeralds Gästeliste ausgeschlossen zu werden, damit sie Rose Gesellschaft leisten konnte. Der Gedanke zauberte Emerald ein Lächeln auf die Lippen.
Der junge Herzog von Kent, der im Jahr zuvor seinen einundzwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte, stand in dem Ruf, sehr schwer festzunageln zu sein, wenn es darum ging, Einladungen anzunehmen, aber Emerald war gewiss, dass sie keine Probleme haben würde, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er würde gar nicht anders können, als sich in sie zu verlieben. Kein Mann konnte ihr widerstehen.
Nur schade, dass der Herzog von Kent kein anständiges imposantes Heim besaß, etwa wie Blenheim oder Osterby. Sie würde ein Wort mit ihrem Treuhänder Mr Melrose wechseln müssen, der auch der Anwalt ihres verstorbenen Vaters gewesen war. Als Gemahlin eines Herzogs von königlichem Geblüt würde es doch sicher nur recht und billig sein, dass sie Haus und Anwesen ihres verstorbenen Vaters nutzte, als da wären Lenchester House in London, wo sie ihren Debütantinnenball halten würde, und der Familiensitz. Ihre Mutter war dagegen, dass sie ihren Debütantinnenball in Lenchester hielt, sie hatte gesagt, rein formell habe sie nicht das Recht, das Haus zu nutzen, denn es sei zusammen mit allem anderen, was zu dem Herzogstitel gehörte, durch das Erstgeborenenrecht an den neuen Erben gefallen, den Enkel des Großonkels ihres verstorbenen Vaters, des schwarzen Schafs der Familie, der als junger Mann ein Schiff nach Australien bestiegen hatte. Ursprünglich war man davon ausgegangen, das schwarze Schaf wäre gestorben, ohne zu heiraten, doch dann hatte sich herausgestellt, dass er verheiratet gewesen war und einen Sohn hatte, der wiederum ebenfalls einen Sohn hatte. Den versuchte Mr Melrose jetzt zu finden. Wie auch immer, Mr Melrose war mit Emerald einer Meinung gewesen, es gebe wirklich keinen Grund, warum die Tochter des verstorbenen Herzogs ihren Ball nicht in Lenchester House halten sollte. Ihr Vater hätte es so gewollt, davon war Emerald überzeugt. Wie sie auch davon überzeugt war, dass ihr Vater es lieber gesehen hätte, wenn sie in Osterby und Lenchester House lebte statt irgendein Erbe, von dessen Existenz er nicht einmal etwas gewusst hatte. Und der jetzt Osterby und alles andere erben würde, und das nur, weil er ein Mann war.
Lenchester House war einfach phantastisch. Es war bis vor kurzem an einen griechischen Millionär vermietet gewesen, und Emerald sah keinen Grund, warum sie und der Herzog von Kent nicht darin leben sollten, sobald sie verheiratet waren.
Mademoiselle Jeanne war immer noch mit der Mona Lisa zugange. Emerald bedachte das Porträt mit einem abschätzigen Blick. Sie war viel hübscher. Und überhaupt fand sie das Porträt langweilig. Sie bevorzugte die kühnen Pinselstriche und die strahlenden Farben moderner Künstler, auch wenn ihre Mutter solche Gemälde nicht im Traum in Denham an die Wand hängen würde. Emerald fand, sie könnte eine Gönnerin moderner Kunst werden, sobald sie verheiratet war. Sie hörte schon förmlich das Lob, mit dem die Presse sie wegen ihres exzellenten Auges und ihres hervorragenden Geschmacks bedachte, und die Kommentare in den Klatschspalten würden ihren Status bestätigen: »Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Kent, ist Londons bedeutendste Gastgeberin und darüber hinaus eine bekannte Gönnerin moderner Kunst.«
Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Kent. Emerald brüstete sich und dachte, wie gut ihr der Titel doch stand.
Ella zitterte, als sie das Gebäude verließ, in dem Dr. Williamsons Praxis lag, und auf die Harley Street trat, nicht so sehr wegen des rauen, beißenden Winds wie in schockiertem Unglauben und Aufregung darüber, dass sie es tatsächlich gewagt hatte.
Eine adrett gekleidete Arzthelferin hatte sie gewogen und gemessen, und dann hatte Ella ein langes Formular ausgefüllt. Der ernst dreinblickende Dr. Williamson hatte ihr anschließend gesagt, zum Wohle ihrer Gesundheit müsse sie unbedingt die von ihm verordneten Medikamente nehmen, um abzunehmen.
Sie sollte zwei Pillen am Tag nehmen, eine nach dem Frühstück und eine am späten Nachmittag, und in einem Monat sollte sie wiederkommen, um erneut gewogen und gemessen zu werden und ein neues Rezept zu erhalten.
Es war nicht geschummelt, redete Ella sich zu. Die Diätpillen halfen ihr nur, ihren Appetit zu zügeln. Und wenn sie ihn gezügelt hatte und ein wenig Gewicht verloren hatte, dann würde niemand mehr hinter ihrem Rücken über sie lachen – besonders nicht Oliver Charters.
3
»Janey, ich weiß immer noch nicht, ob wir wirklich zu der Party gehen sollten«, protestierte Ella, die verärgert und gereizt war, als sie sah, dass Janey sich, statt ihr zuzuhören, darauf konzentrierte, einen dicken schwarzen Strich um ihre Augen zu malen – und zwar so sehr konzentriert, dass sie dabei die Zungenspitze zwischen die Lippen schob.
»Wir können nicht nicht gehen«, verkündete Janey, die anscheinend doch zugehört hatte. »Ich hab’s versprochen.«
Das hieß, dass sie Dan versprochen hatte zu kommen, und sie wollte ihn nicht enttäuschen. Nicht wo die Dinge gerade so aufregend waren.
Ella antwortete nicht. Sie wusste, dass es zwecklos war. Doch sie wünschte sich, ihre Schwester würde sich ein wenig konventioneller zurechtmachen. Janey betrachtete sich als Bohemien, zumindest hatte sie das getan, bevor sie zum ersten Mal Mary Quants Laden Bazaar in der King’s Road aufgesucht und sich in ihren unverkennbaren Stil verliebt hatte. Es war Janeys größtes Ziel, dass Mary ihre eigenen Entwürfe bewunderte – Entwürfe, die Ella insgeheim viel zu gewagt fand. Man musste sich nur das gestreifte Minikleid ansehen, dass Janey sich genäht hatte und das sie an diesem Nachmittag unbedingt hatte tragen wollen. Sie hatte Ella und Rose so lange gepiesackt und beschwatzt, bis sie mit ihr in ihr Lieblingscafé, das Fantasy, gegangen waren.
Das Fantasy, das einzige »anständige« Café außerhalb von Soho, war im Besitz von Archie McNair, der ein Freund und Förderer von Mary Quant war, und Janey hatte Ella und Rose aufgeregt erzählt, sie hoffe, ihr Idol würde reinschauen und sie in ihrer neuesten Kreation entdecken. Das war zwar nicht passiert, aber Janey hatte trotzdem ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt. Kein Wunder, dass die Leute, genauer gesagt die Männer, Janey dermaßen angestiert hatten. Sosehr sie ihre jüngere Schwester liebte, gab es doch Zeiten, da wünschte Ella sich, Janey würde sich schicklicher benehmen und vernünftige, richtige Erwachsenensachen tragen und nicht Kleider, bei denen die Leute gar nicht anders konnten, als sie anzustieren.
Aufmerksamkeit zu erregen war Ella äußerst unangenehm. Als Kinder waren Janey und sie nur dann in den Fokus der Aufmerksamkeit ihrer Mutter geraten, wenn sie etwas falsch gemacht hatten – etwas, das den Zorn ihrer Mutter erregt hatte und für das Ella, als Ältere, immer die Schuld bekam.
Ihre Stiefmutter war ganz anders als ihre verstorbene Mutter. Als Ellas Vater Amber geheiratet hatte, hatte sich ihr Leben grundlegend verändert. Amber war eine richtige Mutter; sie wusste, was wichtig war, dass man zum Beispiel keine nassen Socken tragen oder im Dunkeln nicht ohne Licht die Treppe hinaufgehen sollte.
Wenigstens ist mein Gewicht etwas, wofür ich bald keine Aufmerksamkeit mehr auf mich ziehen werde, dachte Ella mit leisem Vergnügen. Dr. Williamsons Diätpillen hatten gehalten, was der Arzt und Libby ihr versprochen hatten, und sie hatte schon etwas abgenommen. Nicht dass sie jemandem davon erzählt hatte oder davon, wie sehr die grausamen Worte und das Gelächter sie kränkten. Ohne ihre kleinen gelben Pillen, die auf magische Weise ihren Hunger zügelten, wäre sie verloren.
»Du kannst ja hierbleiben, wenn du willst«, erklärte Janey ihrer Schwester. »Du musst nicht mitkommen.«
Das Letzte, wonach Ella an einem kalten Winterabend der Sinn stand, war, zu einer Party in einem schmuddeligen, verrauchten Keller zu gehen, wo lauter Leute waren, die sie nicht kannte und mit denen sie sich bei dem ganzen Lärm unmöglich unterhalten konnte, doch Janeys Worte hatten sie misstrauisch gemacht.
»Selbstverständlich komme ich mit«, beharrte Ella. »Ich muss schließlich dafür sorgen, dass du keinen Unsinn machst.«
»Red keinen Blödsinn. Natürlich mache ich keinen Unsinn«, verteidigte Janey sich entrüstet.
Ella war nicht überzeugt. »Das ist bei weitem nicht ›natürlich‹«, erklärte sie Janey. »Denk nur an die Männer, die du neulich aus diesem Jazzclub mitgebracht hast und die ich unten schlafend angetroffen habe.«
»Es war eine eiskalte Nacht, Ella, und sie wussten nicht, wohin.«
»Wir hätten in unseren eigenen Betten ermordet werden können oder Schlimmeres«, konterte Ella mit wachsender Empörung, doch Janey kicherte nur.
»Sei nicht dumm, sie waren viel zu betrunken.«
»Das ist nicht lustig, Janey«, wandte Ella ein. »Die Eltern hätten das ganz und gar nicht gutgeheißen.«
»Du machst viel zu viel Wirbel darum, Ella.«
Janey wünschte sich schon, Ella würde zu Hause bleiben, so sauertöpfisch, wie sie war. Janey hatte sich mit Dan auf der Party verabredet, und sie wollte nicht, dass Ella ihr den Abend verdarb.
Dan. Allein bei dem Gedanken an ihn machte sich in ihrem Bauch ein köstliches Kribbeln breit.
»Wenn das so eine Rowdy-Party ist in einem schrecklich verrauchten Loch voller schmuddeliger Musiker, dann …«, setzte Ella an, doch Janey, die mit ihrem Augen-Make-up fertig war und jetzt weißen Lippenstift auftrug, unterbrach sie.
»Willst du wirklich so gehen?«, fragte sie ihre Schwester und warf einen missbilligenden Blick auf Ellas karierten Faltenrock und marineblauen Pullover. »Wir gehen auf eine Party, nicht in die Schule …«
»In einen kalten, feuchten Keller«, versetzte Ella. »Und außerdem ist überhaupt nichts auszusetzen an dem, was ich trage.«
»Ich wette, bei Vogue sehen sie das anders.« Janey schnitt eine Grimasse. »Ich kann etwas für dich entwerfen, wenn du magst.«
Ella schauderte. »Nein, danke.«
»Also, du könntest wenigstens ein Kleid anziehen. Sieh nur, wie hübsch Rose in ihrem aussieht.«
Die Schwestern blickten zu Rose hinüber, die in einem dunkelgrünen Mohairkleid hereinkam.
»Red keinen Blödsinn«, widersprach Ella. »So etwas könnte ich nie im Leben tragen. Ich bin zu dick, und die Farbe würde mir sowieso nicht so gut stehen wie Rose.«
Während Ella und Janey groß und blond waren, graue Augen und gute englische Haut hatten, war Rose eine exotische Mischung aus Ost und West, zarte Knochen und nur ein Meter fünfundfünfzig groß. Ihre Haut war olivfarben, ihr herzförmiges Gesicht hatte hohe Wangenknochen und volle, weiche Lippen, während ihre dunkelbraunen Augen europäisch geschnitten waren. Ihr langes Haar, das sie immer in einem Chignon trug, war seidig glatt und tintenschwarz.
Janey sah Ella ungeduldig an. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie sich viel lieber ein schäbiges möbliertes Zimmer mit einer ihrer Künstler-Freundinnen geteilt, als in Luxus in dem eleganten Backsteinhaus ihrer Eltern am Cheyne Walk zu leben. Wenigstens lag es in Chelsea, was es einigermaßen akzeptabel machte. Janey liebte ihre Familie von Herzen, doch sie war immer schon ein Rebell gewesen, sie liebte das Unkonventionelle und begeisterte sich leidenschaftlich für Mode und Musik, die Kunst und das Leben.
Es war schade, dass Ella darauf bestanden hatte, sie zurück zum Cheyne Walk zu schleifen, denn wenn sie in dem Café geblieben wären, hätte immer noch die Chance bestanden, dass Mary Quant hereingekommen wäre und sie entdeckt hätte. Nur ihre Schwester konnte so altmodisch sein zu denken, das Ritual des Nachmittagstees habe noch irgendeine Bedeutung. Sie kapierte einfach nicht, dass in den Kreisen, in denen Janey verkehrte, allein die Erwähnung des Nachmittagstees einen als furchtbar altmodisch brandmarkte. Man käme nie darauf, dass Ella ihren Abschluss in St. Martins gemacht hatte, aber Ella hatte sich ja schließlich auch glücklich auf ihren Job bei Vogue gestürzt, während für Janey nichts anderes zählte als ihre eigenen Modeentwürfe. Solange sie denken konnte, wollte sie Modedesignerin werden. Schon als kleines Mädchen hatte sie Amber Reste von Seidenstoffen abgeschwatzt, um daraus Kleider für ihre Puppen zu nähen.
»Also, ich hoffe nur, dass das eine anständige Party ist«, warnte Ella, »denn Mama hat im Augenblick genug Sorgen mit Emerald, ohne dass sie sich auch noch wegen dir grämen muss.«
Ella wünschte sich, Janey wäre mehr wie Amber. Sie machte sich schreckliche Sorgen, wie lässig ihre jüngere Schwester mit dem Leben und seinen Gefahren umging. Wo Ella ängstlich die Stirn runzelte, lachte Janey. Wo Ella sich misstrauisch zurückzog, trat Janey keck einen Schritt vor und packte zu. Wo Ella Gefahr sah, sah Janey nur Aufregendes. Doch Janey teilte auch nicht Ellas Erinnerungen und wusste nicht, was Ella wusste. Ihre leibliche Mutter hatte die Aufregung geliebt, ja, sich schier danach verzehrt. Ella hatte gehört, wie sie das gesagt hatte. Sie hatte mit angesehen, wie sie wild im Raum auf und ab lief wie ein Vogel, der mit den Flügeln immer wieder an die Gitterstäbe seines Käfigs schlägt. Ihre Mutter hatte hysterisch gelacht und war dann zusammen mit ihrer Tante Cassandra die Treppe rauf in ihrem Schlafzimmer verschwunden.
Janey war der Liebling ihrer Mutter gewesen, sie hatte ihr irgendwie immer ein Lächeln entlocken können, während Ella nur harsche Worte zu hören bekam.
Janey begriff nicht, wie sehr Ella sich davor fürchtete, eine von ihnen könnte diese Wesenszüge von ihrer Mutter geerbt haben. Janey hatte Glück, sie erinnerte sich nicht so gut an ihre Mutter wie Ella. Selbst jetzt wachte Ella manchmal noch nachts auf und überlegte, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn ihre leibliche Mutter nicht gestorben wäre. Sie erinnerte sich lebhaft an ihre Stimmungsschwankungen, die Wutanfälle, die wie aus dem Nichts kamen, gefolgt von reichlich Tränen und Gebrüll.
Ihre Mutter war eben ein bisschen verrückt gewesen – mehr als ein bisschen. Blanche, Ambers Großmutter, war einmal entschlüpft, dass ihre Verrücktheit durch die Geburt von Ella und Janey ausgelöst worden war. Ella fand es schrecklich, an die Krankheit ihrer Mutter zu denken. Sie fand jeden Gedanken an ihre Mutter schrecklich. Wie sehr sie Emerald doch darum beneidete, dass Amber ihre Mutter war.
Sobald Ella merkte, dass sie sich über etwas aufregte oder wütend wurde, rief sie sich ganz bewusst ihre Mutter in Erinnerung und verschloss ihre Gefühle. Sie würde niemals heiraten – oder Kinder bekommen –, denn sie wollte nicht enden wie ihre Mutter.
Aber was war mit Janey? Janey wusste nicht, warum sie sich davor fürchten sollte, was sie womöglich von ihrer Mutter geerbt hatten, und Ella brachte es nicht über sich, es ihr zu erzählen, denn sosehr sie sich auch um ihre jüngere Schwester mit ihrem Leichtsinn und ihrer Unbesonnenheit sorgte, so liebte Ella sie doch von Herzen. Sie wollte Janey nicht ihre Freude nehmen und sie in Angst und Schrecken versetzen.
4
Paris
»Na, dein Vater mag ja ein Herzog gewesen sein, Emerald, aber das macht dich noch lange nicht zur Herzogin.«
Emerald musste sich sehr zusammenreißen, Gwendolyn nicht mit Blicken zu töten.
Emerald, die Ehrenwerte Lydia Munroe– Tochter von Emeralds Patentante Beth– und Lady Gwendolyn– Nichte ebenjener Patentante und Cousine von Lydia– würden zusammen debütieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!