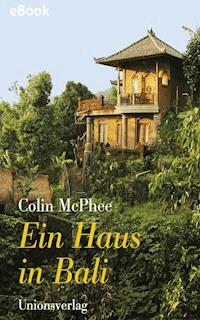
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Colin McPhee die Insel betrat, verfiel er ihr und wurde im Laufe der Jahre mit ihr und ihren Menschen auf einzigartige Weise vertraut. Er wurde zum größten Kenner balinesischer Musik und Kultur. Er erzählt vom Abenteuer, in Bali ein Haus bauen zu wollen. Dabei entsteht ein Bild von den Menschen und den Geistern, von Traditionen und Tanz, Spiritualität, Essen und Riten und natürlich der Musik. Dieser legendär gewordene Bericht ist nicht nur eine humorvolle, packende Lektüre. Bis heute ist es die wohl tiefgründigste Einführung in Balis Geheimnisse geblieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als Colin McPhee Bali betrat, verfiel er dieser Insel und wurde auf einzigartige Weise mit ihr und ihren Menschen vertraut. Er wurde zum größten Kenner balinesischer Musik und Kultur. Er erzählt von Menschen und Geistern, von Traditionen und Tanz, von Riten und natürlich der Musik: Bis heute die wohl tiefgründigste Einführung in Balis Geheimnisse.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin McPhee (1900-1964) war kanadischer Musikwissenschaftler und Komponist. 1931 heiratete er die Anthropologin Jane Belo, eine Schülerin von Margaret Mead, und lebte bis 1938 in Bali und Java. Nach der Rückkehr in die USA lebte er in New York und lehrte ab 1960 Musikwissenschaften in Los Angeles.
Zur Webseite von Colin McPhee.
Ines Anselmi ist Ethnologin, Journalistin und Freischaffende in der Kunst- und Kulturpromotion. Bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia wirkte sie als Projektleiterin mit Schwerpunkt interkultureller Dialog. Davor war sie Texterin und Marketingleiterin einer Entwicklungsorganisation.
Zur Webseite von Ines Anselmi.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin McPhee
Ein Haus in Bali
Aus dem Englischen von Ines Anselmi
Mit Fotografien des Autors
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1946 unter dem Titel A House in Bali im Verlag The John Day Company, New York.
Die Übersetzung wurde unterstützt von Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung.
Die Übersetzerin dankt Charlie Richter, Leiter des Studios für Musik der Kulturen (SMK) an der Musik Akademie Basel, für die Hilfe bei der Übersetzung balinesischer Musikbegriffe und Charlotte Wörner für die Anregung.
Originaltitel: A House in Bali (1946)
© Colin McPhee 1946
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Werner Gadliger
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30902-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 22:33h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
EIN HAUS IN BALI
Teil IDer HafenDenpasarDas Haus in KedatonNyoman KalerDie MaskenEin SchattenspielDie Form in der MusikDie Götter steigen herabKesyurPorträt eines PrinzenChetigAbschiedsfestTeil IIDas Haus in den HügelnDurusDer Tempel der TotenUrsymphonieDer RegentSampihIda Bagus Gede vertreibt die DämonenFortsetzung der Geschichte von SampihAblauf der ZeitLotringDer GrillenkampfDie Feuerbestattung in SabaEine zweite AbreiseTeil IIIZwei Jahre späterDas Gamelan von SemaraDer GuruDer KindermusikclubDie Lichter im TalWorterklärungenAllgemeinMusikTanzBilderAbbildungsverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Ines Anselmi: Beobachter, Zuhörer und Vollblutmusiker
Über Colin McPhee
Über Ines Anselmi
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Bali
Zum Thema Musik
Zum Thema Indonesien
Zum Thema Asien
Zum Thema Ethnologie
Für George Davis
Teil I
Der Hafen
Das Schiff war am späten Nachmittag von Surabaya nach Bali ausgelaufen.
Der Boy stolperte mit meinem Gepäck die Treppe hinunter zu den rund um den Salon angeordneten Kajüten und trug es zur Luxuskabine, die direkt über der Schiffsschraube lag. Ich öffnete die Tür und entdeckte einen stämmigen chinesischen Händler, der sich in der unteren Koje schon häuslich eingerichtet hatte. Er hatte das Oberteil seines weißen Seidenpyjamas abgestreift und lag da, entspannt wie ein ruhender Buddha, und rauchte seelenruhig eine Opiumpfeife. Auf der oberen Koje war sein beachtliches Gepäck ordentlich ausgebreitet, zu dem auch ein Vogelkäfig mit einem rastlosen Star gehörte. Das Bullauge war zugeklemmt, damit kein Lufthauch in dieses gemütliche Paradies eindringen konnte. Ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu stören, und als der Boy mein Gepäck abgestellt hatte, schloss ich die Tür und ging die Treppe hinauf.
Ich verbrachte die Nacht auf Deck, beugte mich über die Reling und spähte in der Dunkelheit nach einem schwachen Lichtschimmer, der Land anzeigte. Unter der sanften Bewegung des Schiffes kräuselte sich das Wasser zu Schaumkronen, die sich mit einem leisen Zischen wieder auflösten. Die Maschinen wimmerten im Schlafe, vibrierten von Zeit zu Zeit im Schiffsinneren, sodass die kleinen Kaffeetassen, die der Deckboy auf den Tischen zurückgelassen hatte, auf ihren Untertellerchen klingelten.
Selbst wenn ich die Kabine für mich alleine gehabt hätte, wäre an Schlaf nicht zu denken gewesen, denn die Aufregung in meinem Innern hielt mich hellwach. Ich war den ganzen weiten Weg hergekommen auf der Suche nach einer Musik – um die Gamelans zu hören, die seltsam und lieblich klingenden Gongorchester, die anscheinend immer noch an den Fürstenhöfen von Java und in den Dörfern und Tempeln Balis musizierten. Als ich in die Nacht hinausschaute, konnte ich es kaum glauben, dass dieses musikalische Abenteuer jetzt beginnen sollte.
Ich war ein junger Komponist, unlängst von einem Studienaufenthalt in Paris nach New York zurückgekehrt. Die vergangenen zwei Jahre waren mit Komponieren und dem Auffinden von Aufführungsmöglichkeiten ausgefüllt gewesen. Ganz zufällig hatte ich die wenigen Grammofonaufnahmen gehört, die mein Leben vollkommen verändern sollten und mich auf der Suche nach etwas Undefinierbarem – Musik oder Lebenserfahrung, das wusste ich noch nicht genau – nun hierherführten. Die Aufnahmen stammten aus Bali. Die klaren metallischen Töne der Musik waren wie das Schwingen von tausend Glocken, zart, wirr, von sinnlichem Reiz, überwältigend und geheimnisvoll. Ich bat darum, die Schallplatten ein paar Tage behalten zu dürfen, und als ich sie wieder und wieder abspielte, verzauberte mich der Klang immer mehr. Wer waren diese Musiker, fragte ich mich. Wie war diese Musik zustande gekommen? Vor allem aber, wie konnte diese Musik bis zum heutigen Tag überleben?
Ich gab die Aufnahmen zurück, aber ich konnte sie nicht vergessen. Zu jener Zeit wusste ich wenig über östliche Musik. Ich glaubte immer noch, dass sich ein Künstler auf seine eigene unmittelbare Umgebung ausrichten müsse. Aber die Wirkung der Musik war tiefer als vermutet, denn als ich in den frühen Büchern von Crawfurd und Raffles die märchenhaften Erzählungen von diesen altehrwürdigen zeremoniellen Orchestern las, fing meine Fantasie Feuer, und eines Tages entschied ich mich, die Reise nach Osten anzutreten, um sie mit eigenen Augen zu sehen.
Ich lehnte mich an die Schiffsbrüstung und dachte über all das nach, während das phosphoreszierende Kielwasser im Dunkeln verschwand. Ich konnte mich an das veränderte Aussehen des Himmels nicht gewöhnen, eben noch flache Sterngebilde nahmen plötzliche neue Dimensionen an und enthüllten Ebenen, die sich weit in den Weltraum ausdehnten. Plötzlich hellte sich die Nacht auf, und überraschend nah zeichneten sich die Umrisse von Bergen am Horizont ab.
Bei Sonnenaufgang warfen die ins Tal hinablaufenden Bergkämme Schatten, an den Ausläufern der Gebirge glitzerten die Palmen im taufeuchten Morgenlicht. Aber am späteren Morgen verflachten sich die Berge wieder zu Kegeln, und eine Stunde später, als wir anlegten, strahlte die Sonne Licht und Hitze in alle Richtungen aus.
Die kleine Hafenstadt von Buleleng zog sich als weißes Band entlang des Meeres. Zu beiden Seiten der Hauptstraße befanden sich im Schatten ausladender Baumriesen die Läden, halb versteckt im Innern eines langen Säulengangs. Japaner verkauften hier Thermosflaschen, Taschenlampen und Puppen aus Kunststoff, Händler aus Bombay boten Batik- und Manchesterstoffe feil. Die chinesischen Läden waren vollgestopft mit Waren aus aller Welt, Eisenwaren, Porzellan, Schinken, Lackfarben, geräucherter Ente, Seidenstoffen und Feuerwerk. Araber, Chinesen und Balinesen in farbenfroh geblümten Batiktüchern schlenderten unter den Arkaden. Friedlich saßen sie in winzigen Restaurants, rauchten, tranken synthetischen Birnensaft in verlockendem Rosarot, das in Mexiko, Harlem, Neapel, Hongkong und Batavia typisch ist für Süßigkeiten. Die Stadt verströmte wie alle Städte des Ostens den feinen sinnlichen Duft von Muskatnuss und Kräuterzigaretten, Kokosöl, Gardenien und Trockenfisch. Von irgendwoher ertönte eine liebliche kristallklare Musik, ein Gong setzte ein, begleitet von einer glockenhellen leisen Melodie, verstummte, setzte wieder ein.
Ein Wagen wartete, um mich über die Berge an die Südküste zu bringen, aber ich hatte es nicht eilig abzureisen. Ich wandte mich von der Hauptstraße ab und stieg durch ein Labyrinth von Gassen hinab. Aus winzigen, auf einer Seite offenen Buden ergossen sich die Waren auf die Straße. Kopra- und Kaffeehändler drängten sich neben Fotografen und Zahnärzten. Letztere waren Japaner, deren Wirkungsstätten nichts vor den Passanten verheimlichten. Inmitten jeder Praxis thronte ein Plüschsessel auf wackligem Aufbau; die Wände waren bedeckt mit furchterregenden Schaubildern, und hinter Glaskästen prangten perlenfarbige Backenzähne und goldene Gebisse.
Die Musik hatte aufgehört, doch plötzlich erklang sie erneut, lauter und sehr nahe. Am Ende der Straße stand ein kleiner chinesischer Tempel, die Musik drang aus dem Inneren durch die geöffnete Tür. Jetzt aus der Nähe nahm ich wahr, dass sie gewiss nicht einstimmig, sondern stark und eindeutig aus vielen verschiedenen Arten von Tönen zusammengesetzt war. Es rasselte, schellte und echote, untermalt von stetigem Trommeln, das einmal wild anschwoll und sich im nächsten Moment in ein kaum hörbares Klopfen verwandelte.
Im Innern des Tempels war es kühl und dunkel. Auf dem Altar brannte Weihrauch. Den Wänden entlang reihten sich leere Spieltische, daneben auf dem Boden schliefen traumversunken ein paar Chinesen. Auf den Matten, die neben dem Eingang ausgebreitet waren, saßen in einem Durcheinander von Gongs und Instrumenten mit großen Metallplatten balinesische Musiker in einer Reihe. Im Schatten waren die riesigen, hinter dem Orchester aufgehängten Gongs fast nicht zu erkennen, aber durch die Tür spiegelte sich das Licht auf den kleinen, waagrecht vorne aufgereihten Gongs. Mit gemessenen aufeinander abgestimmten Bewegungen klopften die Männer mit Hämmerchen und Schlägeln auf die Gongs und Klanglatten. Die Männer neben den großen Gongs im Hintergrund benutzten Schlägel mit dick gepolsterten Köpfen. Nur selten und in langen Abständen schienen sie zum Leben zu erwachen, hoben ihre Hände, um unendlich behutsam auf den neben ihnen hängenden Gong zu schlagen.
Die Melodie entfaltete sich wie ein uralter Gesang, ernst und metallisch, umwoben von endlos kontrapunktierenden Tönen der kleinen Gongs im Vordergrund. Von Zeit zu Zeit erhob sich über den Trommeln der weiche widerhallende Ton eines großen Gongs, tief und durchdringend schien er den Tempel mit einem feinen Echo zu erfüllen.
Die Musik endete, und die Männer legten ihre Schlägel beiseite. Sie starrten mich an, doch ihr Blick war nicht unfreundlich. Ein junger Chinese kam zu mir und sprach ein paar höfliche Worte in Englisch. Ich begann, ihn auszufragen. Offenbar waren die Spieler für die Tempelzeremonien engagiert worden, da es in Buleleng keine chinesischen Musiker gab. Der Titel des soeben gespielten Stücks? Er beriet sich mit dem Trommler. »Das Honigmeer«.
Die Männer ergriffen wieder die Schlägel, um das lebhaftere »Schnappende Krokodil« anzustimmen. Völlig bezaubert stand ich da. Es war noch unglaublicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber diesmal fingen die Musiker am Ende des Stückes nicht wieder an zu spielen. Einige erhoben sich und gingen hinaus. Ich wartete eine Weile und hoffte, sie würden zurückkommen. Doch dann sah ich auf meine Uhr und merkte, dass es Zeit war aufzubrechen, wenn ich Denpasar an der Südküste der Insel noch vor Sonnenuntergang erreichen wollte. Widerstrebend kehrte ich zurück durch die engen Gassen in die Richtung, aus der ich gekommen war.
Der Fahrer streifte seine Sandalen ab, umklammerte die Kupplung mit den Zehen und startete den Wagen. Schon bevor wir die Stadt verließen, stieg die Straße langsam an, wir passierten gepflegte Kolonialbungalows, das Haus des Statthalters mit weißen Säulenreihen und gusseisernen Verzierungen im Barockstil, weiter oben erstreckten sich die Reisfelder auf immer schmäleren Terrassen, je steiler die Straße anstieg. Unter uns dehnte sich die weite Fläche des Meeres in einem Blau, das durch eine scharfe dunkle Linie vom Himmel abgetrennt war. Das Schiff hatte schon Kurs auf Celebes genommen und glitt als winziger Punkt im Schneckentempo über den Ozean.
Der Wagen wurde langsamer, je steiler es bergauf ging, und begann, unter der heißen Sonne zu keuchen. Als wir die Felder hinter uns ließen und in den Wald kamen, hörten wir ein explosionsartiges Geräusch, aus dem Kühler schoss Dampf. Seufzend stieg der Fahrer aus.
Ich wanderte die Straße hinauf. Der Wald war in ein weiches goldenes Licht getaucht, es prallte von der Oberfläche riesiger dicker Blätter ab, durchleuchtete andere und drang in Höhlen ein, die sich zwischen dichtem Wurzelwerk auftaten. Keine einzige Blume heiterte diese geheime Welt auf, kein Ton war zu hören außer dem plötzlichen Laut irgendeines Vogels, der einen Moment lang anschlug wie eine Stimmgabel. Ich kehrte zurück und fand den Chauffeur, der sich am Kühler zu schaffen machte. Alles Wasser war verdampft, und die Hitze hatte das Metall an den Lötfugen zum Schmelzen gebracht, offensichtlich nicht zum ersten Mal. Der erfinderische Fahrer füllte mithilfe eines Streichholzes Moos in die Zwischenräume. Dann verstopfte er das Loch mit einem Holzkeil. Er holte aus dem Wagen eine Dose mit der Aufschrift »Beste Australische Butter« und füllte sie mit Wasser aus einem nahen Bach. Er goss das Wasser ein und knallte die Haube zu. Dann lächelte er, sagte etwas mir Unverständliches und setzte sich wieder in den Wagen.
Der Wald lichtete sich, wir waren auf dem kahlen Gipfel des Berges angelangt, die Straße führte nun am Rand eines gewaltigen Kraters entlang. Seine Innenwand war vom Dschungel überwachsen, weit unten glitzerte ein See. Im Innern dieses Beckens erhob sich ein Kegel, die Abhänge durchzogen von Lava, die einst bis weit ins Tal hinuntergeströmt war, aus seiner Flanke stießen Dampfwolken, die sich langsam in der Luft auflösten.
Jetzt begann die lange Abfahrt Richtung Meer, die Straße vor uns verschwand weiter unten zwischen den Bäumen. Bald tauchten Kornfelder auf, ein paar Hütten und schließlich, verborgen hinter einem Hain, ein Dorf. Auf einmal füllte sich die Straße mit Menschen und Tieren. Szenen huschten vorbei – Erntearbeiter mitten im gelben Reis, lärmende Kinder rings um zwei kopulierende Pferde, eine Reihe singender Frauen mit Opfergaben auf dem Kopf, ein langer Festzug mit goldenen Sonnenschirmen, der sich zum Klang von Gongs und wilden Trommelschlägen fortbewegte. Der Fahrer bremste vor Schweinen und Enten ab, nicht aber vor Hühnern und Hunden, die ihm anscheinend gleichgültig waren. Grau, ausgehungert und zittrig lungerten die Hunde auf den Mauern und an den Eingängen der Dörfer herum. Sie waren so träge, dass sie sich kaum von der Straße wegschleppen konnten. Wir stießen sie mit einem Klaps zur Seite und fuhren weiter.
Ganz plötzlich erreichten wir das Meer, violett im Licht des Spätnachmittags. Rosa Wolkentürme standen bewegungslos am Himmel, warfen schimmernde Flecken auf die Wasseroberfläche. Wir fuhren vorbei an Fischer-Praus, die ihren Fang abluden, an Fischernetzen, die schon zum Trocknen an Masten aufgehängt waren. Weiß verputzte Häuser mit Ziegeldächern tauchten auf; gleich darauf erreichten wir Denpasar und bogen in die Auffahrt des Hotels ein.
Ich war erschöpft und konnte es kaum erwarten, aus dem Wagen zu steigen. Im Hotel, einem geräumigen kühlen Bungalow, geleitete man mich zu einem Zimmer, das auf eine tiefer gelegene Veranda mit einer Stufe zum Garten hinausführte. Zwischen den Palmen war ein Kommen und Gehen von Menschen und kleinen Karren auf der Straße zu sehen. Ich läutete nach einem Drink und ließ mich in den niedrigen gepolsterten Sessel fallen.
Während ich wartete, erhob sich ein fremdartiger Ton hoch oben am Himmel, hell und bebend, lieblicher als alles, was ich an diesem Tag gehört hatte. Ich schaute hinaus. Eine Schar Tauben kreiste in den letzten Strahlen der Abendsonne. Der Ton schien ihnen zu folgen, und ich konnte nicht erraten, was es war. Ich rief den Boy, der mir erklärte, dass der Besitzer der Tauben kleine Glöcklein an ihre Füße gehängt und Bambuspfeifen an ihren Schwanzfedern befestigt habe. Sie kreisten und kreisten über uns und zogen weite Klangschleifen über den Himmel. Dann entschwanden sie, die Glöcklein erstarben plötzlich.
Denpasar
Denpasar war eine weitläufige Stadt mit weißen Regierungsgebäuden, einem Dutzend europäischer Häuser und einer Ladenstraße im Zentrum, umgeben von Hütten, die sich unter einem Gewirr von Bäumen und Palmen dicht zusammendrängten. Ruhe und Ordnung herrschten auf dem großen Platz, um den sich die europäischen Häuser gruppierten. Hier trafen sich am Spätnachmittag der Arzt, der Shell-Agent, der Schulaufseher und die Krankenschwester des Spitals zum Tennisspiel; in einem anderen Teil des Feldes fand ein chaotisches Fußballspiel unter Balinesen statt. Sie trugen gestreifte Trikots und Turnhosen, gestreifte Socken und zu schwere Schuhe, die sie behinderten, wenn sie rannten und kickten, sodass es aussah, als bewegten sie sich unter Wasser.
Die Läden erinnerten an Buleleng – chinesische Lebensmittelhändler und Goldschmiede, chinesische Apotheker, Fotografen und Fahrradvertreter in einer Reihe; es gab auch einen japanischen Fotografen (wie in fast jeder Kleinstadt Südostasiens), der zwar wenig zu tun hatte, dessen Geschäft sich aber in strategischer Lage an der Hauptstraßenkreuzung befand, von wo aus man sowohl die europäischen Büros und Häuser als auch die chinesischen Läden überblicken konnte. In einer Seitenstraße verkauften Araber Textilien und billige Koffer. Im javanischen Eissalon konnte man Eis in den grellsten Farben erstehen, sofern die elektrische Maschine funktionierte. Es gab keine Kirche, aber in den arabischen Vierteln stand eine Moschee; ein kleines Kino zeigte zweimal die Woche Wildwestfilme. An dem einen Ende der Hauptstraße breitete sich der Markt aus, durch den sich die Leute in einem Durcheinander von Schweinen, Töpferwaren, Batikstoffen, Früchten, Messingartikeln und Matten ihren Weg bahnten.
Tagsüber läuteten unablässig die Glocken der unzähligen Ponykarren in den Straßen, und man hörte das röchelnde Hupen von Bussen und Autos, die andauernd stadtein- und -auswärts fuhren. Das Krähen von tausend Hähnen, das Bellen von tausend Hunden bildete einen klangvollen Hintergrund, vor dem sich der melancholische Ruf eines vorbeigehenden Straßenhändlers ausnahm wie eine Oboe in einer Symphonie.
Aber nachts, wenn die Läden geschlossen waren und die halbe Stadt schon schlief, erstarben die Geräusche so gründlich, dass man jedes Wehen eines Blattes, jedes trockene Rascheln eines Palmwedels hören konnte. Aus allen Richtungen wogte nun sanfte, geheimnisvolle Musik, summend, bebend über dem zarten dumpfen Klang von Trommeln. Die Töne kamen aus verschiedenen Entfernungen und verliehen der Nacht eine grenzenlose Perspektive. Spätnachts hörte die Musik auf. Nun war die Stille vollkommen, nur ab und zu vernahm man eine einsame hohe, nasale Stimme, die wehmütig ein Lied ohne Ende sang. Oder es brach plötzlich der Aufruhr der Hunde aus, der mit einem dünnen vereinzelten Heulen begann und sich rasch zu einem lautstarken Wehklagen steigerte, bis wieder Totenstille herrschte.
Das Hotel war mit seinen kühlen Lobbys und gekachelten Böden eine wahre Oase nach all den Stunden in der grellen Sonne und Hitze, die ich zwar liebte, die mir aber den letzten Tropfen Energie entzogen. Ich konnte es kaum glauben, dass das Thermometer lediglich 29°C anzeigte. Nach einem Spaziergang durch die Stadt ließ ich mich auf das Bett fallen, das wie alle Betten in Südostasien keine Sprungfedern hatte. Ich bekam einen Hautausschlag, den der Hotelmanager sofort als »Roten Hund« diagnostizierte. Nur die zufällige Entdeckung in meinem Wörterbuch, dass »roode hond« im Holländischen »Hitzepickel« bedeutete, hielt mich davon ab, eilends einen Arzt aufzusuchen.
Ich versuchte jedoch nicht, Holländisch zu lernen, sondern Malaiisch.
Malaiisch ist eine Sprache, die kinderleicht und einfach scheint, sofern man alltägliche Belange ausdrücken will, aber kompliziert und vieldeutig wird, sobald man einen komplexen Gedanken ausdrücken möchte. Sie ist das Esperanto der malaiischen Halbinsel und Südostasiens, die sogar in Colombo und Hongkong gesprochen wird. Der Wortschatz enthält viele arabische Wörter, ein bisschen Sanskrit, Portugiesisch und Javanisch, ein wenig Holländisch und Englisch und einige lieblich klingende Begriffe aus den Ursprachen, zum Beispiel für Mensch, Fisch, Kokosnuss und weitere Dinge, die von Madagaskar bis zur Osterinsel geläufig sind. Ich hatte an Bord des Schiffes mit dem Erlernen von Malaiisch begonnen, bis jetzt aber nicht viel mehr geschafft als die Frage nach heißem Rasierwasser, nach mehr Kaffee oder nach Eiswasser.
Erst nachdem ich Sarda getroffen hatte, verspürte ich das Bedürfnis nach einem umfangreicheren Wortschatz. Wenn ich einen Wagen brauchte, rief ich die chinesische Garage an, die mir gewöhnlich einen etwas älteren, aber gut erhaltenen Buick schickte. Sarda war der Name des selbstbeherrschten und gut aussehenden Jünglings, der den Wagen mit einer Miene äußerster Verachtung chauffierte.
Er kleidete sich elegant. Sein Batiksarong war steif und neu, mit einem Muster aus Blumen und Tennisschlägern. Er trug ein seidenes Sporthemd, darüber eine gut sitzende, im amerikanischen Stil geschnittene weiße Jacke. In der Brusttasche steckten ein Drehbleistift, ein Füllfederhalter und ein Kamm. An den Füßen trug er Sandalen, auf dem Kopf ein Batiktuch, in dessen Falten er eine Rose befestigt hatte.
Zuerst saß ich hinten, neben mir meine Kameras, Thermosflaschen und Sandwiches, doch bald war ich diese Absonderung leid und wechselte nach vorne, wo ich mit Sarda während der Fahrt reden konnte.
Der Hoteldirektor missbilligte das sehr. Denn diese kleine Geste bedeutete offenbar etwas Unziemliches, möglicherweise Wohlwollen, Vertrautheit, oder noch schlimmer, Gleichheit, eine vom kolonialen Standpunkt aus abscheuliche Vorstellung.
»Sie müssen Distanz halten«, mahnte der Direktor, »der angemessene Platz für einen weißen Mann ist der Rücksitz. Früher haben Holländer Eingeborene geheiratet; heute ist das anders. Gehen Sie mit ihnen ins Bett, wenn Sie möchten, aber achten Sie darauf, dass sie durch den Hintereingang eintreten.«
Er sprach sehr ernst, aber ohne Hass. Er war rotgesichtig, immer in Schweiß gebadet. Er schikanierte seine Boys, manchmal wutentbrannt, dann wieder in matter Routine. Trotz allem schien er mit ihnen zurechtzukommen, denn die Bedienung war ausgezeichnet.
»Ahmat!«, schrie er, als wir in der Lobby saßen. »Ahmat!«, brüllte er so laut, dass ich fürchtete, das Glas auf dem riesigen Bild der niederländischen Königin, das über unseren Köpfen hing, würde zerspringen.
Eine dünne Gestalt näherte sich.
»Bring uns zwei Gin-Bitter, beeile dich!«
Er betupfte sich die Stirn mit einem feuchten Taschentuch.
»Faul!«, klagte er. »Man kann ihnen nichts beibringen. Zehn Jahre bin ich nun schon hier«, stöhnte er. »Wenn die Mädchen nicht wären … Haben Sie die Kleine bemerkt, die am Eingang Ringe verkauft?«
Wir leerten unsere Drinks, und ich stand auf. Er richtete ein Abschiedswort an mich. »Ich sehe Sie nicht gerne dort auf dem Vordersitz. Der weiße Mann sollte nie vergessen, die Würde der weißen Rasse aufrechtzuerhalten.« Er rülpste leise. Dann fügte er noch hinzu: »Wenn Sie wirklich vorne sitzen müssen, steuern Sie den Wagen selber und lassen den Chauffeur hinten sitzen.«
Aber ich saß weiterhin dort, wo es mir gefiel. Wir fuhren ohne Verdeck, die heiße Sonne brannte auf unsere Köpfe. Nur wenn wir die Tennisplätze passierten oder die Hotelauffahrt nahmen, fühlte ich mich befangen, auffällig und rebellisch.
Im Hotel wurden Ausflüge für Reisende angeboten, die sich nur kurz auf der Insel aufhielten. Jeder Tag war von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang durchgeplant. »Do. Vorm.: heiliger Teich; Gräber der Könige; Palast von Karangasem; Mittagessen in einer Gaststätte. Nachm.: Fledermaus-Höhle; heiliger Wald; Riesenbanyanbaum; heiße Quellen. Abends, 9 Uhr: Tanzvorführung im Hotel.«
Ich zog es vor, aufs Geratewohl über die Insel zu fahren, mich in dem Netz von Nebenstraßen zu verlieren, die in die Hügel hinaufführten, wo man auf das Meer hinabsah und die gefluteten Reisfelder im Sonnenlicht aufschienen wie Scherben eines zerbrochenen Spiegels. Ständig ertönte irgendwo Musik. Die Leute sangen in den Feldern oder beim Baden in den Flüssen. Hinter den Dorfmauern hervor drang der Klang von Flöten und Zimbeln, gespielt von unsichtbaren Musikern, die zu jeder Tages- und Nachtstunde übten. Kräftiges Trommeln und das Anschlagen riesiger Gongs ließen während Festlichkeiten die Tempel erzittern. Wenn wir nachts heimfuhren, passierten wir ein Dorf nach dem anderen, in dem die Leute am Straßenrand um den Schein einer kleinen Lampe herum kauerten, um den Puppen des Schattenspiels zuzuschauen.
Wenn das Auto von der Küste weg in die Berge hinauffuhr, schienen sich Stil und Stimmung der Musik zu verändern. In der Ebene spielten die Musiker heiter und lebhaft eine Musik von schimmernder Ornamentierung, die so reich und vielschichtig war wie die Verzierungen der Tempel selbst. Aber in den Bergen, je höher man reiste und je weiter die Dörfer voneinander entfernt lagen, wurde die Musik ähnlich wie die Architektur der Tempel immer strenger, nahm mehr und mehr einen altehrwürdigen ernsten Ausdruck an. Hier oben in den nebel- und wolkenverhangenen Dörfern mit ihren moosgrünen Tempelmauern und farnüberwachsenen Dächern wurde die Stille nur selten an einigen Dorffesten vom gravitätischen Klang alter ritueller Musik unterbrochen.
Obwohl sich Sarda sichtlich langweilte bei diesen Exkursionen in die Hügel (»Typisch Bergler!«, pflegte er hochmütig zu bemerken, wenn wir einem langsamen Tanz zuschauten), fand er sich bald damit ab, den Wagen jedes Mal zu stoppen, wenn Musik ertönte. Ich pflegte auszusteigen und mir einen Weg durch die Menge bis zur Gruppe der Musiker zu bahnen. Niemanden schien dieses Eindringen im Geringsten zu stören, und während ich dort saß und zuhörte, die turbulenten Vorgänge eines Tempelfestes betrachtete, die Frauen mit aufgetürmten Opfergaben auf den Köpfen, die zeremoniellen Tänze vor den Altären, die feierlichen Umzüge und die krachenden Feuerwerkskörper, ging jegliches Zeitgefühl verloren.
Manchmal, nach einem langen Vormittag zwangloser Erkundung der Gegend, hielt Sarda auf dem Marktplatz eines Dorfes an, wir setzten uns vor eine Kaffeebude und tranken Tee oder lauwarmes Bier. In das Stimmengewirr des Marktes mischten sich Kinderstimmen, die aus der offenen Türe der kleinen öffentlichen Schule drangen, schläfrig leierten sie zum Takt eines Lineals das Einmaleins herunter. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Gruppe von Knaben um den geparkten Wagen versammelte. Kommentare machten die Runde.
»Essex.«
»Nein, Buick 1927. Ein altes Modell.«
Ein Greis fragte: »Wie ist das möglich? Ein Karren, der einfach so läuft, ohne Zugtier?«
Mitleidloses Gelächter verstieß ihn ins finstere Mittelalter.
»Wach auf, Großvater, denke nach! Du trittst auf das Pedal, ziehst am Griff, und ab geht es.«
Sarda hörte verächtlich schweigend zu. Er wandte sich an mich. »Das Gerede von Berglern!« Schwungvoll startete er den Wagen, und wir entschwanden mit grandioser Schnelligkeit, wie die Götter.
Am frühen Morgen zeigte sich die Insel in einer goldenen Frische, nass und glänzend von Feuchtigkeit wie Grünpflanzen im Fenster eines Blumengeschäfts. Gegen Mittag wurde sie härter und nüchterner. Aber am späten Nachmittag verwandelte sich die Insel erneut; sie wurde unwirklich, verschwenderisch und theatralisch wie eine altmodische Opernkulisse. Wenn sich die Sonne dem Horizont näherte, nahmen Männer und Frauen die Farbe von poliertem Kupfer an, Schatten färbten sich lila, der Rasen blau, und alles Weiße warf ein tiefes Rosa zurück.
Eines Abends, als wir über Land fuhren, ging der Vollmond über den Feldern auf, scharlachrot, riesig, unglaublich verformt im unsichtbaren Dunst. Ich bat Sarda, den Wagen zu stoppen, und schaute schweigend hinaus. Ein Anflug romantischer Begeisterung in meiner Stimme hatte Sarda wohl zum Nachdenken gebracht, denn plötzlich fragte er: »Haben Sie in Amerika vielleicht keinen Mond?« Er sprach so arglos, dass ich nicht sicher war, ob er es ironisch meinte oder nicht. Ich antwortete ihm, doch, wir hätten einen, und darauf fuhr er los und meinte, ich würde zu spät kommen zum Abendessen im Hotel.
Es war während der ersten Woche, als wir eines Spätnachmittags in einem Dorf ankamen, in dem Flaggen und Luftschlangen leuchteten. Vor dem Tempel hatte sich eine Menge versammelt, und der Klang flüchtiger, komplexer Musik erfüllte die Luft. Ich schob mich durch das Gedränge zu einem offenen Platz, an dessen einem Ende die Musiker um ihre Instrumente saßen. Am anderen Ende markierten zwei an einem Draht aufgespannte Vorhänge einen Bühneneingang.
Mit beinah fieberhafter Heftigkeit stieg die Musik höher und tiefer. Vor dem Orchester lehnten sich zwei Trommler über ihre Instrumente, ihre Hände wirbelten gegen den Trommelrand wie Mottenflügel gegen eine Lampe. Unversehens hörte die Musik auf. Es gab eine Pause, die Spieler ruhten aus. Bald aber zogen sie das Publikum wieder in ihren Bann. Sie ergriffen ihre kleinen Hämmer und Schlägel, der erste Trommler gab ein Zeichen, und abermals ergoss sich die Musik über uns wie ein Regenschauer.
Der Vorhang teilte sich, ein Mädchen von etwa neun Jahren erschien auf der Bühne, offensichtlich in Gold gekleidet. Die untergehende Sonne strahlte durch die Bäume, und das Mädchen glitzerte wie ein Insekt, als es sich bewegte. Nicht lange danach folgten ihm zwei andere Mädchen. Ihre Rockschöße waren steif und metallisch, und in ihrem Kopfschmuck wippten auf Drähte gesteckte goldene Blumen, die bei jeder Körperbewegung zitterten. Tanz und Musik erschienen wie eine einzige Regung. Die Kinder schwirrten wie Kolibris. Ihre Gebärden waren von unendlicher Eleganz, subtil und grazil, sie glichen zierlichen Statuen, die zum Leben erweckt worden waren – nicht geschmeidig fließend, sondern wie die Bildsequenz in einem Film, in einer Abfolge von Posen, die kaum einen Sekundenbruchteil dauerten. Man spürte, dass sie sich jeder Sechzehntelnote in der Musik bewusst waren.
Zuerst war der Tanz förmlich und abstrakt. Die Geschichte habe noch nicht begonnen, sagte Sarda. Doch bald wurde klar, dass sich ein Drama offenbarte. Es gab eine Szene voller Zärtlichkeit, gefolgt von einem Marsch um die Bühne herum. Das erste Kind setzte ein Paar goldener Flügel auf und verwandelte sich in einen Vogel. Das zweite schwang einen Kris, um es abzuwehren. Es gab einen weiteren Marsch, einen Kampf. Die Tänzerinnen wechselten schnell von Rolle zu Rolle.
»Jetzt nimmt der König von Lasem Abschied von der Prinzessin Langkasari, die er entführt hat«, erklärte Sarda. »Er geht fort, um gegen ihren Bruder zu kämpfen. Ein Rabe fliegt ihm voraus. Er stolpert über einen Stein. Er wird getötet werden …«
Schließlich verstummte die Musik, und die Kinder – Schweiß perlte auf ihren Stirnen – setzten sich zu den Musikern, mit hängenden Köpfen wie verwelkte Blumen. Etwas ergreifend Verstörendes lag in ihrer kühlen, voradoleszenten Anmut, in ihren ernsten Gesichtern, die weder unschuldig noch verdorben wirkten.
Immer wieder schien die hypnotische Musik in meinen Ohren den Motor zu übertönen, als wir in der Nacht heimfuhren.
»Das sind die Legong-Tänzerinnen des Prinzen von Saba«, bemerkte Sarda. »Er soll wahnsinnig verliebt sein in die erste Tänzerin, doch er kann sie noch nicht heiraten. Er muss ihre erste Menstruation abwarten. Seine zweite Frau ist krank vor Eifersucht.«
»Was meint das kleine Mädchen dazu?«
»Wahrscheinlich nichts. Es würde sich nicht getrauen, etwas zu sagen. Es ist nur ein Bauernmädchen. Eigentlich müsste er eine der beiden anderen Tänzerinnen bevorzugen. Sie sind hübscher, die eine ist Prinzessin, die andere Brahmanin.«
»Sie wirken sehr jung.«
»Wer wünscht denn eine geöffnete Blüte? Und außerdem, wenn sie noch Jungfrauen sein sollen …«
»Und er, wie ist er?«
»Ein großer Spieler, ein großer Liebhaber der Tanzkunst. Seine Musiker sind berühmt. Er hat soeben die Trommel gespielt.«
Mir fiel der dramatisch anmutende junge Mann ein, der so fieberhaft getrommelt hatte, die Augen auf die Tänzerinnen und ihre Bewegungen auf der Bühne geheftet. Seine Energie schien in jeden Ton der Musik zu strömen, in jede Bewegung der Tänzerinnen, durch ihren Körper hindurch bis zu den zarten Händen, die immer wieder neue wunderschöne Formen in die Luft zeichneten.
»Und wer bildet die Tänzerinnen aus?«
»Es heißt, er bilde sie selber aus.«
Schweigend setzten wir die Fahrt fort. Für das Abendessen im Hotel war es zu spät, so ging ich ins chinesische Restaurant an der Hauptstraße. Es war kurz vor der Sperrstunde, ich saß allein mit Sarda, während der Koch schläfrig eine Pfanne auf den Herd stellte und das verglimmende Feuer anfachte. Von irgendwo aus dem Hintergrund ertönte eine Flöte über dem schwachen Zupfen einer Zither.
Wir fuhren zum Meer hinunter. Der Mond stand hoch am Himmel, der Strand war in silberweißes Licht getaucht. Die Berge rund um die Bucht in der Ferne waren niedrig und glasklar.
»Ich habe Lust zu schwimmen«, bemerkte ich. »Ist es hier sicher?«
»Ja; hier gibt es keine Haie.«
»Kommst du mit?«
Sarda steckte den Autoschlüssel in seine Tasche und stieg aus.
Wir zogen uns aus, hängten unsere Kleider über einen am Strand liegenden Einbaum. Langsam gingen wir ins Wasser. Weit draußen hörte man die Brandung auf den Riffs, weit draußen schienen und schaukelten die kleinen Lampen der Fischer-Praus.
Als wir aus dem Wasser kamen, setzten wir uns auf die Felsen und ließen uns von der leichten Brise trocknen. Ich wollte nicht zum Hotel zurückkehren. Lange blieb ich liegen, hörte der Brandung auf den Riffs zu und ließ den Sand durch die Finger rinnen.
»Tuan scheint hier sehr glücklich«, bemerkte Sarda ein paar Tage danach.
»Sehr glücklich, in der Tat, Sarda.«
»Warum im Hotel bleiben? In einem Dorf nicht weit von Denpasar weiß ich von einem kleinen Haus, das vermietet wird. Es ist nicht teuer.«
In meiner Vorstellung sah ich eine strohgedeckte Hütte inmitten von Baumfarnen und Bambus. Mir wurde schlagartig klar, wie sehr ich des Hotels überdrüssig war, wie dringend ich auf meine Art in einem eigenen Zuhause leben wollte. Ich teilte Sarda mit, wir würden gleich am nächsten Morgen zu dem Dorf fahren. Sofern das Haus ein Dach besaß, war ich entschlossen, es zu nehmen.
Das Haus in Kedaton
Das Haus war klein und quadratisch, mit einem Wellblechdach, innen und außen weiß verputzten Wänden. Es hatte vier genau gleich große Zimmer, jedes mit einem geschlossenen Fensterladen, und Zementböden, die beim geringsten Geräusch widerhallten. Dahinter befand sich ein noch kleineres Gebäude, es enthielt eine Küche, ein Bad und einen Platz für die Schlafmatte eines Bediensteten.
Das Haus stand auf einem schmalen rechteckigen Grundstück, umgeben von einem nahezu leeren, mit Moos und Farn überwucherten Graben, aus dem von Zeit zu Zeit ein Frosch trübselig quakte. Einst war dieser Wassergraben bis zum Rand gefüllt gewesen; denn das Haus war, so schien es, als »Vergnügungsort« für einen Brahmanenpriester aus dem Dorf erbaut worden und hieß im Volksmund immer noch Gunung Sari, »Berg der Blumen«. Aber der Priester hatte es vor langer Zeit aufgegeben und vermietete es nun von Zeit zu Zeit an einen durchreisenden Weißen, der nach einheimischer Art leben wollte.
Die Türen quietschten, die Zimmer rochen muffig, ein Jahr lang war das Haus zugesperrt gewesen. Aber von der geräumigen vorderen Terrasse aus sah man durch die Palmen hindurch über schimmernde Reisfelder und konnte einen Blick auf das Meer erhaschen. Die Verhandlungen wurden vom jungen Enkel des alten Priesters geschäftsmäßig geführt. Er sagte, die Miete betrage vierzig Gulden im Monat, und ich könne einziehen, wann ich wolle. Er versprach, bis zu meiner Ankunft alles Notwendige einzurichten.
Die Missbilligung des Hotelmanagers, als ich ihm die Änderung meiner Pläne mitteilte, war echt, um nicht zu sagen, beredt. Aber als er sah, dass ich nicht auf ihn hören wollte, wurde er plötzlich überraschend menschlich und erbot sich an, mir Bettwäsche, Tafelsilber und bequeme Sessel zu leihen. Ich glaubte sogar einen Anflug von Neid in seiner Stimme zu entdecken, als er nun Ratschläge über Termiten erteilte und vor dem Wasser warnte. Er meinte, ich würde einen Koch und einen Hausdiener benötigen, die der Room Boy leicht für mich finden könne.
An jenem Abend näherte sich ein äußerst träger junger Mann in weißer Jacke und Hose meiner Veranda im Hotel, setzte sich auf den Boden und verneigte sich höflich, die Hände unter dem Kinn gefaltet. Er sah nicht besonders tüchtig aus, aber der Room Boy versicherte, der Junge hätte kürzlich in diesem Hotel gearbeitet. Er sagte auch, er habe eine Köchin für mich gefunden. Am nächsten Morgen, als ich im Pyjama zum Morgenkaffee nach draußen ging, wartete sie schon auf mich und stand geduldig im nassen Gras. Sie war eine kleine dralle Maduresin mit rundem Gesicht und der Miene eines schmollenden Kindes. Sie war barfuß und trug einen weißen, mit roten Pfauen bedruckten Sarong, eine kurze weiße Jacke, die sich an den Seitennähten löste und sich über ihrem Busen spannte, ein Dreieck ihrer Taille entblößend.
»Das ist die Köchin«, sagte der Boy. »Sie kann holländisch kochen.«
»Guten Tag, Köchin«, sagte ich.
»Tabe tuan; tuan chari koki?« Sie sprach in dem seltsamen, kindlichen Singsang der indonesischen Bediensteten, monoton und unergründlich. Ich gab ihr etwas Geld, wies sie an, Pfannen und Töpfe zu kaufen, und sagte ihr, dass ich in zwei Tagen in dem Haus zu Mittag essen würde.
Zwei Tage später zeigte sich das Haus voller Wärme und Leben. Der Sohn des Priesters und zwei andere Jungen hießen mich willkommen. Sie hatten das Haus sauber gefegt und die Möbel sorgfältig angeordnet. Die Köchin und der Hausboy waren schon dort. Die Fensterläden standen weit offen, und ein Hauch von Erwartung ging von dem Ort aus.
Zwei der Zimmer waren genau gleich eingerichtet. Jedes enthielt ein freistehendes, klangvolles Eisenbett, in weichen weißen Tüll gehüllt wie ein Mädchen bei der Erstkommunion. Auf dem Bett lagen zwei Kissen, und über die Mitte streckte sich das »Dutch Wife«, ein langes Polster, prall wie eine Wurst. Direkt an der Wand jedes Zimmers befand sich ein Tisch mit Emailkrug und -waschschüssel, darüber hing ein kleiner Spiegel. In der Ecke stand ein Stuhl. Der dritte Raum enthielt einen kahlen Esstisch und vier symmetrisch angeordnete Stühle. Der vierte Raum war gänzlich leer. Auf die freien Fensterbänke hatten die Boys Trinkgläser mit hellen Blumen gestellt, die in der Morgensonne durchsichtig leuchteten.
Die Köchin hatte sich schon häuslich eingerichtet. Sie saß auf dem Küchenboden, fächelte das Feuer von drei kleinen Kohlenbecken und rührte in den Töpfen darüber. Um sie herum reihten sich Schalen mit geraspelter Kokosnuss, gebratenen Zwiebeln und mir unbekannten Zutaten. Auf der Matte neben ihr erhoben sich Hügelchen aus rotem Pfeffer, Knoblauch und Nüssen. Es gab Haufen von Bananen, Enteneiern, Krabben, etwas australische Butter in einer großen Dose und ein betäubtes Huhn, das mit zusammengebundenen Füßen an der Wand an einem Nagel hing. Ihre Zigaretten und Betel lagen in Griffnähe der Köchin. Ein ausgemergelter Hund hatte schon seinen Platz eingenommen und schnüffelte in den Ecken des Raumes herum.
Ein kräftiger, vielschichtiger Geruch lag in der Luft, beißend und scharf, von verbrannten Federn, Fisch und brutzelndem Kokosnussöl. Es sollte für mich ein alltäglicher Geruch werden, pünktlich und unvermeidlich wie der morgendliche Duft des Kaffees zu Hause. Er stammte hauptsächlich von »Sra«, einer Paste aus Garnelen, die einmal zerrieben, getrocknet, mit Meerwasser vermischt und monatelang in der Erde vergraben worden waren, um zu fermentieren. Sie wurde in fast allem verwendet, zuerst angebraten, um ihr Aroma zu entfalten. Sie roch unglaublich faulig. Eine erbsengroße Menge genügte vollauf, um ein ganzes Gericht zu würzen. Sie verlieh dem Essen einen pikanten herben Geschmack, und schon bald war ich süchtig danach wie ein Tier nach Salz.
Jeden Abend gab ich der Köchin einen Gulden, damals etwa 40 Cents, den sie in chinesische Münzen umtauschte, wenn sie im Morgengrauen zum Markt ging. Sie kaufte davon ein Paar Hühnchen oder einen schönen Fisch, Gemüse, Früchte, Eier, Reis, Tofu, eine Handvoll Trockenfisch für sich selbst und den Boy, und hatte noch etwas übrig, um sich Zigaretten und Betel zu genehmigen.
Jeden Morgen tauchte sie gegen sieben Uhr auf, ein großes Waschbecken auf dem Kopf balancierend. Es hatte sich in einen fantastischen Hut verwandelt, geschmückt mit Ananas, Lauchstängeln, Kohlköpfen und Bananen, dazwischen ragte mit starrem Blick ein Huhn oder eine Ente hervor.
»Tabe tuan.«
»Tabe Köchin. Wie läuft es?«
»Ja, tuan.«
Sie war zu einsilbig, zu achtlos, um eine vollständige Antwort zu geben. Sie stapfte schweigend zum Hinterhaus. Aber es dauerte nie lange, bis ihre Stimme einen anderen Ton annahm. Sie war eine Frau mit einem etwas zänkischen Temperament, und sie weigerte sich, mit dem Boy auszukommen. Sie war Maduresin und Mohammedanerin, er ein ungläubiger Balinese und ein Schweinefleischesser noch dazu. Ihr Keifen verwandelte sich bald in ein schneidendes Schwatzen, das zu einem Geschrei anschwoll und schließlich in den höheren Obertönen der Verärgerung verebbte.
Das Mittagessen kochte sie nach javanischer Art, das heißt Reis, begleitet von einem Dutzend verschiedener Speisen, die für sechs Personen gereicht hätten. Der Tisch war vollgestellt mit Schalen, in denen Fisch und Geflügel in grünen, gelben und dunkelroten Saucen schwammen. Einige Speisen schmeckten ein wenig nach Curry, aber unendlich viel frischer im Aroma; andere waren so scharf gewürzt, dass sie einem Tränen in die Augen und Schweiß auf die Stirn trieben.
Die Zubereitung dieser Speisen war kompliziert und benötigte Stunden geduldiger Arbeit. Der Plan hinter dieser Vielfalt schien zu sein, dem Gaumen eines Gourmets zu schmeicheln, denn ein Huhn wurde niemals nur auf eine Art gekocht, sondern teilweise gebraten, gegrillt, gedämpft, geschmort, geschnetzelt und mit großer Sorgfalt gewürzt, um die Unterschiede hervorzuheben. Einen Fisch bereitete sie in derselben Weise zu. Doch damit nicht genug, gab es doch noch zahllose Beilagen mit exotischen Delikatessen – Akazienblütenkompott, eingemachte Enteneier, winzige knusprige Tintenfische, die auf dem Teller wie Spinnen aussahen.
Ihre Süßspeisen waren noch exotischer. Denn das Mittagessen endete etwa mit Maiskörnern und Kokosraspeln, vermischt mit Palmzuckersirup, kleinen triefenden Reisbällchen, heimtückisch gefüllt mit noch mehr Sirup, oder einer Ananas in Scheiben, die mit Salz, rotem Pfeffer und Knoblauch gegessen wurden.
Abends aber kochte die Köchin »holländisch«. Dann tischte sie Hackbraten oder Ente in einer schwarzen und seltsamen Sauce auf, Pfannkuchen und Pudding wechselten sich als Nachspeise ab.
Der Boy war seltsam träge und farblos. »Nennen Sie mich Gusti (Prinz)«, hatte er gesagt, obwohl er offenbar kein Anrecht auf diesen Titel hatte. »Er ein Gusti?«, ereiferte sich die Köchin mir gegenüber. Sie lachte höhnisch. Am frühen Morgen brachte mir Gusti schlaftrunken lauwarmen Kaffee. Er schleifte die Matratze in die Sonne, verschob die Stühle und wischte Staub, als würde ihn das die letzte Kraft kosten. Er schaffte es, jeden Morgen ein oder zwei Hemden zu waschen, und verbrachte den Nachmittag in einer köstlichen Traumwelt von Zigarettenrauch und bedächtigem, gedankenvollem Bügeln. Erst erledigte er meine Hemden, dann ein Paar Hosen. Danach ruhte er aus. Dann plättete er sein eigenes Hemd und seine Jacke, oder er bügelte eine Stunde lang modische Falten in seinen Sarong. Diesen trug er, falls er gerade nicht in Stimmung für Hosen war, geschickt um die Taille gewickelt, die Falten vorne so gerafft, dass sich das flache Akkordeonplissee bei jedem Schritt öffnete, was einen an ägyptische Reliefs erinnerte.
Bald lief der Haushalt wie von selbst. Ich wurde taub gegen die Stimme der Köchin. Als ich verstehen lernte, was sie sagte, wurde mir klar, dass sie die meiste Zeit nur schimpfte, um in Übung zu bleiben; diese Ausbrüche waren ihr tägliches Training, das nötig war, um ihre Stimme in Schwung zu halten in der fortwährenden Klage der Frau gegen den Mann.
Das Dorf war viereckig angelegt wie ein Schachbrett, wie alle Dörfer der Insel bestand es aus einem Netz von Straßen und Wegen, die nach Norden und Süden, Osten und Westen verliefen. Man hatte den Eindruck, es liege inmitten eines lieblichen Waldes; die Häuser versteckten sich hinter Mauern in einem Dschungel von Brotfruchtbäumen und Palmen, deren lange Wedel wie Federn herabhingen und das Licht der Morgensonne in tausend Facetten reflektierten.
Das Haus lag in unmittelbarer Nähe der Hauptstraße an einem Ende des Dorfes. Gegenüber stand der Tempel der Quellen. Man ging die Straße hinunter am Tempel der Dorfältesten vorbei zum Markt und dem Clubhaus der Männer. Danach gelangte man zum Tempel der Erdachse. Draußen in den Feldern stand das Tempelchen für Sri, die Reisgöttin. Noch weiter entfernt sah man vom Haus aus ein paar Schreine für Sarawati, die Göttin des Lernens. Hinter dem Friedhof am südlichen Dorfrand befand sich der Tempel der Toten. Still und verlassen wartete jeder Tempel auf seinen Festtag, an dem sich die Innenhöfe jeweils mit Menschen füllten und die Mauern von Musik widerhallten.
Auf dem Marktplatz in der Dorfmitte herrschte von früh bis spät reges Treiben. Hier trafen sich die Bewohner zum Klatschen, um eine Handvoll Trockenfisch oder ein Maß Reis zu kaufen. An jedem dritten Tag, am Markttag, konnte man Schweine und Enten, Matten, japanische Textilien, Haushaltswaren aus China und Java kaufen. Hier versammelten sich auch die Männer im Schatten des riesigen Banyanbaumes, der den ganzen Markt überdachte, um in Muße zu plaudern oder einfach dazusitzen und an gar nichts zu denken. Sie brachten ihre Kampfhähne mit, hockten stundenlang dort, massierten geistesabwesend die kräftigen strammen Schenkel der Tiere oder strichen mit den Fingern über ihre langen seidenweichen Hälse.
Nachts verwandelte sich das Clubhaus der Männer in das gesellschaftliche Zentrum des Dorfes. Es war eine längliche Hütte aus Bambus und Palmstroh, mit einem erhöhten Boden aus steinhart getrockneter Erde. Hier wurde das Gamelan, das dem Musikclub der jüngeren Männer des Dorfes gehörte, aufbewahrt. Tagsüber konnte man selten vorbeigehen, ohne aus dem Inneren die leisen Töne von Gongs oder Metallplatten zu hören, wenn irgendein Kind, das im kühlen Dunkel der leeren Hütte saß, für sich allein improvisierte und spielen lernte. Doch nach Einbruch der Dunkelheit war die Hütte ein erleuchtetes Zentrum inmitten des hellen Scheins kleiner Lampen. Draußen hatten die Marktfrauen ihre Tischchen mit Süßigkeiten und Betel aufgestellt, derweil die Clubmitglieder in der Hütte zusammenkamen, um zu üben. Jetzt war es Zeit, die Musikstücke durchzunehmen, die sie bereits kannten, rein um des Vergnügens willen, oder die schwierigen Teile einer neuen Komposition zu erarbeiten, die sie gerade einstudierten. Sie verwendeten keine Noten (es schien tatsächlich keine zu geben), jede Phrase der Melodie, jedes noch so komplizierte Detail der Begleitung hatten sie nach dem Gehör gelernt, indem sie aufmerksam und mit unendlicher Geduld dem Lehrer folgten, der unter Umständen aus einem anderen Dorf herbeigerufen worden war. Sie spielten bis tief in der Nacht. Von meinem Haus aus konnte ich hören, wie sie Satz um Satz durchgingen, korrigierten, verbesserten, bis die Musik wie von selbst zu fließen begann. Beim Einschlafen hatte ich die klingenden Töne im Ohr, und im Schlaf hörte ich sie noch immer, sah sie vielmehr, denn sie schienen sich nun in einen schimmernden Silberregen verwandelt zu haben.
Nyoman Kaler
Ein balinesisches Dorf ist unterteilt in Viertel oder Banjars. Jedes hat seinen eigenen Vorsteher, seinen Priester, sein besonderes Gemeinschaftsleben. Manchmal ist das Dorf friedlich, mit ausgeglichenen Beziehungen zwischen allen Banjars, aber oft (so sollte ich herausfinden) herrschen Verbitterung und Rivalität zwischen angrenzenden Vierteln, vor allem unter Jugendlichen und jüngeren Männern. Eines Abends, kurz nach meiner Ankunft im Dorf, erhielt ich Besuch vom Vorsteher meines eigenen Banjar.
In der Abenddämmerung saß ich auf der Veranda und unterhielt mich mit Sarda, als ich Schritte auf dem Kies hörte. Ich spähte hinaus und sah, wie sich drei Gestalten in einer Reihe durch die Bäume näherten. Der Anführer hatte einen seltsamen Gang. Er schien zu trudeln, denn obwohl er vorwärtsging, neigte sich sein Körper auf die rechte Seite, während sein Kopf etwas nach links kippte. Es sah aus, als wäre er im Begriff, in alle Richtungen loszugehen.
Aber in der Art, wie er die zwei Stufen zur Veranda heraufkam und sich neben meinem Stuhl auf den Boden setzte, lag unverkennbar Autorität. Seine zwei jungen Begleiter nahmen ehrerbietig auf der unteren Stufe Platz.
Sarda stellte ihn vor.
»Das ist Nyoman Kaler, Vorsteher des Banjar und Lehrer der Legong-Tänzerinnen.«
Er trug eine eng anliegende weiße Jacke im Kolonialstil mit Messingknöpfen bis zum Hals; ein abgetragener Sarong und ein straff geknotetes Kopftuch vervollständigten seine Kleidung. Er verneigte sich höflich, bevor er sprach: »Tuan ist eben angekommen? Es heißt, Tuan stammt aus Amerika.«
Er redete mit angenehmer freundlicher Stimme. Er war ein schmächtiger Mann um die dreißig, mit intelligenten Augen und einem lächelnden, wohlgeformten Mund, der sinnlich und gleichzeitig ein wenig spöttisch war. Auch wirkte er etwas kleinlich, etwas Vogelhaftes lag in der Art, wie er beim Sprechen den Kopf erst auf die eine, dann auf die andere Seite neigte.
Die Knaben saßen sehr ruhig und schweigend da, die Hände im Schoß gefaltet. Der ältere hatte die Züge von Nyoman Kaler, doch sein Gesicht strahlte nur Heiterkeit aus. Eine kleine weiße Blumenknospe, den Stängel an einem Haar befestigt, hing über die Mitte seiner Stirn.
»Tuan ist vielleicht gekommen, um Bilder zu malen?« Mein Besucher kam direkt zur Sache.
Ich erklärte ihm, dass ich ein Musiker sei, dass ich Musik komponiere und nur hergekommen sei, um balinesische Musik zu hören. Ich sagte ihm, dass ich mehrere Monate zu bleiben gedenke. Es mache mich glücklich zu erfahren, dass er Musiker sei wie ich selbst, und ich hoffe, er würde mein Haus oft besuchen.
»Ja«, antwortete er, »gerne!« Und falls er mir nützlich sein könne, solle ich nur fragen.
Nach kurzer Zeit bat er höflich um die Erlaubnis zu gehen. Alle drei verneigten sich, standen auf und traten in die Dunkelheit hinaus.
»Er ist ein kluger Mann«, bemerkte Sarda, nachdem sie fort waren. »Er versteht viel, nicht nur von Musik und Tanz.«
Gusti äußerte sich weniger begeistert. »Es heißt, er könne sich in einen Leyak verwandeln.«
Was bedeutet das?
Er zögerte, senkte die Stimme.
»Er versteht es, sich in einen Affen oder einen Feuerball zu verwandeln.«
»Der Junge mit der Blume im Haar, wer war das?«
»Sein Neffe, Made Tantra.«
Zwei Tage später machte Nyoman Kaler erneut seine Aufwartung. Diesmal kam er allein, mitten am Vormittag, und die Zeit verging mit der angenehmsten Unterhaltung. Als wir da saßen, rauchten und Kaffee tranken, begann ich, ihn über die Musik im Dorf auszufragen.





























