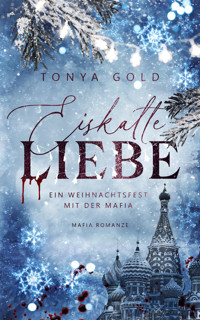2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Schlechte Entscheidungen, machen gute Geschichten." Eigentlich hatte Francesca nur nett sein und den kleinen Jungen vom Buchladen nach Hause bringen wollen. Was sie nicht wusste: Dieser ist der jüngste Sohn des mächtigen Mafiabosses in Cardiff. Vito Mancini macht Francesca sogleich zum Kindermädchen für Santiano. Nur ungern beugt sie sich dem Willen ihres neuen Chefs und kämpft fortan mit Geschehnissen, die sie drohen, zu zerstören. Wird der Mafiaboss über die kriminelle Vergangenheit ihres Bruders erfahren und ihn für seine Zwecke missbrauchen? Dass sie fortlaufend mit Santianos großem Bruder Marcello aneinandergerät, treibt sie zusätzlich in den Wahnsinn. Dieser lässt sie jede Sekunde spüren, dass sie ihm unterlegen ist – und trotzdem lässt er die Schmetterlinge in ihrem Bauch wild tanzen. Zu allem Übel führt Donatello Catalano, jener Erzfeind der Familie, seinen ersten Schlag gegen Vito Mancini aus. Auf einmal befindet sich Francesca nicht nur inmitten einer alten Mafiafehde, sondern auch in verzweifelter Sorge um ihren kleinen Bruder und ihre widersprüchlichen Gefühle zu Marcello.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ein Herz aus Asche und Staub
KINDERMÄDCHEN BEIM MAFIABOSS
TONYA GOLD
Inhalt
Ohne Titel
Wichtiger Hinweis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Danksagung
Über die Autorin
Tonya Gold
Ein Herz aus Asche und Staub
-
Kindermädchen beim Mafiaboss
Ein Herz aus Asche und Staub
Kindermädchen beim Mafiaboss
©Tonya Gold, 2024, Deutschland
Lektorat und Korrektorat: Aurora Flemming
Covergestaltung: Schattmaier Design
Bildmaterial: Shutterstock.com, Tonya Gold Privataufnahmen
Innendesign und Illustrationen: Tonya Gold
Buchsatz Taschenbuch und gebundenes Buch: Tonya Gold
E-Book Buchsatz: Falkenfederdesign
ISBN: 978-3-75923-790-3
Alle Rechte vorbehalten
Antonia Gebhardt
Heegermühler Weg 5
13156 Berlin
Instagram: @tonya_gold_autorin
~
Für alle, die sich nicht entscheiden können, ob sie dem Licht hinterherjagen oder mit der Dunkelheit tanzen sollten ...
Die Dämmerung ist auch noch da.
~
Wichtiger Hinweis
Interessant, dass du hier bist. Wieso? Das musst du selbst herausfinden …
Allerdings hättest du dieses Buch nicht aufgeschlagen, wenn dich nicht dieses Genre oder das Cover ansprechen würden. Aber auch für dich hier ein Wort der Warnung: Dieses Buch ist nichts für sensible oder zartbesaitete Gemüter.
Vielleicht ist das nicht dein erster Roman in diesem Genre – oder du bist genauso neu auf den dunklen Seiten der Welt wie ich. Andernfalls wurdest du dazu gezwungen, hier zu sein? Ebenfalls wie ich?
Egal, warum du hier bist, glaub mir, ich wäre all diesen kriminellen Männern, die du in diesem Buch kennenlernen wirst, liebend gern nicht begegnet. Ich hätte mit der größten Freude auf all diese chaotischen Gefühle, mit den unendlichen Achterbahnfahrten und den tiefschwarzen Abgründen verzichtet, die die menschliche Seele so wundervoll verborgen hält und die dennoch existieren! All das Schlechte im Menschen, unter dem sich das Gute verbergen kann.
Wenn du allerdings nichts gegen eine ernsthafte Konfrontation mit sensiblen Themen wie Depression, Dominanz, Drogenmissbrauch, Gewalt, Kriminalität, Mobbing, dem organisierten Verbrechen, Selbstheilungsprozessen und Suizid hast, dann bist du hier richtig. Falls dich außerdem derbe Sprache und expliziten Szenen nicht stören und dich dabei auch Erkrankungen und der Tod eines Elternteils nicht davon abhalten können, weiterzulesen, dann ist dieses Buch ebenso etwas für dich.
Sollten dir diese ersten Sätze und der Ton auf den ersten Seiten hingegen schon zu nahe gehen, rate ich dir, das Buch zu schließen; denn jetzt hast du noch die Möglichkeit dazu.
Blätterst du allerdings um … na ja … sagen wir, dann ist das Schicksal deines Lebens nicht mehr deines. Männer wie Marcello Mancini stehen darauf, es sich unter den Nagel zu reißen und dich machen zu lassen, was sie für richtig halten, während sie dir den Himmel und die Hölle gleichermaßen versprechen.
Also … übernimm Verantwortung für dich und dein Leben. Und entscheide: blätterst du um oder nicht?
Ach so, … darum wird es auch gehen: Verantwortung.
Ich sehnte mich nach blauem Himmel.
Nach Sonnenschein.
Wolkenloser Weite.
Strahlendem Blau.
Wie oft ich diesen Satz gerade heute wiederholt hatte, wusste ich nicht. Es war ein bisschen wie mein persönliches Mantra, das für mehr stand als nur einen Wetterzustand. Es symbolisierte für mich den optimalen Zustand von individueller Freiheit und Autonomie.
Als ich jedoch meinen Kopf hob und die Wolken über mir betrachtete, erschienen sie mir eher wie das Spiegelbild meines Lebens; grau und irgendwie zum Wegrennen. Wer mochte da schon gern bei solcher Aussicht verweilen?
Ich starrte hinauf, atmete tief ein und schloss die Augen. Zum hundertsten Mal fragte ich mich, warum ich mir von allen englischsprachigen Orten ausgerechnet England ausgesucht hatte.
Ausgesucht oder mich selbst dazu gezwungen, es als Alternative anzusehen, weil ich nicht loslassen kann?
Ich hätte es schließlich warm und angenehm in West- oder Südamerika haben oder abgeschottet in Neuseeland leben können. Stattdessen war ich nach Wales gezogen; Wales, das nahe an Deutschland lag, weil ich doch nicht vollkommen mit allem hatte abschließen können. Mein Zuhause zu verlassen und auszuwandern, um die Wunden heilen lassen zu können, war das eine gewesen. Den einzigen Menschen jedoch für immer zurückzulassen, der mir von diesem Zuhause noch geblieben war, war etwas anderes. Und das konnte ich anscheinend noch nicht. Und genau deswegen war ich nicht in Amerika oder Neuseeland, sondern hier in England. Weil ich es nicht lassen konnte, mich auch weiterhin um ihn zu sorgen; obwohl er deutlich gemacht hatte, dass ich für ihn das Allerletzte war.
Ein verbittertes Lachen drang aus meiner Kehle und zwischen meine Lippen hindurch. Erneut quälte mich diese Zerrissenheit. Ein Zwiespalt, bei dem ich nicht wusste, ob ich doch wieder nach Hause zurückkehren oder meinen Neuanfang endlich bewusst leben sollte.
Welches Zuhause?
Ich zuckte bei meinen eigenen, spöttischen Gedanken zusammen, bevor ich schwer schlucken musste; weil es dort keinen Zufluchtsort mehr gab. Mein neues Heim sollte jetzt hier sein – Cardiff –, doch meine fruchtlosen Versuche, mich von meinen alten, halbtoten Wurzeln zu lösen, war schwerer, als ich es für möglich gehalten hatte. Scheiße! Ich wollte glücklich sein! Und nicht immer über meine Vergangenheit nachdenken. Ich hatte mir geschworen, nur noch Licht und Liebe in mein Leben zu lassen. War das nicht der eine riesige Pluspunkt? Dass England nahe an Deutschland lag? Ja – und der fette Minuspunkt war das ständig trüb-nasse, traurige Wetter, wovon ich befürchte, immer antriebsloser zu werden.
Mensch! Was war denn nur falsch mit mir? Wieso konnte ich denn nur das Schlechte sehen? Ich hatte genügend Trauer erlebt und sehnte mich nach einem Tag mit strahlend blauem Himmel und hellem, freundlichem Sonnenschein. Einen Tag voller unbeschwerter Freude. Nur einen einzigen – wo ich machen konnte, was ich wollte. Ohne Verantwortung. Ohne Verpflichtungen, außer mir selbst gegenüber! Aber bis dahin musste ich noch warten.
Ausharren und Abwarten.
Abwarten und Ausharren.
Blauen Himmel. Ich wünsche mir nur blauen Himmel.
Ich seufzte leise, als ich bemerkte, dass ich die zweite grüne Ampel verpasst hatte. Ich stand bereits seit genau viereinhalb Minuten auf dem Bürgersteig zur Queen Street und starrte in den Himmel.
Toll Francesca. Wirklich toll. Du hast auch sonst nach dem Feierabend nichts zu tun …
Verärgert über mein erneutes miesepetriges Denken, rieb ich mir über die Stirn und zwang mich zur Konzentration. Vor mir lag die Queen’s Arcade, während sich neben mir die Menschenmassen vorbeischoben, die anscheinend genauso wie ich nach dem Feierabend bummeln gehen wollten.
Und obwohl ich eigentlich viel zu müde war, hatte ich mich gezwungen, heute rauszugehen. Ich wollte mir nach der Arbeit einen schönen Nachmittag machen und nicht bereits um acht im Bett liegen, weil ich vor Langeweile ganz schläfrig wurde. Schließlich gab es an diesem Tag etwas zu feiern: mein bestandenes Probehalbjahr im Kindergarten. Und dafür hatte ich beschlossen, einen Ort aufzusuchen, wo viele Menschen waren und ich einige Einkaufsmöglichkeiten hätte – genauso, wie ich es aus meiner Kindheit kannte. Als Kinder waren wir mit Mama und manchmal auch mit Papa bummeln gegangen, wo wir uns zu dritt oder zu viert einen schönen Nachmittag gemacht hatten. Einige der wenigen sorgenlosen Momente.
Ich atmete tief durch, nickte mir dann selbst zu und fokussierte meinen Blick. Ich wollte heute Nachmittag Spaß haben. Mit diesem Gedanken folgte ich den restlichen Massen in die Arkaden, ließ mich für eine Weile von den Menschen an den Geschäften vorbeitreiben. Ich schlenderte durch die vollen Hallen und Läden, stoppte mal hier, mal dort; fand jedoch nichts, was meine Aufmerksamkeit erregte oder mir ansatzweise Freude bereitete. Außerdem halten die lauten Schritte der Leute auf dem Marmorboden in meinen Ohren wider, während ich ständig angerempelt wurde. Seufzend blieb ich stehen und rieb mir über meine Nasenwurzel. Nein, das hier war nichts, was mir Freude bereitete. Es war, um ehrlich zu sein, die reinste Hölle. Am liebsten wäre ich woanders hingegangen, doch ich kannte mich noch nicht gut in Cardiff aus. Ich lebte seit einem halben Jahr hier und hatte es fürs Erste wichtiger empfunden, mir eine vernünftige Wohnung und eine neue Arbeitsstelle zu suchen, bevor ich bummelnd und tingelnd die Hafenstadt erkundete. Deswegen hatte ich mir nur ein wenig die Touristenattraktionen angeschaut und den Rest auf später verschoben. Jetzt wünschte ich, ich hätte mir doch früher Zeit dafür genommen.
Nein, ich wünsche mir, erst gar nicht in die Arkaden gegangen zu sein. Weil es mich frustriert. Weil es mich an die letzten drei glücklichen Augenblicke mit ihm erinnert! An meine Kindheit.
Doch statt fluchtartig die Hallen zu verlassen, blieb ich weiterhin stehen und holte mein Handy wie automatisch aus meiner Gesäßtasche. Mit angespannter Erwartung schaute ich auf den aufleuchtenden Bildschirm und hielt die Luft an – doch nichts war auf dem Bildschirm zu sehen. Kein Anruf. Keine Nachricht.
Natürlich. Was hatte ich auch erwartet?
Ich stieß die Luft aus, versuchte die aufkeimende Enttäuschung zu verdrängen, bevor ich plötzlich nach vorn stolperte. Ein Kerl hatte mich im Vorbeigehen angerempelt und besaß die Frechheit, sich gereizt zu mir umzudrehen und mir einen Vogel zu zeigen.
Was? So ein …
Verärgert rieb ich mir meinen Arm und schaute wieder auf mein Handy, das mir immer noch einen leeren Bildschirm anzeigte. Verdammt! Was erwartete ich? Auch wenn die Hoffnung zuletzt starb, – er hatte gesagt, dass er sich nicht melden würde! Wieso wartete ich dann immer noch darauf?
Ich atmete einmal tief ein und steckte das Handy frustriert wieder weg. Vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an ihm nehmen. Einfach mein Leben leben und mich um mich selbst kümmern, dann würde ich garantiert leichter vorankommen – eventuell. Ich wischte mir einmal übers Gesicht und drehte mich kurz. Nein, ich wollte hier weg. Hier zu sein bereitete mir keine Freude. Es weckte eher traurige Erinnerungen und ließ mich schwermütig werden.
Entschlossen drehte ich mich um, verließ die Arkaden auf dem schnellsten Weg und wandte mich, einer Intuition folgend, nach rechts. Von Weitem konnte ich schon das grüne Schild mit der abgeblätterten Farbe und der goldenen Schrift erkennen. Darauf zueilend, stieß ich die Ladentür mit einem beherzten Schwung auf und atmete tief durch, während das Glöckchen über mir bimmelte.
Ja – das hier ist besser! Mit weniger Gedanken an ihn behaftet. Dafür mit neuen Erinnerungen von mir behangen.
Wieso ich vorhin nicht hierhergekommen war, wusste ich selbst nicht. Ich liebte diesen Laden seit dem Augenblick, als ich ihn vor einigen Wochen zufällig entdeckt hatte. Aber irgendwie schien ich ganz automatisch Orte aus meiner Kindheit aufzusuchen, die mich an ihn und meine Familie erinnerten. Ich verzog das Gesicht und schüttelte den Gedanken ab. Mit einem leisen Seufzer trat ich weiter in den Buchladen. Ich atmete den Duft des gebundenen Papiers tief ein, der in der Luft lag und der mir schon seit meiner Kindheit Halt gab und mein Herz aufgeregt flattern ließ. Auch wenn ich mich als Kind immer dafür geschämt hatte, vor der eigenen Familie flüchten zu wollen, hatte ich meine innere Ruhe nur zwischen den Worten dieser bedruckten, geleimten Seiten finden können. Sie hatten mir das Eintauchen in fremde Welten so einfach und vertraut gemacht, dass mir die Realität wie ein ferner Traum vorgekommen war. Die liebste Zeit war mir die gewesen, wo ich stundenlang unter der Decke hatte liegen können, um in den tollkühnsten Abenteuern zu versinken und Drachen erschlagen zu dürfen. Und so änderten sich manche Dinge nie; denn heute kam mir ein Buchladen immer noch wie ein blauer Himmel vor, in dem ich meinen Frieden und eine gewisse Freiheit finden konnte.
Zum ersten Mal an diesem Tag zauberte sich ein echtes Lächeln auf meine Lippen. Ich hatte mein Probehalbjahr bestanden. Und war in einem kleinen Buchladen.
Ich beschloss, mir zur Feier des Tages ein oder zwei Bücher zu kaufen und lief den ersten Gang entlang. Geradewegs marschierte ich an Kochbüchern und anderen Haushaltstipps und -ideen vorbei und lief in die Abteilung mit den Liebesromanen, wo ich nach etwas Dunklerem für meine Seele suchte. Etwas, was mir süß und heiß prickelnd den Rücken hinunterlaufen würde oder mich in Welten voller Spaß, Ungezwungenheit und eventueller Kriminalität entführte. Denn ja – manchmal war süße, rosarote Zuckerwatte eine wunderbare Ablenkung von der harten Realität; aber heute wollte ich verboten heiße Mafiosi dabei erwischen, wie sie ihren illegalen Geschäften nachgingen.
Ich blätterte eine Weile durch verschiedene Romane und entschied mich für zwei Bücher, mit aufwendig gestalteten Umschlägen. Einer von ihnen zeigte Blüten mit Munition und Waffen, die halb hinter der Titelei verborgen lagen. Die Klappentexte wirkten ebenfalls vielversprechend und ich klemmte mir beide Exemplare unter den Arm. Ich schaute mich noch einmal im Laden um und ließ meinen Blick über die anderen Besucher des Ladens gleiten, dabei fiel mir ein kleiner Junge auf, der allein vor einem Regal stand. Er blätterte mit leuchtenden Augen durch ein Buch, was mich schmunzeln ließ. Ein glücklicher kleiner Mensch, der sich in den Seiten mit den vielen Buchstaben und Bildern verlieren konnte, um für ein paar Minuten neue Welten zu erkunden, war leider so selten geworden.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf das Regal vor mir, blätterte noch durch einige weitere Romane, bevor ich weiter in die Kinderbuchabteilung schlenderte. Ich liebte Märchen und war immer wieder auf der Suche nach neuen Geschichten für junge Leser, die ich dann im Kindergarten vorlesen konnte.
Ich betrachtete einige der bunt gestalteten Cover und nahm eines in die Hand, während ich registrierte, dass der kleine Junge immer noch allein vor der Bücherwand stand. Ich musterte ihn genauer und schätzte ihn auf vielleicht fünf Jahre. Während ich mich erneut im Laden umschaute, fragte ich mich, wann wohl seine Eltern auftauchen würden. Schließlich stand ich seit mindestens zwanzig Minuten hier; und der Kleine schaute sich immer noch ungerührt die Bücher an, ohne auch nur Ausschau nach seinen Eltern zu halten. Ich runzelte die Stirn, wartete noch einen Moment, bevor ich den Kopf schüttelte und das Buch zurück ins Regal stellte, das ich mir angeschaut hatte. Wahrscheinlich machte ich mir schon wieder zu viele Gedanken um etwas, das mich gar nichts anging. Die Eltern des Jungen waren mit Sicherheit genauso vertieft in ihre Bücher wie ihr Sohn und hatten bestimmt nur die Zeit aus den Augen verloren.
Kümmere dich um dich selbst!
Ich suchte mir noch zwei weitere Märchenbücher und ein Kinderbuch aus, bevor ich mit meiner Ausbeute zur Kasse losgehen wollte. Ich schaute mich jedoch noch einmal zu dem kleinen Jungen um und entdeckte ihn jetzt vor einem Regal mit Weltliteratur. Er betrachtete mit schief gelegtem Kopf die Romane vor sich, wozu er langsam mit dem Finger über einige Buchrücken strich und die Lippen dazu bewegte, als würde er sich die Titel leise selbst vorlesen.
Soll ich ihn ansprechen? Fragen, wo seine Eltern sind? Nein! Ich sollte mich nicht in Dinge einmischen, die mich nichts angehen. Lauf zur Kasse! LOS!
Ich schüttelte erneut den Kopf und schaute auf meine eigenen Bücher, während ich begann, die Summe zu überschlagend.
34,20 £ … 50,40 £ … 68,64 £ …
„Entschuldigen Sie, Miss?“ Ich zuckte zusammen und sah zur Seite. Der Junge stand auf einmal vor mir und sah mich bittend an. „Könnten Sie mir das Buch dort runterreichen?“
Für einen Moment betrachtete ich ihn überraschend schweigend. „Äh, wie bitte?“
„Können Sie mir das Buch dort runterreichen?“
Ich folgte seinem ausgestreckten, kleinen Finger und folgte ihm dann zum Bücherregal. Er klang so förmlich … ungewöhnlich für ein Kinds.
„Meinst du das hier? Die Abenteuer des Tom Sawyer?“, fragte ich und deutete auf ein Taschenbuch mit blau-gelben Verzierungen auf dem Umschlag.
„Ja, genau.“
„Aber warum nimmst du nicht lieber das Buch dort hinten mit den vielen Illustrationen zu der Geschichte? Ich wette, das würdest du eindeutig schöner finden!“
„Oh, welches denn?“ Aufgeregt schaute der Kleine sich die Reihen mit den Büchern an und versuchte herauszufinden, welches ich wohl meinte. Ich grinste breit und reichte ihm das gebundene Buch hinunter. Auch dieses war eine Ausgabe von Mark Twains Klassiker, doch es war eindeutig besser geeignet für Kinder.
„Oh! Das ist aber schön. Danke.“
„Hast du denn genügend Geld dabei?“
„Nein. Aber das bezahlt mein Papo.“
„Und wo ist dein … äh Papo, wenn ich fragen darf?“ War der Kleine Italiener?
„Der ist zu Hause. Aber wenn ich da jetzt anrufe, kommt bestimmt gleich jemand und holt mich ab, und dann kann ich mir nicht mehr all diese schönen Bücher anschauen.“
Ich stockte und runzelte die Stirn.
Moment mal …
„Du hast ein eigenes Handy?“
„Nein. Aber ich könnte nach vorn zur Kasse gehen und von da anrufen.“
„Du kannst nach vorn zur Kasse gehen?“, echote ich und starrte den Kleinen immer verwirrter an. War es hier so üblich, dass man einfach zu einer Verkäuferin gehen konnte, um bei sich zu Hause anzurufen?
„Und wie willst du dein Buch dann bezahlen?“
„Anschreiben“, erklärte er und das Wort hörte sich fremd aus seinem Kindermund an.
„Und deine Mama?“, hakte ich vorsichtig nach.
„Die ist auch zu Hause.“
„Und … mit wem bist du dann hier?“
„Mit niemanden.“
Er ist allein hier?
Ich blickte mich schnell im Laden um, ob ich doch jemanden sehen oder bemerken würde, dem der kleine Junge vielleicht gehörte. Aber da war niemand – absolut niemand.
Langsam drehte ich mich wieder zu ihm zurück und kniete mich vor ihn. „Hey. Was hältst du davon, wenn ich dir das Buch kaufe und dich dann nach Hause bringe? Verrätst du mir, wie du heißt und wo du wohnst?“ Ich kam mir zwar plötzlich wie eine Entführerin vor, aber wenn seine Eltern zu Hause waren, hatte er niemanden, der auf ihn aufpasste.
„Mein Name ist Santiano Mancini und ich wohne in der Bellford Road eins, in Michaelstorn. Ist von hier fünfzehn Minuten mit dem Auto. Hab’ auf die Uhr geschaut und genau aufgepasst. Ich kann nämlich schon die Uhr lesen!“ Erwartungsvoll schaute er mich an.
„Aha“, erwiderte ich zögerlich und versuchte, meine kontroversen Eindrücke vor ihm zu verbergen. „Santiano ist ein wirklich schöner Name!“, erwiderte ich dann freundlicher. Außerdem, wie war er hierhergekommen, wenn man mit dem Auto fünfzehn Minuten nach Cardiff brauchte? Er war doch hoffentlich nicht gelaufen? Und wie konnten seine Eltern nicht bemerken, dass er weg war? Oder hatten sie es schon bemerkt und suchten nach ihm? Und wieso schaute er mich so gespannt an, als würde er fast schon voraussetzen, dass ich seinen Namen kannte? War er ein Junge aus dem Kindergarten?
„Kaufst du mir das Buch wirklich?“, riss Santiano mich aus meinen Gedanken und wirkte in diesem Moment wieder wie der kleine Junge vor dem Bücherregal.
„Ja“, erwiderte ich zaghaft lächelnd, bevor ich ihm das schwere Buch aus den kleinen Händen nahm. Ich runzelte die Stirn und mich überkam ein ungutes Gefühl – als würde hier irgendetwas nicht stimmen, ganz und gar nicht; und damit meinte ich nicht nur, dass ein fünfjähriger alleine in einem Buchladen war. Allerdings schob ich es schnell wieder weg. „Aber bevor wir zur Kasse gehen, muss ich noch ein paar Bücher wegbringen, in Ordnung? Für alle zusammen wird das Geld nicht reichen …“
„Ja.“
Er nickte eifrig und strahlte mich an. Dennoch verstärkte sich das ungute Gefühl in mir. Es bildete sich ein Knoten in meinem Magen und ein leicht pikendes Kribbeln überfiel meinen Körper. Wie war er allein nach Cardiff gekommen?
„Santiano? Das klingt italienisch.“
„Ist es auch! Ich bin ein echter Italiener!“
Er klang so stolz dabei, als hätte er mir gerade erklärt, dass er den Mount Everest erklommen hätte, was mich laut lachen ließ.
„Ach was!“, stieß ich schmunzelnd aus und legte den Kopf schief, bevor ich wieder ernst wurde. „Und sag mal, Santiano … warum bist du eigentlich von zu Hause weggelaufen?“
„Oh, ich bin nicht von zu Hause weggelaufen!“
„Ach nein?“
„Nein. Ich bin nur vor meinem Kindermädchen davongelaufen. So eine blöde Kuh. Sagt mir immer, was ich zu tun habe.“
Ich zog skeptisch die Augenbrauen hoch und betrachtete dabei die beiden Märchenbücher in meinem Arm. Eines davon musste daran glauben. „Papo wird sie bereits gefeuert haben“, redete er unbekümmert weiter, während er mich so breit angrinste, als hätte er mir gerade verkündet, einen wertvollen Schatz gefunden zu haben.
Wie bitte?
„Warum glaubst du, dass dein Papa ihr jetzt schon gekündigt hat? Bist du etwa mit Absicht weggelaufen?“ Ich hoffte, dass meine voreiligen Vermutungen genau das waren – voreilig getroffen. Doch Santiano sah nicht so aus, als würde ich falsch liegen. Er grinste noch immer und ich wusste, dass ich voll ins Schwarze getroffen hatte. „Das ist aber überhaupt nicht nett. Da hast du sie doch in eine schreckliche Lage gebracht!“ Ungläubig starrte ich ihn an. Er zuckte jedoch nur mit den Schultern, als wäre ihm das vollkommen gleich.
„Ja, ich bin mit Absicht weggelaufen! Papo hat gesagt, wenn ich noch mal weglaufe, wird sie gekündigt.“ Erneut klang er wieder so unfassbar gestelzt. Als würde er die Worte eines Erwachsenen benutzten; in diesem Fall anscheinend die seines Vaters. „Und außerdem ist mir das egal. Sie war total gemein zu mir. Hat mich ständig herumkommandiert und ich musste immer diese blöden Fliegen tragen, obwohl sie wusste, dass die mir immer am Kinn kratzen. Und manchmal habe ich auch einen Klaps auf den Po bekommen, nur weil ich nicht das getan habe, was sie wollte.“
„Santiano! Das …“ Mir fehlten die Worte. Ein Kind, das weglief, um sein Kindermädchen in Schwierigkeiten zu bringen, war ganz sicher kein Unschuldslamm; aber ihm einen Klaps zugeben, war auch nicht richtig. Und außerdem … befürchtete er gar nicht, Ärger von seinem Vater zu bekommen?
„Das war nicht in Ordnung, Santiano! Wegzulaufen und andere in Schwierigkeiten zu bringen ist … ist … das macht man nicht! Und ist sehr, sehr gemein. Außerdem machen sich deine Eltern doch bestimmt Sorgen um dich!“
„Ja … nein. Weiß ich nicht …“ Lief er etwa nur weg, um das Interesse seines Vaters zu bekommen?
Kinder taten oft dumme, gemeine Sachen, um die Aufmerksamkeit derjenigen zu erlangen, nach der sie sich am meisten sehnten. Allerdings waren Kinder auch nur so grausam wie ihre Eltern und entweder hatte Santianos Vater keine Zeit für ihn oder er interessierte sich nicht für ihn, was wiederrum sein Verhalten erklären würde. Dass ein solch junger Mensch bereits so berechnend sein konnte, zeugte entweder von einem sehr schlechten Umfeld oder sehr schlechten Vorbildern. „Aber komm. Wir gehen jetzt zur Kasse und dann fahren wir zu dir nach Hause.“ Es war besser, wenn wir solche Themen nicht in einem Buchladen besprachen. Außerdem sah er kurz so aus, als würde er sich umdrehen und weglaufen wollen.
„Können wir davor noch etwas essen?“, fragte er und schien mit sich zu hadern. Anscheinend wollte er zwar mit mir mitkommen, gleichzeitig schien ihm überhaupt nicht zu gefallen, was ich gerade gesagt hatte. „Papo und Mammina haben bestimmt schon Abendbrot gegessen und heute ist Versammlung, da ist immer so viel los.“ Erneut hörte er sich wie ein kleiner Erwachsener an, was mich innerlich erschaudern ließ.
„Versammlung? Ja … das hört sich wichtig an.“ In meinem Kopf bildeten sich immer mehr Fragezeichen. Wer war der Kleine? Oder eher – wer war sein Vater? Als hätte er meinen Gedanken gehört, meinte er: „Mhh … Papo ist einer der mächtigsten und wichtigsten Männer im Land!“
„Aha“, machte ich und presste die Lippen zusammen. War sein Vater womöglich ein Gouverneur? Gab es so etwas in England? Oder ein Politiker?
„Wir müssen uns aber beeilen! Es ist ja schon sechs Uhr und du musst doch bestimmt gleich ins Bett, oder?“
„Ja. Eigentlich schon.“
„Dann los. Was magst du denn essen?“
„Können wir zu McDonalds gehen? Zu Hause gibt es immer so ekliges Zeug wie Brokkoli.“ Jetzt musste ich doch wieder glucksend lachen und schüttelte den Kopf. Das Gesicht, das er dabei verzog, war einfach zu komisch. „Bei McDonalds gibt es nur zusammengepanschte Sachen. Ich kenne ein tolles Bistro, da gibt es auch Burger und Pommes und die sind so viel besser! Ist gleich hier um die Ecke, aber jetzt bezahlen wir erst einmal.“
Wir liefen gemeinsam zur Kasse und ich legte unsere Bücher auf den Verkaufstresen. Danach verließen wir den Laden.
„Hast du ein Auto?“, fragte er mich draußen und sah sich erwartungsvoll um.
„Nein.“
„Und wie willst du mich dann nach Hause bringen?“
„Taxi?“, fragte ich nur und das leise, verzweifelte Fragezeichen am Ende des Satzes war viel zu deutlich zu hören. Ich hoffte inständig, dass ich noch genügend Geld auf meinem Konto hatte, um das Essen und die Fahrt zu bezahlen. „Komm. Wir gehen hier lang“, lenkte ich schnell ab. „Auf dem Weg zum Bistro kannst du dir schon mal überlegen, was du essen willst!“
„Oh, ich weiß. Nuggets! Mit viel Pommes. Oder nein! Einen Burger! Und Pommes! Und Nuggets!“
„Und welchen Burger?“
„Ähm …“ Er legte den Kopf schief, während ich meine Hand ausstreckte, die er wie selbstverständlich nahm. „Ich glaube, ich nehme einen Cheeseburger. Und du?“
„Ich nehme … auch Nuggets und Pommes. Und ich denke … einen Hähnchenburger.“
„Toll.“ Er grinste mich breit an und die ersten Straßenlaternen gingen schon an.
„Sag mal, Santiano, willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich würde gern bei dir zu Hause anrufen.“
„Ja. Hast du einen Stift und Zettel?
„Habe ich.“ Ich blieb kurz stehen und holte das zusammengefaltete Stück Papier aus meiner Hosentasche heraus, auf dem ich noch vorhin etwas notiert hatte. Dazu hatte ich anscheint aus Versehen den Stift mit eingesteckt, denn dieser befand sich auch noch in meiner Hosentasche, wie ich jetzt feststellte. „Danke. Dann rufe ich da gleich an, ja?“ fragte ich unsicher, nachdem er mir die Nummer genannt hatte.
„Klar. Wenn du willst.“ Er zuckte nur die Schultern. Wir traten in den Laden und ich gab unsere Bestellung auf, bevor wir uns setzten und auf das Essen warteten. Ich betrachtete ihn und wunderte mich über die Gleichgültigkeit, mit der er die ganze Situation handhabte; als würde er nicht einmal Ärger oder etwas Ähnliches erwarten.
Ob es seine Eltern interessiert, dass ich ihn gefunden habe?
Mir kam das alles immer merkwürdiger vor. Ein Junge, der weglief, um die Aufmerksamkeit seines Vaters zu erlangen. Mit Absicht sein Kindermädchen in Schwierigkeiten brachte, und wie ein Erwachsener sprach.
„Ich schlage vor, du liest ein wenig in deinem Buch und ich komme gleich wieder“, riss ich mich aus meinen Bedenken. Ich würde erst Antworten bekommen, wenn ich dieses Telefonat führen würde! „Ich stehe dort.“ Ich zeigte auf eine Säule, fünf Schritte von unserem Tisch entfernt. Er nickte und holte sein neues Buch aus meiner Tasche und blätterte begierig die ersten Seiten um. Ich achtete noch darauf, dass er sich vorsichtshalber eine Servierte in den Kragen seines teuer aussehenden Pullovers klemmte – falls das Essen doch schon kommen sollte –, stand auf und fischte aus meiner Jeans den Zettel mit der Telefonnummer. Ich nahm mein Handy, tippte die Nummer ein und hielt es mir abwartend ans Ohr.
Mein Herz begann mit jedem Klingeln schneller zu schlagen. Ich hasste telefonieren. Soweit es möglich war, schrieb ich mir unbekannten Leuten immer eine Nachricht oder Mail, sodass ich mich nicht beim Sprechen vor lauter Aufregung verhaspelte, doch jetzt ging das nicht. In diesem Augenblick musste ich sprechen!
„Villa Mancini. Wie kann ich weiterhelfen?“, glaubte ich zu hören, da ich die Frau ziemlich schlecht verstand. Im Hintergrund waren Rufe zu hören. Sprach man dort auf Italienisch? Auch im Bistro war es laut, weshalb ich mir das andere Ohr zuhielt, um die Person besser hören zu können. Kurz war ich aus dem Konzept gebracht. Was war denn da los? Feierten die eine Party?
„Hi. Abend. Mein Name ist Francesca Alpino“, stotterte ich und schluckte einmal. „Ich habe Santiano Mancini in einem Buchladen gefunden. Ich bin mit ihm gerade bei McTavish etwas essen, weil er meinte, dass Sie heute Abend bei sich eine Versammlung oder so haben“, ratterte ich herunter und hielt dann kurz den Atem an, ehe ich fortfuhr: „Und na ja, weil das Abendbrot schon vorbei ist – sagt er, also Santiano. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich ihn nach dem Essen mit einem Taxi nach Hause bringe.“ Mein Herz raste in meiner Brust, sodass ich das Gefühl hatte, es würde mir gleich hinausspringen. Kurz passierte gar nichts, dann sagte die Frau: „Einen Moment. Ich gebe weiter.“ Ich hörte, wie Stimmen lauter wurden, etwas raschelte und eine zweite Frauenstimme sprach: „Vittoria Mancini.“
„Guten Abend. Mein Name ist Francesca Alpino. Sind Sie Santianos Mutter?“
„Ja.“
„Ich habe Santiano in einem Buchladen gefunden.“
„Gefunden? Was soll das heißen?“ Für diese Erkenntnis klang sie unheimlich ruhig.
„Er hat sich Bücher angeschaut – in einem Buchladen. Da hab’ ich ihn gefunden.“ Mein Gott! Reiß dich zusammen! Auf dem Mond war er mit Sicherheit nicht. Und gefunden hast du ihn auch nicht dort. Also höre auf, dich die ganze Zeit zu wiederholen! „Wollen Sie kurz mit ihm reden? Ich hab’ ihn allein in einem Buchladen in der Nähe der Queen’s Arcarde gefunden.“
Ja, hast du schon zum dritten Mal gesagt! Himmel, wie ich Telefonate verabscheute!
„Santiano ist schon wieder weggelaufen?“
„Ja.“ O Gott! Hatten seine Eltern das etwa gar nicht bemerkt?
„Das … das … um Himmels willen! Und Ms Smith hat uns nicht Bescheid gesagt?“, kreischte Mrs Mancini jetzt. Ich schloss entsetzt die Augen.
„Er ist unversehrt! Alles gut. Er meinte, nun ja …“, ich stockte, weil es mir unangenehm war, ihr das zu sagen. „Er meinte, dass er mit Absicht davongelaufen sei, weil er das Kindermädchen nicht mag.“
Mrs Mancini seufzte. „Ja, das tut er in letzter Zeit häufiger. Vielen Dank, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Kann ich meinen Sohn bitte einmal sprechen?“ Der plötzlich kühlere, resignierte Tonfall irritierte mich.
„Ja, na klar!“ Ich war unterdessen wieder näher an unseren Tisch getreten und hatte ihre Antwort abgewartet. Jetzt hielt ich dem Kleinen mein Handy ans Ohr. Er nahm es und schaute mich genervt dabei an. Ich hörte, wie Santianos Mutter irgendetwas sagte, während er eine Seite seines neuen Buches umblätterte und dabei auf Italienisch murmelnd antwortete. Er sah nicht glücklich aus, aber wirklichen Ärger schien er auch nicht zu bekommen. Dann reichte er mir das Handy zurück und ich hielt es mir probeweise noch mal ans Ohr, doch das Piepen erklärte mir, dass seine Mutter am anderen Ende bereits aufgelegt hatte. Ich runzelte die Stirn und fragte mich plötzlich, in was ich mich da eingemischt hatte. Was waren das denn für Leute? Das ungute Gefühl von vorhin beschlich mich erneut, bevor ich mich langsam setzte und Santiano skeptisch betrachtete. Mir fiel wieder sein erwartungsvoller Ausdruck ein, als er mir seinen Namen genannt hatte. Er hatte geglaubt, dass ich ihn kannte. Hatte fast ein wenig überrascht dreingeschaut, als ich nicht wusste, wer er war. War das nun gut oder schlecht für mich? Ich war mir nicht ganz sicher und ich wusste auch nicht, ob ich es herausfinden wollte.
„Na, da war ja bei dir zu Hause ganz schön was los!“, bemerkte ich und konnte nicht länger mein Misstrauen verbergen.
„Ach ne … das ist normal. Wenn die ganze Familie da ist, ist es viel lauter! Oder wenn Papo sauer ist und alle anschreit.“
Wenn sein Vater alle anschrie? War der Mann Choleriker oder nur ein Geschäftsmann, der eine sehr kurze Geduldsschnur hatte? Ich schluckte die Frage hinunter, die mir auf der Zunge lag. Allmählich war ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Kleinen wirklich nach Hause bringen oder jemals diesen Mann, der sein Vater sein sollte, überhaupt kennenlernen wollte. Er schien nicht freundlich zu sein. Auch wenn ich diese plötzliche Abneigung nicht ganz erklären konnte, wollte ich Santiano dennoch nicht hier allein sitzen lassen. Das wäre nicht richtig. Und außerdem brachte ich ihn ja nur zu seinen Eltern, danach würde ich wieder zurückfahren und mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Ganz einfach, richtig?
Als unser Essen in diesem Moment kam, nahm ich Santiano das Buch aus der Hand und steckte es wieder in meine Tasche.
„Dein Papa scheint ja ein ganz Netter zu sein“, rutschte es mir verspätet auf seine Erklärung hinaus. Innerlich gab ich mir verbal eine Ohrfeige.
„Er ist auch nett. Wirklich! Manchmal …“
Aha.
„Wie heißt du eigentlich?“
„Francesca.“
„Oh! Dann bist du auch Italienerin?“
Ich lächelte müde. „Zu einem Viertel. Meine Oma kam aus Italien und mein Opa war Deutscher. Und da meine Mama zur Hälfte Italienerin war und meinen Papa geheiratet hatte, der auch Deutscher war, bin ich nur noch zu einem kleinen Teil Italienerin.“
„Aha“, erwiderte er und blickte mich mit großen Augen an.
„Warst du schon mal in Italien?“, wollte Santiano weiterwissen.
„Nein, leider noch nicht. Aber ich möchte unbedingt einmal das Dorf besuchen, in dem meine Oma aufwuchs. Warst du denn einmal in Italien?“
„Ja. Ganz oft schon. Drei Mal!“
Ich grinste. „Drei Mal, ja?“
„Ja! In Neapel.“
„Das hört sich toll an.“
„War es auch! Aber eigentlich kommen Papo und Mammina aus Palermo.“
„Und warst du schon mal in Palermo?“
„Nein. Wir dürfen Sizilien nicht betreten.“
„Ihr … ihr dürft Sizilien nicht betreten? Wieso denn das?“, erkundigte ich mich neugierig, während der Knoten in meinem Magen sich heftiger denn je zusammenzog.
„Ja. Ist kompliziert.“
„Kompliziert? Wieso kompliziert?“, hakte ich vorsichtig nach, auch wenn mir mein Bauchgefühlt sagte, dass es besser wäre, wenn ich den Grund dafür nicht kannte.
„Genau weiß ich das nicht, aber es hat was mit den Catalanos zu tun und mit Mammina. Ich glaube, Papo sollte jemanden heiraten …“, er machte eine Pause und schien nachzudenken. „… und hat sich in Mammina verliebt und damit die Catalanos beleidigt, die ihn dann umbringen wollten. Und dann wurde er verbannt, oder so.“
Oder so?
Ich starrte Santiano ungläubig an. Man hatte seinen Vater umbringen wollen? Er war verbannt worden? Wo war ich hier gelandet? Mitten in einer Szenerie eines Mafiafilms?
Irgendwie lustig, dass ich vor noch einer Stunde, ein Buch üb er genau so etwas lesen wollte – und das als entspannend bezeichnet habe …!
Ich öffnete den Mund, schloss ihn jedoch wieder. Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Während mir tausende Fragen durch den Kopf schossen, zwang ich mich, die Klappe zu halten. Es war eindeutig besser, nicht zu viel zu wissen. Auch wenn meine Neugier geweckt war und ich insgeheim wissen wollte, warum seine Eltern eine öffentliche Insel nicht betreten durften oder wieso man seinen Vater umbringen wollte, verkniff ich mir diese und ähnliche Fragen – in meinen Büchern führte es schließlich auch immer zu einer Katastrophe. Ich war nur nett und brachte ihn nach Hause. Nichts. Weiter.
Santiano musterte mich schon wieder so eindringlich.
„Was?“
„Du siehst echt cool aus! So düster.“
Ich lachte. Seit meiner Jugend schminkte ich mir Smokey-Eyes und probierte mich immer wieder an verschiedenen Haarstilen. Momentan trug ich mein dunkles Haar an den Spitzen weißblond. Gelegentlich fand ich auch an farbigen Kontaktlinsen Gefallen, doch am Ende mochte ich meine bernsteinfarbenen Augen am liebsten.
Als wir dreißig Minuten später endlich in dem Taxi saßen und ich dem Fahrer die Adresse nannte, verzog dieser unwillkürlich das Gesicht. Das Lächeln, das vorher seine Mundwinkel geziert hatte, kippte in sich zusammen. Er zog finster die Augenbrauen kraus und fuhr mit angespannter Miene los. Das mulmige Gefühl in meinem Magen riet mir, dem Mann einen Hunderter in die Hand zu drücken und zu sagen, dass er den Kleinen allein nach Hause fahren soll, doch eine unsichtbare Macht musste mich an den Kunstledersitz des Taxis gebunden haben. Das Taxi hielt viel schneller vor dem Haus – oder eher dem Grundstück –, als mir lieb war. Santiano sprang in dem Moment aus dem Auto, in dem es hielt und marschierte wie selbstverständlich zu dem riesigen Tor. Der riesige, einschüchternde Palazzo, der dahinter lag, wurde von Bodenlampen beleuchtet. Wie durch Geisterhand öffnete sich das Tor und Santiano ging mit schnellen Schritten weiter.
„Warten Sie hier bitte. Ich komme gleich wieder“, rief ich dem Taxifahrer zu, bevor ich aus dem Wagen sprang und Santiano folgte. Ich lief mit leicht geöffnetem Mund und großen Augen den Kiesweg zum Haus hinauf, wo ich meinen Blick über das imposante Gelände schweifen ließ, das mich an dem Film „Der Pate“ erinnerte. Ich schluckte schwer, während sich das ungute Gefühl in meinem Magen wie ein Zementklumpen festsetzte.
Oh, Francesca! Wo hast du dich hier schon wieder eingemischt?
Ich schaute mich unsicher um. All diese grünen Hecken, diese wunderschönen Beete und Springbrunnen – sie erinnerten mich an die Flora und Fauna der Toskana. Selbst die Architektur war typisch im Stil der Bauten von Rom und Siena und wirkte hier in Cardiff fehl am Platz. Der Palazzo ragte majestätisch und prunkvoll über all dem Grün im Schatten des Dämmerlichts am Ende des langen Kiesweges auf. Trotz des Lichtes der alten Laternen, die am Wegrand standen, konnte ich das kurze Aufblitzen der roten Punkte von Überwachungskameras erkennen.
Mir lief ein Schauder über den Rücken. Schnell schloss ich zu Santiano auf und griff nach seiner Hand. Er lächelte nur, bis er sich mit einem plötzlichen Ruck wieder von mir löste und zur Haustür vorrannte, die soeben geöffnet wurde. Eine Frau stand auf der Türschwelle.
„Mammina!“, rief der Kleine und rannte in die Arme seiner Mutter, die ihn fest an sich drückte. Für einen Moment blieb ich stehen und haderte mit mir, ob es nicht besser wäre, einfach nur nett aus der Ferne zu winken, um mich dann wieder umzudrehen und zu verschwinden. Doch ich gab mir einen Ruck und lief zu Santianos Mutter hinüber. Alles andere wäre mehr als unhöflich.
Im Näherkommen erkannte ich, dass Mrs Mancini top aussah, wie ein Model, mit wunderschönen, einnehmenden Zügen und einer unschlagbaren Figur. Sie hatte helle, braune Augen, die jedoch von dem Lächeln auf ihren vollen Lippen nicht erreicht wurden. Ihre dunkelbraunen Haare, die sie hochgesteckt trug, betonten ihre leicht ovalen Züge, außerdem glaubte ich auf ihrer Stupsnase Sommersprossen zu erkennen. Ich schluckte, als ich vor ihr stehen blieb und sie unverhohlen musterte. Ihre Aura war unnahbar. Und dieses Anwesen gruselig.
„Bella Notte“, begrüßte ich sie.
„Bella Notte.“ Sie nickte mir minimal zu, während sie mich ebenfalls einer eingehenden Musterung unterzog.
„Du kannst italienisch? Das wusste ich ja gar nicht!“, rief Santiano gleichzeitig laut aus. Seine Begeisterung konnte ich auf seinen leuchtenden Augen ablesen, doch ich schüttelte den Kopf und lächelte gequält. „Nein. Das und noch zwei, drei andere Wörter sind das Einzige, was ich auf Italienisch sagen kann!“, erwiderte ich, woraufhin Santiano sofort einen Flunsch zog.
„Kommen Sie doch herein!“
Perplex wandte ich mich wieder seiner Mutter zu. Damit hatte ich nicht gerechnet.
„Oh!“, rief ich überrascht. „Ich … das ist wirklich sehr nett und ich will nicht unhöflich sein, aber der Taxifahrer steht vorn am Tor und wartet auf mich.“
„Bitte! Mein Mann will sich bei Ihnen persönlich bedanken und um den Taxifahrer kümmere ich mich schon. Bitte!“ Ihr Englisch war akzentfrei und ihre vornehme Aussprache verlieh den Worten etwas Majestätisches. Doch ihre Bitte kam mir mehr wie ein Befehl als eine nette Geste vor; als hätte ich gar keine Alternative. Am liebsten wollte ich mich umdrehen und davonlaufen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich es nicht. Ich stand da und starrte die fremde Frau an, versuchte herauszufinden, was mich an der gesamten Situation störte, oder warum ich nicht einfach Nein sagen konnte. Lag es an ihrem Auftreten und der Atmosphäre des Grundstücks oder daran, dass ich zu neugierig war? Ich wusste es nicht, aber die aufkeimende Ungeduld von Mrs Mancini ließ mich zögerlich nicken.
„Sehr schön. Dann kommen Sie!“
Damit trat sie zur Seite und bedeutete mir mit einer eleganten Armbewegung, ins Haus zu kommen. Abgesehen davon, dass dieses Haus riesig war, konnte ich mich gar nicht an all den Kostbarkeiten sattsehen, die allein nur im Flur standen.
Rechts vom Eingang führte eine imposante Treppe hoch in die obigen Stockwerke und am Ende des Flures im Erdgeschoss lag ein Zimmer, aus dem laute Stimmen drangen.
Ich ließ Santiano und seiner Mutter den Vortritt und bereitete mich mental auf das vor, was mich gleich erwarten würde. Vorsichtig und leise folgte ich Mrs Mancini. Nervös kaute ich auf der Unterlippe, mein Atem ging flach.
Im Näherkommen bemerkte ich, dass der Raum anscheinend zur Hälfte Speisezimmer und Wohnzimmer zusammen war, das fast genauso groß und beeindruckend war, wie der Flur. In der vorderen Hälfte erstreckte sich eine Sofalandschaft und ein großer Couchtisch aus Glas. In der hinteren Hälfte nahm ein langer Tisch mit vielen Stühlen den Raum diagonal ein. Das Klavier, dass links, halb vor dem Tisch stand, schien eine Grenze zwischen den beiden Hälften zu bilden. Ich blieb steif stehen und schluckte. Mein Blick huschte über die vielen, in Anzügen gekleideten Männer, die sich laut miteinander unterhielten. Nein, ich sollte nicht hier sein. Ich sollte mit hundertprozentiger Sicherheit nicht hier sein! Es wäre besser, wenn ich mich einfach umdrehen würde und …
„Papo!“ Santiano brüllte einmal quer durch den Raum und lenkte damit sofort die gesamte Aufmerksamkeit auf uns.
„Ah! Da ist ja mein kleiner Rabauke!“
Ein hochgewachsener Mann, vielleicht Mitte, Ende vierzig, mit stählernen Zügen, dunklen, leicht melierten Haaren und einem spitzen Kinn, hob den Kleinen hoch. Er sah überaus attraktiv aus – wenn da nicht diese Aura aus Macht und Brutalität wäre, die ihn umgab. Mir lief es bei seinem Anblick eiskalt den Rücken hinunter und mir war klar, dass ich diesen Mann nicht einmal zum Freund haben wollte, wenn ich im Sterben lag. Dabei stellte ich fest, dass Santiano eine verblüffende Ähnlichkeit zu diesem Mann aufwies.
„Vito. Signorina Alpino. Sie war so lieb und hat uns Santiano zurückgebracht!“
Mrs Mancini klang kühl und resigniert und sah dabei aus wie eine Königin. Als die dunklen, bohrenden Augen auf mich fielen, wäre ich am liebsten im Boden versunken. Fast buchstäblich, denn meine Knie wurden etwas weich.
Ich lächelte schüchtern und versuchte mir meine schwitzigen Hände unauffällig an meiner Jeans abzuwischen. Ich bemerkte erst jetzt, dass ich im Türrahmen des Zimmers stehen geblieben war und trat mutig einen Schritt näher.
„Ich muss mich bei Ihnen bedanken, Signorina Alpino. Mein Sohn hatte anscheinend eine sehr schöne Zeit mit Ihnen.“ Seine Worte klangen genauso kalkulierend und bedrohlich wie sein bohrender Blick, was mir für einen Moment die Luft zum Atmen nahm.
„Oh, ja! Sie ist ganz toll! Sie hat mir sogar ein Buch gekauft!“
„Ach ja, richtig!“, rief ich leise erschrocken, weil ich den Roman bereits wieder vergessen hatte und ihn jetzt aus meiner Tasche holte. Mr Mancini kam auf mich zu, streckte seine beringte, tätowierte Hand danach aus und nahm mir mit einem misstrauischen Blick das Buch ab. Santiano auf seinem Arm wirkte auf absurde Weise fehl am Platz. Dieser kräftige, bedrohliche Mann zusammen mit diesem kleinen Fünfjährigen zu sehen, bildete einen unwirklichen Kontrast zwischen Gut und Böse. Nett und grausam.
„Die Abenteuer des Tom Sawyer?“, fragte er mit stechendem Blick.
„Ihr Sohn wollte sich eine andere Ausgabe des Klassikers kaufen, aber diese hielt ich für ihn besser geeignet.“
Er betrachtete das Buch noch einen Moment. Danach drehte er sich um, lief zurück in die Mitte des Zimmers und setzte Santiano ab. Das Buch legte er auf den Glastisch neben sich, bevor er sich wieder zu mir umwandte.
„Nun, Santiano, deine Mammina wird dich ins Bett bringen. Und mit Ihnen Signorina Alpino würde ich gern noch ein Wort reden.“
Meine Augen weiteten sich ein Stück, bevor mein Blick zu Santianos Mutter huschte. Diese nickte ihrem Mann zu, bevor sie Santiano an die Hand nahm.
„Gute Nacht, Francesca.“ Santiano stand auf einmal, wie aus dem Boden gewachsen vor mir, weshalb ich ihn nur verwirrt anblinzelte.
„Gute Nacht, Santiano“, murmelte ich und betrachtete ihn mit wachsender Unruhe. Die Härchen auf meinen Armen stellten sich auf und der Gedanke, allein mit seinem Vater und diesen anderen Männern zu sein, die ungewöhnlich still waren, war mir gar nicht geheuer. Santiano hingegen grinste mich sorglos und glücklich an, während ich das Gefühl nicht loswurde, dass der kleine Knirps aus irgendeinem Grund mehr wusste als ich. Schneller als mir lieb war, war ich plötzlich mit zwanzig Männern allein in diesem riesigen Raum und konnte das lästige Gefühl nicht abschütteln, den Löwen gerade zum Fraß vorgeworfen worden zu sein.
„Wie ich sehe, ist Santiano ganz angetan von Ihnen. Und wie Sie mitbekommen haben, ist er heute nicht zum ersten Mal eines seiner Kindermädchen davongelaufen – Ihnen aber nicht. Was bedeutet, dass Sie etwas an sich haben, was niemand vor Ihnen hatte. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich noch zeigen.“
Er machte eine Pause und ich wusste nicht, ob das nur eine Kunstpause war oder ich etwas erwidern sollte.
„Ich würde Sie gern als Kindermädchen einstellen, Signorina Alpino. Natürlich können Sie dann nicht weiterhin in Cardiff wohnen. Zu weit entfernt und unnötiger Zeitaufwand. Sie werden hier auf dem Grundstück in einem Haus wohnen, damit Sie zu jeder Zeit in Reichweite sind. Um die Bezahlung sollten Sie sich keine Sorgen machen, Sie bekommen Kost und Logie umsonst. Als Pädagogin sollten Sie dazu in der Lage sein, meinen Sohn zu erziehen und unter Kontrolle zu halten. Ich werde morgen den Vertrag aufsetzten, lesen Sie sich diesen gründlich durch.“ Eine erneute Pause, in der mich seine dunklen Iriden musterten. Ich hingegen starrte in einfach nur entsetzt an. Woher wusste er das alles? Wie hatte er herausgefunden, dass ich Pädagogin war? „Santiano muss um sieben Uhr geweckt werden, damit wir um acht Uhr gemeinsam frühstücken können. Das bedeutet, dass Sie spätestens um halb sechs aufstehen müssen, um etwaige Arbeiten zu erledigen und Santianos Kleidung zurechtzulegen. Unsere Haushälterin Milly wird Ihnen morgen die Hausordnung und alles Weitere erklären. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte als erstes an sie. Isabelle wird Sie zu Ihren Räumlichkeiten führen.“
Moment mal! Was? Wovon spricht der Kerl? Erstens: Woher weiß er, dass ich in Cardiff wohne und Erzieherin bin? Und außerdem! Was soll das heißen? Er setzt morgen den Vertrag auf? Welchen Vertrag? Einen Arbeitsvertrag? Ich habe bereits eine Arbeit!
Ich blinzelte und spätestens jetzt war das unerträgliche Gefühl in meinem Magen so schlimm, dass ich vor Angst zu Stein erstarrte. Mr Mancini erklärte mir all das mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre das Ganze bereits beschlossene Sache. Ich starrte ihn noch einen Moment an, bevor ich meine Sprache wiederfand: „Äh, Sir? Mr Mancini“, piepste ich mit zitternder Stimme.
„Signore Mancini!“, kam es sofort von allen Ecken des Raumes, was mich heftig zusammenzucken ließ. Mein Herzschlag trommelte mir in meinen Ohren und meine Kehle war so zugeschnürt, dass ich ein Würgen unterdrücken musste.
„Signore Mancini“, wiederholte ich und klang dabei, als wäre ich auf einen Schlag heiser geworden. „N-nein!“, presste ich dann doch noch heraus und hatte das Gefühl, damit eine verbale Atombombe in die Luft gejagt zu haben. Es war urplötzlich nicht nur still im Raum, sondern jegliche Bewegungen wirkten eingefroren. Jeder starrte mich an; entsetzt und schockiert, als hätte ich den Mann vor mir beleidigt. Ein eiskalter Schauder lief mir den Rücken hinunter. Ich ballte die Hände zu Fäusten, um deren Zittern nicht zu verraten. Die Enge in meiner Brust schnürte mir fast die Luft ab. Mir wurde übel.
Verdammt! Was geschieht hier?
Mir wurde schwindelig, während ich flatternd die Lider hob und mir klar wurde, dass anscheinend in den letzten fünf Sekunden die Zeit stehengeblieben sein musste. Jeder in diesem Raum, sah mich an, als wäre ich lebensmüde geworden. Die dunklen, bohrenden Augen von Signore Mancini, wie er anscheint genannt werden wollte, lagen auf mir, als würden sie in die tiefsten Winkel meiner Seele blicken wollen. Ich räusperte mich leise und versuchte, mein Rückgrat zu finden, doch unter diesem Blick schien es sich in Luft aufgelöst zu haben. Die plötzliche Stille war so erdrückend, dass man nicht nur eine Stecknadel hätte fallen hören können, sondern die Schmetterlinge wahrscheinlich auch atmen.
„Ich kann nicht … nicht als Kindermädchen für Santiano … also für Sie arbeiten. Ich habe bereits eine Arbeit und … und …“, stotterte ich und schaffte es nicht, den Satz zu vervollständigen. Alles in mir wollte wegrennen und gleichzeitig deutlich machen, dass ich hier nicht einfach arbeiten konnte. Was dachte sich der Kerl?
Unter seinem Blick erlosch jedoch meine aufkeimende Empörung.
„Signorina Alpino. Sie haben doch einen Bruder in Berlin.“ Der sanfte Tonfall, stand im Kontrast zu seinen bedrohlichen Worten, weil sie Informationen enthielten, die er nicht wissen konnte – nicht wissen durfte. Ich öffnete meinen Mund, starte ihn an und bekam doch keine der vielen Fragen über die Lippen, die sich in meinem Kopf begannen zu türmen: Woher wissen Sie das? Wer sind Sie? Warum fragen Sie das? Was wollen Sie mir damit sagen?
Das Einzige, was ich zustande brachte, war ein leises Röcheln.
„Wie ich gehört habe, ist er schon vorbestraft.“ Erneut taxierte mich der großgewachsene Mann aufmerksam mit seinen kalten Augen. „Sie wollen doch nicht, dass eine weitere Straftat dazukommt, oder? Das würde dann schließlich bedeuten, dass er ins Gefängnis muss, richtig?“
Seine heuchlerischen Fragen ätzten sich wie Gift in meine Zellen. Nein! Natürlich wollte ich nicht, dass mein Bruder ins Gefängnis wanderte, welche Schwester wollte das schon! Aber was sollte diese Frage bedeuten? Drohte er mir? Woher wusste er das alles? Sollte das etwa heißen, dass er meinem Bruder ein Verbrechen anhängen würde, das er gar nicht begangen hätte, wenn ich nicht für ihn arbeitete? Warum? Bevor ich jedoch meinen Mut finden konnte, meine vielen entsetzten Gedanken zu Fragen zu formulieren, hörte ich hinter mir langsame, doch feste Schritte. Ich drehte mich um und trat augenblicklich zur Seite. Der Mann, der an mir vorbeilief, war großgewachsen und in eine schwarze Chino gekleidet. Sein Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren, trug die Farbe von dunklem Blut, sein Haar war dunkelbraun, fast schwarz und an den Seiten kurz. Doch was am meisten von ihm herausstach, waren seine intensiven, eisblauen Augen. Er ließ im Vorbeigehen seinen stechenden Blick über mich gleiten, ehe er dicht vor mir stehenblieb. Ein anzügliches Lächeln zupfte an seinen Mundwinkeln. Er hob seine beringte Hand, wobei er eine meiner Haarsträhnen auflas und durch seine Finger gleiten ließ. Dann strich er in einer federleichten Berührung meine Kieferkonturen entlang, was ein intensives Kribbeln in meinem Körper erzeugte. Ich versank für einen Moment in diesen bedrohlich wirkenden Iriden.
„Und wer bist du, mia bella?“ Seine Worte wurden von einem anspielenden Unterton begleitet, der mich aus meiner Starre erwachen ließ. Ich trat schnell einen Schritt zurück, während ich seine Hand wegschlug und meine Haarsträhne aus seinen Fingern befreite. Das laszive Grinsen, das er mir schenkte, ließ die aufkommende Gänsehaut auf meinen Armen zu einem heißen Prickeln werden. Es wirkte einnehmend und versprechend.
„Niemand, der dich etwas angeht“, erklärte ich bestimmt. „Ich wollte sowieso gerade gehen.“
„Schade eigentlich“, murmelte er, während er seinen Blick aufreizend langsam an mir auf und ab gleiten ließ. Obwohl ich wusste, dass ich diese Geste, zusammen mit diesem Ausdruck widerlich und abstoßend finden sollte, konnte ich nicht leugnen, dass sie das genaue Gegenteil in mir auslösten. Ich hatte das Gefühl, unter seinem durchdringenden Blick zum ersten Mal seit langem gesehen zu werden.
„Das bezweifle ich!“ Ich sprach extra laut und trat einen weiteren Schritt zurück. Sein intensiver Duft nebelte mich ein und ließ mich langsamer und sehr merkwürdige Dinge denken.
Auch wenn ich die Empfindung nicht nachvollziehen konnte, weil sein Blick mich gerade ziemlich deutlich auszog, ließ ich meine Augen ebenfalls über seine Züge huschen. Die schulterlangen, dunkelbraunen, fast schwarz aussenden Haare, legten sich in leichten Wellen um sein Gesicht. Alles an ihm wirkte trainiert. Die vielen Tattoos auf seinen Unterarmen, zusammen mit dem vielen silbernen Schmuck, ließen ihn lässig, wie sexy zugleich wirken.
„Tschüss“, keuchte ich.
„Nun dann, Signorina Alpino. Isabelle wartet draußen im Flur auf sie“, schaltete sich jetzt wieder Signore Mancini ein. Verwirrt schaute ich zu ihm.
In diesem Moment sagte er etwas auf Italienisch zu dem Kerl mit den eisblauen Augen. Dieser schien soeben das Interesse an mir verloren zu haben. Er lief an mir vorbei und antwortete Mancini auf Italienisch.
„Gehen Sie jetzt“, wies mich Mancini schließlich an, weil ich mich noch immer keinen Zentimeter gerührt hatte.
Das passiert hier nicht gerade wirklich, oder? Das kann er nicht ernst meinen! Er kann meinem Bruder nichts anhängen, oder? Außerdem – woher weiß er das alles? Ich muss hier weg!
Ich öffnete den Mund, bekam jedoch keinen Ton heraus. Ich schluckte und starrte die Männer an, versuchte meine Sprache und meinen Mut wiederzufinden, doch ich bekam nicht eine Silbe hervor.
„Man-Mancini … Signore!“, versuchte ich es noch einmal, allerdings war meine Stimme viel zu leise, um Gehör zu finden. Ich hätte schreien müssen – entschied mich jedoch, einfach zu verschwinden. Mancini bluffte, er konnte gar nichts gegen Francesco in der Hand haben. Und auf gar keinen Fall konnte er seine Drohung ernst meinen. Mit einem letzten Blick ließ ich meine Augen über die schwarz gekleideten Männer huschen, deren Anblick mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Nein! Ich musste sofort hier weg! Es war eine absolut beschissene Idee gewesen, nicht doch schon wieder um acht im Bett zu liegen, nur damit ich mir selbst nicht wie eine langweilige Schrulle vorkam.
Verflucht!
Ich drehte mich um und eilte den Flur hinunter. So leise wie ich konnte, öffnete ich die Tür, schlüpfte hinaus und hechtete den Kiesweg zurück zum Tor. Mein Herz raste, als ich den Weg hinunterlief und inständig hoffte, in der Dunkelheit der Nacht verschwinden zu können. In dem Moment hörte ich Schritte hinter mir. Ich wagte es nicht, mich umzudrehen, ich wollte nur zum Tor. Vielleicht, wenn ich rannte …
„Signorina!“, hörte ich eine Frauenstimme rufen.
Nein! War der Weg vorhin auch schon so lang gewesen? Schneller! SCHNELLER!
„Signorina!“ Die Stimme war nun lauter, die Schritte näherten sich schnell. Und da wurde ich auch schon am Arm gepackt! Durch den Ruck drehte ich mich halb zu der Frau mit den blond gefärbten Haaren und den wasserblauen Augen um. Sie machte Anstalten, mich zurück zum Haus zu ziehen, weshalb ich meine Füße in den Boden stemmte. „Kommen Sie. Das ist der falsche Weg zu Ihren neuen Räumlichkeiten“, erklärte sie und warf mir einen verärgerten Blick zu.
„Was? Nein! Hören Sie! Das ist ein Missverständnis! Ich – au! Sie tun mir weh!“ Sie hatte mich fester am Arm gepackt und zerrte mich nun grob in Richtung Haus. Durch ihr kräftiges Ziehen stolperte ich nach vorn, verlor beinahe das Gleichgewicht und sah hilflos dabei zu, wie der Palazzo wieder bedrohlich näher kam. Die Fingernägel der Frau gruben sich tief in meine Haut, während ich versuchte, mich aus ihrem Griff zu winden. Doch egal, was ich tat, ihre Hand lag wie ein Schraubstock um meinen Oberarm. Sie war stärker als sie aussah. Sie zog mich zurück zum Haus.
Nein!
„Milly wird Ihnen morgen früh alles Weitere erklären. Am besten ist es, wenn Sie um sechs Uhr bereits in der Küche …“
„Ich habe gar nicht gewusst, dass sich die Bungalows neuerdings vor dem Haus befinden!“, sagte plötzlich eine dritte Stimme unweit von uns. Die Frau blieb so erschrocken und stocksteif bei dem Klang der dunklen Stimme stehen, dass ich in sie hineinrannte. Auch ohne, dass ich meinen Kopf zur Seite drehen musste, wusste ich, wer der Mann war. Jener Kerl, der kurz zuvor ein Feuer in mir erzeugt hatte, das jetzt, bei seinem Anblick, wieder aufzulodern drohte. Er stand keine zwei Meter von uns entfernt, vor der Haustür und zündete sich gerade eine Zigarette an. Automatisch huschten meine Augen zu seinen stecknadelgroßen Pupillen. Während mein Herz für einen Augenblick stoppte und ich scharf die Luft einsog, überkam mich erneut ein fiebriges Kribbeln. Meine Wangen fühlten sich mit einem Mal wieder sehr warm an, während ich nicht leugnen konnte, wie intensiv die Anziehung zu ihm zu sein schien.
„Marcello!“, keuchte die Angestellte erschrocken.
„Isabelle.“
Marcello … bedeutet der Name nicht ‚der Kriegerische‘? Passt irgendwie zu ihm … glaube ich.
„Ich … sie ist nur in die falsche Richtung gelaufen! Wirklich! Ich …“ Die blonde Frau stotterte und ich konnte deutlich auf ihren bleichen Zügen Angst und Begierde gleichermaßen sehen, als ich jetzt neben sie trat. Allerdings schien die Angst bei ihr zu überwiegen, denn ich spürte, wie ein leichtes Zittern von der Hand an meinem Arm ausging.
Bevor Isabelle jedoch auch nur ein weiteres Wort an ihn richten konnte, kam der Kerl so schnell auf uns zu, dass ich nur einmal mit den Wimpern schlagen musste, ehe ich spürte, wie sich seine Hand in meine langen Haare grub. Mit einem Ruck zog er meinen Kopf nach hinten. Mir entfuhr ein erschrockener Schrei und ich schaute ihm nun direkt in seine eisblauen Augen.
„Du solltest nicht weglaufen, Bambola … weißt du, was mein Vater mit kleinen, ungezogenen Püppchen macht, die nicht tun, was er sagt?“
„N-nein“, stotterte ich jetzt auch, weil mir seine Worte, zusammen mit dem finsteren Blick und seiner Grabesstimme, schreckliche Angst einjagten.
„Er macht mit ihnen grausame Dinge. Wirklich grausame Dinge …“ Kurz ließ er die Worte auf mich wirken, was mich erzittern ließ. Mein Atem ging nur stoßweise. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich in verdammt großen Problemen steckte. Ich sah ihn mit großen Augen an, während mein Herz in meiner Brust schlug, als würde es am liebsten wegrennen wollen. „Und der Tod ist noch die gnädigste Wahl, die er ihnen lässt. Also komm erst gar nicht auf komische Gedanken. Sei brav und lass dich von Isabelle in den Bungalow bringen. Und solltest du dennoch Theater machen, wirst du mich kennenlernen!“, hauchte er. Seine Worte ließen keinen Zweifel daran, dass er mir verdammt wehtun würde. Also nickte ich nur wie betäubt. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte man mir eine Dachlatte dagegen geschlagen. Alles schien kopfzustehen und wild durcheinander gefallen zu sein. Weder wusste ich, was das alles sollte, noch warum das alles geschah. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich keine andere Möglichkeit hatte. Ich musste diesen Menschen gehorchen!
„Okay … Alles klar“, wisperte ich und hoffte, dass dies als Zustimmung reichen würde. Das kurze Nicken von ihm zeigte mir, dass er verstanden hatte.
„Dann los.“ Damit ließ er von mir und trat einen Schritt zurück. Als wäre das Isabelles Startsignal gewesen, lief sie so eilig an Marcello vorbei, wie sie konnte.
„Den Weg in die Küche finden Sie ganz einfach, Sie können vom Außenbereich eine der Terassentüren des Wohnzimmers öffnen und von dort in den Flur treten, die Treppe hinunter und dann sind Sie auch schon da.“
Isabelle redete, als wäre nichts von dem gerade geschehen. Es wirkte, als würde sie ihre Angst überspielen wollen. Wir umrundeten das Haus und liefen an einem riesigen Pool vorbei, der direkt an den Terrassenbereich des Wohnzimmers grenzte. Ein rechter Hausflügel schloss den Garten ein und ließ den Palazzo wie ein überdimensionales L wirken. Die Grünfläche erstreckte sich hinter dem Pool bis zu einer kleineren Anzahl von Bungalows. „Hey! Isabelle! Stopp! Ich … Was war das gerade gewesen?“
„Marcello!“
„Was?“, fragte ich verängstigt. Ich konnte nichts dagegen tun, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Erneut versuchte ich meinem Arm aus ihrem Griff zu befreien, weil ich wollte, dass sie verdammt nochmal stehen blieb und mir erklärte, was das hier eigentlich sollte. „Hören Sie auf damit“, fauchte sie mir entgegen und stolperte dabei einige Schritte zurück. „Gewöhnen Sie sich am besten daran!“, riet sie. In ihrem gereizten Blick konnte ich so etwas wie Mitleid und eine Warnung erkennen.
„Woran?“
„Stellen Sie keine Fragen, sondern kommen Sie! Und legen Sie sich nicht mit Marcello an.“ Plötzlich klang sie wesentlich sanfter –wehmütiger.
„Nein! Jetzt lassen Sie mich endlich los! Und erklären Sie …“